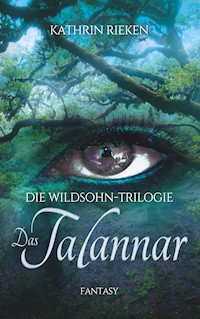Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Wildsohn-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ahacco ist in den Tausendherzwald zu den Wildsöhnen zurückgekehrt und bereitet sich auf seine letzte Prüfung, die Totensuche, vor. Außerdem will er die Spione finden, die Herzog Thorondar bei den Prüflingen eingeschleust hat, bevor sie dem machtgierigen Herrscher das größte Geheimnis der Wildsöhne verraten. Doch Ahaccos Pläne drohen zu scheitern. Die Spione sind fest entschlossen, ihren Widersacher zu töten. Und auch Mika´aela, die Anführerin der Schattenalben, versucht alles, um seine Totensuche zu sabotieren. Werden die Waldgeister dem jungen Wildsohn helfen, gegen seine mächtigen Feinde zu bestehen? »So fantastisch wie fantasievoll« schrieb die Augsburger Allgemeine Zeitung über den ersten Teil der Trilogie. Dieses Buch setzt in Sachen Spannung noch eins drauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autorin
Kathrin Rieken ist eine deutsche Physikerin und Fantasy-Schriftstellerin. 1996 in Augsburg geboren, begann sie früh, Gedichte und Geschichten zu schreiben. Für das Gedicht »Ostfriesland bei Nacht« erhielt sie 2008 einen Preis beim Literaturwettbewerb des Arbeitskreises Ostfriesischer Autoren. 2018 veröffentlichte sie zwei Bände der »Wildsohn«-Trilogie, an der sie seit ihrem 14. Lebensjahr schreibt. Der erste erschien 2020 in einer überarbeiteten Neuausgabe unter dem Titel »Das Talannar« bei BoD. »Die Totensuche« ist die Neuausgabe des zweiten Bands. Zurzeit schreibt sie am dritten Teil. Kathrin Rieken hat einen Master-Abschluss in Physik und forscht an der Universität Augsburg. In ihrer Freizeit ist sie als Fitness-Trainerin im Turnverein und als Violinistin in der Mittelalterrockband »Sturmfänger« aktiv.
Es hat viele Jahrhunderte gedauert, bis die ›wachsenden Inseln‹ ihre heutige Größe erreicht haben. Leider ist es den Menschen nicht in gleichem Maße gelungen, Größe zu entwickeln. Die Völker, die in diesem Zeitraum vom Antlitz Ormands getilgt wurden, sind ein trauriger Beleg dafür.
Aus dem Buch »Geschichte Ormands und der Kreskiden« von Me. R. Warwinther
Inhalt:
Drei Namen
Enttäuschung
Jared
Zurück in Wildheim
Ein unerwarteter Gast
Endloser Schlaf
Die Spione
Hinterlist
Rumiens Verrat
Letzte Vorbereitungen
Nach Orfheim
Die Ratssitzung
Im Unerforschten Gebiet
Eichenherz’ Geheimnis
Die Siebenzahnschlucht
Rosen, Rauch und Bitterkeit
Der Oberste Wildmeister
Sonnenfrau
Die Kette von Tál A’Durh
Wächter des Unteren Reichs
Die Geisterkraft
Im Königswald
Ein heimliches Treffen
Zwei gegen einen
Im Turm
Das Rätsel der Gnome
Unter Feinden
Waldbrand
Der Findling
Ungleiche Gegner
Flucht aus Lichterland
Ahaccos Entscheidung
Entkommen
Weiter hinab
Weniger als erhofft
Die Macht der Namen
In der Höhle des Löwen
In der Schatzkammer
Zurück in Sinnabol
Ahaccos Traum
Tageslicht
Im Sommerlager
Briallenberg
Das Zerwürfnis der Wildmeister
Enthüllungen
Unterwegs zum Xorrocfeld
Die Namenszeremonie
Neue Wege
Wiedersehen
Der Hinterhalt
Spiel auf Zeit
Die Macht des Windes
Alte Liebe
Atempause
Tödliches Gift
Jeder an seinem Platz
Anhang: Karte von Ormand
Personenverzeichnis
Drei Namen
Eythan. Elion. Yorad , hallte es wie Trommelschläge in Ahaccos Kopf wider, während er die dunkle, staubige Straße Richtung Sinnabol hinunter galoppierte.
Diese drei Namen standen auf dem Zettel, den ihm Rumien bei seinem Aufbruch aus Eisthal, der Hauptstadt Ormands, heimlich zugesteckt hatte. Mit keinem von ihnen konnte Ahacco ein Gesicht verbinden. Aber das würde er bald ändern! Denn es waren mehr als nur Namen für ihn. Die drei jungen Leute waren Verräter, Spione des Herzogs von Ormand. Seit Jahren lebten sie unerkannt unter den Wildsöhnen und warteten auf den richtigen Zeitpunkt, um dem Stamm sein letztes großes Geheimnis zu entreißen.
Sieh zu, dass du diese verdammten Spione findest , hatte Rumien ihn gebeten. Seinem Freund lagen die Wildsöhne ebenfalls am Herzen. Doch Rumien konnte nichts tun. Herzog Thorondar hielt ihn in Eisthal fest.
So war es an Ahacco, diejenigen unter den Wildsöhnen zu warnen, denen er vertraute, und die Spione daran zu hindern, die ›Letzte Prüfung‹, die Totensuche, zu bestehen.
Leichter gesagt als getan , dachte er. Denn er musste befürchten, dass die drei sich heute womöglich anders nannten.
Mit klopfendem Herzen ritt er durch die Finsternis, an Feldern, Mooren und kleinen Wäldchen vorbei. Ab und an passierte er ein Dorf, das noch in tiefem Schlummer lag. Aber sich selbst erlaubte Ahacco keinen Schlaf.
Erst gegen Ende der Nacht rastete er bei den Gelben Feldern, deren Halme im Mondlicht wie silberne Nadeln aussahen. Es war jedoch nur eine kurze Pause. Noch bevor die ersten Strahlen der Sonne die Landschaft in Farben tauchten, brachen Pferd und Reiter wieder auf.
Die Nüstern seiner Stute Nachttanz blähten sich, als sie sich im Morgengrauen dem Cornorath näherten. Bald konnte Ahacco das Rauschen des Flusses hören, und nicht viel später erreichten sie dessen Ufer. Nach dem Unwetter vor einigen Tagen hatte die Sonne Zeit genug gehabt, die überschwemmten Uferwege zu trocknen. Die starke Strömung hatte den Schlamm rasch flussabwärts getrieben, sodass das Wasser fast wieder klar war.
Ahacco ließ Nachttanz trinken. Dann folgte er dem Flusslauf ein Stück, bis die Königsbrücke in Sicht kam. Das kleine Wachhaus davor schien unbesetzt zu sein. Doch noch ehe die Stute ihre Hufe auf die großen, in den Boden versenkten Steinquader setzen konnte, die den Zugang zur Brücke bildeten, öffnete sich die Holztür des Häuschens. Zwei Wachen traten heraus und versperrten Ross und Reiter den Weg.
»Es tut mir leid, mein Herr«, sprach der größere der beiden Männer Ahacco höflich an. »Wir haben Befehl, niemanden mehr hinüber zu lassen.«
Nachttanz schnaubte missbilligend, als die andere Wache ihr in die Zügel griff.
»Auf wessen Befehl?«, fragte Ahacco.
»Die Anordnung kommt von ...«
»Sie kommt von mir.«
Beim Klang der barschen Stimme fuhren die Männer herum. Von allen dreien unbemerkt hatten sich auf dem Uferweg Reiter genähert. Eine rothaarige junge Frau ritt an der Spitze der Gruppe, die aus ihr und vier Männern bestand.
Die Frau zügelte ihren edlen Schimmel und richtete sich im Sattel auf. »Ich habe den Befehl gegeben. Niemand darf den Fluss überqueren«, sagte sie und kniff die Lippen zusammen, bis diese nur noch einen schmalen Strich bildeten.
Ahacco erkannte an ihrer reich bestickten Kleidung, die aus einem feinen, dünnen Stoff bestand, dass er es mit einer Adeligen zu tun hatte. Jetzt, da er sie und ihre Männer genauer in Augenschein nahm, bemerkte er, dass sie auf ihren Mänteln ein ihm fremdes Wappen trugen: eine Weinrebe auf schwarzem Grund, die sich um ein goldenes Schwert rankte.
Er neigte den Kopf und fragte: »Verzeiht meine Neugierde, Herrin: Mit wem habe ich die Ehre?«
Die Frau hatte ihn skeptisch von oben bis unten gemustert. Seine respektvolle Anrede schien sie milde zu stimmen. »Mein Name ist Caera von Briallen, Stadt- und Markgräfin von Briallenberg«, antwortete sie. »Und wer sind Sie? Wissen Sie denn nicht, dass Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn Sie Richtung Osten reiten?«
»Mein Name ist Ahacco. Ich möchte nach Sinnabol, Gräfin. Es war mir nicht bewusst, dass mir dort Gefahren drohen«, erwiderte er.
»In Sinnabol nicht, da haben Sie recht. Zumindest noch nicht. Aber Sie müssen trotzdem hierbleiben. Es heißt, dass von der Ostküste eine feindliche Armee auf uns zukommt.«
Sie weiß also über die Schattenkrieger Bescheid, dachte Ahacco.
»Der Herzog hat alle Städte und Grafschaften zu den Waffen gerufen« fuhr die Gräfin fort. »Ormands Heer wird sich auf dem Xorrocfeld sammeln. Wenn es zur Schlacht kommt, ist jenseits dieser Brücke niemand mehr seines Lebens sicher.«
»Das Xorrocfeld ist noch ein gutes Stück von meinem Ziel entfernt«, warf Ahacco ein.
»Nicht weit genug. Und eine Schlacht ist nur etwas für Soldaten«, kanzelte sie seinen Einwand ab.
»Ich muss aber nach Sinnabol«, insistierte Ahacco. Vielleicht hätte er statt des Reisemantels besser etwas Edleres aus der Kleiderkammer des Eisthaler Schlosses mitnehmen sollen, dachte er. Jedenfalls hatte er weder Zeit noch Lust, sich von dieser ebenso gutaussehenden wie überheblichen Dame aufhalten zu lassen.
»Niemand außer den Männern des Herzogs überquert diese Brücke«, erwiderte Caera von Briallen bestimmt. »Reiten Sie also zurück, von wo auch immer Sie kommen.«
Geistesgegenwärtig griff Ahacco in seine Brusttasche und holte die silberne Brosche heraus, die ihm Thorondar in Ik’Ernu gegeben hatte. Der »Weisheitsdrache«, das herzogliche Wappentier, wies ihn als dessen Vertrauten aus und war angeblich auf ganz Ormand bekannt.
Er reichte ihr die Brosche. »Ich komme aus Eisthal und bin im Auftrag des Herzogs unterwegs«, log er. »Ihr solltet mich also besser passieren lassen.«
Misstrauisch wanderten ihre dunklen Augen zwischen dem Drachen und Ahaccos Gesicht hin und her. Sie kannte das Symbol, schien aber noch zu überlegen, ob er die Brosche nicht vielleicht irgendwo gestohlen hatte.
Letztlich kam sie wohl zu dem Schluss, lieber keine Einwände mehr geltend zu machen. Mit einer mürrischen Handbewegung wies sie die Wachen an, ihn durchzulassen.
»Ich weiß nicht, womit der Herzog Sie betraut hat. Aber hören Sie besser auf mich und bleiben Sie hier«, sagte sie. »Sie haben sicher mitbekommen, dass an der Ostküste seltsame Kreaturen aufgetaucht sind.« Die Gräfin zog die Stirn kraus. »Es sind viele Hunderte, und sie wagen sich immer weiter landeinwärts. Das neue Land, aus dem sie stammen, reicht ihnen wohl nicht mehr, denn sie überfallen bereits Dörfer, die weit von der Küste entfernt liegen.«
»Ihr sprecht bestimmt von den Kreaturen aus Lichterland«, sagte Ahacco, dem die Fakten gut vertraut waren. Die Gräfin konnte ja nicht wissen, dass er zuletzt in eben dieser Gegend gelebt hatte und sogar Augenzeuge der jüngsten Wachstumsphase gewesen war. Diese hatte in der Nähe des Dorfes Ik’Ernu einen schwarzen Berg und dämonische Wesen hervorgebracht, die sich ›Schattenalben‹ nannten. Über deren Armee, die ›Schattenkrieger‹, wusste er allerdings nicht viel mehr als das, was er von Flüchtlingen erfahren hatte. Zum Glück war Ik’Ernu längst evakuiert gewesen, als diese Bestien erstmals aufgetaucht waren.
»Nein, nicht Lichterland«, entgegnete Caera von Briallen. »Kürzlich soll ein weiteres Stück Land entstanden sein. Der einzige Augenzeuge, der bislang davon berichten konnte, ist der Kapitän eines Handelsschiffes. Der Mann will das Wachstum durch sein Fernrohr beobachtet haben. Er ist davon überzeugt, dass die Kreaturen direkt aus der Erde emporgestiegen seien.« Sie lachte bitter. »Vielleicht hat er übertrieben, vielleicht auch einfach zu tief in die Flasche geschaut. Die Lage ist jedenfalls ernst.«
Noch mehr neues Land? Ahacco war erstaunt. Mit Sicherheit war dies das Werk von Mika’aela, der Anführerin der Schattenalben. »Danke für die Warnung«, sagte er. »Nun entschuldigt mich, ich bin in Eile.« Er wollte den Weisheitsdrachen wieder an sich nehmen, überlegte es sich aber anders. »Ihr seid nicht zufällig auf dem Weg nach Eisthal?«, fragte er.
»In der Tat. Ich muss mit Herzog Thorondar wegen der Aushebung sprechen.«
»Dann gebt ihm doch bitte die Brosche zurück. Mein Name ist Ahacco. Richtet ihm aus, ich bräuchte sie nicht mehr.«
Überrascht sah Caera von Briallen auf. »Sind Sie sicher?«
Ahacco nickte. Der Drache würde ihm dort, wo er hinwollte, sowieso nichts nützen. Ihm gefiel der Gedanke, Thorondar mit der Rückgabe des Schmuckstücks zu brüskieren.
»Viel Glück«, rief die junge Frau ihm nach.
»Danke. Das kann ich gut gebrauchen.« Er warf ihr ein freundliches Lächeln zu und trieb Nachttanz voran.
Während die Gräfin und ihr Gefolge ihren Weg nach Eisthal fortsetzten, folgte Ahacco der Straße nach Sinnabol. Als er später am Tag den Xorrocstrom überqueren wollte, winkten ihn die Brückenwachen einfach durch. Sie vertrauten vermutlich darauf, dass ihre Kollegen den fremden Reiter bereits kontrolliert hatten.
Vom Xorroc bis nach Sinnabol war es nicht mehr weit. Nachdem er im hohen Gras einer duftenden Wiese ein wenig geschlafen und anschließend gut gefrühstückt hatte, erreichte Ahacco sein Ziel in gestrecktem Galopp am frühen Vormittag.
Nachttanz schnaubte und fiel in einen schnellen Trab, als sie sich der Stadtmauer näherten. Der junge Mann konnte schon von weitem das Haus des Bürgermeisters erkennen, das leicht erhöht auf einem Hügel lag. Obwohl es ihn zum nah gelegenen Waldrand und nach Wildheim zog, wollte er zuerst in die Stadt reiten, um mit Makaloro zu sprechen.
Der Bürgermeister staunte nicht schlecht, Ahacco so bald schon wiederzusehen. Zum Glück war er höflich genug, ihn nicht sofort mit Fragen nach Neuigkeiten aus der Hauptstadt zu überfallen. Stattdessen führte er ihn ins Esszimmer, wo Brot, Butter, Obst und Wasser – vermutlich Reste des Frühstücks – auf dem Tisch standen.
Ahacco hatte weniger Geduld. Kaum dass sie den Raum betreten hatten, fragte er, ob es Nachricht von seinen Freunden Tongo und Kada gäbe.
Makaloro musste ihn enttäuschen. Auch er hatte von den beiden Jugendlichen, die der Herzog als Kundschafter an die Ostküste geschickt hatte, noch nichts gehört.
Besorgt ließ sich Ahacco auf einen Stuhl fallen. »Sie wollten eigentlich so schnell wie möglich wieder hier sein«, dachte er laut. Er hatte erwartet, dass die beiden auf ihrem Rückweg in Sinnabol rasten würden.
Irgendetwas musste sie aufgehalten haben.
Makaloro stützte die Hände auf den Tisch und beugte sich ein wenig vor. »Befürchten Sie nicht gleich das Schlimmste«, meinte er. »Es ist ein langer Weg, und Ihre Freunde sind erst seit einigen Tagen weg. Wahrscheinlich werden sie schon bald hier eintreffen.« Er machte mit der Rechten eine einladende Geste. »Umso mehr würde ich mich freuen, wenn Sie so lange Gast in meinem Haus sind. Möchten Sie etwas essen oder trinken?«
Ahacco zwang sich zu einem Lächeln. »Nur ein Wasser bitte.«
»Sie bleiben also hier?«, fragte der Bürgermeister, während er ihm ein Glas einschenkte.
Der junge Wildsohn leerte es in einem Zug und wischte sich den Mund mit dem Ärmel des Mantels trocken. »Wenn es Ihnen keine Umstände macht, nehme ich Ihr Angebot gerne an«, antwortete er. »Zumindest für ein paar Tage.«
»Gerne. Ich freue mich immer über Gäste«, lachte Makaloro. »Ihr Pferd steht draußen, nehme ich an?«
»Ja. Könnten Sie ...«
Bereits die Andeutung genügte seinem Gastgeber. »Natürlich! Ihrem Tier soll es ebenfalls an nichts fehlen. Bevor ich Ihnen Ihr Zimmer zeige, möchte ich Sie jedoch um etwas bitten.«
»Worum geht es?«
»Ich möchte, dass Sie mir alles erzählen, was Sie wissen.«
Ahacco sah den Mann fragend an. Er ahnte, worauf Makaloro hinauswollte. Aber konnte er ihm vertrauen?
Der Bürgermeister seufzte. »Ich bitte Sie«, sagte er tadelnd, »ich bin ebenso wenig ein Mann des Herzogs wie Sie. Und Sie wissen vermutlich mehr über die Bedrohung, der Ihre Freunde nachspüren, als Sie zugeben wollen.«
Ahacco nickte zögerlich.
»Was Sie mit den Wildsöhnen zu schaffen haben, interessiert mich nicht«, fuhr Makaloro fort. »In den letzten Tagen sind viele Flüchtlinge bei uns angenommen. Das Unheil, das diese Menschen heimgesucht hat, ist auf dem Weg hierher. Wie jeder andere auf Ormand möchte ich wissen, was da auf uns zukommt. Das müssen Sie doch verstehen. Schließlich trage ich die Verantwortung für die ganze Stadt.«
Der junge Mann stimmte ihm zu.
»Dann sagen Sie mir: Was hat es mit diesen Bestien auf sich, von denen die Flüchtlinge berichten?«, bat Makaloro ihn nachdrücklich.
Ahacco gab ihm einen Abriss dessen, was er wusste und was Rumien und er in Eisthal herausgefunden hatten. Dafür musste er weit in der Vergangenheit anfangen, mit der Verfolgung der Vaeren durch die Menschen und ihrem Entschluss, fortan ein Leben im Verborgenen zu führen. Er erzählte Makaloro von Lichur, dem jungen Vaeren, der sich einst dem Stamm der Wildsöhne angeschlossen hatte. Vom Ältestenrat der Vaeren, der sein Volk zum Kampf gegen die Menschen aufgestachelt hatte, der aber gestürzt und ins Untere Reich verbannt worden war. Und natürlich von Lichurs magischem Schwert Daru’Chur, das einst ein wichtiger Teil des Bannspruchs gegen die Ältesten gewesen war und sich seit Kurzem in seinem, Ahaccos, Besitz befand. Dies erklärte nicht zuletzt, warum die Schattenalben ihn als den Erben Lichurs ansahen.
Der Bürgermeister hing geradezu an seinen Lippen.
Als Ahacco geendet hatte, verspürte er eine gewisse Erleichterung. Dass er sich jemandem hatte anvertrauen können, half ihm, all die frischen Eindrücke und Erkenntnisse zu verarbeiten. Zudem war Makaloro ein verantwortungsbewusster Mann, der mit den heiklen Informationen, die er gerade erhalten hatte, sicher gut umzugehen wusste.
Der Bürgermeister brauchte eine Weile, um das Gehörte zu überdenken. Dann fragte er: »Habe ich Sie richtig verstanden? Sie vermuten, dass es sich bei den Schattenalben um den Ältestenrat dieses geheimnisvollen Waldvolks, der Vaeren, handelt? Dass er irgendwie einen Weg zurück in unsere Welt gefunden hat?«
Ahacco nickte. »Darum wohl auch der Name ›Entsprungene‹. Die Alben sind aufgetaucht, als das neue Land entstanden ist.«
»Und was wollen sie? Das habe ich nicht ganz verstanden.«
»Ihre Anführerin, Mika’aela, hasst die Menschen. Sie ist eine machthungrige Person und will die ganze Insel erobern. Sie kann dabei auf große Mengen an Schwarzem Quarz zurückgreifen.« Wie die Herkunft der Kreaturen mit diesem Gestein zusammenhing, hatte Ahacco noch nicht herausgefunden. Er war aber sicher, dass es eine Verbindung gab.
»Schwarzer Quarz?«, wiederholte Makaloro verständnislos.
»Die Schattenalben behaupten, er sei unzerstörbar und trage eine ungeheure Kraft in sich«, erklärte Ahacco. »Ich vermute, dass Mika’aela inzwischen einen Weg gefunden hat, das geheimnisvolle Gestein für ihre Zwecke zu nutzen.«
»Und wie genau soll das gehen?«
»Mit Magie«, antwortete der Wildsohn. Noch vor ein paar Wochen hätte er dieses Wort nicht ohne einen skeptischen Unterton benutzt. Doch nach allem, was passiert war, kam es ihm jetzt ganz treffend vor. »Ich kann es nicht anders beschreiben. Sie hat quasi aus dem Nichts Hunderte von Lebewesen erschaffen! Das sind die Bestien, die uns bedrohen: die Schattenkrieger, ihre dunkle Armee.« Er atmete tief durch, bevor er weitersprach. »Ich habe Mika’aela kennengelernt. Sie ist zu allem fähig. Und glauben Sie mir: Ich wünschte, ich wäre ihr nie begegnet.« Er konnte das wahnsinnige Leuchten in den Augen der Schattenalbin beinahe vor sich sehen.
Sein Gesichtsausdruck hatte offenbar Bände gesprochen. »Sie müssen dort Schreckliches erlebt haben«, bemerkte Makaloro teilnahmsvoll.
Ahacco schwieg. Er dachte an seine Ziehmutter Martha, die Mika’aela beim Überfall der Schattenalben auf Ik’Ernu umgebracht hatte – und an Lissa, Rumiens Frau, die ebenfalls ermordet worden war. Sie hatten ihre sterblichen Überreste vor der Evakuierung des Dorfes zusammen mit den anderen Toten verbrennen müssen. Für Trauer war ihnen nicht viel Zeit geblieben.
»Wie können wir diese Bestien aufhalten?«, fragte der Bürgermeister.
»Der Herzog hat beschlossen, dass sich Ormands Heer ihnen auf dem Xorrocfeld entgegenstellen soll«, antwortete Ahacco. »Sie haben bestimmt auch schon den Befehl erhalten, alle kampffähigen Männer zu schicken.«
»Natürlich«, bestätigte Makaloro. »Und nicht nur das. Da es in Sinnabol mehr Waffenschmiede gibt als überall sonst auf der Insel, können wir uns vor Aufträgen kaum retten. In den Schmieden wird fast ohne Pause gearbeitet.«
»Ich befürchte, dass normale Waffen gegen die Schattenkrieger wenig ausrichten werden«, meinte Ahacco. »Kürzlich habe ich mit Flüchtlingen von der Küste gesprochen, die Mika’aelas Soldaten kämpfen sahen. Sie müssen schrecklich sein: wild, brutal und unglaublich stark. Überall hinterlassen sie nur Feuer und Tod und sind kaum zu stoppen«, berichtete er.
Der Bürgermeister war bleich geworden. »Aber irgendetwas müssen wir doch tun. Was würden Sie denn vorschlagen?«
Ahacco senkte den Blick. »Ich weiß es nicht. Noch nicht.«
Enttäuschung
»Nebelherz! Wo bist du?«
Regenherz kam unter einem jungen, hochgewachsenen Raiséllhornbaum zum Stehen und sah sich suchend um. Seine Freundin war nicht an ihrem Lieblingsplatz. Zumindest konnte er sie nicht entdecken.
»Fáinne!«, rief er, und benutzte ihren Kindernamen, den sie ihrem Rufnamen immer noch vorzog. Kein Wunder, dachte er. ›Nebelherz‹ war schließlich nicht besonders schmeichelhaft. Mit diesem Namen bezeichnete man Vaeren, die mit ihren Gedanken ständig woanders waren.
Regenherz wollte eben weiterlaufen, als er ein Rascheln im Geäst der benachbarten Esche hörte. Dort saß sie also!
Rasch schwang sich der junge Vaere zu seiner Freundin hinauf und tippte ihr auf die Schulter.
Fáinne wandte sich ab. »Bitte lass mich allein.«
Über seine Flederohren strömte eine Flut von Eindrücken auf Regenherz ein, die er nur schwer sortieren konnte. »Friss doch nicht immer alles in dich hinein. So löst du deine Probleme auch nicht«, sagte er.
Fáinne sah nicht einmal auf. »Was versteht ein Kindskopf wie du schon von meinen Problemen?«, brummte sie missmutig.
Er musste unwillkürlich schmunzeln. Wie für alle Vaeren war die Wahrheit auch für sie das höchste Gut. Und er spürte deutlich, dass sie selbst wusste, wie unrecht sie ihm mit diesen Worten tat.
Zum Glück bemerkte sie sein Schmunzeln nicht. »Ich spüre, dass du traurig bist«, sagte Regenherz und legte eine Hand auf ihren Arm.
»Fass mich nicht an«, fauchte sie schärfer als beabsichtigt.
Er zog die Hand zurück. »Entschuldige. Aber du versteckst dich bereits seit Tagen. Nicht nur ich mache mir Sorgen, auch Eichenherz will wissen, was mit dir los ist.«
»Hat er dich geschickt?«
»Nein. Er hat nur nach dir gefragt«, antwortete Regenherz. Er setzte sich auf einen anderen Ast, der ihrem gegenüber lag, und sah sie ernst an. »Ich bin hier, weil ich dein Freund bin. Vielleicht möchtest du ja mit jemandem reden.«
Doch Fáinne starrte nur weiter teilnahmslos in die Ferne.
»Ich verstehe es, wenn du allein sein willst«, fuhr Regenherz fort. »Ich habe aber eine Neuigkeit, die dich bestimmt interessiert. Der Schwarze Reiter ist zurück. Ich habe ihn selbst gesehen.«
Fáinne wäre fast zusammengezuckt. Sie konnte sich gerade noch beherrschen. »Wo hast du ihn gesehen?«, fragte sie etwas zu schnell. Sie wollte Regenherz eigentlich nicht zu erkennen geben, wie sehr sie sich über diese Nachricht freute.
»Vorhin. Er ist in die Stadt geritten.« Regenherz zögerte, dann fragte er skeptisch: »Du wirst ihn wieder treffen, nicht wahr?«
Sie gab sich unbeeindruckt. »Warum auch nicht?«
»Weil er ein Mensch ist. Und weil er dir vielleicht etwas zu viel bedeutet.« Seine Miene war ernst, und seine Flederohren ragten in die Höhe wie zwei erhobene Zeigefinger.
Fáinne konnte gar nicht anders, als laut zu lachen. »Wehe, du erzählst Eichenherz diesen Blödsinn! Er bedeutet mir ... nun ja, nicht nichts , das gebe ich zu. Aber auch nicht zu viel, was immer das heißen soll.« Sie knuffte mit der Rechten seine linke Schulter.
Regenherz erkannte das als Zeichen der Versöhnung. »Und was hast du jetzt vor?«, fragte er.
»Ich werde nicht lange weg sein. Falls Eichenherz nach mir fragt, sag ihm bitte einfach, dass es mir nicht gut geht.«
»Das ist viel verlangt«, wandte der junge Vaere ein.
»Bitte tu es trotzdem. Es ist ja nicht gelogen.«
Der junge Vaere nickte. »Und wo willst du hin?«
Fáinne erhob sich ohne eine Antwort auf ihrem Ast und balancierte in Richtung Baumstamm.
»Du gehst also zu ihm«, stellte er eingeschnappt fest. »Du kennst ihn doch gar nicht.«
»Kaum. Na und? Ich glaube, er braucht meine Hilfe.«
»Aber ... er ist ein Mensch «, ermahnte Regenherz sie nachdrücklich. »Menschen sind gefährlich. Und sie sind unberechenbar, weil sie richtig und falsch nicht unterscheiden können.«
»Wer sagt das denn? Deine Bücher, die du so fleißig liest?«, fragte Fáinne von oben herab. »Bücher können irren – so wie diejenigen, die sie geschrieben haben. Dieser Mann ist anders. Ich bin mir sicher, dass es noch viele Menschen gibt, die anders sind, als man es uns dauernd erzählt. Wenn du jemals mit einem von ihnen geredet hättest, wüsstest du das vielleicht auch.« Sie sprang leichtfüßig auf einen niedrigeren Ast.
Regenherz seufzte. Er hatte ihrer Zielstrebigkeit und ihrer spitzen Zunge nur selten etwas entgegenzusetzen. Das war schon früher so gewesen und hatte sich nicht geändert, seit sie erwachsen geworden waren.
»Na gut«, sagte er resigniert. »Ich hoffe nur, dass Eichenherz mich nicht fragen wird, wo genau du bist.«
»Du bist ein wahrer Freund.« Fáinnes Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass sie ihm aufrichtig dankbar war.
»Aber wenn er bereits ahnt, dass du dich mit diesem Mann triffst, werde ich es nicht abstreiten.« Regenherz’ Flederohren zitterten. »Außerdem hast du gelogen«, sagte er. »Ich spüre das. Er bedeutet dir viel mehr, als du mir oder dir selbst gegenüber zugeben willst.«
Fáinne brauchte keinen Wahrheitssinn, um den Unterton in der Stimme ihres Freundes richtig zu deuten. Sie biss sich auf die Unterlippe. »Tut mir leid«, murmelte sie, bevor sie am Stamm der Esche hinabglitt und Regenherz mit seiner nagenden Eifersucht allein zurückließ.
Als Ahacco von der Stadtmauer Sinnabols aus den nah gelegenen Waldrand sah, ergriff ihn eine tiefe Sehnsucht. Die Bäume schienen geradezu nach ihm zu rufen.
Fáinne hatte wohl recht: Er war ein Teil des Waldes. Darum konnte er den Drang nicht länger ignorieren. Er musste einfach gehen.
Entschlossen machte er sich auf den Weg.
Er hatte die Baumgrenze erst wenige Schritte hinter sich gelassen, da meinte er, aus den Augenwinkeln eine Gestalt wahrzunehmen, die sich hinter einem Strauch verbarg und ihn heimlich beobachtete. Kaum hatte die Person gemerkt, dass sie entdeckt worden war, verschwand sie lautlos im Unterholz. Ahacco sah nur noch einen Streifen weißblondes Haar, der kurz in der Sonne aufleuchtete.
Sofort nahm er die Verfolgung auf. Die Gestalt lief auf ihm wohlbekannten Wegen vor ihm her. Obwohl sie einen Vorsprung hatte und er von ihr kaum mehr als einen Schemen zu Gesicht bekam, war er sich bereits sicher, wen er da verfolgte.
»Lynn!«, rief er laut.
Prompt verlangsamte die Waldläuferin ihren Schritt. Als kostete es sie große Überwindung, blieb sie schließlich stehen und ließ ihn zu sich aufschließen.
Der Anblick seiner Jugendfreundin beunruhigte Ahacco. Sie schien gestresst zu sein. Ihre Gesichtshaut war von rötlichen Stellen gezeichnet.
»Es ist schön, dich zu sehen«, begrüßte er sie. »Ist alles in Ordnung mit dir?«
Aber Lynn antwortete nicht und wich seinem Blick weiterhin aus.
Da fiel ihm das Geschenk ein, das sie ihm vor seiner Abreise nach Eisthal gemacht hatte. »Danke übrigens für das Zaumzeug. Nachttanz und mir gefällt es sehr.«
Sie winkte ab. Ahacco wusste, dass sie sich geschmeichelt fühlte. In vielen Dingen war sie immer noch so, wie er sie von früher kannte.
»Was willst du hier?«, fragte sie. »Ich habe nicht damit gerechnet, dich so schnell wieder in Wildheim zu sehen.« Es war eine schroffe Begrüßung, doch Lynns Tonfall war versöhnlich.
»Kannst du mich zu Grog bringen?«, fragte Ahacco geradeheraus.
Die Waldläuferin musterte ihn eindringlich. Er sah eine Mischung aus Zweifel und Hoffnung in ihren Augen. Lynn bedeutete ihm knapp, ihr zu folgen, und sie fielen wieder in einen schnellen Lauf.
Auf für normale Menschen kaum erkennbaren Pfaden gelangten sie bald zum Lager der Wildsöhne. Ahacco erschrak bei dem Anblick, der sich ihm bot. Das Lager befand sich in einem schlimmem Zustand: Fast alle Palánn waren eingestürzt oder verwüstet. Die wenigen Hütten, die noch standen, rochen nach Fäulnis. Das Laub auf ihren Dächern war so schwarz wie die Kronen der umstehenden Bäume.
»Es steht nicht gut um Wildheim«, kommentierte Lynn den Anblick knapp. »Der Schatten ist in unseren Wald eingefallen und hat vieles verzehrt, das vorher licht und lebendig war.«
Von den Wildsöhnen war niemand zu sehen. Lynn zufolge übten sie gerade unter Tjius und Fjanns Aufsicht im Wald.
»Hat er das Lager angegriffen?«, fragte Ahacco.
»Er?« Lynn sah ihn verständnislos an. Dann begriff sie. »Nein, das hier war ein Rudel Wölfe«, antwortete sie düster, »aber keine normalen Wölfe, sondern riesige Tiere ... Wie das, das wir vor ein paar Tagen am Eichweiher beobachtet haben. Sie trauen sich jetzt immer weiter vor. Zum Glück wurde niemand verletzt.«
Sie steuerte auf eine der wenigen Hütten zu, die noch intakt waren. »Bin gleich wieder da«, sagte sie und verschwand im Palánn.
Ahacco sah sich um. Neben der Feuerstelle sprang ihm ein frisch abgezogenes schwarzes Fell ins Auge. So unnatürlich groß, wie es war, musste es einem der Wölfe gehört haben. Offenbar hatten sich die Wildsöhne erfolgreich gegen die kräftigen Tiere zur Wehr gesetzt.
Als Wildmeister Grog aus seiner Hütte trat, erhellte ein Lächeln sein besorgtes Gesicht. »Hallo Ahacco!«, begrüßte er ihn, gefolgt von einem herzlichen Händedruck. »Hast du deine Angelegenheiten in der Hauptstadt erledigen können?«
Ahacco nickte. »Das Wichtigste auf jeden Fall. Die Leute aus meinem Dorf haben dort ein neues Zuhause gefunden.«
»Das freut mich«, sagte Grog. »Und was ist mit dir? Wirst du auch nach Eisthal umsiedeln?«
Der junge Mann schüttelte den Kopf. »Ganz sicher nicht.«
Lynn war hinter ihrem Vater aus dem Palánn getreten und musterte Ahacco neugierig. »Und warum bist du nun hier?«, fragte sie.
Grogs Blick schien den jungen Mann zu durchbohren. »Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Wir haben bei uns immer noch einen Platz für dich.«
Ahacco hielt dem Blick seines alten Wildmeisters stand. Wie hätte er dessen Angebot vergessen können! Er durfte seine Letzte Prüfung, vor der er vor vielen Jahren davongelaufen war, wiederholen. So etwas war in der langen Geschichte der Wildsöhne noch nie vorgekommen.
»Ich habe meine Entscheidung getroffen«, antwortete er. »Wenn Euer Angebot noch gilt, würde ich gerne an der Totensuche teilnehmen.«
Während sich auf Grogs Gesicht ein ebenso überraschtes wie erfreutes Strahlen ausbreitete, sprang Lynn mit einem kleinen Jauchzer auf Ahacco zu und fiel ihm um den Hals.
»Nicht so fest, du erstickst mich ja!«, rief Ahacco grinsend und schob sie sanft von sich.
Verlegen strich Lynn sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ich freu’ mich nur, dass du dich so entschieden hast«, sagte sie.
»Ich auch!« Grog gab seinem früheren Schüler einen so kräftigen Schlag zwischen die Schulterblätter, dass diesem fast die Luft wegblieb.
»Ich hoffe, ich überlebe die Entscheidung«, meinte Ahacco scherzhaft, als er wieder zu Atem gekommen war.
Fáinne sah, wie die junge Frau Ahacco umarmte. Sie spürte selbst aus großer Entfernung, dass die Waldläuferin starke Gefühle für ihn empfand, die weit in ihre gemeinsame Vergangenheit zurück reichten. Zwischen ihr und Ahacco musste einmal etwas gewesen sein, das diese Frau bis heute im Herzen trug.
Ob es ihm auch so ging, konnte Fáinne nicht sagen. Die Gefühle des ›Schwarzen Reiters‹, wie sie ihn manchmal nannte, blieben ihr wie immer verschlossen.
Fáinnes Flederohren begannen zu zittern. Sie fühlte eine Welle von Wut und Enttäuschung in sich hochkochen.
Eigentlich war sie hier, um Ahacco zu erzählen, was sie über die Spione der Waldhasser herausgefunden hatte. Vor seiner Abreise nach Eisthal hatte er sie darum gebeten, die Wildsöhne zu beobachten. Und sie war erfolgreich gewesen: Sie wusste, wer die drei waren.
Aber hier vergeudete sie nur ihre Zeit! Entschlossen drehte die Vaere sich um und rannte zurück in den Wahren Wald.
Wie recht Regenherz doch gehabt hatte! Die Menschen waren unberechenbar. Außerdem ärgerte es Fáinne, dass ihr Jugendfreund auch mit seiner anderen Vermutung ins Schwarze getroffen hatte: Sie hatte ihre Gefühle bei weitem nicht so gut im Griff, wie sie es sich selbst einzureden versuchte.
Es war offensichtlich: Sie sollte diesen Menschen lieber aus ihrem Leben verbannen, bevor sie die Kontrolle über sich selbst verlor. Vielleicht wurde es Zeit, dass sie sich wieder den wirklich wichtigen Dingen widmete, zum Beispiel ihrer Ausbildung bei Meister Eichenherz und der anstehenden Namenszeremonie.
Fáinne atmete im Laufen tief durch. Warum fühlte sie sich nur so stark zu Ahacco hingezogen? Weil dieser Mensch mit seinem ›Wahren Herzen‹ etwas ganz Besonderes war, wie Eichenherz schon öfter festgestellt hatte? Der alte Mann hatte auch vorausgesehen, dass dem Schwarzen Reiter ein gefährliches Schicksal drohte. Darum hatte er Fáinne nachdrücklich dazu geraten, ihn nicht mehr zu treffen.
Was dachte sie sich bloß, was aus ihrer Beziehung zu Ahacco werden würde? Vielleicht war es wirklich besser, die ganze Sache einfach zu vergessen.
Jared
»Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du lebst«, hauchte Kada.
Jared lachte abfällig. »Du warst ja wirklich total überrascht, mich zu sehen.«
Kada schluckte nur. Der Schock, dass sie in dieser seltsamen Ruine in Lichterland auf ihren alten Freund getroffen war, saß ihr noch tief in den Knochen. Schließlich hatten die Schattenalben Jared erst vor wenigen Tagen vor ihren Augen ermordet!
»Wird Zeit, dass ich dich aufklär’«, meinte er und rückte auf dem Steinquader, den sie als Sitzgelegenheit nutzten, näher an das Mädchen heran. »Der Biss der Schattenalben ist giftig, aber nicht tödlich. Du stirbst nur, wenn sie dir die Kehle aufreißen – oder wenn sie dich fressen natürlich. Zum Glück ist mir beides erspart geblieben. Ich habe zwar viel Blut verloren, aber das Zeug, das ich durch den Biss aufgenommen habe, hält mich am Leben ...«
Jareds Gesicht war dem ihrem nun ganz nah. Seine Haut war noch blasser als sonst. »Sie nennen mich den Grauen Alb. Meine äußere Hülle ist noch dieselbe wie früher, doch da drin ... Ich habe mich verändert.«
Es war die Art, wie er das letzte Wort aussprach, die Kada vor Entsetzen erstarren ließ. »Was ... Was haben sie mit dir gemacht?«, fragte sie kaum hörbar.
»Keine Ahnung«, entgegnete Jared und entblößte beim Grinsen eine Reihe schmutziger Zähne. »Aber weißt du was? Es gefällt mir. Ich habe jetzt ein paar praktische Fähigkeiten. Ich kann dich zum Beispiel kontrollieren, wenn ich will.«
Das Mädchen begriff, dass sie sich vom Äußeren des Jungen, das sie so sehr an ihren früheren Freund erinnerte, nicht täuschen lassen durfte. Sie musste äußerst vorsichtig sein.
Obwohl ihr das Herz bis zum Hals schlug, nahm sie all ihren Mut zusammen und fragte: »Jared, was hast du mit Tongo gemacht?«
»Bist du etwa immer noch mit diesem Hänfling zusammen? Das tut mir leid.« Jared schüttelte den Kopf und lachte höhnisch. »Ich fürchte, Tongo fand meine Gegenwart ermüdend. Er ist doch glatt eingepennt.« Bei diesen Worten deutete er auf die leblose Gestalt, die weiter unten, hinter einer von Rissen und Furchen zernarbten Säule, am Boden lag.
»Du meinst, er schläft die ganze Zeit?« Kada stand auf und sprang von der Tribüne, auf der sie gesessen hatten, ins Gras hinunter. Sie lief zu ihrem Freund und kniete sich neben ihn.
Tongo atmete schwach, aber regelmäßig. Sein Gesicht war totenblass und kam ihr fast so blutleer vor wie Jareds. Zum Glück konnte sie keine Bissspuren entdecken.
Jared lachte. »Er schläft, so lange ich will. Ich sagte doch, ich kann euch jetzt kontrollieren.«
Als Kada erschrocken zu ihm aufsah, erklärte er: »Die Alben nennen das den ›Endlosen Schlaf‹ – eine der Gaben, die ich seit meiner Verwandlung habe. Tongo wird erst wieder aufwachen, wenn ich es ihm erlaube. Aber das hat Zeit. Solange er schläft, kann ich auf seine Lebenskraft zugreifen. Sie macht mich stärker.« Er legte theatralisch eine Hand auf seine Brust und grinste wieder.
»Das verstehe ich nicht«, rief Kada. »Warum haben die Schattenalben dich am Leben gelassen?«
»Die Aela meinte wohl, ich könnte ihr von Nutzen sein. Ich bin jetzt sowas wie ihr Berater. Sie weiß nämlich herzlich wenig über die Menschen, ihre Gewohnheiten und ihre Denkweise. Natürlich habe ich mich auch anderweitig nützlich gemacht ...«
Kada erhob sich. Sie hatte den Sinn seiner Worte sofort erfasst. »Du warst das! Du hast Ahaccos Kette gestohlen.«
Diese verfluchte Halskette , dachte sie im Stillen. Sie wusste aus eigener Erfahrung, dass die Anführerin der Schattenalben über Leichen gegangen war, um das ›Talannar‹, wie sie es nannte, zu bekommen.
»Kluges Mädchen!« rief Jared. Es gelang ihm trotz seiner aufgesetzten Überheblichkeit nicht ganz, seine Überraschung zu verbergen. »Es war sogar noch leichter, als ich gedacht hatte. Ahacco ist so ein Dummkopf. Er hatte das Ding offenbar immer bei sich. So war es ganz einfach, es zu klauen.«
»Ahacco ist klüger als du und deine ›Aela‹«, sagte Kada wütend. »Wenn er merkt, dass wir nicht zurückkommen, wird er uns suchen – und er wird Soldaten mitbringen.«
»Bist du sicher?«, fragte Jared hämisch. »Ich habe gehört, dass er was Besseres zu tun hat. Dass er zu den Wildsöhnen zurückkehren will. Ich glaube kaum, dass er euch beiden hinterherlaufen wird.«
»Mir hat er gesagt, er hätte mit den Wildsöhnen nichts mehr zu tun«, entgegnete Kada. Sie versuchte, sich ihre Verunsicherung nicht anmerken zu lassen. »Wo hast du das gehört?«
»Ist doch egal.« Jared sprang ebenfalls von der steinernen Tribüne zu Boden. »Wird Zeit, dass du deinem Freund ins Reich der Träume folgst. Wusstest du, dass man im Endlosen Schlaf nichts als Albträume hat? Alle von der schlimmsten Sorte. Keine Freude, kein Glück, keine Hoffnung. Und deine ganze Lebenskraft geht an mich.«
»Warte!« Vielleicht war noch etwas von dem Jared, den sie gekannt hatte, übrig geblieben, dachte Kada. Sie musste irgendwie versuchen, zu ihren früheren Freund durchzudringen. »Lass uns zusammen von hier verschwinden. Du hast dich verändert, das stimmt. Du kannst doch trotzdem mit uns kommen. Denk mal nach: Wenn die Schattenalben dich nicht mehr brauchen, werden sie dich auch töten.«
»Netter Versuch, aber da irrst du dich«, sagte Jared kalt. Sein Blick bohrte sich in ihre Augen.
Kada war wie gelähmt, als er auf sie zukam. Selbst als er neben ihr stehen blieb und ihr mit sanfter Geste das Haar aus dem Nacken strich, konnte sie keinen Finger rühren.
Sie spürte mit wachsendem Ekel, wie seine kühlen Lippen an ihrer Kehle hinabfuhren, wie sein trockener, halb geöffneter Mund über ihr Schlüsselbein strich.
In diesem Moment schrillten alle Alarmglocken in Kadas Körper auf einmal. Ein plötzlicher Energiestoß durchfuhr sie, und mit letzter Willenskraft sprang sie auf die Beine und torkelte von ihm weg.
Jared setzte ihr nach.
Ihre Beine gehorchten ihr wieder. Geistesgegenwärtig schwang Kada sich hoch auf die Tribüne und rannte los. Sie stürzte die Stufen einer verwitterten Treppe hinauf, die zu einer Turmruine führte. Hinter sich hörte sie Jareds Keuchen und die Geräusche seiner schweren Stiefel auf den Steinplatten.
Was ist das hier nur für ein Gebäude? , fragte sie sich. Und wo kam es her? Bevor das neue Land vor der Küste entstanden war, hatte es hier nur Wasser gegeben.
Kada hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Sie erreichte das Ende der Treppe und fand sich auf einer von Zinnen gesäumten, kleinen Plattform wieder. Hier oben pfiff ein scharfer Wind, der vom nahen Meer kam und ihr in den Augen brannte. Gehetzt sah sie sich um. Der einzige Fluchtweg war eine etwas tiefer gelegene Mauer, die von dem Turm wegführte.
Sie hatte keine andere Wahl. Bevor Jared sie erreichen konnte, sprang sie durch eine breite Lücke, die ihr eine abgebrochene Zinne bot. Sie fiel einige Fuß tief und landete am äußersten Rand der schmalen Mauer. Mit etwas Glück fand sie ihr Gleichgewicht wieder. Rechts von ihr ging es steil hinab in die Tiefe.
Sie warf einen Blick zurück zum Turm.
Jared musterte die Mauer abschätzend, sprang ihr aber nicht hinterher. »Du kannst mir nicht entkommen!«, zischte er zornig und lief zurück zur Treppe.
Kada balancierte die Zinnen der Mauer entlang, bis wieder die Tribüne in Sicht kam. Auf der Suche nach einer möglichen Deckung konnte sie dort unten aber nur ein paar Säulen und einen seltsamen Riss im Boden ausmachen. Die Spalte war ziemlich breit und so dunkel, dass sie abgrundtief wirkte.
Schaudernd wandte sich Kada von ihrem Anblick ab.
Gerade tauchte Jared wieder im Eingang auf. Er hatte es nun nicht mehr eilig. Gemessenen Schrittes ging er zu Tongo hinüber.
Das Mädchen blieb wie angewurzelt stehen. Er würde doch nicht ...
Jared zog einen Dolch aus dem Gürtel und hielt ihn dem reglos daliegenden Jugendlichen an die Kehle. »Komm sofort wieder runter«, forderte er sie auf.
Selbst von hier oben konnte Kada das Blut sehen, das hervortrat, wo die scharfe Klinge Tongos Haut berührte. »Tu das nicht! Bitte!«
»Komm einfach her.«
»Warte kurz!«, rief sie. Rasch balancierte sie ein Stück weiter, bis sie die Trümmer eines anderen Turms erreichte, der zu einem mannshohen Haufen zusammengefallen war. Diesen benutzte sie, um hinabzuklettern.
Jared erwartete sie mit einem siegesgewissen Lächeln.
Diesmal gab es für Kada kein Entrinnen. Der Junge trat so nah an sie heran, dass sie alle Schattierungen seiner grauen, ausdruckslosen Augen erkennen konnte. Sacht hob er ihr Kinn an. Sie fragte sich, ob er sie jetzt womöglich auch noch zu küssen versuchen würde.
Aber bevor sie das herausfinden konnte, verließ Kada schon jedes Gefühl für ihren Körper, und sie verlor das Bewusstsein.
Jareds starken Arme fingen sie auf, als sie fiel.
Zurück in Wildheim
Es waren nur noch sieben Tage bis zur Totensuche. Ahacco beschloss, bis dahin wie die anderen Wildsöhne an so vielen Schulungen und Übungen wie möglich teilzunehmen. Er konnte sich zwar noch an vieles erinnern, was er in den langen Jahren der Ausbildung bei den Wildmeistern Grog und Fondrú gelernt hatte. Aber ohne eine Auffrischung hätte er vermutlich keine Chance, die Prüfung zu bestehen.
Dies war zumindest Lynns Ansicht. Ahacco vertraute ihr, denn sie musste es schließlich wissen. Im Gegensatz zu ihm hatte sie die Totensuche bereits vor Jahren abgelegt.
Die Waldläuferin stellte ihn den anderen Prüflingen vor und riet ihm nachdrücklich, mit ihnen gemeinsam zu lernen. Ahacco war dankbar für die guten Ratschläge. Das straffe Programm würde ihm nur wenig Zeit lassen, sich weiterhin Sorgen um Kada und Tongo zu machen.
Als er an diesem Morgen das Haus des Bürgermeisters verlassen hatte und Richtung Wald gelaufen war, hatte er eigentlich erwartet, auf Fáinne zu treffen. Er hoffte, dass sie etwas über Eythan, Elion und Yorad, die vermutlich unter falschen Namen bei den Wildsöhnen lebten, herausgefunden hatte. Mithilfe ihrer Flederohren, dem zusätzlichen Sinnesorgan der Vaeren, war es ihr vielleicht gelungen, die drei zu identifizieren.
Sie war aber nicht aufgetaucht. Es konnte gut sein, dass Fáinne von seiner Rückkehr einfach noch nichts mitbekommen hatte, dachte Ahacco. Dies war eine naheliegende Erklärung. Schlimmer wäre es gewesen, wenn sie seinetwegen Schwierigkeiten mit ihrem Volk bekommen hatte. Er wusste, dass die Vaeren Kontakte mit Menschen strikt ablehnten.
Auch ohne ihre Hilfe würde Ahacco die nächsten Tage dazu nutzen müssen, die Spione ausfindig zu machen. Wenn er sie nicht aufhalten konnte, würden sie Thorondar nach der Totensuche das Geheimnis ihrer Kräfte verraten – Kräfte, von denen Ahacco selbst vermutlich erst einen Bruchteil kannte. Nach allem, was er über den Herzog herausgefunden hatte, war dessen Fassade als gütiger Landesvater und großzügiger Förderer der Wissenschaften und Künste nur aufgesetzt. Dahinter verbarg sich ein machtgieriger und absolut skrupelloser Mann. Er durfte das geheime Wissen der Wildsöhne niemals erlangen.
Ahacco war sicher, dass Grog und Lynn ihm in jeder Hinsicht zustimmen würden – wenn er sie denn eingeweiht hätte. Gleich nach seiner Ankunft in Wildheim, noch während sie mit dem Aufräumen des Lagers beschäftigt gewesen waren, wollte er wenigstens sie, die ihm hier am nächsten standen, über alles informieren. Aber dann hatte er es sich anders überlegt. Er wusste selbst nicht so genau warum.
Zum Teil machte er sich Sorgen, wie die beiden auf seine Enthüllungen reagierten. Vor allem Grog würde die Tatsache schwer treffen, dass er sein Wissen, seine Erfahrungen, ja einen Teil seines Lebens mit Verrätern geteilt hatte. Lynn würde wahrscheinlich einfach fuchsteufelswild werden und sofort damit beginnen, die drei jungen Männer zu suchen. Aber Grog?
Und was würden die anderen Wildsöhne und Waldläuferinnen sagen? Würden sie überhaupt auf Ahaccos Wort vertrauen?
Es konnte gut sein, dass die Spione – sollten sie sie denn finden – einfach alle Vorwürfe abstritten. Würden die anderen Wildsöhne in diesem Fall womöglich zu ihnen halten? Ahacco war den meisten schließlich fremd. Mit den Beschuldigten dagegen lebten sie seit Jahren in einer verschworenen Gemeinschaft.
Für den Augenblick schien es Ahacco richtig, niemanden einzuweihen und die Sache auf eigene Faust zu regeln. Dennoch plagte ihn ein schlechtes Gewissen.
Nachdem er mit Lynn einen Großteil des Stoffs durchgegangen war, den er für die Prüfung wiederholen musste, nutzten sie eine kurze Pause dazu, sich mit Grog vor dessen Palánn zusammenzusetzen.
Da sie ungestört waren, brachte Ahacco das Gespräch auf ein Thema, das ihn seit dem Auszug aus Ik’Ernu beschäftigte. »Wisst Ihr noch, worüber wir damals, nach Rumiens Verschwinden, gesprochen haben?«, fragte er den Wildmeister.
»Was genau meinst du?«, wollte dieser wissen.
»Ihr habt mich gefragt, ob mir hier im Wald jemals etwas Seltsames zugestoßen ist. Ich habe geantwortet, dass ich Stimmen höre.«
Grog und Lynn wechselten einen vielsagenden Blick.
»Ich höre sie immer noch, wenn ich in den Wald gehe oder wenn ich auch nur in die Nähe der Bäume komme«, fuhr Ahacco fort. »Es ist fast so, als wollten sie zu mir sprechen. Aber ich verstehe sie nicht. Noch nicht.«
Gespannt beobachtete er die Reaktion der beiden. Falls sie sich wunderten, ließen sie es sich nicht anmerken.
»Du hast als Wildsohn eine besondere Bindung zur Natur«, erklärte Grog. »Wer sagt denn, dass die Bäume nicht zu dir sprechen können?«
Lynn schmunzelte.
Es war offensichtlich, dass der Wildmeister und seine Tochter etwas vor Ahacco verbargen. Vermutlich war dies eines der Geheimnisse, die mit der Totensuche zu tun hatten. »Ihr wisst, woher die Stimmen kommen«, stellte der junge Mann fest, »vielleicht sogar, wem sie gehören. Oder nicht?«
Da Grog und Lynn eisern schwiegen, fuhr er einfach fort: »Ich kenne die Kräfte, die der Wald uns verleiht. Ich weiß zum Beispiel, dass ich sie als Heilkräfte einsetzen kann.« Er erinnerte sich gut daran, wie er vor einigen Tagen Baltrex, den früheren Dorfvorsteher von Ik’Ernu, von einem schweren Wundfieber geheilt hatte. Oder wie es ihm – eher durch Zufall – zum ersten Mal gelungen war, die von Messerstichen versehrte Rinde einer Rotbuche wieder zu verschließen. Jedes Mal hatte er dabei die geheimnisvollen Stimmen vernommen.
»Ich hatte einmal einen Schüler, der seine Gabe dazu benutzte, um sich an den Menschen zu rächen, die ihn als Kind misshandelt hatten«, erzählte Grog unvermittelt. »Er hat einen Mann und eine Frau getötet. Für ihn war die Tat gerechtfertigt. Doch eines Tages, als der Wildsohn in einer Klamm einem dritten Opfer auflauerte, wurde er von einem Erdstoß überrascht. Die Klamm begrub ihn bei lebendigem Leib, und wir konnten später nur noch seine Leiche bergen.« Er sah Ahacco ernst an. »Seitdem erzählen wir unseren Schülern nach der Totensuche diese Geschichte – in der Hoffnung, dass sie ihre Fähigkeiten nicht für böse Zwecke einsetzen.«
Ahacco war nicht sicher, was Grog ihm damit sagen wollte. Seine Hände waren jedoch feucht vor Aufregung. Hatten diese Kräfte ihren eigenen Willen? Konnten sie einen Menschen vielleicht sogar kontrollieren? Grog zufolge war es an jedem selbst, sich ihrer nur mit guten Absichten zu bedienen – oder die Konsequenzen zu tragen. Wie sonst sollte er sich den Erdstoß in der Geschichte des Wildmeisters erklären? Aber hieß das auch, dass jedem, der seine Macht für böse Zwecke einsetzte, der Tod drohte?
»Wie auch immer, es ist jedenfalls sehr ungewöhnlich, dass du schon jetzt –«
Grog brachte seinen Satz nicht zu Ende, denn in diesem Augenblick betrat eine Gruppe junger Wildsöhne das Lager. Sie gehörten nicht zu den Prüflingen, die man Ahacco bereits vorgestellt hatte, sondern zu einem jüngeren Jahrgang, der offenbar unter der Obhut von Wildmeister Fondrú stand.
Grog seufzte. »Beenden wir dieses Gespräch«, sagte er und stand auf, um seinen Kollegen zu begrüßen.
»Seit wann habt ihr zwei Scharen im Lager?«, erkundigte sich Ahacco bei Lynn. Solange er zurückdenken konnte, hatte es in Wildheim immer nur eine Gruppe gegeben, die von zwei Wildmeistern betreut worden war.
»Du meinst die da? Die sind vor ein paar Wochen aus den Östlichen Wäldern zu uns gekommen, weil sie dort Probleme mit den Menschen hatten«, erklärte Lynn.
»Und wo sind ihre Wildmeister?«, hakte Ahacco nach.
Lynns Miene verfinsterte sich, und sie ballte unwillkürlich die Fäuste.
»Ihr Lager wurde niedergebrannt«, antwortete sie. »Sie haben es nicht hierhergeschafft. Zum Glück konnten sie ihre Schützlinge rechtzeitig vor den Waldhassern verstecken.«
Grog, der sich gerade wieder zu ihnen setzte, schien ihre letzten Worte mitbekommen zu haben, denn er sagte: »Wildheim ist groß genug für uns alle. Außerdem haben wir Lynn, Tjiu und Fjann. Sie sind gut ausgebildet und können uns bei beiden Scharen unterstützen.«
Lynn winkte den Neuankömmlingen zur Begrüßung zu.
Ahacco beobachtete, wie sich ein Wildsohn mit strubbeligem schwarzen Haar von der Gruppe löste und zu ihnen herüberkam.
»Das ist Keir«, stellte Lynn ihn vor.
Die Blicke der jungen Männer begegneten sich für einen Moment. Ahacco meinte, in Keirs ernstem Gesicht eine plötzliche Nervosität zu erkennen. Kannte der andere ihn? Oder verwirrte es Keir nur, einen Fremden in vertrauter Runde mit Grog und Lynn anzutreffen?
Keir ließ sich weiter nichts anmerken – außer dass seine Augen in Lynns Gegenwart regelrecht zu leuchten begannen.
»Hallo«, begrüßte er die Waldläuferin. »Wildmeister Grog.« Zaghaft nickte er zuletzt auch Ahacco zu.
»Wie war eure Schulung?«, fragte Grog.
»Wie immer eigentlich: lehrreich und intensiv«, erwiderte der Jugendliche, der nicht viel älter als Tongo sein mochte.
Der Wildmeister nickte billigend und neigte den Kopf in Ahaccos Richtung. »Keir, das ist Ahacco. Er ist zu uns gekommen, um seine Letzte Prüfung zu wiederholen.« Obwohl er damit etwas völlig Außergewöhnliches gesagt hatte, machte er keine Anstalten, Keir diese Tatsache weiter zu erläutern.
Die beiden Wildsöhne reichten sich die Hand.
»Ich habe von dir gehört. Eine zweite Chance«, meinte Keir. Sein Tonfall ließ sich nicht deuten.
»Ahacco hat seine Prüfung vor ein paar Jahren abgebrochen und woanders gelebt«, brummte der Wildmeister. »Aber er ist ein begabter Kerl. Darum darf er diesmal an der Totensuche teilnehmen.« Und an Ahacco gewandt erklärte er: »Keir ist einer der besten in seiner Schar. Er wird von Lynn trainiert, und ich bin mir sicher, dass er seine Prüfung im nächsten Jahr mit Bravour bestehen wird.«
»Auf jeden Fall habe ich nicht vor, sie mittendrin abzubrechen«, meinte Keir, und es gelang ihm, diese Spitze gegen Ahacco im Tonfall vollster Bescheidenheit vorzubringen.
Erstaunt schnappte Lynn nach Luft.
Ahacco hatte die Botschaft ebenfalls verstanden. »Das war bei mir damals auch nicht so geplant«, erwiderte er beherrscht, ohne Keir dabei anzusehen.
»Man hat immer eine Wahl«, murmelte dieser. Dann sah er Grog und Lynn an, und mit den Worten »Ich muss los, unsere Schulung ist noch nicht zu Ende« lief er rasch zu seiner Schar zurück.
Grog zwinkerte Ahacco versöhnlich zu. »Stets bemüht, nichts zu verpassen, stimmt’s?«
»Gibt es viele, die über mich so denken wie er?«
»Ich glaube nicht«, wiegelte Grog ab.
»Lächelt Keir auch mal?«, stichelte Ahacco.
Grog lachte laut und räumte leiser ein: »Er ist ein eher ernster Junge. Sehr ehrgeizig noch dazu. Er hat heute wohl einen schlechten Tag, wie mir scheint.«
»Er meinte, er habe schon von mir gehört?«
Lynn und Grog wechselten erneut einen vielsagenden Blick.
»Im Lager wird viel geredet«, sagte die Waldläuferin. »Vielleicht hat er dich bei deinem letzten Besuch gesehen und sich bei den anderen nach dir erkundigt.«
Fragt sich nur, was er dabei aufgeschnappt hat , dachte Ahacco.
Am frühen Nachmittag war er mit dem Stoff, den er sich für heute vorgenommen hatte, durch. Er hatte weniger vergessen als angenommen. Das beruhigte ihn sehr.
Die anderen Prüflinge, die das Lager für eine praktische Übung verlassen hatten, waren noch nicht wieder zurück. Ahacco nutzte die freie Zeit, um sich in den Schatten zu setzen und auszuruhen.
Eigentlich wollte er den gesamten Lernstoff noch einmal wiederholen. Der lange Ritt und die konzentrierte Arbeit hatten ihn jedoch ziemlich erschöpft. Darum übermannte ihn der Schlaf, kaum dass er sich an einen der schwarzen Baumstämme gelehnt hatte.
Laute Stimmen in seiner Nähe weckten ihn kurze Zeit später wieder auf.
Fjann stand breit grinsend vor ihm. »Guten Morgen«, scherzte der Wildmeistergehilfe. »Freut mich, dass du wieder bei uns bist. Ist ja gerade noch rechtzeitig.«
Ahacco richtete sich verschlafen auf. »Hallo. Tut mir leid. Ich wollte nur kurz die Augen zumachen.«
»Keine Angst, das bleibt unter uns«, lachte Fjann. »Hauptsache, du bist hier. Komm, setz dich zu uns!« Er bedeutete Ahacco, ihm zu folgen.
Das Lager hatte sich mit Wildsöhnen und Waldläuferinnen gefüllt, die um die Feuerstellen herum plauderten und einen Imbiss zu sich nahmen. Ahacco zählte ein gutes Dutzend ältere Prüflinge und etwa zwanzig jüngere Wildsöhne, die vermutlich zu Keirs Jahrgang gehörten.
Fjann steuerte das Feuer an, an dem es sich Lynn und Tjiu gemütlich gemacht hatten. Die beiden saßen im Schatten eines Palánn und unterbrachen ihr Gespräch, als sie ihre Freunde näherkommen sahen.
Tjiu winkte Ahacco strahlend zu.
»Fertig mit Lernen?«, fragte die Waldläuferin und hielt ihm einen Brotkorb hin. »Willst du auch?«
»Ja. Und nein danke.« Ahacco ließ sich neben ihr nieder.
Lynn musterte ihn besorgt. »Etwas mehr Essen würde dir guttun. Du hast schon mal besser ausgesehen.«
»Ich habe wirklich keinen Hunger, Lynn.«
Achselzuckend stellte Lynn den Korb wieder weg.
Ahacco warf unauffällig einen Blick in die Runde und musterte die bunte Schar. Die meisten Wildsöhne saßen zu dritt oder viert zusammen und unterhielten sich. Das laute Stimmengewirr auf engstem Raum machte es jedoch unmöglich, einzelnen Gesprächen zu folgen.
Was hatte er auch erwartet? Die Spione des Herzogs würden wohl kaum offen über ihre Absichten sprechen. Außerdem waren sie sicher bemüht, nicht aufzufallen. Aber Ahacco würde sie schon finden. Während der Schulungen und Übungen, die in den nächsten Tagen anstanden, gelänge es ihm bestimmt, den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen.
»Ahacco! Ich habe dich etwas gefragt.« Lynn seufzte theatralisch.
Verwirrt sah er auf. »Entschuldige. Was hast du gesagt?«
»Ich wollte wissen, warum du immer noch dieses Schwert mit dir herumträgst.«
»Das? Oh.« Ahacco war gar nicht aufgefallen, dass er Daru’Chur am Gürtel trug, so sehr hatte er sich daran gewöhnt. »Das wollte ich heute Morgen eigentlich in der Stadt lassen. Aber ich habe ja noch nicht einmal mein Zeug ausgepackt.«
»Zeig mal.« Interessiert musterte Fjann die Waffe, die neben Ahacco auf dem Boden lag. »Ich hatte noch nie ein Schwert in der Hand.«
»Wirklich?« Ahacco reichte es ihm.
»Du solltest eigentlich wissen, dass wir die Waffen der Waldhasser hier nicht gerne sehen«, tadelte ihn Lynn streng. »Wir erlauben in Wildheim nur Kjann, Messer und Pfeil und Bogen.«
»Ich weiß«, sagte Ahacco verlegen.
»Wo hast du das eigentlich her? Es sieht irgendwie wertvoll aus.«
»Gefunden«, antwortete Ahacco wahrheitsgemäß.
»Und wer hat es da liegengelassen, wo du es ... ›gefunden‹ hast?«, hakte Tjiu augenzwinkernd nach.
»Es lag in einer Felsspalte, und das schon lange«, beteuerte Ahacco. Als er merkte, dass Lynn ihn argwöhnisch ansah, fügte er hinzu: »Schau nicht so, das ist wahr. Es ist uralt. Ich habe mittlerweile ein paar Dinge darüber herausgefunden.«
»Und zwar?«
»Das Schwert gehörte einmal einem Wildsohn, der Lichur hieß. Und es wurde vor Hunderten von Jahren geschmiedet. Von einem Mann namens Dwolen.«
Ahaccos Worten folgte atemloses Schweigen. Alle drei starrten ihn mit offenen Mündern an.
»Ein Dwolen-Schwert?«, rief Fjann, und das ungewollt so laut, dass die Gespräche der am nächsten sitzenden Wildsöhne verstummten. Mehrere Köpfe wandten sich ihnen zu. Und dann erhoben sich sogar einige der Jugendlichen und umringten die vier neugierig.
»Ist das das Schwert?«, fragte einer der älteren Jungen.
»Das soll von Meister Dwolen sein?«, wollte ein pausbäckiger Wildsohn wissen, dessen Misstrauen nicht zu überhören war.
»Sind da seine Initialen darauf?«, fragte ein Dritter.
Fjann drehte und wendete Daru’Chur ehrfürchtig, bis sein Blick an einer Stelle am Heft hängenblieb. Er zeigte Ahacco eine haarfeine Gravur, die diesem bisher nicht aufgefallen war.
»Ein ›F‹ und ein ›L‹. Das sieht jedenfalls nicht nach Meister Dwolen aus«, sagte er enttäuscht.
»Wo habt ihr das denn her?«, fragte einer der Umstehenden.
Alle Blicke richteten sich auf Ahacco.
»Ähm ... Also, das Schwert gehört mir«, antwortete er. »Aber kann mir vielleicht mal jemand erklären, warum hier jeder Meister Dwolen kennt? Ich selbst habe seinen Namen vor ein paar Tagen das erste Mal gehört.«
Einige lachten. Lynn nicht. Sie stand auf und zog ihn kurzerhand mit auf die Beine. »Komm, ich zeige es dir.«
Ahacco nahm Daru’Chur wieder an sich und ließ sich von der Waldläuferin durch das Lager führen. Die meisten Wildsöhne folgten ihnen flüsternd.
Sie brauchten nicht weit zu laufen. Drei Palánn weiter steuerte Lynn auf einen mannshohen, moosbewachsenen Felsen am Rand des Lagers zu, an den sich Ahacco aus seiner Jugend erinnerte. Sie umrundete ihn und wies mit der ausgestreckten Hand nach unten.
Was sie ihm hatte zeigen wollen, entpuppte sich als eine Art Grabstein. Er war eher niedrig, dafür umso breiter, und halb von abgestorbenen Efeuranken überwuchert, die einmal den gesamten Felsen bedeckt haben mussten.
»Das ist sein Grab – Meister Dwolens Grab«, sagte Lynn.
Erstaunt trat Ahacco näher. Dieser Ort war so nah am Lager. Doch er hätte schwören können, dass er noch nie hier gewesen war. Zumindest hatte er diesen Grabstein, den die meisten Wildsöhne offenbar kannten, noch nie bemerkt.
Umso neugieriger fegte er nun mit der Hand die trockenen Ranken beiseite und versuchte, die in den Stein gemeißelten Worte zu lesen. ›Me. Dwolen‹ stand dort. Kein Geburts- und Todesjahr. Dafür fand er unter dem Namen eine Inschrift, die er nach und nach entziffern konnte:
»In Gedenken an einen Schmied von Herz und Geist:
Nicht nur auf Gold und Stahl traf sein Hammer,
Sondern auch auf das Übel dieser Welt.
In tiefer Verehrung nehmen wir Abschied
Vom größten Meister seiner Zunft.«
»Und hier liegen wirklich Dwolens Gebeine?«, fragte er. Alle, die er anschaute, nickten.
»Nun, wir haben noch nie nachgesehen«, bemerkte Fjann, erntete für den schlechten Scherz aber nur missbilligende Blicke.
»Ich verstehe das nicht. Was hatte er denn mit den Wildsöhnen zu tun?«, wollte Ahacco wissen.
Lynn runzelte die Stirn. »Meister Dwolen war ein Freund des Waldvolkes. Die einzigen Waffen außer Kjann, Pfeil und Bogen oder Messern, die ein Wildsohn je geführt hat, stammen von ihm. Hier kennt ihn jeder. Hast du in all den Jahren im Wald wirklich nie etwas von ihm gehört?«
Ahacco schüttelte den Kopf.
»Er war nicht nur ein Waffenschmied, sondern stellte auch Rüstungen her«, meldete sich Tjiu zu Wort.
»Und Schmuck«, ergänzte Fjann. »Zu seiner Zeit gab es unter den Waldhassern angeblich keinen begabteren Kunstschmied als ihn.«
»Wie ist er so berühmt geworden?«, fragte Ahacco.
»Durch seine Waffen«, antwortete ein rothaariger, älterer Wildsohn rechts von Ahacco. »Jede von ihnen ist einzigartig, er hat nie zweimal die gleiche hergestellt. Mein früherer Wildmeister hat uns mal erzählt, dass viele Menschen ihn für einen Hexer hielten. Es hieß, er hätte die Waffen mit übernatürlichen Kräften ausgestattet. Darum auch die Probleme, die er später bekam: Irgendwann haben die Leute angefangen, alles, was er je geschmiedet hat, zu suchen und zu zerstören.«
»Ein seltsamer Zufall, dass du sein Schwert gefunden hast«, sinnierte Lynn.
Ahacco wusste schon lange, dass Daru’Chur kein gewöhnliches Schwert war. Die Furcht der Alben, wenn sie es sahen, und die Tatsache, dass es ihn, seinen Träger, nicht verletzen konnte – beides sprach dafür, dass Dwolen die Waffe tatsächlich mit magischen Kräften versehen hatte. Er war jedoch erstaunt zu hören, dass es nur noch sehr wenige Werke des Meister auf Aerdenwelt geben sollte und dass es sich dabei ausschließlich um Unikate handelte. Hatte Mika’aela nicht davon gesprochen, dass es vier Talannare gab und dass alle diese Schmuckstücke von ein und demselben Schmied stammten? Womöglich bestand hier sogar eine Verbindung, die er bisher noch nicht erkannt hatte, dachte er bei sich. Dann war es vielleicht kein Zufall, dass die Talannare und Daru’Chur von Dwolen stammten. Am Ende hatte Dwolen Lichur das Schwert womöglich deshalb gegeben: damit er die Schmuckstücke beschützte – eine Aufgabe, an der Ahacco leider gescheitert war.
»Was sollen das denn für Kräfte sein, die in Meister Dwolens Werken stecken?«, erkundigte er sich, als wüsste er nicht, wovon die Rede war.
»Also ich glaube nicht, dass da etwas dran ist«, erwiderte Lynn trocken. »Auf jeden Fall sollen seine Waffen zu den besten gehören, die es auf den Kreskiden je gegeben hat.«
»Hast du denn etwas Ungewöhnliches an deinem Schwert bemerkt?«, hakte Fjann neugierig nach.
Die Wildsöhne warteten gespannt auf seine Antwort.
»Nein«, log Ahacco zur allgemeinen Enttäuschung. »Vielleicht ist es ja auch eine Fälschung«, fügte er lächeln hinzu.
»Es ist nicht schwer, das festzustellen«, meinte der rothaarige Wildsohn. »Es heißt, dass alle Dwolen-Waffen eine gemeinsame Eigenschaft aufweisen: Sie können ihrem Besitzer nichts anhaben.«
Ahacco zuckte leicht zusammen, sagte aber nichts. Er wollte auf keinen Fall noch mehr Aufsehen erregen.
»Was ist?«, fragte Tjiu neugierig. »Willst du nicht herausfinden, ob du ein echtes Dwolen-Schwert gefunden hast?«
Ahacco wich einen Schritt zurück, als Lynn die Hand nach Daru’Chur ausstreckte.
»Das ist doch nur Gerede«, sagte er.
»Gib schon her«, forderte sie ihn auf. »Ich werde dir nicht gleich die Hand damit abhacken.«
Die Wildsöhne beobachteten gespannt, wie Lynn den Ärmel von Ahaccos Hemds hochschob und die Schwertspitze auf seinen rechten Unterarm setzte. Sie ritzte ihm eine fingerlange Wunde in die Haut. Unter dem enttäuschten Murren aus vielen Kehlen fing diese sofort leicht zu bluten an.
»Schade«, meinte der Rothaarige. »Es ist eine Fälschung. Trotzdem sieht es nach einem verdammt guten Schwert aus.« Damit war sein Interesse erloschen. Er drehte sich mit einem Achselzucken um und ging zurück ins Lager. Die meisten Jungen taten es ihm gleich.
Gut, dass wir das geklärt haben , dachte Ahacco erleichtert und nahm Daru’Chur wieder an sich. Rasch steckte er die Waffe zurück in die lederne Scheide. Das Heft ließ er unter seinem Hemd verschwinden, bevor die anderen das bläuliche Leuchten bemerken konnten, das sich unweigerlich einstellen würde, wenn die Wunde verheilte.
»Tut mir leid.« Lynn zog eine entschuldigende Grimasse. »Komm, zeig mal deinen Arm. Ich kann ihn dir verbinden.«
Ahacco winkte ab. »Danke, aber das ist nicht schlimm. An der Luft heilt das schnell«, sagte er. Unter dem Ärmel spürte er bereits, wie sich das Licht wie eine zweite Haut über dem Kratzer ausbreitete und ihn verschloss.
»Was treibt ihr denn da?«
Die verbliebenen Wildsöhne drehten sich um. Wildmeister Grog war ihnen gefolgt und stapfte ungehalten auf sie zu. Sein forschender Blick blieb an Ahacco hängen, der nach wie vor in der Mitte der Gruppe stand.
»Kaum bist du wieder da, dreht sich alles nur noch um dich!«, schimpfte er.
Es war nicht ganz klar, ob seine Bemerkung ernst oder scherzhaft gemeint war. Einzelne Lacher verstummten jedenfalls sehr schnell wieder.
»Was gibt es denn so Wichtiges, dass ihr alle mit dem Lernen aufhört?«, fragte der Wildmeister, nun etwas ruhiger.