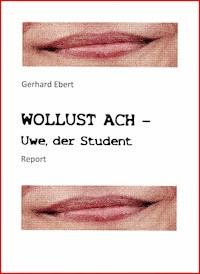Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Sammlung von Theaterrezensionen aus vier Jahrzehnten DDR-Theater vermittelt - zwangsläufig aus der Sicht des Kritikers - ein Bild von der ästhetischen Vielfalt dieser Bühnenkunst, ihrer tiefen Verwurzelung im Volk wie in humanistischer deutscher Tradition. Das Bild ergibt sich vor allem aus den Inszenierungen von Werken Bertolt Brechts und Heiner Müllers sowie von neuen Werken der Dramatiker Peter Hacks und Volker Braun. Das Bild wird komplettiert durch die Dokumentation der tiefgründigen szenischen Auseinandersetzungen mit Werken Shakespeares, Goethes, Schillers, Hauptmanns und Gorkis sowie weiteren Werken der Weltdramatik. Ergebnis war de facto ein utopisches Theater, in seiner progressiv humanistischen Ästhetik seiner Zeit weit voraus, die diktatorischen Züge der Gesellschaft ignorierend und über sie hinaus weisend. Seine primär ergötzende, sekundär sowohl aufklärerische als auch didaktische Funktion zerbrach in dem Maße, in dem der entstandene reale Sozialismus dem von den Bühnen postulierten Geist widersprach. Aus kritischer Übereinstimmung mit der historisch neuen Gesellschaft wurde kritische Distanzierung. Das macht die besondere, geschichtlich absolut einmalige Qualität dieser deutschen Bühnenkunst aus. Dafür ein wenig Bewusstsein zu wecken und also einen aufrichtigen Umgang mit deutscher Theatergeschichte zu stimulieren, ist mein inniges Anliegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Ebert
Das utopische Theater
Von Brecht bis Müller - vier Jahrzehnte DDR-Theater - Rezensionen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
„Der gute Mensch von Sezuan“
„Der Lohndrücker“
„Marie Hedder“
„Das Tagebuch der Anne Frank“
„Mann ist Mann“
„Wallenstein-Trilogie“
„Das Schwitzbad“
„Professor Mamlock“
„Kredit bei Nibelungen“
„Die Räuber“
„Die Holländerbraut“
„Die Dreigroschenoper“
„Der Kirschgarten“
„Holländerbraut“
„Dantons Tod“
„Lysistrate und die NATO“
„Der Mann von draußen“
„Die Dreigroschenoper“
„Die Dreigroschenoper“
„Herr Puntila und sein Knecht Matti“
„Mann ist Mann“
„Prinz Friedrich von Homburg“ und „Der zerbrochne Krug“
„Puntila“
„Die Winterschlacht“
„Mutter Courage und ihre Kinder“
„Leben des Galilei“
„Die Zeche zahlt Koritke“
„Aufzeichnungen eines Toten“
„Das andere Gesicht“
„Aufzeichnungen eines Toten“
„Der Prozeß“
„Faust“
„Wallenstein“-Trilogie
„Bürgermeister Anna“
„Frau Flinz“
„Er ging aus dem Haus“
„Juristen“
„Der Hungerkünstler geht“
„Der Bau“
„Der Auftrag“
„Die Dreigroschenoper“
„Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher“
„Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen“
„Urfaust“
„Macbeth“
„Trommeln in der Nacht“
„Johann Faustus“
„Trommeln in der Nacht“
„Urfaust“
„Bruder Eichmann“
„Platonow“
„Wallenstein“
„Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen“
„Volpone“
„Iphigenie“
„Die Kinder“
„Wallenstein-Trilogie“
„Der neue Prozeß“
„Der Kirschgarten“
„Lokomotive im Spargelbeet“
„Der Sturm“
„Der Held der westlichen Welt“
„Der Kaufmann von Venedig“
„König Johann“
„Der Kaufmann von Venedig“
„Der blaue Boll“
„Die Ratten“
„Die Aula“
„Winterschlacht“
„Troilus und Cressida“
„Die Falle“
„Bürger Schippel“
„Die Binsen“
„Nibelungen-Trilogie“
„Josef und Maria“
„Medea“
„Die Preußen kommen“
„Penthesilea“
„Egmont“
„Mensch Meier“
„Totentanz“
„Der Sturmgeselle Sokrates“
„Vor dem Ruhestand“
„Der Hauptmann von Köpenick“
„Minna von Barnhelm“
„Kikeriki“
„Zufällig eine Frau: Elisabeth“
„Siegfried/Frauenprotokolle/Deutscher Furor“
„Die Fliegen“
„Die Umsiedlerin“
„Die Bakchen“
„Der Meister und Margarita“
„Ein Monat auf dem Lande“
„Warten auf Godot“
„Fatzer“
„Anatomie Titus Fall of Rome…”
Berlin Alexanderplatz“
„Barbaren“
„Nathan der Weise“, „Philotas“ und „Emilia Galotti“
„Fegefeuer in Ingolstadt“
„Der rote Hahn“
„Maries Baby“
„Baal“
„Sommergäste“
„Der Park“
„Der Lohndrücker“
„Transit Europa“
„Die Mutter“
„Trommeln in der Nacht“
„Prometheus in Fesseln“
„Die Übergangsgesellschaft“
„Baal“
„Die echten Sedemunds“
„Warten auf Godot“
„Das trunkene Schiff“
„Lenins Tod“
„Transit Europa“
„Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei“
Heiner Müller zum 60. Geburtstag
„Germania Tod in Berlin“
„Wolokolamsker Chaussee“, Teile IV und V,
„Theatermacher“
„Santerre“
„Der Selbstmörder“
„Quartett“
„Die Geisel“
„Ritter der Tafelrunde“
„Hundeherz“
„Die Festung“
„Der verwunschene Berg“
„Wolokolamsker Chaussee“
„Wolokolamsker Chaussee“
„Transit Europa“
„Kein Runter kein Fern“
„Nackt in Wien“
„Woyzeck“
„Mein Kampf“
„Hamlet“
„Adam und Eva“
„Nachtasyl“
„Prinz Friedrich von Homburg“
„Richard III.“
Plebejisches oder bürgerliches Theater, das ist nun die Frage
Nachwort
Impressum neobooks
Vorwort
Lassen Sie mich bitte mit einem Zitat beginnen, mit einer ästhetischen Maßgabe Bertolt Brechts (1898-1956), dem Klassiker des utopischen Theaters der DDR. Ich brauche ihn als Kronzeugen. In seinem „Kleinen Organon für das Theater“ aus dem Jahre 1948 schrieb er: „Das Theater muss sich in der Wirklichkeit engagieren, um wirkungsvolle Abbilder der Wirklichkeit herstellen zu können und zu dürfen… Es macht die praktikablen Abbildungen der Gesellschaft, die dazu imstande sind, sie zu beeinflussen, ganz und gar als ein Spiel: für die Erbauer der Gesellschaft stellt es die Erlebnisse der Gesellschaft aus, die vergangenen wie die gegenwärtigen, und in einer solchen Weise, daß die Empfindungen, Einsichten und Impulse genossen werden können, welche die Leidenschaftlichsten, Weisesten und Tätigsten unter uns aus den Ereignissen des Tages und des Jahrhunderts gewinnen. Sie seien unterhalten mit der Weisheit, welche von der Lösung der Probleme kommt, mit demZorn, in den das Mitleid mit den Unterdrückten nützlich sich verwandeln kann, mit dem Respekt vor der Respektierung des Menschlichen, das heißt Menschenfreundlichen, kurz mit all dem, was die Produzierenden ergötzt.“
In der Tat:Das Theater der DDR unterstellte sozialen Gemeinsinn der Bürger und versuchte, sie zu „ergötzen“, ihnen Impulse für das Leben zu geben. Insofern war es - historisch einmalig und wahrscheinlich unwiederholbar - ein utopisches Theater. Im unerschütterlichen Bekenntnis zu Antifaschismus und Frieden und im tiefen Glauben an gesellschaftlichen Fortschritt entstanden vor allem in den Jahren der aufstrebenden Republik faszinierende, darunter alsbald weltberühmte Inszenierungen.
Es geschah dies trotz bornierter Enge parteipolitischer Erwartungen. Diese gipfelten in der Forderung an die Theater, mit Stücken und Aufführungen unmittelbar zur Unterstützung der jeweils jüngsten Parteibeschlüsse beizutragen. Die nach dieser Maxime entstandenen Produktionen blieben bedeutungslos. Direkte politische Eingriffe wie das Verbot von Inszenierungen, zum Beispiel das des „Schwitzbad“ von Majakowski 1959 an der Berliner Volksbühne, konnten Geburt und Entwicklung einer historisch neuen Theaterkunst nicht aufhalten.
Das Berliner Ensemble unter Bertolt Brecht und Helene Weigel war schon bald nach seiner Gründung 1949 geradezu ein Mekka des Theaters. Erinnert sei an Aufführungen wie „Mutter Courage und ihre Kinder“ (1949 und 1951) mit Helene Weigel und Ernst Busch, „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ (1949) mit Leonard Steckel und Erwin Geschonneck, „Die Mutter“ (1951) mit Helene Weigel und Ernst Busch, „Der kaukasische Kreidekreis“ (1954) mit Helene Weigel und Ernst Busch, „Leben des Galilei“ (1956) mit Ernst Busch. (Leider war ich in dieser Zeit noch Student.)
Überragende Regie-Persönlichkeiten wie Bertolt Brecht, Erich Engel und Benno Besson am Berliner Ensemble sowie Wolfgang Langhoff, Wolfgang Heinz und Karl Paryla am Deutschen Theater Berlin, Fritz Wisten an der Berliner Volksbühne und Maxim Vallentin am Maxim Gorki Theater beförderten und pflegten eine künstlerische Qualität, die international höchste Anerkennung genoss. Das Wirken dieser Künstler beflügelte junge Regisseure und Darsteller wie auch junge Schriftsteller. Dramatiker wie Peter Hacks, Volker Braun und Heiner Müller forderten ästhetisch heraus. Es entstand eine opulente sozial-realistische Bühnenkunst, die sich nicht in einem platten Naturalismus erschöpfte, sondern offen war für vielfältige Spielweisen.
Je unfähiger sich indessen die Führung der DDR erwies, die Widersprüche des neuartigen antikapitalistischen Systems zu lösen und demzufolge Verkrustungen und Verstörungen zunahmen und das Land schließlich regelrecht stagnierte, desto komplizierter wurde die Situation für das Theater. Seine Funktion, den Zuschauer zu ergötzen, kaum begriffen und noch kaum erblüht, erwies sich als utopisch und verkümmerte. Die Künstler griffen zurück auf alte erprobte Mittel, schockierten ihre Zuschauer wieder im Sinne eines kritischen, schließlich eines verstörenden Realismus. Symptomatisch dafür der Weg von Bertolt Brecht zu Heiner Müller. Zuversicht und Vertrauen bei Brecht, das Tor zu einer neuen, menschenwürdigeren Gesellschaft in Deutschland aufgestoßen zu wissen, und schließlich Wut, Ohnmacht und Verzweiflung bei Müller über das offenbare Scheitern des historisch ersten Versuchs, auf deutschem Boden eine humanistische sozialistische Gesellschaft zu errichten.
Knapp vier Jahrzehnte dieses Theaters eines wahrhaft historischen Aufbruchs hat der Autor vorliegender Publikation von 1955 bis 1990 theaterkritisch begleitet, zunächst als junger Redakteur des „SONNTAG“, dann als freier Mitarbeiter der Zeitungen „Theater der Zeit“, „Junge Welt“ und „Neues Deutschland“. Dabei hat er sich - stets auch selbst auf der Suche - mehr oder weniger glücklich an den Maßgaben Brechts orientiert und sieht keinen Grund, dies zu verleugnen. Vergnügung als nobelste Funktion des Theaters, und zwar nicht als Selbstzweck, sondern als ein Ereignis unterhaltsamen Leben-Lernens, als ästhetische Hilfe bei der Vermenschlichung der Gesellschaft wie jedes einzelnen Bürgers bleibt die Hoffnung.
Ein wenig fragwürdig allerdings lesen sich aus heutiger Sicht die in meinen Kritiken zuweilen nassforsch postulierten Bezüge zur Gesellschaft und der diesen Kritiken innewohnende unbedingte Glaube an den neuen deutschen Staat und die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Da obwaltete eine doktrinäre schwarz-weiß Mentalität insbesondere in der Beurteilung der BRD, wie sie umgekehrt heutzutage freilich auch bezüglich der untergegangenen DDR zu beobachten ist.
Wie auch immer: Unverwechselbare künstlerische Leistungen sind und bleiben historische Tatsache als Bestandteil deutscher Theatergeschichte nach der Zerschlagung des faschistischen Deutschlands. Nachkommenden dokumentarisches Material an die Hand zu geben, um ihnen eine differenzierte und lebenswahre Sicht zu ermöglichen, scheint dringend geboten.
Berlin 2014
Gerhard Ebert
„Der gute Mensch von Sezuan“
von Bertolt Brecht,
DDR-Erstaufführung am Volkstheater Rostock,
Regie Benno Besson
Der Engel der Vorstädte
Mit der DDR-Erstaufführung des Parabelstückes „Der gute Mensch von Sezuan" von Bertolt Brecht hat sich das Volkstheater Rostock in die erste Reihe der Theater unserer Republik gespielt. Noch wichtiger ist: Brechts episches Theater, das Theater der nackten Erkenntnis, hat bei einem Publikum gesiegt, das zum ersten Male die desillusionierende Theaterkunst Brechts erleben konnte; erleben freilich nicht im althergebrachten Sinne, sondern eben im Sinne des bewußten, des betrachtenden Erlebens.
Einfach ist Brechts Parabel. Shen Te, ein armes Menschenkind in der Provinz Sezuan des vorrevolutionären Chinas, eine Prostituierte aus Not, beherbergt drei Götter, die auf die Erde gekommen sind, um gute Menschen zu suchen. Weil Shen Te ein guter Mensch ist, schenken ihr die Götter tausend Silberdollar. Für das Geld kauft sich Shen Te einen kleinen Tabakladen. Bald muß sie feststellen, daß man vom „Gut sein" in einer Ausbeutergesellschaft nicht leben kann, daß man vielmehr unter die Räder kommt. Shen Te jedoch will leben. Sie verkleidet sich als Vetter Shui Ta und läßt die armen Menschen für sich arbeiten. Doch die ausgebeutete Menge meint, Shui Ta habe Shen Te, den Engel der Vorstädte, ermordet, um sich deren Eigentum anzueignen. Man bringt Shui Ta vor Gericht, und dort enthüllt Shen Te die grausame Wahrheit: Der böse Shui Ta ist Shen Te, der gute Mensch von Sezuan! Shen Te ruft die Götter um Hilfe an, aber die ziehen sich in ihr Nichts zurück.
Brecht schließt in einem Epilog mit der Aufforderung ans Publikum, überall dort die Gesellschaftsordnung zu ändern, wo — wie einst in China — ein guter Mensch böse werden muß, um leben zu können.
Benno Besson, der Gastregisseur vom Berliner Ensemble, hat in Käthe Reichel, der „Grusche" der „Kreidekreis"-Inszenierung in Frankfurt (Main), eine überragende Darstellerin der Doppelrolle Shen Te/Shui Ta gefunden. Käthe Reichels Spiel als Shen Te ist von bestrickender Herzlichkeit, Natürlichkeit und Wärme und zugleich von einer hinreißenden schauspielerischen Intensität, gar nicht verfremdet im Sinne Brechts, sondern zutiefst durchlebt. Käthe Reichel ist eine überragende Sprecherin Brechtscher Verse, sie führte die Aufführung zum Sieg, und neben ihr zu bestehen, war für ihre Mitspieler nicht leicht. Erfreulich daher, daß das Ensemble trotz der ungewohnten Aufgabe mit ihr wuchs, so daß — abgesehen von einigen sprachlichen Mängeln — von einer geschlossenen Ensembleleistung gesprochen werden muß.
Wochenpost, 28. Januar 1956
„Der Lohndrücker“
von Heiner Müller,
Uraufführung am Schauspielhaus Leipzig,
Regie Günter Schwarzlose
Neue Stücke - neue Probleme
In einer Studio-Inszenierung wurde Heiner Müllers Szenenfolge „Der Lohndrücker" nun endlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Aufführung ist eine beachtliche Ensembleleistung der Leipziger Künstler, die Müllers „Lohndrücker" (und Baierls „Feststellung") neben der normalen Probenarbeit einstudierten. Daß dabei ein echter Theaterabend zustande kam, soll hier vorweggenommen und dafür plädiert werden, beide Stücke schleunigst in den Abendspielplan aufzunehmen.
Feststand, daß die Erprobung des Stückes wichtige Aufschlüsse geben würde über die neue Dramatik, ihre Darstellung und ihre Publikumswirksamkeit. Wenn nun die Kritik herausfinden sollte, Theaterstücke wie „Der Lohndrücker", welche die Exposition des Konfliktes, seine Entwicklung, Austragung und Lösung nur in filmartig aufblendenden Szenen und Szenchen liefern, seien wegweisend für die neue Dramatik, muß sie damit rechnen, daß flinke Ästheten sehr bald eine passende Theorie zur Hand haben, vor der dann die Dramatiker sitzen wie die Kaninchen vor dem Licht. Sie muß sich das also gut überlegen.
Selbst bei den günstigen Leipziger Bühnenverhältnissen wurde offenkundig, daß dieses Stück enorme Anforderungen an die Technik stellt. (Das Bühnenbild wurde im Hinblick auf Gastspiele relativ praktisch gebaut von Harald Reichert.) Aber das interessiert erst in zweiter Linie. Wichtiger ist: Da Müller die Aussage jeder einzelnen Szene geradezu wie mit Zeitraffer und Lupe komprimiert, so daß der Inhalt seine knappe, verdichtete Form fast zu sprengen scheint, eine Qualität, die vom Darsteller wie vom Zuschauer Konzentration auf den wesentlichen Vorgang erzwingt, gibt er sozusagen nur die markanten Drehpunkte seiner Handlung. Dem jungen Regisseur Günter Schwarzlose ist es zwar gelungen, nahezu jeder Szene jene Dichte, jene drangvolle Gewichtigkeit zu verleihen, die der Text verlangt, und gleichzeitig den Handlungsbogen durchzuhalten beziehungsweise sichtbar zu machen (die Realisierung des Stückes auf der Bühne ist also möglich), aber er kann nicht verhindern, daß die zahlreichen Pausen Aufmerksamkeit absorbieren. Der Autor sollte sich auf spezifisch dramatische Gestaltungsprinzipien besinnen und die Erneuerung des Theaters nicht durch eine Art abgewandelte Filmtechnik suchen. Hier liegt eine gewisse Gefahr, die verknappende, ungestische Behandlung des Konfliktes zur Manier zu machen.
Der neue Inhalt macht das Stück schon heute zu einem theatergeschichtlichen Ereignis. Die Pionierarbeit von Karl Grünberg und Hermann-Werner Kubsch in den ersten Jahren unseres Aufbaus, ihr Vorstoß zu neuen Inhalten in der Dramatik ist nicht vergessen. Aber was damals noch nicht mehr als ein Versuch werden konnte, das ist heute, einige Jahre danach, das sozial realistische Abbild eines bestimmten Abschnittes unserer Entwicklung, aus der Erfahrung gestaltet und deshalb gültiger in seiner künstlerischen Aussage.
1948/49 in einem volkseigenen Betrieb. Balke, ein Maurer, der erkannt hat, was es heißt, für sich selbst zu schaffen, demzufolge nach neuen Normen arbeitet und mehr verdient, wird von der Belegschaft des Betriebes als Lohndrücker beschimpft. Als er mit zwei Kollegen, die er für die Arbeit gewinnen kann, kurzfristig einen Ringofen reparieren will, wird seine Arbeit sabotiert, er selbst verprügelt. Er weiß, was er will, dennoch droht er zu verzagen. Da hilft die Partei. Schließlich erkennt auch einer seiner Gegner, worumesgeht, und hilft ihm. Dieses Geschehen aus dem Jahre 1948, heute auf der Bühne betrachtet, weckt Optimismus im Zuschauer; denn der weiß, so ist es gewesen, aber so ist es nicht mehr; inzwischen gibt es viele Balkes. Und seine Gegner, die auch noch heute im Parkett sitzen, werden nachdenklich gestimmt. Wir hoffen daher, dem Stück bald auf anderen Bühnen zu begegnen.
Die Aufführung ist eine Kollektivleistung, steht jedoch im Zeichen eines Darstellers. Horst Hiemer gibt den Balke. Hiemer ist ein junger begabter Schauspieler. Vor wenigen Jahren von der Theaterhochschule zur Leipziger Bühne gekommen, spielt er jetzt zum ersten Male eine große Rolle der sozialistischen Dramatik. Und das Beglückende tritt ein: Hier trifft sich — wie zu Lessings Zeiten der bürgerliche Schauspieler mit der bürgerlichen Rolle — der neue, sozialistische Darsteller mit der neuen, sozialistischen Rolle. Da steht ein kluger, bewußter und einfacher Arbeiter auf der Bühne, beherrscht, konzentriert, nicht ohne Widersprüche. Welch besonnene Energie steckt in ihm, gepaart mit Bescheidenheit, Stolz und Kraft! Wenn er dem hochnäsig-ungläubigen Ingenieur seinen Plan zeigt, ist er fast schüchtern, aber wißbegierig zugleich und selbstbewußt.
Aus der Vielzahl der Darsteller sei noch genannt Martin Knapfel als Arbeiter Krüger, sehr treffend in der Charakterisierung eines Arbeiters, dessen Klassenverbundenheit ihn schließlich zum Handeln zwingt. Prägnante Charaktere geben auch Ivan Malré als Arbeiter Zemke, Gerd Fürstenau als Arbeiter Lerka und Günter Grabbert als Parteisekretär Schorn. Manfred Zetzsche sollte die Figur des Arbeiters Karras von vornherein um einiges widersprüchlicher anlegen, damit seine Aktion im letzten Bild, nämlich die Hilfe für Balke, glaubhafter wird.
Das Publikum, am Premierentag nach einstündiger voraufgehender Feier etwas nervös und unkonzentriert, hatte anfangs sichtlich Mühe, der knappen Handlung zu folgen. Von der eigenen Phantasie hinzusetzen zu lassen, was der Autor nicht ausspricht, ist ohnehin ungewohnt und bereitet einige Schwierigkeiten. Die Zuspitzung des Konfliktes fand schließlich das ungeteilte Interesse, und die Zustimmung am Schluß war ehrlich und klar.
SONNTAG, 6. April 1958
„Marie Hedder“
von Gerhard Fabian,
Uraufführung am Theater Greifswald,
Regie Horst Reinecke
Dramatisches Neuland
Man könnte einen Streit vom Zaune brechen über die Frage, ob es denn typisch sei, daß die Mutter zweier unehelicher Kinder nicht in eine LPG aufgenommen wird, weil sie im Dorf als Hure verschrien ist. Gewiß ist dies sozusagen ein Fall am Rande, nicht geeignet, die historischen Veränderungen auf dem Dorf in ihrer ganzen Breite zu spiegeln; aber er ist aus dem Leben gegriffen, und im Moment über seine Abseitigkeit zu diskutieren, hieße unserer Gegenwartsdramatik einen Bärendienst erweisen. Wir müssen fragen: Ist es dem Autor Gerhard Fabian gelungen, diesem Vorfall auf der Bühne dramatisches Leben einzuhauchen und ihn in solche gesellschaftlichen Zusammenhänge zu stellen, daß die Tendenz der Entwicklung auf dem Lande sichtbar wird?
Die Geschichte spielt 1954 in einem Dorf der Deutschen Demokratischen Republik. Marie Hedders Mutter ist gestorben. Marie bleibt zurück mit zwei Kindern. Allein kann sie den Hof nicht bewirtschaften. Sie will in die LPG eintreten. Aber die Genossenschaftsbauern wollen sie nicht aufnehmen, da sie eine Hure sei und der Ruf der LPG nicht geschädigt werden dürfe. Der Autor läßt keinen Zweifel darüber, daß der Vorwurf der Bauern ungerechtfertigt ist. Doch Werner Mertens, Maries ehemaliger Verlobter, der sie mit den Kindern vorfand, als er nach Gefangenschaft und Aufenthalt in Westdeutschland ins Dorf zurückkehrte, glaubte den Gerüchten und trennte sich von ihr. Fritz Ligowski, Vater des einen Kindes, ansonsten verheiratet, hat Marie Hedder erpreßt, indem er ihr Maschinen und Saatgut lieh. Er ist ihr ärgster Gegner in der Genossenschaft, denn er will sein Handeln vertuschen und Marie in die Stadt abschieben. Krischan, ein alter Bauer, versucht vergebens, die Genossenschafter zur Aufnahme der Marie Hedder zu bewegen. Auch alle seine Appelle an Mertens, ihr zu helfen, sind vergebens. Endlich kommt Mertens dahinter, daß Ligowski der Marie zwar nachstellt, aber abgewiesen wird. Das macht ihn stutzig und schließlich beginnt er einzusehen, daß er ihr gegenüber unrecht gehandelt hat. In einer klärenden Aussprache kommen sich beide wieder näher. Nun verteidigt Mertens seine Marie und drängt auf einer Versammlung Ligowski in die Enge, so daß dieser Farbe bekennt,
Die dramatische Gestaltung des Konfliktes hat eine wesentliche Qualität: Die Existenz der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft wird bereits als selbstverständlich gezeigt und der Eintritt in die LPG als erstrebenswertes Ziel. Das Publikum ist daher mit Krischan empört darüber, daß die Bauern so stur sind, Marie den Eintritt zu verweigern. So wird das Ganze keine Lektion über die Vorzüge der LPG, sondern ein Schauspiel über Widersprüche in den gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen, die sich aus den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen ergeben.
Gerhard Fabian ist begabt. Er schreibt mit viel Liebe zur Sache und mit gesunder Naivität, vielleicht ein wenig zu unbekümmert. Seine Dialoge bedürfen hier und da der straffenden, präzisierenden Bearbeitung, verraten jedoch Blick und Gefühl für dra-matische Steigerungen. Wenn man mit seinem Stück, das nach herkömmlichen drama-tischen Gesetzen gebaut ist, nicht vollauf zufrieden sein kann, dann deshalb, weil er den Konflikt nicht in seiner ganzen Widersprüchlichkeit erschöpft und vielfach über abstrakt Menschliches nicht hinauskommt. Das macht sich besonders bei der Charak-terisierung der Marie Hedder bemerkbar. Sie trägt mehr oder weniger passiv ihr Miß-geschick, rafft sich zwar zur Aussprache mit ihrem ehemaligen Verlobten auf, gibt sich im übrigen aber als die Geduldete. Warum schenkt der Autor dieser Figur nicht eine Portion trotzige, bewußte Aktivität? Das hätte nicht nur der Marie Hedder gedient, sondern dem Realismus des ganzen Stückes. Auf diese Weise hätte sich auch die Rolle der Partei im Dorf besser herausarbeiten lassen. Jetzt blieb sie zu sehr verschwommen.
Überdies schlägt sich der Autor selbst ein Schnippchen, indem er einen Schriftsteller sich in die Angelegenheit Hedder— LPG einmischen läßt. Dieser junge Mann namens Blauberg will den Konflikt nämlich auf seine Flinke-Feder-Manier lösen und kommt damit zu spät. Er kommt so spät, daß er den Schluß des Stückes verpatzt: Gerade hat sich Ligowski entlarvt, da taucht Blauberg auf und stellt selbstkritisch fest, daß er nie einen guten Roman zustande bringen werde, wenn er wie hier immer zu spät komme. Aber, lieber Gerhard Fabian, das sollte doch wohl nicht bewiesen werden! Daß der Blauberg ein Federfuchser ist, haben wir schon vorher mitbekommen. Jetzt, am Schluß des Stückes, wollen wir uns unsere Genugtuung darüber, daß der Marie Hedder Recht werden wird, nicht zerreden lassen.
Es gibt, meine ich, zwei Möglichkeiten, das Stück zu inszenieren. Das hängt davon ab, ob man das Verhalten der Bauern, so wie es sich in der Wirklichkeit zugetragen hat, ernst nimmt,oderob man die Kritik ihres Verhaltens spielt. Die letztere Art der Darstellung scheint mir die realistischere; denn sie sucht die Widersprüchlichkeit der Figuren und gibt sich nicht mit dem vordergründigen Gefühl zufrieden. Horst Reinecke, der Gastregisseur für diese Uraufführung, wählte die erste Möglichkeit. Sie gestattet der Figur der Marie kaum mehr, als Mitleid zu erregen. Erni Wilhelm gibt eine schlichte, bescheidene und einfache junge Frau, die sich in dem neuen Leben auf dem Dorf nur zaghaft zurechtfindet. Damit zeichnet sie genau das Bild der Rolle, das der Autor entwirft. Die Regie hätte es bereichern können, indem sie in der Marie einen gesunden Trotz weckt, ein Aufbegehren gegen die Verbohrtheit der Bauern. Jetzt ge-winnt man den Eindruck, als sei die ganze Aufführung kurz in sentimentale Theatralik getunkt worden, so daß einige verlorene Tropfen hängengeblieben sind, die nun vor unseren Augen vertrocknen. Diesen Eindruck vermögen auch Werner Godemann als Werner Mertens, Alwin Brosch als Krischan und Heinz-Karl Konrad als Fritz Ligowski nicht zu mindern, die ihre Figuren treffend zu charakterisieren wissen.
Dem Theater in der Universitätsstadt Greifswald gebührt Dank für die Uraufführung dieses Stückes, das mutig in dramatisches Neuland vorstößt. Wir hoffen, unsere kritischen Betrachtungen über das Werk bald an Hand weiterer Aufführungen ergänzen zu können.
Neues Deutschland, 11. April 1958
„Das Tagebuch der Anne Frank“
von Frances Goodrich und Albert Hackett,
Deutsches Theater Berlin,
Regie Emil Stöhr
Warum sind die Menschen so töricht?
Schweigend erhoben wir uns. Das Schicksal des jüdischen Mädchens Anne Frank, aufgezeichnet von Anne in ihrem Tagebuch, für die Bühne bearbeitet von Frances Goodrich und Albert Hackett, erschütterte auch die Zuschauer in den Kammerspielen des Deutschen Theaters. Viele Tausende vor ihnen — in Deutschland und in anderen Ländern — verließen die Theater ebenso ergriffen und wachgerüt-telt wie sie. Wachgerüttelt? Droht neue, ähnliche Gefahr?
Am Mittwoch, dem 3. Mai 1944, schrieb die vierzehnjährige Anne: „Warum, wofür ist überhaupt Krieg? Warum können die Menschen nicht in Frieden leben? Warum alle die Verwüstungen? Diese Fragen sind verständlich, aber eine erschöpfende Antwort hat bisher noch niemand gefunden. Ja, warum werden in England stets größere Flugzeuge, noch schwerere Bomben konstruiert und zur selben Zeit Reihenhäuser für den Wiederaufbau? Warum werden täglich Millionen für den Krieg verwendet, aber für die Heilkunde, die Künstler und auch für die Armen ist kein Pfennig verfügbar? Warum sind die Menschen so töricht?"
Seit diese Zeilen geschrieben wurden, ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen. Und in der Prinzengracht in Amsterdam, wo Anne Frank in ihrem Versteck mit dem geliebten Tagebuch Zwiesprache hielt und verzweifelt Antwort suchte auf die Fragen ihres frühreifen Herzens, dort in der Prinzengracht ist wieder das friedliche, normale Leben eingezogen. Also ist alles schon wieder Historie, würdig lediglich gedenkender Trauer? Nein! Der Tod Anne Franks und ihrer Angehörigen ist kein Einzelschicksal, das wir — zufrieden im Theatersessel sitzend — teilnahmsvoll entgegennehmen und dann vergessen wie eine beliebige Bühnentragödie. Hier sind wir aufgerufen! Und unser ergriffenes Schweigen sei Bekenntnis zur Tat. Vergessen wir nie:
Ende des Jahres 1939 lebten in Europa 9,5 Millionen Juden, bis 1945 wurden 6 Millionen von ihnen ermordet. Am 9. November 1954 wurde im Bayrischen Rundfunk folgender Kommentar gesprochen: „. . . die wegen Beihilfe zum Totschlag in Bergen-Belsen verurteilte Hertha Ehlert bekommt vom Bund Heimkehrerentschädi-gung. Ein deutsches Gericht lehnte die Rente eines rassisch Verfolgten mit der Be-gründung ab, die fettarme Kost im KZ sei seiner Gesundheit förderlich gewesen ..." Wo entschied dieses deutsche Gericht? In dem Staat, in dem 1958 — rund 14 Jahre nach jenem verzweifelten Ruf aus einsamem Versteck — ein Herr Adenauer erklärt, Westdeutschland sei das wichtigste Kriegspotential der USA, und in dem sich ein Herr Strauß ungestraft ein „Rüstungsdreieck Bonn-Rom-Paris zur Herstellung kom-mender Waffen“ wünschen kann.
„Warum sind die Menschen so töricht?" fragte damals Anne Frank. Und was fragen wir? Packt uns nicht kalter Haß gegen jene Unmenschen, die von Atomwaffen wie von Kinderspielzeug reden, die nach Atomraketen schreien, weil es in Europa „zahlreiche ungelöste territoriale Probleme" gäbe? Anne Frank ist tot. Mit ihr viele Millionen unschuldige Opfer jener, die heute in Westdeutschland offen erklären, noch immer nicht genug zu haben. Doch wir versprechen dir, Anne, unschuldiges, lebenshungriges, wissensdurstiges Menschenkind: Du sollst nicht umsonst gemordet sein! —
Es drängte den Rezensenten, diese Gedanken hier auszusprechen. Die szenische Bearbeitung des Tagebuches durch die beiden amerikanischen Autoren fordert geradezu dazu heraus; denn in ihrer Tragödie von den eingeschlossenen jüdischen Menschen haben sie vor allem den tragischen Untergang des Mädels Anne Frank sichtbar gemacht. Vom ersten kindlich-naiven und ungestümen Besitzergreifen des Versteckes durch Anne, von der Ausgelassenheit gegenüber Peter, vom Trotz gegenüber der Mutter geht ihr Weg bis zu bohrenden Fragen nach dem Sinn des Daseins und schließlich zur gar nicht mehr naiven, sondern zur bewußten Kritik an den Erwachsenen: Ihr habt versäumt, mein junges Leben zu schützen! Blitzschnell wird einem hier die brennende Aktualität bewußt.
Es handelt sich um eines der bewegendsten Nachkriegsstücke des kritischen Realismus. Durch die Figur der Anne gibt es die unmißverständliche Kritik, ohne daß es eine Lösung andeuten könnte. Die Tragik ist, daß die Lösung, nämlich die Verhinderung des Faschismus, lange Zeit vorher liegen müßte.
Gespielt werden muß also die kritische Anklage. Die Gestapo, die nicht auftritt, muß als Gegenspieler immer gegenwärtig sein, sie muß als unheilvolle Drohung jede Handlung der Eingeschlossenen mitbestimmen. Sie alle, Otto Frank, seine Frau, die beiden Daans und auch Dussel, haben sich in ihr Schicksal ergeben. Nur ein Schrei gellt auf wie das Wüten eines jungen, verwundeten Tieres — der Annes. Sie allein begreift die Tragik: Ihre Flucht aus dem Leben hätte nicht sein müssen, hätten die Menschen den Faschismus nicht zugelassen.
Regisseur Emil Stöhr versucht, die Entwicklung Annes bis zu diesem Höhepunkt zu führen, welcher zugleich der des Stückes ist. Aber die zweifellos begabte Kati Székely konnte ihm begreiflicherweise nicht folgen. Das frühreife Mädchen Anne Frank, ihr Maß an Klugheit, Nachdenklichkeit, Empfindungstiefe, ihre kühle und nüchterne Beobachtungsgabe und schließlich ihre schaurige Entschlossenheit, vermag eine Debütantin schwerlich in all ihren Widersprüchen zu geben. Kati Szé-kely spielt vor allem die liebreizende, naiv-dreiste, manchmal aufdringlich ungezo-gene Anne, sie ist aggressiv und schüchtern in ihrer zarten Liebe zu Peter. Doch wenn sie den Erwachsenen ihren aus gequältem Herzen quellenden Notschrei ent-gegen zu schleudern hätte, benimmt sie sich kaum anders als vorher, da sie über-mütig gegen Mutter oder Peter rebelliert. Sie spielt den privaten Trotz, und es sollte gerade hier die erbitterte, bewußte Anklage des jüdischen Menschen schlechthin sein.
Diese letzte, nur großen Theaterabenden eigene menschliche, zugleich gesellschaftliche Widersprüche aufreißende Tiefe war der Aufführung in den Kammerspielen versagt, die im übrigen mit Wolfgang Heinz als Otto Frank, Ursula Burg als Edith Frank, Loni Michelis als Frau van Daan, Werner Pledath als Herr van Daan und Friedrich Richter als Dussel ausgezeichnet besetzt war.
SONNTAG, Februar 1958
„Mann ist Mann“
von Bertolt Brecht,
Volkstheater Rostock,
Regie Benno Besson
Niemand tut diese Inszenierung weh?
Bertolt Brechts „Mann ist Mann" wurde im September 1926 in Darmstadt uraufgeführt. Der bürgerliche Kritiker Bernhard Diebold sah in der Formel „Mann ist Mann" eine bolschewistische Losung. Der Mann fühlte sich also getroffen. Doch Brecht selbst scheint damit noch nicht zufrieden gewesen zu sein; denn unter dem Datum vom Oktober 1926 berichtete Elisabeth Hauptmann über den Dichter: „Nach der Aufführung von ,Mann ist Mann' beschafft sich Brecht Arbeiten über den Sozialismus und Marxismus und läßt sich aufschreiben, welche Grundwerke er davon zuerst studieren soll. Aus dem Urlaub schreibt er in einem Brief kurze Zeit später: „Ich stecke acht Schuh tief im ‚Kapital'. Ich muß das jetzt genau wissen ..." Dieses Bedürfnis Brechts trifft zusammen mit den wiederauflebenden revolutionären Kämpfen der deutschen Arbeiterklasse in den Jahren 1927/28.
Was ging dem voraus? Nach dem ersten Weltkrieg und nach der Inflation war es 1925 vorübergehend zur Stabilisierung des deutschen Kapitalismus gekommen. Die revolutionäre Bewegung der Nachkriegsjahre ebbte zeitweilig ab. In den Betrieben hatte die Einführung des Fließbandverfahrens verstärkte Antreibereien zur Folge. Der Arbeiter am Band wurde zum Objekt, das beliebig ausgewechselt werden konnte: Mann wurde Mann. Die Bourgeoisie triumphierte.
Diese gesellschaftliche Entwicklung sah der junge Brecht nicht vom Standpunkt der Arbeiterklasse, von wo aus er besonders den schweren Kampf der in einigen deutschen Ländern zur Illegalität gegezwungenen KPD hätte verfolgen können, sondern vom Standpunkt des linken bürgerlichen Intellektuellen, der die Mißstände des Kapitalismus zwar entlarvte, aber nicht die Kräfte sah, die befähigt waren, die Zustände von Grund auf zu verändern. Im Gegenteil! Sein Zweifel an der Kraft des Proletariats — genährt durch die vorübergehende Ebbe in den Klassenkämpfen — fand beredten Ausdruck in der Figur eines Packers, der zum entfesselten Kleinbürger faschistischer Prägung und zum Verräter an seiner Klasse absinkt!
Brecht erfand die Parabel vom Packer Galy Gay, der einen Fisch kaufen wollte, aber von Kolonialsoldaten zum vierten Mann einer Maschinengewehrabteilung ummontiert wird, weil er nicht „nein" sagen kann. Die Formel „Mann ist Mann" ist nur der vordergründige Aufhänger für Brechts Absicht zu beweisen, daß der Kapitalismus mit einem Menschen beliebig viel macht, wenn er nicht „nein" sagt.
Natürlich genügt das „Nein" sagen nicht. Brecht schrieb dazu später selbst:„Die heutige Welt ist den heutigen Menschen nur beschreibbar, wenn sie als eine veränderliche Welt beschrieben wird." Wer aber verändern will, muß auch die Ursachen aufdecken, um Erscheinungen richtig deuten zu können. Nun hat aber nicht das Absinken einzelner Arbeiter zu Kleinbürgern oder die Verwandlung der kleinbürgerlichen Massen in wildgewordene Spießer den Faschismus verursacht, sondern das Monopolkapital, das mit den normalen Mitteln der bürgerlichen Demokratie nicht mehr regieren konnte. Deshalb appellierte es an die niedersten Instinkte im Menschen und machte große Teile des Volkes für den Krieg reif. Die Ursachen für das Verhalten des Packers Galy Gay hat Brecht nicht gezeigt.
Nachdem 1933 der Faschismus in Deutschland jede demokratische Freiheit erstickt hatte, schrieb Brecht 1936: „Die Parabel ,Mann ist Mann' kann ohne große Mühe konkretisiert werden. Die Verwandlung des Kleinbürgers Galy Gay in eine ,menschliche Kampfmaschine' kann statt in Indien in Deutschland spielen. Die Sammlung der Armee zu Kilkoa kann in den Parteitag der NSDAP zu Nürnberg verwandelt werden. Die Stelle des Elefanten Billy Humph kann ein gestohlenes, nunmehr der SA gehörendes Privatauto einnehmen. Der Einbruch kann statt in den Tempel des Herrn Wang in den Laden eines jüdischen Trödlers erfolgen." Das zeigt, wie sehr Brecht „Mann ist Mann" als ein Stück des Kampfes gegen den Faschismus gesehen haben wollte.
Was also liegt näher, als daß man diese Parabel, spielt man sie 1959, in die Kolonie Westdeutschland „verlegt"? Weder die bewußten westdeutschen noch die Arbeiter der DDR würden sich getroffen fühlen, im Gegenteil, ihr Blick würde geschärft für die verderbliche Rolle der rechten SPD-Führung, die fleißig Adenauer hilft, die westdeutschen Arbeiter zu Kolonial-Söldnern „umzumontieren". Aber vor einer solchen erregenden, parteilichen Inszenierung scheute Benno Besson in Rostock zurück. Er bemühte sich nicht einmal, dem Stück insofern gerecht zu werden, daß die Aussage Brechts vermittelt und die bestürzende Parallele zu Westdeutschland deutlich wird. Die Rostocker Inszenierung tut niemand weh. Die gesamte bürgerliche Kritik würde sie mit Lob überschütten und sich an der brillanten Form berauschen; aber Besson spielt leider nicht Brecht.
Brechts Stück „Mann ist Mann" ist eine Satire auf einige Folgeerscheinungen der bankrotten bürgerlichen Demokratie, es ist aber auf keinen Fall ein belangloser Zirkus. Das aber kam in Rostock heraus; und das Premierenpublikum war mit Recht verstimmt. Wir schätzen Benno Besson als einen verdienstvollen Regisseur des Berliner Ensembles. Umso mehr müssen wir ihm eine Warnung Brechts ins Gedächtnis rufen, die auf die Rostocker Inszenierung gemünzt sein könnte. Brecht schrieb 1955 in „Einige Irrtümer über die Spielweise des Berliner Ensembles": „Die Form einer Aufführung kann nur gut sein, wenn sie die Form ihres Inhalts ist, nur schlecht, wenn sie es nicht ist. Sonst kann dochüberhauptnichts bewiesen werden."
Benno Besson beginnt mit einer Fehlbesetzung. Heinz Schubert vom Berliner Ensemble ist ein gestisch vorzüglicher, am Brecht-Stil gewachsener Darsteller. Aber Galy Gay ist er nicht. Wenn ihn seine Frau einen Elefanten heißt, wird's komisch; wenn er ein Gewicht stemmt, wird's wieder komisch; denn er muß sich wirklich anstrengen. Damit ist äußere, formale, falsche Komik dort gesetzt, wo Brecht den Widerspruch aufdecken will, daß in einem so kräftigen, großen Mann eine solche grenzenlose, die eigene Kraft verkennende Ahnungslosigkeit steckt, daß dieser Mann nicht „nein" sagen kann, obwohl schon ein Funken Widerstand den Kolonialsöldnern Angst einjagen würde. Dadurch wird auch das Umschlagen des Galy Gay zum „Schlächter" verharmlost und die historisch bewiesene Gefährlichkeit dieser Entwicklung travestiert, also Brechts satirisches Lustspiel seines Kerns beraubt.
Bei Besson folgt ein weiterer Fehler. Anstatt daß die Söldner Uria, Jesse und Polly alle Kraft aufwenden müssen, um diesen Elefanten Gay einfangen zu können, anstatt daß sie also von der Regie klein und dürftig, aber gerade darum gefährlich und brutal gezeigt werden, wobei mit den Mitteln der Verfremdung auch das Wesen der Kolonialarmeen der Gegenwart hätte gezeigt werden können, erhebt sie Besson, setzt er sie auf Stelzen, und macht sie zu Clowns, denen das Ummontieren ein smarter Jux ist; (Gewiß, auch Brecht stellte sie 1931 auf Stelzen, aber nicht, um sie als Clowns zu zeigen, sondern als Ungeheuer. Das war richtig; denn damals drohte schon unmittelbar das Ungeheuer Faschismus.) Bei Besson drehen die Soldaten einfach ein Ding, bei Brecht pfeifen sie auf dem letzten Loch: Wenn es ihnen nicht gelingt, ihre Kampfkraft mit dem Hünen Gay aufzufrischen, ist es schlecht um sie bestellt (was ebenfalls durch die Geschichte längst bewiesen ist).
In Rostock wird das alles auf den Kopf gestellt. Kein Wunder, daß der so wichtige, den Zuschauer orientierende Zwischenspruch gestrichen wurde. Das Publikum weiß am Ende nur, daß auf der Bühne allerlei absurde Späße getrieben wurden. Mithin handelt es sich weniger um eine realistische Inszenierung, sondern eher um eine Verballhornung des Stückes.
Neues Deutschland, 22. Februar 1959
„Wallenstein-Trilogie“
von Friedrich Schiller,
Deutsches Theater Berlin,
Regie Karl Paryla
Heller Auftakt zum Schiller-Jahr
Karl Paryla stellte seine Inszenierungmitten in die Problematik unserer Tage: Deutschland ist geteilt. Reaktionäre, antinationale Cliquen haben unsere Heimat gespalten und verdienen daran. Das wahre, bessere Deutschland kämpft unter Führung der Arbeiterklasse für die Einheit der Nation. Von dieser Gegebenheit ging der Regisseur an die Bewältigung des Schillerschen Werkes heran und machte sichtbar, daß scheitern wird, wer gegen oder ohne das Volk handelt.
„Albrecht Wallenstein verfolgte in Deutschland dasselbe Ziel, das Richelieu in Frankreich gleichzeitig verfolgte: die Herstellung einer rein weltlichen Monarchie, die sich frei von allen konfessionellen Gegensätzen über die hadernden Fürsten erheben, die Klassengegen-sätze im Innern mildern und die gesamte Kraft der Nation nach außen kehren sollte." (Franz Mehring). Aber Wallenstein fand — zum Teil aus eigenem Unvermögen — nicht die Kräfte, auf die er sich bei der Verwirklichung seines Planes hätte stützen können. Sowohl prote-stantische und katholische Fürsten als auch die Städte widersetzten sich ihm. Die Armee, auf die er gebaut hatte, verließ ihn, weil sie ebenso feudal orientiert wie organisiert war. Und die Bauern, die während des deutschen Bauernkrieges gewaltige Energien entwickelt hat-ten, verachtete er und ließ sie durch die Armee ausplündern. Das ist der Kern seiner Tra-gödie.
Es zeugt vom dichterischen Genius Schillers, daß er sich für diesen gewaltigen Stoff begeisterte. Acht Jahre seines Lebens (1791 bis 1799) schrieb er an der Trilogie, in einer Zeit, da Deutschland noch immer nicht geeint war, aber die Zeichen der Revolution und schließlich die Französische Revolution auch in Deutschland den Ruf nach Freiheit und Einheit immer stärker erklingen ließen. Gerade in jenen Jahren, als der Dichter vom Jubel über die Französische Revolution bis hin zu deren Verdammung ärgste Widersprüche im Denken und Handeln durchmachte, vollendete er ein Werk, das zu einem einzigartigen künstlerischen Bekenntnis geworden ist.
Die Beschäftigung mit dem „Wallenstein" holte Schiller aus dem Reich idealistischer Vorstellungen zurück auf die Erde, zwang ihn zum Realismus, der das Wesen seines Werkes ausmachte, sich aber zugleich in stetem Widerspruch mit dem Idealismus des Dichters befand. Schiller berichtete hierüber selbst in einem Brief an Goethe vom 28. November 1796: „Was die dramatische Handlung als die Hauptsache anbetrifft, so will mir der wahrhaft undankbare und unpoetische Stoff freilich noch nicht ganz parieren;essind noch Lücken im Gange, und manches will sich gar nicht in die engen Grenzen einer Tragödienökonomie hereinbegeben... Das eigentliche Schicksal tut noch zuwenig und der eigene Fehler des Helden noch zuviel zu seinem Unglück." Schillers Anschauungen von der Tragödie gerieten also in Widerstreit mit dem Stoff. Und im Schaffensprozeß wandelten sich seine ästhetischen Ansichten. Darüber schrieb er am 21. März 1796 an W. v. Humboldt: „Wallenstein ist ein Charakter, der — als echt realistisch — nur im ganzen, aber nie im einzelnen interessieren kann... Er hat nichts Edles, er erscheint in keinem einzelnen Lebensakt groß, er hat wenig Würde und dergleichen, ich hoffe aber nichtsdestoweniger, auf rein realistischem Weg einen dramatisch großen Charakter in ihm aufzustellen... Die Aufgabe wird dadurch schwerer und folglich auch interessanter, ‚daß der eigentliche Realismus den Erfolg nötig hat, den der idealistische Charakter entbehren kann.' Unglücklicherweise aber hat Wallenstein den Erfolg gegen sich und nun erfordert es Geschicklichkeit, ihn auf der gehörigen Höhe zu erhalten. Seine Unternehmung ist moralisch schlecht, und sie verunglückt physisch... Er berechnet alles auf die Wirkung, und diese mißlingt. Er kann sich nicht, wie der Idealist, in sich selbst einhüllen und sich über die Materie erheben, sondern er will die Materie sich unterwerfen und erreicht es nicht."
Schiller gibt mit der kritischen Selbsteinschätzung wichtige Hinweise für die Regie. Paryla hat sie beachtet. Und er ist dem Dichter werkgetreu auch dort gefolgt, wo er sein neu gefundenes Prinzip durchbricht und — höherem Zwecke dienend — die fehlende Idealität doch noch einschmuggelt. Auch darüber berichtet der Dichter: „Ich bin seit gestern endlich an den poetisch wichtigsten, bis jetzt immer aufgesparten Teil des Wallenstein gegangen, der der Liebe gewidmet und sich seiner frei menschlichen Natur nach von dem geschäftigen Wesen der übrigen Staatsaktion völlig trennt, ja demselben, dem Geist nach, entgegensetzt." (Brief an Goethe vom 9. November 1798). Schiller hat sich also nicht ganz und gar davon lösen wollen, die „fehlende Wahrheit durch schöne Idealität" zu ersetzen — und er hat aus dem ihm offenbar gewordenen Widerspruch eine poetische Tugend gemacht. Ihm reichte die historische Wahrheit nicht aus; denn die heißt: Wallenstein scheitert. Schillers Dichterherz konnte also nicht Wallenstein gehören. Es gehörte Max Piccolomini: „Den Hauptcharak-ter sowie die meisten Nebencharaktere traktiere ich wirklich bis jetzt mit der reinen Liebe des Künstlers; bloß für den nächsten nach dem Hauptcharakter, den jungen Piccolomini, bin ich durch meine eigene Zuneigung interessiert..." (Brief an Goethe, 28. November 1796). Und dieser Figur legte er jene herrlichen Verse in den Mund, die in unvergleichlichem, ergreifendem Pathos von der tiefen Sehnsucht des Dichters und der Nation künden: „O schöner Tag, wenn endlich der Soldat / Ins Leben heimkehrt in die Menschlichkeit..." und „...Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf, /Woher soll Friede kommen?“
Uns schienesnotwendig, den Dichter so ausführlich zu seinem Werke sprechen zu lassen, weil er selbst am besten charakterisiert, welch tiefe Widersprüchlichkeit die Trilogie durchzieht und welch gewaltige Aufgabe der Regie zufällt, trotz all dieser Widersprüche die grandiose Einheit sichtbar zu machen.
In Wolfgang Heinz als Wallenstein stand Paryla ein Schauspieler zur Verfügung, der in wohl einmaliger schauspielerischer Vollendung den widersprüchlichen Charakter der Figur ausdeutete, keinen ihrer Gegensätze unterschlug und doch ihre Einheit wahrte. Bevor Heinz' Wallenstein die Bühne betritt, wird seinepolitisch-militärische Situation durch das „Lager" genau umrissen. Paryla gliedert, ohne die Turbulenz zu vernachlässigen, klar die einzelnen Gruppen der Soldaten. Und ihre Stellung wird sichtbar im Verhalten zu dem armen,ausgeplünderten Bauern. Im Geiste des Dichters stellt Paryla diese Figur in den Vordergrund, um zu zeigen, daß eine Armee, die nicht dem Volke verpflichtet, sondern einer Einzelpersönlich-keit verschworen ist, von keinen hohen Idealen beseelt sein kann, wenn der einzelne eigen-süchtige Ziele verfolgt. Die ganze Verworfenheit dieses Söldnerhaufens fasst der Regisseur zum Schluß in dem bekannten Reiterlied zusammen, das sich im Tempo immer mehr stei-gernd bis zur Ekstase, schließlich zum furiosen Auftakt der Tragödie wird. Dasselbe Lied läßt Paryla später die Pappenheimer noch einmal singen — jedoch in Moll gesetzt —, als es zum Sterben geht. Das ist die Kehrseite der gleichen Medaille. Ein genialer Regieeinfall, der die Katastrophe der Söldner und ihres Feldherrn sichtbar macht.
Zunächst sehen wir Wallenstein im Gespräch mit der Gattin, forschend, wägend, etwas müde. Kraftvoll, machtbewußt tritt er sodann in die Verhandlung mit Questenberg und setzt den kaiserlichen Forderungen seine eigenen entgegen. Damit zwingt er sich selbst, nun seinen Plänen zu folgen. Aber noch schreckt er vor der Aktion zurück. Heinz motiviert dieses Zögern nicht mit dem Sternenglauben Wallensteins. Sein Friedländer ringt zutiefst mit der Frage, ob seine Gedanken historische Berechtigung haben. Er läßt sich zwar mit einem typisch feudalen Trick die Stimmen seiner Generale holen, aber erst das Handeln des Kaisers treibt auch ihn zu Entscheidungen. Bevor er mit den Schweden paktiert, um sie seinen Interessen dienstbar zu machen, durchforscht er noch einmal seine Gedanken: Nicht die Macht des Kaisers fürchtet er, sondern das Gestrige, die Gewohnheit. „Sei im Besitze, und du wohnst im Recht", spricht Heinz' Wallenstein bereits mit Zuversicht, als einer, der gewonnene Erkenntnis nutzen will. Aber Wallenstein hat dem Gestrigen nichts Neues entgegenzusetzen, er verficht sein Anliegen mit gestrigen, mit feudalen Mitteln.
Noch einmal betont Heinz den tiefen Konflikt des Friedländers, den er nicht zu lösen vermochte. Erneut grübelnd, mit sich uneins, schon verzagend, aber doch bestimmt und gültig sagt er zum Bürgermeister von Eger: „Die Erfüllung der Zeiten ist gekommen, Bürgermeister, / Die Hohen werden fallen, und die Niedrigen / Erheben sich." Aber die Erkenntnis kommt für Wallenstein zu spät. Sie bleibt als mahnende Verpflichtung des Dichtersfürdie Nachwelt.
Wallensteins Gegenspieler ist Octavio Piccolomini als Vertreter des Kaisers, ist das Gestrige auch in Gestalt der feudalen Hausinteressen der Gräfin Terzky, sind schließlich die vollkommen in feudaler Denkungsart verharrenden Generale. Während Heinz den Wallenstein im Sinne Schillers konsequent realistisch durchhält, ihn weder „edel" noch „groß" spielt, ihn in der harten Auseinandersetzung mit seinen Gegnern und im Ringen um Klarheit ganz weltnah gibt, leuchtet bei den Gegenspielern — gewiß in Übereinstimmung mit Schiller — ein wenig „Idealisierung" auf. Und zwar Idealisierung in dem Sinne, daß die Figuren eben doch vorwiegend der „Tragödienökonomie" zu dienen haben. Paryla ist dabei der Gefahr nicht entgangen, daß dem unvoreingenommenen Zuschauer die Partei des Kaisers über weite Strecken im Recht zu sein scheint. Zumal Wolfgang Langhoff den Octavio mit trockener, ziel- und selbstbewußter Selbstverständlichkeit gibt. Er ist kein Intrigant, aber ihm fehlt die fein nuancierte Distanz zur Figur, die zum Beispiel Friedrich Richter in der Darstellung des Questenberg gefunden hat. Der schöne Theatertod der Gräfin Terzky schließlich setzt noch im letzten Moment Akzente, welche der Partei der Gestrigen unverdient schmeicheln. Hortense Raky weiß ansonsten ihre Gräfin mimisch und sprachlich hervorragend zu differenzieren.
Bleibt noch die Partei der Liebenden, die aus den Widersprüchen ihrer Zeit keinen Ausweg finden. Ihr Opfer ist gleichzeitig Ausdruck für Größe und Tragik des Dichters Friedrich Schiller. In dem Moment, da sich die Pappenheimer von dem vermeintlichen Verräter Wallenstein abwenden, setzt sich Max Piccolomini — getrieben von der Verzweiflung über die deutschen Zustände, das Bild eines friedlichen Deutschland in der Brust — an ihre Spitze und führt sie in den Tod. Auch für diese Figur hatte Paryla einen großartigen Schauspieler: Horst Drinda. Sein kraftvoll-natürliches Pathos, seine reine, klare Seele, die sich der Zunge mühelos mitteilt, seine erschütternde Verzweiflung, die sich in mitreißendem Aufruf Luft macht, bestimmen mit das Erlebnis dieses großartigen Theaterabends.
Neues Deutschland, 5. April 1959
„Das Schwitzbad“
von Wladimir Majakowski,
Volksbühne Berlin,
Regie Nikolai Petrow
In unbändigem Haß auf die Bürokratien allen Spielarten schrieb 1929 ein genialer Feuerkopf, Wladimir Majakowski, ein aggressives Spektakel, „Das Schwitzbad". Dabei spritzte ihm die Tinte nach allen Seiten. Selbst Unschuldige gerieten in Gefahr, eins abzubekommen. Aber das kümmerte ihn nicht. Um die Karrieristen bloßzustellen, die sich nach dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution im Partei- und im Staatsapparat auf verderbliche, die sozialistische Entwicklung hemmende Weise breit machten, entwarf der Dichter Prototypen dieser Mißgeburten der Sowjetgesellschaft. Und weil er nicht nur einen bestimmtem Bürokraten zur Strecke bringen wollte, sondern auf einen Ritt die ganze Clique, bediente er sich der Groteske. Popedonossikow, der Vorsitzende eines imaginären Koordinierungsausschusses, und sein Sekretär Optimistenko, die beide eine epochemachende Erfindung — die Zeitmaschine — sabotieren, stellen mithin die personifizierte Bürokratie dar, die zu Charakteren verdichtete „Tendenz Schmarotzertum". Eine für die Bühne zurechtgeknetete Tendenz verträgt nun allerdings keinen realen Gegenspieler, etwa einen Funktionär der Partei, sie kann nur mit ebenso übersteigerten theatralischen Mitteln geschlagen werden: hier durch die Zeitmaschine.
Gewiß hätte Majakowski die Bürokraten auch entlarven können, indem er sie nicht durch die Parteiüberprüfung hätte kommen lassen. Womit zweifellos die große Kraft der Partei, ihre Volksverbundenheit und Weisheit besser, weil unmittelbarer zum Ausdruck gekommen wäre als jetzt, da die Gruppe um Popedonossikow erst von der zum Kommunismus eilenden Zeit ausgespieen wird. Aber dann hätte Majakowski ein anderes Stück schreiben müssen.
Der Effekt dieses Dramas mit Zirkus und Feuerwerk besteht den Worten des Dichters zufolge gerade darin, daß es nicht nur—als politisches Stück — radikal gegen Bürokratismus und Engstirnigkeit und für sozialistische Perspektiven kämpft, sondern — als Theaterstück — ebenso radikal gegen Kammerkunst und Mißbrauch von Psychologie. Das aber ist eine Absicht, die sich dem deutschen Zuschauer nicht ohne weiteres erschließt. Er hört und sieht ein Stück, das sich über gewisse ästhetische Regeln hinwegsetzt und bedenkenlos mischt, was von Haus aus nicht unbedingt zusammenpaßt. Satire, Groteske, Kabarett, Zauberei, phantastische Übertreibung, psychologische Folgerichtigkeit, Komik, Tragik — alles ist recht, wenn es der Aussage dient. Diese Form entstand also aus dem Kampf gegen ästhetisierende und proletkultistische Einflüsse in der Kunst, die Majakowski zerschlagen wollte. Es besteht kein Grund anzunehmen, daß der Dichter auch späterhin ein solches Stil-Konglomerat gepflegt hätte. An dieser Stelle entspricht es allerdings genau dem Inhalt.
Damit sind wir bei den besonderen Schwierigkeiten für eine Inszenierung in der Deutschen Demokratischen Republik.
Eine Erscheinung der Gesellschaft, die Bürokratie, wird abstrakt personifiziert und durch eine abstrakt-utopische Erscheinung, die Zeitmaschine, ad absurdum geführt. Auf der Bühne bedarf auch das einer gewissen konkreten Gestaltung. Dies wissend, projizierte Majakowski seine theatralische Konstruktion in die Sowjetgesellschaft zurück. Es entstanden der imaginäre Koordinierungsausschuß und psychologisch mehr oder weniger echt gezeichnete Figuren. Das führte zwangsläufig zu Unebenheiten. Den sowjetischen Zuschauer, der die historische Situation kennt, in der das Werk entstand, stört das natürlich kaum. Der deutsche Zuschauer, derlei Theater ohnehin nicht gewöhnt, findet sich nur schwer zurecht. Die Regie sollte daher eliminieren, was für deutsche Verhältnisse nicht zutrifft und vom Wesentlichen ablenkt. So könnte auf zahlreiche, heute unwirksame Repliken — zum Beispiel von Iwan Iwanowitsch oder von Momentalnikow — zugunsten eines zügigeren Ablaufs verzichtet werden. Professor Nikolai Petrow, der Gastregisseur aus Moskau, wohl der einzige kompetente Interpret von Majakowskis „Schwitzbad", war in dieser Hinsicht wohl von seinen deutschen Kollegen nicht immer bestens beraten.
„Das Schwitzbad" stellte für diese erste Gastregie ein ebenso reizvolles wie schwieriges Werk dar. Und Petrows Absicht war richtig, die Konzeption seiner Moskauer Aufführung grundsätzlich beizubehalten, nämlich Bürokratismus, Karrierismus und dogmatische Engstirnigkeit angesichts des stürmischen Vorwärtsschreitens der sozialistischen Gesellschaft tödlich zu treffen, und dies vor allem auch durch den unbesiegbaren Optimismus des Genossen Welossipedkin. Die Konzeption entspricht genau dem Anliegen des Autors und wurde vom Regisseur, wenn man alle Schwierigkeiten recht bedenkt, in der Volksbühne nahezu vollendet umgesetzt. Nahezu deshalb, weil einige Momente einer noch mitreißenderen Aufführung im Wege stehen. Hier hat Professor Petrow offenbar aus Freundlichkeit seinen deutschen Kollegen nicht genügend widersprochen. Zum Beispiel dem Bühnenbildner.
Roman Weyl, einer der Talentiertesten seines Faches in Deutschland, der — um Peter Edels Gedanken zu wiederholen — längst einen Preis verdient hätte, Roman Weyl hat seine Konzeption in einem Punkt nicht genügend durchdacht. Er baut eine wahrhaft phantastische Zeitmaschine. Und er trifft mit dem zweiten Bild, dem Wartezimmer Optimistenkos, hervorragend den Sinngehalt der Szenen, die sich in diesem Raum abzuspielen haben. Da gibt es nichts Verstaubtes, kein überflüssiges Gerümpel, keineKopierung eines bestimmten Einrichtungsstils; allein mit dem eingeknickten Schreibtisch, mit den drei großen, bis zur Decke reichenden Aktenstapeln und dem überdimensionalen Federhalter — alles auf ein großes Bürobuch gesetzt — schafft er eine Bürokratenstube, die für eine deutsche Inszenierung haargenau stimmt und wegen ihrer satirischen „Selbstentlarvung" berechtigtes Entzücken hervorruft. Nicht so beim Arbeitsraum Popedonossikows.
Den Popedonossikow läßt Majakowski im fünften Akt sagen, er verwalte einen wahrhaft sozialistischen Winkel. In der Tat, dieser engstirnige, dumme Beamte verwaltet nur einen Winkel! Er ist ein hohler Bürokrat, der sich aufblasen muß, um Macht vortäuschen zu können, der Macht gewonnen hat, weil er sich aufblies, der aber nur eine Stenotypistin zuerkannt bekam und im übrigen sich nicht einmal selbst Fahrkarten bewilligen kann. Dieser Mann hat seinen Amtsapparat über seine realen Machtbefugnisse hinaus aufgebläht. Wenn er nun aber von Roman Weyl in ein komfortables, seiner wahren Situation widersprechendes, einem bourgeoisen Generaldirektor anstehendes Etablissement gesetzt wird, verliert er an innerer Dialektik. Und dem Darsteller wird erschwert, ihn mimisch zu erledigen, die Karikatur realistisch genau anzusetzen. Die Figur nimmt zwangsläufig einen etwas modifizierten Charakter an. Sie geriet in diesem Fall um einige Grade zu intellektuell. Und die Borniertheit zum Beispiel, mit der Kutscheras Popedonossikow mit dem Bildnis von Karl Marx korrespondiert — übrigens großartig gemacht —, paßt schon nicht mehr ganz zu diesem nunmehr zu durchtriebenen Schmarotzer. Ein Merkmal für die unrealistische Lösung des Bildes ist der Mechanismus des Stuhles, der je nach der Situation „besetzt" oder „frei" anzeigt. Das ist nichts anderes als ein Mätzchen, das die Unklarheit des Bühnenbildners signalisiert.
Professor Petrow verdanken wir die Bekanntschaft mit dem Theaterdichter Majakowski. Petrow erweist sich als ein feinsinniger, dezenter, äußerst exakter, pointensicherer, realistisch empfindender Regisseur, der derart in die Szene, in die Gestaltung des Dialogs verliebt ist, daß er zuweilen den Verlauf des Ganzen etwas aus dem Auge verliert. Er hat keinem Darsteller etwas aufgezwungen, er hat sie fast alle wunderbar gelöst, zu sich selbst und zur Rolle geführt. Franz Kutschera zerfetzt die Gefühle nicht, er hält sie unter Kontrolle, sie spielen nicht mit ihm, sondern er mit ihnen. Kritisch schmeckt er jeden Satz gleichsam ab nach dessen enthüllenden Gehalt und setzt ihn prall und saftig in den Raum, auf daß ihn jeder ebenso kritisch konsumieren kann. Ein Augen- und Ohrenschmaus der ganze Schauspieler! Herbert Grünbaum sodann, dieser liebenswürdige, warme, herzliche, ein wenig raunzende Darsteller, gibt einen Optimistenko, daß man an derFigur seine helle Freude hat und doch nie vergißt, sich von ihr zu distanzieren. Einzigartig, wie er am Schreibtisch selig-vergnügt vor sich hin präludiert und sich seines Daseins freut, wie er wieselflink die Treppen hinauf- und hinabwetzt und schließlich wacker an der Frau der Zukunft vorbeidefiliert. Das ist große Schauspielkunst, geweckt von einem großen Regisseur. Kaum minder sauber und vital agieren Rolf Ludwig als Welossipedkin, Otto Tausig als Erfinder Tschudakow, Edwin Marian als Arbeiter Foskin und Hannelore Schüler als Stenotypistin Underton. Sie vollbringt — wie man zu sagen pflegt — ein Kabinettstückchen. In weiteren Rollen Marianne Wünscher, Gerry Wolf, Hans-Joachim Hanisch, Ursula Braun und Heinz-Werner Pätzold.
Christine Laszar, neu auf dieser Bühne, findet als phosphoreszierende Frau, als Abgesandte aus dem Kommunismus, weder gestisch noch sprachlich jene überzeugende Kraft, die gerade von dieser Frau ausgehen müßte. Sie kommt eher geradenwegs vom Mond, der allerdings in diesem Falle selbst im Jahre 2030 noch nicht von sozialistischen Menschen betreten wurde. Ihr fehlt das Selbstbewusstsein eines Vertreters des siegreichen Kommunismus, die Lebensklugheit eines Menschen aus dem Jahre 2030, der unerschütterliche Glaube an die Kraft der Arbeiterklasse. Das alles ohne falsches Pathos darzustellen, ist zweifellos schwer. Aber ganz ohne Pathos geht es auch nicht. Von der großartigsten Sache der Welt — der Erstürmung des Kommunismus in bestürzend kurzer, in rasender Zeit — wie von einer verlockend-ungewöhnlichen Ferienreise zu sprechen, nimmt dem Stück viel von seinem revolutionären Elan und seinem grenzenlosen Optimismus. Fehlbesetzung also einer gewiß begabten Darstellerin.
Die Gastregie hat das offensichtlich gespürt und einen Ausgleich gesucht. Der Dokumentarfilm aber war das nicht. Dokumentarische Filmszenen, in ein Theaterstück eingeblendet, in dem sie nicht von vornherein dramaturgisch vorgesehen sind, ergeben in den meisten Fällen einen Stilbruch. Bilder von Franco, von Hitler, von sengenden und brennenden faschistischen Truppen können manchen Zuschauer an dieser Stelle verwirren. Selbst mit dem Sputnikhund werden zum Teil Assoziationen geweckt, die mit dem Stück gar nichts zu tun haben. Und die letzte, diese entscheidende, grandiose Szene hängt dann regelrecht in der Luft, obwohl sie noch einmal die große Regiekunst Petrows offenbart. Ich werde nie vergessen, wie die Madame Messallianssowa konsterniert im All herumhumpelt, dem Popedonossikow schließlich eine letzte moralische Ohrfeige versetzt und wie dieser dann endgültig zusammenbricht.
Trotz unserer kritischen Einwände: Wir sahen eine für die deutsche Bühne außergewöhnliche Aufführung, die — unterstützt durch Hanns Eislers die Mentalität des Stückes köstlich kommentierende Musik und Ernst Buschs mitreißende Gesangskunst — die Gemüter noch lange bewegen wird. Und wer sich von Majakowski getroffen fühlt, sollte über sich ein bißchen selbstkritisch nachdenken. Vielleicht verordnet er sich dann „Das Schwitzbad" ein zweites Mal.
SONNTAG, vorgesehen für Nr. 7/1959, bereits auf der Seite, aber kurz vor Druckbeginn noch eliminiert und also bisher nicht veröffentlicht. Die Inszenierung wurde nach der Premiere verboten.
„Professor Mamlock“
von Friedrich Wolf,
Deutsches Theater Berlin,
Regie: Wolfgang Heinz und Wolf-Dieter Panse
Diener der Wahrheit
Das Deutsche Theater Berlin setzte „Professor Mamlock" auf den Spielplan. Bei uns hat der Faschismus seit 1945 keine Basis mehr. Die Aufführung greift also nicht unmittelbar — wie es in Westdeutschland der Fall wäre — in den tagespolitischen Kampf ein, ist aber dennoch auch für uns wesentlich als Bekenntnis und Mahnung. Die Jugend, die den Faschismus und seine Menschenfeindlichkeit nicht bewußt erlebt oder kaum in Erinnerung hat, sieht anschaulich und drastisch, wohin Duldsamkeit und Vertrauensseligkeit gegenüber den Nazis führen. Die Erwachsenen aber werden durch das Schicksal Mamlocks zur Wachsamkeit gerufen; denn sie kennen nur zu gut, was in Westdeutschland wieder zur Macht drängt.
Friedrich Wolf schrieb die Tragödie des deutschen jüdischen Intellektuellen, der seinen Beruf über alles liebte, als Arzt Großes leistete, aber politisch völlig versagte. Es ist die Tragödie jener Menschen, die 1933 glaubten, wenn sie sich nicht um Politik kümmern, werde sich die Politik auch nicht um sie kümmern. Mamlock schlägt die Warnungen seines Sohnes Rolf in den Wind, lieber weist er ihn aus der Wohnung, als daß er dem jungen Mitglied einer roten Studentengruppe Glauben schenkt. Die politische Naivität des Vaters rächt sich bitter. Mamlock wird von den Faschisten verhöhnt, angepöbelt und aus seiner Klinik getrieben. Sein Glaube an die Gerechtigkeit des bourgeoisen Staates und an die Unantastbarkeit der „Verfassung" bricht zusammen. Zu spät.
Den Mamlock gibt Wolfgang Heinz, einen geradezu hysterisch selbstbewußten Arzt, der seine politische Instinktlosigkeit ebenso energisch verteidigt wie sein Berufsethos. Man kann nicht Mitleid haben mit diesem Mamlock. Das ist gut so. Hier zeigen Heinz und Wolf-Dieter Panse, der junge Regisseur, Konsequenz. Die Inszenierung ist zuweilen laut, wo sie betonter, umständlich, wo sie bestimmter hätte sein können. Ulrich Thein spielt einen intelligenten, sehr gut erfaßten Jungkommunisten, Otto Mellies den bedachten, zielbewußten Sohn Rolf und Karola Ebeling genau die eben dem Kindesalter entwachsene Tochter Ruth. In weiteren Rollen Ursula Burg, Felicitas Ritsch, Waldemar Schütz, Walter Lendrich und Werner Pledath.
SONNTAG, 31. Januar 1960
„Kredit bei Nibelungen“
von Fritz Kühn,
Städtische Theater Karl-Marx-Stadt,
Regie: Wolfgang Keymer
„Kredit bei Nibelungen“
nennt Fritz Kühn seinzweites dramatischesWerk, das in Potsdamund in Karl-Marx-Stadt uraufgeführt wurde. Eshandelt sich — lautAutor — um eine tragische Komödie. In dem Stück ist nichts tragisch.Weder großen noch kleinen bürgerlichen Gaunern vermögen wir inSachen Tragödie ästhetischen Kredit einzuräumen. Aber streiten wiruns nicht über dasGenre. Kühn hat denSatiren auf bourgeoiseKorruption im allgemeinen und westdeutsche faschistisch-militaristische Restauration imBesonderen eine treffliche hinzugefügt. Erhatte einen Einfall! Erläßt dem stellungslosenFotografen Block einfallen, aus der Mär,Hitler komme demnächst ins großdeutscheBundesreich zurück, Kapital zu schlagen. Block findet in Amelia Gruber eine ebenfalls geldbedürftige, obendrein solid gebaute Komplizin, die den stramm-gläubigen alten Nazis Hunderter und Tausender aus den prallen Taschen lockt. Geheimrat Justus Wülfing allerdings durchschautden Schwindel. Jedoch: Er schlägt aus dem Betrug auf seineWeise Kapital. Block wird eingesperrt, doch der von ihm organisierte Nibelungen-Kreis beginnt unter Wülfings Leitung zu arbeiten, zwar nicht in Erwartung des „Führers", aber in dessemGeiste.
Kühn benutzt seinen theatralischen Einfall also, um den Nachweis zu führen, daß sich der Faschismus in Westdeutschland völlig legal neu konstituiert. Das istdenn freilich von bestürzender Aktualität. Fernab ästhetischer Erwägungen wird klar: Es wäreeine Tragödie für das deutsche Volk, gelänge es nicht, denFaschisten und Militaristen das schmutzige Handwerk zu legen.Das Stück Kühns ist noch aus anderem Grunde wertvoll. Eszählt zu den wichtigsten zeitgenössischen dramatischen Werkendieser Spielzeit. Kühn ist talentiert. Seine Dialoge fordern dieGesteheraus, sie sind knapp, gut durchdacht und von geistiger Spannkraft. Die Szene zwischen dem Juden Fisch und dem geschäftstüchtigen Nazi Schönfelder zum Beispiel ist dramaturgisch meisterhaft gestaltet. In Karl-Marx-Stadt, wo ichdasStück sah, war deutlich zu spüren, daß sich das ganze Ensemble für dieses Werk entschieden hatte. Unter der Regie von Wolfgang Keymerwurde vorzüglich gespielt. Ein wenig mehr gestische Präzisionbeim Profilieren der Figuren, ein wenig mehr kritische Schärfe, und die Aufführung würde sogar Glanz bekommen. Den kleinen Gauner Block gibt Wolfgang Sasse, die Komplizin Amelia unausgeglichen Christine Schwarze und den großen Gauner WülfingPeter Harzheim. In vortrefflicher Studie Julius Klee als DavidFisch.Dem Stück sind viele Inszenierungen zu wünschen.
SONNTAG, 28. Februar 1960
„Die Räuber“
von Friedrich Schiller,
Maxim Gorki Theater Berlin,
Regie: Maxim Vallentin und Hans Dieter Mäde
Schillers „Räuber“
Maxim Vallentin und Hans Dieter Mäde haben im Berliner MaximGorki Theater„Die Räuber" neu inszeniert. Das Publikum wird aufgerüttelt vom Ruf nach der Republik und kostet bis zur Neige aus das Scheitern des „hochherzigen Jünglings" Karl; es wird abgestoßen vom Ruf nach Unterdrückung und verfolgt erregt das Ende des zynischen Menschenverächters Franz.
Jedoch: Das Haus setzt der Aufführung eigenwillige Grenzen. Diese Bühne kann den Blick nicht freigeben auf die Böhmischen Wälder. Ein kümmerlicher, stilisierter Baum vor tristem Hintergrund ersetzt nicht, was zur Urwüchsigkeit der „Räuber"-Szene gehört. Die Räuber brauchen Raum für ihre Aktionen. Hier ist er nicht. So können die Regisseure ihre Konzeption nicht ausleben. Wider Willen werden sie in die Defensive gedrängt. Diese Kammerspielbühne ist adäquat allein für die Szenen im Schloß. Und jener Streit zwischen Amalia und Franz, den Amalia mit der Vertreibung Franzens beendet, ist dann auch auffallend dicht. Filigranarbeit.
Sabine Krug gibt der Amalia edle Substanz, aufgeklärten Geist und eine reine Seele. Eine geschlossene Darstellung. Helmut Müller-Lankows Franz ist eher ein rustikaler Bastard, denn ein aristokratischer Nachkomme des alten Moor. Müller-Lankow agiert ohne Kulissen-Verschlagenheit, aber zuweilen mit aufdringlicher Lautstärke. Wenn er schreit, verliert er an Ausdruck. Ein Aristokrat ist der Karl Moor Albert Hetterles. Er ist kein Schauspieler der Explosivität. Sein Karl wird von den Ereignissen mehr gedrängt, als daß er sie mit vorantreibt; er gibt einen Karl des späten, nicht des Schillers der Karlsschule. Aber das liegt auch an der Regie, die in dem Streben nach literaturhistorischer Gültigkeit die Schillersche Urwüchsigkeit, das frische Pathos rebellischen Anspruchs und Aufbruchs um Nuancen aus dem Auge verloren hat.
In den weiteren Rollen fällt Walter Jupe als Spiegelberg auf. Dieser kleine Existenzphilosoph mit Angst in den Hosen und Unsinn auf der Zunge intrigiert sich durch die Szene, daß seine modernen Nachkommen noch was lernen könnten. Jochen Thomas als Schweizer ist wieder einmal ein braver, treuherziger Kerl ohne Tadel, seine Affekte freilich bleiben hausbacken gewollt, ohne volkstümliches, ursprüngliches und mitreißendes Temperament; Willi Narloch spielt den Pater mit ernster, gemessener Manier; Kurt Steingraf gibt den Maximilian anfangs so rüstig, daß Franz offenbar auch hinter der Szene tätig ist, um seinen Vater dann doch noch schön mürbe zu kriegen.
SONNTAG, 31. Juli 1960
„Die Holländerbraut“
von Erwin Strittmatter,
Uraufführung des Deutschen Theaters im Berliner Ensemble,
Regie: Benno Besson
„Die Holländerbraut“
Diese Premiere des Deutschen Theaters im Berliner Ensemble haben wir nachdenklich verlassen. In die Freude über das neue Werk Strittmatters mischten sich Überlegungen ästhetischer Art. Das Bild, das uns der Dichter entwirft, ist wahr. Gutsarbeiter und Tagelöhner nehmen 1945 ihre Geschicke in die eigenen Hände. Sie errichten Neubauernhöfe aus Lehm und führen den Klassenkampf gegen Großbauern und Unternehmer. Am Tage arbeiten sie, in der Nacht studieren sie. Der Kampf ist schwer, aber siegreich. Denn es gibt die Partei, die Partei der Arbeiterklasse. Und die Genossen, eben aus dem KZ entlassen, stehen ihren Mann. Strittmatter gibt wie in „Katzgraben" einen Querschnitt durch die sozialen Schichten des Dorfes. Er stellt uns die unterschiedlichsten Charaktere vor, plastisch und rund wie in seinen Romanen. Da treibt die Idiotin Schnurfarski ihr Unwesen, da kommt die alte Feimer, das Kräuterweib, mit der Zeit nicht mehr zurecht, da künden Kinder den neuen Tag an. Leben in Hülle und Fülle. Dennoch kann das Stück nicht restlos überzeugen.
Wir wissen, das dramatische Gebiet, das wir betreten, ist Neuland, ist nicht mit Verkehrszeichen versehen. Unser Kompaß, die marxistische Ästhetik, gibt die Richtung an. Aber Sackgassen sind nicht markiert, Hauptstraßen nicht gekennzeichnet. Einzelne können irren. Prüfen wir jeden Schritt. Nur gemeinsam kommen wir voran. Beträchtlichen Boden haben wir gewonnen mit Sakowskis „Die Entscheidung der Lene Mattke". Weiter gekommen sind wir durch die Autoren Hauser, Zinner, Baierl, Hacks, Müller, Richter, Heller/Gruchmann-Reuter, Pfeiffer. Nun Erwin Strittmatter. Sein Stück ist ein mutiger Versuch. Er stößt uns mitten hinein in die Diskussion um unsere neue sozialistische Dramatik.