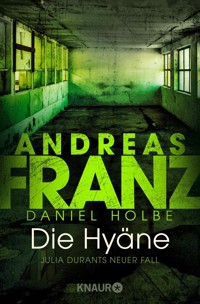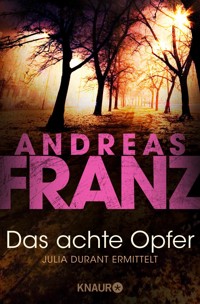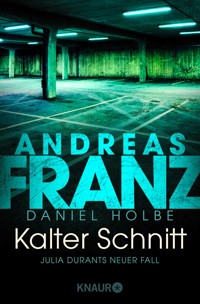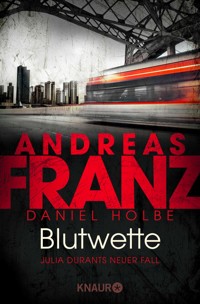Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Julia Durant ermittelt
- Sprache: Deutsch
Von einem Tag auf den anderen verschwindet der Autohändler Rolf Lura spurlos. Keiner kann sich erklären, was mit ihm passiert ist – auch nicht seine Frau. Ein Fall für Julia Durant? Die Frankfurter Kommissarin und ihr Team vermuten ein Verbrechen, vor allem als sich herausstellt, dass Rolfs Frau schon seit längerem ein Verhältnis mit seinem besten Freund Werner Becker hatte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch dann verschwindet plötzlich auch Becker ... Das Verlies von Andreas Franz: Spannung pur im eBook!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Franz
Das Verlies
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Rolf Lura, ein erfolgreicher Autohändler, ist verschwunden. Seine Frau kann sich nicht erklären, was passiert sein könnte. Alle Spuren führen zunächst ins Nichts.Julia Durant und ihr Team stehen vor einem Rätsel, doch dann finden sie heraus, dass Luras Frau ein Verhältnis mit seinem besten Freund Werner Becker gehabt hat und dass Rolf Lura ein echter Tyrann gewesen sein muss. Haben Becker und seine Geliebte den unliebsamen Ehemann umgebracht? Gerade als sich dieser Verdacht zu bestätigen scheint, verschwindet auch Werner Becker spurlos, und die Kriminalisten um Julia Durant müssen ganz von vorne anfangen.Sie stoßen auf eine erschütternde Familientragödie …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Epilog
Dieses Buch ist all jenen Menschen gewidmet, die das Leben meistern, ohne psychische und physische Gewalt anzuwenden. Sie werden am Ende zu den Gewinnern gehören, auch wenn sie sich manchmal als Verlierer fühlen mögen. Mit Gewalt löst man keine Probleme, man schafft nur welche. Ich möchte mich aber auch bei meiner Lektorin Christine Steffen-Reimann bedanken, mit der ich seit Anbeginn zusammengearbeitet habe und hoffentlich noch lange werde. Und danke auch an Beate Kuckertz, Dr. Übleis und Dr. Gisela Menza, denen ich viel zu verdanken habe.
Melissa Roth stand etwa zehn Meter neben der Bushaltestelle, holte einen kleinen Spiegel und den Lippenstift aus der Handtasche, steckte aber beides wieder zurück, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihre Lippen noch keine Auffrischung brauchten. Sie trug einen kurzen hellen Rock, halb hohe Schuhe und eine dünne Jacke. Ihr langes blondes Haar hatte sie zu einem Zopf geflochten, der fast bis zum Po reichte. Sie war hübsch, eine der hübschesten jungen Frauen, die er kannte, eigentlich sogar die hübscheste, wenn er es recht betrachtete. An der Uni drehten alle Männer die Köpfe nach ihr um, die Schwulen vielleicht ausgenommen, und es gab kaum einen Studenten oder sogar Professor, der nicht gerne etwas mit ihr angefangen hätte. Sie war eine hervorragende Studentin, aber auf eine gewisse Weise auch ein kleines Luder. Seit er sie kannte, hatte sie mindestens fünf Kerle gehabt, darunter auch ein Professor. Die längste Liaison dauerte ungefähr zwei Wochen. Er hatte alles akribisch notiert. Sie war in seinem BWL-Kurs, außerdem hatte sie noch Anglistik belegt. Vor einigen Tagen aber hatte er zufällig erfahren, dass sie eventuell vorhatte, diesen ganzen trockenen Kram hinzuschmeißen und stattdessen auf Kunst umzusatteln. Einige Male hatten sie sich kurz über Belanglosigkeiten unterhalten, meist beim Verlassen des Hörsaals, mehr aber auch nicht. Sie war für ihn ein weit entfernter Traum, er offensichtlich nicht ihr Typ, was sie ihm durch die Blume zu verstehen gegeben hatte, als sie eine Einladung zum Essen ablehnte. Es war die Art, wie sie ablehnte, die ihn wütend gemacht hatte. Er hatte ihr zwar seinen Namen genannt, doch sie hatte ihn bestimmt längst vergessen. Aber das würde sich bald ändern.
Seit exakt zweiundfünfzig Tagen beobachtete er Melissa, seit er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Er führte genau Buch über ihre Aktivitäten außerhalb der Uni und wusste, mit wem sie heute Abend verabredet war. Sie ließ sich nie von ihrer Wohnung abholen, sondern stets an dieser Bushaltestelle, und sie hatte auch noch nie eine ihrer Bekanntschaften mit zu sich nach oben genommen. Anscheinend zog sie es vor, es mit den Kerlen in deren Buden zu treiben, denn nicht selten kam sie erst gegen drei oder vier Uhr morgens zurück. Auch heute lief wieder alles wie gewohnt ab.
Aber diesmal kam derjenige nicht. Es verschaffte ihm eine große Genugtuung, und er musste hämisch grinsen, wenn er sich das Gesicht des Typen vorstellte, als der sich die Bescherung betrachtete. Aber in den letzten zwei Wochen zog eine Bande von Reifenstechern durch die westlichen Vororte Sindlingen und Zeilsheim, weshalb es auch diesmal nur einer von vielen Versicherungsfällen sein würde. Er selbst hatte lange auf diesen Moment gewartet.
Der Bus hielt, in ihm nur ein älterer Mann außer dem Fahrer. Melissa winkte ab, die Türen schlossen sich wieder mit einem Zischen. In immer kürzeren Abständen warf sie einen Blick auf die Uhr, drehte sich ab und zu in die Richtung, aus der ihr derzeitiger Galan kommen musste, doch ihr Gesichtsausdruck wurde von Sekunde zu Sekunde ärgerlicher. Für halb neun hatten sie sich verabredet, und sie hasste Unpünktlichkeit. Der Himmel war jetzt schon den zweiten Tag zugezogen, immer wieder hatte es kurze Schauer gegeben, der Wind war mäßig, die Temperatur beinahe frühlingshaft mild. Für Weihnachten hatten die Meteorologen ebenfalls milde Temperaturen vorausgesagt, aber irgendwann würde der Winter trotzdem Einzug halten. Nach einer knappen halben Stunde war ihre Geduld am Ende. Sie war sehr dünn angezogen und fror trotz der zwölf Grad plus und machte sich auf den Weg zurück zu ihrer Wohnung. In diesem Moment fuhr er mit seinem erst wenige Tage alten BMW 2002 aus der Parklücke, von wo aus er sie immer beobachtete, und um die Ecke und hielt direkt neben ihr. Er kurbelte das Seitenfenster herunter und lächelte sie an.
»Hi. Was machst du denn hier?«, fragte er und tat überrascht, sie zu sehen.
Sie blickte ihn wie ein willkommenes Geschenk an, das ihr den Abend versüßen würde, und zuckte mit den Schultern. »Das frag ich mich allerdings auch. Ich bin verabredet, das heißt, eigentlich war ich verabredet, aber dieser Idiot …«
»Wollen wir was trinken gehen? Oder essen? Ich lad dich ein«, sagte er schnell.
Sie zögerte einen Moment, schaute ins Wageninnere und sah den aufmunternden Blick. »Warum eigentlich nicht. Wenn er jetzt noch kommt, hat er eben Pech gehabt. Und wohin willst du mich entführen?«, fragte sie neckisch lächelnd und setzte sich auf den Beifahrersitz.
»Lass dich überraschen«, antwortete er vielsagend und gab Gas. Er bog an der Ampel rechts ab, nahm die Straße, die aus Frankfurt hinausführte. Nur wenige Autos waren unterwegs, bei diesem Regenwetter verkrochen sich die meisten Leute lieber in ihren Wohnungen. Die Scheibenwischer bewegten sich in monotonem Takt, das Radio spielte leise Musik, sie unterhielten sich einmal mehr über unwichtige Dinge wie das Wetter.
»Ich dachte, wir fahren in die Innenstadt«, sagte Melissa eher belanglos, nachdem sie merkte, dass sie die Stadtgrenze bereits hinter sich gelassen hatten.
»Die besten Lokale gibt es außerhalb. Mit wem warst du eigentlich verabredet?«, fragte er scheinheilig.
»Kennst du nicht«, entgegnete sie und schaute aus dem Fenster in die Dunkelheit. »Wir wollten essen gehen …«
»Woher willst du wissen, dass ich ihn nicht kenne?«
»Also gut«, antwortete sie und verdrehte die Augen, was er nicht sehen konnte, »er heißt Tobias. Ist in meinem Anglistikkurs. Du kannst ihn also nicht kennen.« Und nach einer Weile: »Aber er ist unzuverlässig. Was machst du eigentlich so außerhalb der Uni?«
»Was schon«, sagte er, zuckte mit den Schultern und grinste. »Lernen, lernen, lernen. Und nebenbei ein bisschen arbeiten.«
»Aber heute Abend nicht«, erwiderte sie mit kokettem Augenaufschlag und sah ihn von der Seite an.
»Einmal in der Woche, das hab ich mir vorgenommen, können mir die Bücher gestohlen bleiben. Und dieses eine Mal ist heute.«
»Na gut. Jetzt sag schon, wo wir hinfahren.« Melissa holte eine Zigarette aus der Tasche und wollte sie anzünden.
»Bitte nicht rauchen. Das kannst du doch nachher im Lokal machen. Ich mag keinen Rauch.«
»Bisschen spießig, was?«, fragte sie spöttisch.
»Nee, nur gesundheitsbewusst.«
»Und verrätst du mir jetzt, wo wir hinfahren?«
»Gleich sind wir da«, antwortete er und bog kurz darauf in einen asphaltierten Waldweg ein, an dessen Beginn ein Schild stand mit der Aufschrift: Privatweg – Betreten verboten. Sie runzelte die Stirn, ihr bis dahin gelöster Gesichtsausdruck wurde schlagartig ernst.
»He, was soll das? Wo sind wir hier?«, sagte sie mit einem ängstlichen Unterton in der Stimme.
»Wart doch mal ab«, antwortete er, während er innerlich angespannt wie selten zuvor war und wieder beschleunigte.
»Fahr mich bitte sofort nach Hause«, forderte sie.
»Piano, piano«, beschwichtigte er sie. »Du hast doch nicht etwa Angst, oder?« Und nach ein paar Sekunden: »Komm, vor mir brauchst du keine Angst zu haben, ich tu dir nichts, Ehrenwort …«
»Ich will trotzdem bitte sofort nach Hause!«
»Jetzt mach aber mal halblang, okay!«, herrschte er sie scharf an und trat abrupt auf die Bremse, woraufhin sie beinahe mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geprallt wäre. »Du bist eingestiegen und mit mir mitgefahren. Und ab sofort machst du genau das, was ich dir sage, kapiert!«
»Willst du mich vergewaltigen?«, fragte sie mit einem Mal ruhig und sah ihm in die Augen, doch es gelang ihr nicht ganz, ihre Angst zu verbergen. »Du kannst es auch so haben, ich wollte sowieso schon mal …«
»Was wolltest du sowieso schon mal?«, fragte er misstrauisch.
»Meinst du vielleicht, du bist mir bisher nicht aufgefallen? Du siehst gut aus, du … Na ja, aber du hast dich nie getraut, mich anzusprechen, außer dieser blöden Essenseinladung zwischen Tür und Angel. Und ich mache grundsätzlich nicht den ersten Schritt. Ich stehe auf die gute alte Schule, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Ist schon okay.« Er stellte den Motor ab. Ringsum herrschte absolute Finsternis, nur die Radiobeleuchtung spendete diffuses Licht. Sie waren allein, und er kannte die Gegend gut genug, um zu wissen, dass sich um diese Zeit und vor allem bei diesem Wetter kein Mensch weit und breit aufhalten würde. Die Leute waren mit den Vorbereitungen für Weihnachten beschäftigt, überall in der Stadt waren die Straßen und Geschäfte festlich geschmückt. Er wandte seinen Kopf in ihre Richtung und streichelte über ihr Haar. »Du bist schön, ehrlich. Aber ich kann Frauen nicht leiden, die ständig mit andern ins Bett steigen. Warum machst du das?«
»Wieso steig ich ständig mit andern ins Bett?! Spinnst du? Ich hab Freunde, na und?! Aber ich bin keine Hure …«
»Komm, ich hab dich beobachtet, wenn dich die Typen von der Bushaltestelle abholen und dich irgendwann nachts dort wieder rauslassen. Lässt du dich dafür bezahlen, oder machst du es einfach nur, weil du Spaß daran hast?«
»Das geht dich nichts an. Außerdem, wieso beobachtest du mich? Bist du ein Spanner?«
»Nein, aber mich interessieren die Menschen, die ich gerne mag.«
»So, du magst mich also. Okay, dann machen wir’s eben hier. Oder wir kehren um, und du bringst mich wieder nach Hause. Oder ich laufe notfalls«, sagte sie mit kehliger Stimme, wobei sie vergeblich versuchte ihre Angst zu unterdrücken.
»Bitte, machen wir’s.«
Er griff an ihre Brust. Sie trug keinen BH, sie gehörte zu den Frauen, die so etwas nicht nötig hatten. Kleine feste Brüste. Und während er unter ihre Bluse langte und die rechte Brust massierte, presste er seine Lippen auf ihre. Sie erwiderte seinen Kuss, fasste zwischen seine Beine und fühlte sein erigiertes Glied. Er legte die Rückenlehne des Beifahrersitzes um, seine Erregung steigerte sich ins Unermessliche.
»Mach die Beine breit«, sagte er mit schwerer Stimme und drang kurz darauf mit einem heftigen Stoß in sie ein. Er ejakulierte schon nach wenigen Sekunden. Sie lachte kurz und trocken auf. Er hielt inne, und wollte er eben noch seinen Plan verwerfen, so würde er ihn jetzt nach diesem ihn verhöhnenden Auflachen ausführen. Ihn lachte man nicht aus, schon gar nicht in einer solchen Situation. Sie sah seinen Blick nicht, nicht das Mahlen seiner Kiefer. »Sorry«, sagte er kühl und tonlos, »ich war wohl etwas schnell.«
»Tja«, erwiderte sie leicht spöttisch, »wir können’s ja noch mal probieren, aber dann in aller Ruhe …«
»Vergiss es, ich glaub, das bringt nichts.« Er zog den Reißverschluss seiner Hose hoch.
Seine Hände strichen über ihr Gesicht, er streichelte zärtlich die glatte, feine Haut und sagte: »Weißt du eigentlich, wie ich heiße?«
»Nein. Aber was sind schon Namen?«
»Schade, Melissa«, entgegnete er nur, dann wurde der Druck etwas stärker, er glitt tiefer an ihren Hals, und plötzlich umschlossen die eben noch weichen und zärtlichen Hände diesen und drückten zu. Sie schlug um sich, versuchte ihn zu kratzen, doch seine Knie waren auf ihren Oberarmen. Er wusste genau, wo er den Griff anzusetzen hatte, er hatte es sich einmal von einem Medizinstudenten erklären lassen. Es dauerte keine zwei Minuten, bis das Zungenbein gebrochen war und ihr Kopf schlaff zur Seite fiel. Ein letztes Zucken raste wie ein Stromschlag durch ihren Körper.
Er schaltete die Innenbeleuchtung an und registrierte, dass auf ihrem Sitz ein paar Flecken waren, die man aber leicht beseitigen konnte. Er würde es gleich morgen früh tun. Außerdem hatte sie bei ihren verzweifelten Versuchen, sich zu wehren, mit ihren Schuhen das Handschuhfach ramponiert und ein Loch in den Teppich gerissen. Er zuckte nur mit den Schultern, stieg aus, ging um den Wagen herum, holte den leblosen Körper heraus und legte ihn in den Kofferraum. Mit einem Tuch wischte er kurz über den Sitz.
Er fuhr weiter geradeaus bis zu einem Platz, den außer ein paar gelegentlich vorbeikommenden Spaziergängern und einigen Jägern keiner sonst kannte. Das Grundstück lag eingebettet zwischen riesigen Bäumen und war umschlossen von einem mannshohen Zaun. Über drei Meter hohe, dicht an dicht stehende Koniferen verdeckten den Blick auf das alte, halb verfallene Haus. Er öffnete das Tor und fuhr auf das Grundstück, das von jedem, der hier vorbeikam, wohl für das Refugium eines wunderlichen Einsiedlers gehalten wurde. Er ging ins Haus, schob einen großen Teppich beiseite, öffnete eine flach über der Erde liegende Tür, zündete eine Petroleumlampe an, die er an die Wand hängte, holte den Leichnam aus dem Kofferraum, hievte ihn über die Schulter und schleppte die Tote die lange Treppe hinunter in den Raum, in dem sich ein Feldbett, ein kleiner Tisch, zwei Holzstühle und ein alter Schrank befanden. Die Wände waren weiß, von der Decke baumelte eine Bastlampe, deren Birne jedoch schon seit langem kaputt war. Links von der Treppe befand sich eine weitere Tür, dahinter ein kleinerer Raum mit einem Regal voller Dosen und Flaschen und einem schmalen, hohen Schrank.
Es war kühl hier unten, und früher, als er noch ein Kind war, hatte er den modrigen Geruch wie einen kleinen Schatz empfunden, denn nur ihm war es vorbehalten, diesen Geruch zu atmen. Und seit er sechzehn war, hatte er dieses Refugium angefangen auszubauen, unbemerkt von allen anderen in seiner Familie. Er hatte die Spuren der Vergangenheit allmählich beseitigt, den Estrich und darüber die Fliesen gelegt, auf denen jetzt Teppiche waren. Er hatte die Wände gereinigt und gestrichen und die alten elektrischen Leitungen wieder angeschlossen.
Als er ein Kind war, gerade mal acht Jahre alt, und bei einem seiner heimlichen Ausflüge diesen verlassenen Ort entdeckt hatte, war dies seine Zuflucht geworden. Hier hatte er seinen Gedanken nachhängen können, hierhin konnte er fliehen, wenn ihm die Gegenwart der andern zuwider war. Dabei waren es von hier nur knapp zwanzig Minuten zu Fuß bis zu seinen Eltern – wenn er rannte –, denen das gesamte Gelände bis zur Bundesstraße gehörte, vererbt über Generationen mütterlicherseits hinweg, und irgendwann würde er alles sein Eigen nennen.
»Ich komme morgen wieder, Süße. Schade, du wolltest nicht mal meinen Namen wissen«, sagte er leise und mit einem letzten Blick auf die Tote und schloss die Tür hinter sich. Er nahm den Weg zurück zur Straße, nicht ohne sich vorher zu vergewissern, dass ihn niemand beobachtete.
Nach einer guten halben Stunde langte er zu Hause an. Kaum dass er die Wohnung betreten hatte, klingelte das Telefon. Seine Mutter. Sie wollte nur wissen, wie sein Tag verlaufen war. Bestens, hatte er ihr geantwortet, worüber sie sich natürlich freute. Sie war stolz auf ihren Jungen, und er würde alles tun, um sie nicht zu enttäuschen. Er ließ sich Badewasser ein, trank ein Glas Rotwein und rauchte genüsslich eine Zigarette. Melissa hatte er es verboten, aber er konnte Rauch im Auto nun wirklich nicht ausstehen. Er trocknete sich ab und besah sich im Spiegel. Sie hatte ihn doch einmal erwischt, ein etwas längerer Kratzer auf der linken Wange. Er zuckte mit den Schultern. Im Bett las er ein paar Seiten aus Der Prozeß von Kafka, legte das Buch aber, als seine Augen immer schwerer wurden, auf den Nachtschrank. Er fühlte sich irgendwie gut.
Er hörte es an der Art, wie die Tür aufgeschlossen und wieder zugemacht wurde, wie der Mantel an die Garderobe gehängt wurde, an den Schritten, die langsam näher kamen. Er konnte schon seit langem unterscheiden, ob sein Vater gute oder schlechte Laune hatte. Wovon seine Laune abhing, vermochte er nicht zu sagen, wohl keiner vermochte dies, und es interessierte ihn auch nicht. Heute ahnte er, dass es nach langer Zeit wieder einer dieser Abende werden würde, die er so hasste und vor denen er sich so fürchtete. Doch noch viel mehr hasste er seinen Vater, der für all das verantwortlich war. Aber was sollte er mit seinen zwölf Jahren schon machen, er war hilflos und fühlte sich ohnmächtig. Und er hatte Angst vor dem, was unweigerlich wieder einmal kommen würde. Markus saß auf der Couch, der Fernseher lief, doch er schaute nicht mehr hin. Er wartete auf das Eintreten seines Vaters, alles in ihm war eine einzige unerträgliche Spannung. Er merkte, wie ihm das Schlucken schwer fiel, wie sich alles um seine Brust zusammenzog und es in seinen Händen anfing zu kribbeln.
»Hallo, Papa«, sagte er, als sein Vater ins Zimmer trat, ein Mann von einsvierundsiebzig, schlank, mit dichtem blondem Haar, schmalen, wie ein Strich geformten Lippen und eisblauen Augen.
»Wo ist deine Mutter?«, fragte Rolf Lura, ohne die Begrüßung zu erwidern.
»Oben.«
Rolf Lura machte auf dem Absatz kehrt und stieg die Treppe hinauf. Markus erhob sich, nachdem sein Vater außer Sichtweite war, und begab sich zum Treppenabsatz, um zu lauschen.
»Gabriele?«
Es war der typische Ton, kalt, hart, streng. Markus’ Angst steigerte sich noch weiter, sein Herz pochte wie wild. Seit er denken konnte, war sein Leben von kaum etwas anderem als Angst geprägt.
»Ja?«, erwiderte sie und kam aus dem Schlafzimmer gehuscht. Gabriele Lura war klein und zierlich, nur knapp einsfünfundfünfzig groß, mit vollem rötlich braunem Haar, grazilen Händen und einem sehr ebenmäßigen Gesicht, in dem das Hervorstechendste die sanften grünen Augen und der weiche, malerisch geschwungene Mund waren. Ihre Haut war von einem natürlichen zarten Weiß, das übersät war von unzähligen Sommersprossen.
»Was ist mit Essen?«
»Ist gleich fertig«, entgegnete sie und wollte sich an ihm vorbeiwinden, doch er hielt sie mit einer Hand am Oberarm fest.
»Gleich fertig?«, sagte er mit hochgezogenen Augenbrauen und diesem kalten stechenden Blick. »Hatten wir nicht abgemacht, dass das Essen pünktlich um sieben auf dem Tisch zu stehen hat? Wir haben jetzt aber genau achtzehn Minuten nach sieben, wenn ich nicht irre. Noch nicht einmal der Tisch ist gedeckt. Hast du dafür vielleicht eine Erklärung?«
»Entschuldigung, aber ich habe vergessen, auf die Uhr zu sehen«, sagte sie mit fester Stimme, auch wenn alles in ihr vibrierte.
»Du hast also vergessen, auf die Uhr zu schauen! Sieh an! Aber mich würde viel mehr interessieren, wo du heute Nachmittag warst? Ich habe mehrmals versucht, dich zu erreichen, auch auf deinem Handy. Wofür habe ich dir eigentlich das Handy gekauft, wenn du es nie einschaltest?«
»Ich war spazieren, und zwar im Schwanheimer Wald. Den ganzen Tag habe ich schon Kopfschmerzen. Ich habe meine Tage, und ich habe leider mein Handy vergessen.«
»So, mein kleiner roter Teufel war also mal wieder spazieren«, sagte er mit maliziösem Lächeln. »Und sicher hast du auch deinen lieben Sohn Markus mitgenommen, oder?«
»Markus war bei Daniel. Er ist um Punkt sechs heimgekommen. Und bitte, nicht schon wieder vor dem Jungen«, flehte sie. »Es war doch in letzter Zeit alles so schön.«
»Nicht schon wieder vor dem Jungen, nicht schon wieder vor dem Jungen«, äffte er sie nach, ohne auf ihren letzten Satz einzugehen. »Keine Angst, ich tu ihm nichts, ich hab ihn noch nie angerührt, das weißt du genau. Er kann am wenigsten dafür, dass er eine solche Mutter hat. Außerdem …«
»Du kriegst doch gar nicht mit, was in ihm vorgeht, wenn er das alles mitbekommt«, schrie sie ihn unvermittelt an, wobei in der Mitte der Stirn die Zornesader hervortrat. »Und du bist sein Vater, falls du das vergessen haben solltest!«
Mit einem Mal wurde seine Stimme leise, er zischte nur noch und hob seine Hand, als wollte er gleich zum Schlag ansetzen. »Wage nicht, noch einmal so mit mir zu reden, sonst knallt’s, merk dir das! Ist es vielleicht meine Schuld, wenn es dem Bengel nicht gut geht? … Aber lassen wir das. Du warst also wieder den ganzen Nachmittag allein. Tz, tz, tz, du warst allein, aber das Essen ist nicht fertig. Weißt du was, mir ist der Appetit vergangen. Komm mit nach unten, ich will dir was zeigen«, sagte er bestimmend und zog sie mit eisernem Griff am Arm hinter sich her. Markus rannte leise zurück ins Wohnzimmer und ließ sich auf die Couch fallen. Er tat, als würde er fernsehen.
»Ab auf dein Zimmer«, befahl Rolf Lura und sah den Jungen, keinen Widerspruch duldend, an, »du kannst auch dort in die Glotze stieren. Und mach die Tür hinter dir zu. Und nachher will ich deine Hausaufgaben sehen.«
Markus warf seiner Mutter einen angsterfüllten Blick zu, die ihm mit einem kaum merklichen Nicken bedeutete, dem Befehl seines Vaters nachzukommen. Er verließ wortlos das Zimmer, blieb aber auf halber Treppe stehen, um zu horchen, was gleich geschehen würde, obgleich er es wusste.
»Hier, meine Liebe«, sagte Rolf Lura und zog sie zum Geschirrschrank. »Hier drin sind die Teller«, er nahm einen heraus und ließ ihn auf die Fliesen neben dem Teppich fallen, wo er in viele kleine Teile zerbrach, »die Tassen«, von denen er ebenfalls eine fallen ließ, und mit einem Mal schrie er: »Ganz viele Teller, Tassen, Gläser! Teller, Tassen, Gläser, die ich für teures Geld gekauft habe, um dir eine Freude zu machen! Dir, dir, dir! Und nichts von diesem ganzen verdammten Zeug steht auf dem Tisch, wenn ich nach einem harten Arbeitstag nach Hause komme. Ich möchte von einer liebenden Frau empfangen werden, alles soll Liebe, Frieden und Harmonie ausstrahlen, aber was erwartet mich, wenn ich die Tür aufmache?! Mein Sohn hockt vor der Glotze, anstatt sich um seine Schularbeiten zu kümmern, du treibst dich im Schlafzimmer rum, anstatt das Essen fertig zu haben, und wer weiß, wo du dich sonst noch den ganzen Tag über rumgetrieben hast …«
»Rolf, mir geht es heute wirklich nicht besonders gut. Lass mich dir doch bitte erklären, was …«
»Du willst dich rechtfertigen? Ist ja nichts Neues! Wenn meiner kleinen lieben Gabi nichts mehr einfällt, dann muss sie sich eben rechtfertigen. Und wer sich rechtfertigt, hat Schuld. Aber gut, dann erklär mir doch bitte, wieso hier nichts so funktioniert, wie ich das angeordnet habe.«
Ohne auf die letzte Bemerkung einzugehen, sagte sie: »Das Essen ist fertig, ich muss nur noch den Tisch decken.«
»Aber vorher machst du den Dreck hier weg. Über alles Weitere unterhalten wir uns später, verlass dich drauf. Irgendwann wirst auch du noch lernen, gehorsam zu sein. Los, mach schon!« Er gab ihr einen kräftigen Stoß gegen die Brust, doch sie fiel nicht zu Boden. Sie drehte sich um und holte aus dem Putzschrank die Handschaufel und den Besen und fegte wortlos die Scherben zusammen und schüttete sie in den Mülleimer. Anschließend fuhr sie mit dem Staubsauger über den Boden, um auch die letzten winzigen und mit dem Auge kaum sichtbaren Splitter aufzusaugen.
Rolf Lura lockerte seine Krawatte und setzte sich in seinen Sessel, die Beine breit, und beobachtete seine Frau bei der Arbeit.
»Was gibt’s eigentlich zu essen?«, fragte er mit plötzlich sanfter Stimme und erhob sich gleich wieder, umfasste seine Frau von hinten und presste seine Hände gegen ihre Brüste.
»Szegediner Gulasch, dein Leibgericht. Und bitte, nicht jetzt, ich muss den Tisch decken.«
»Und wenn ich jetzt Hunger auf was anderes habe? Was dann?«, fragte er und küsste sie auf den Hals.
»Ich hab dir doch gesagt, dass ich meine Tage hab. Und jetzt lass mich den Tisch decken.«
»Natürlich, tu das, wir haben auch später noch Zeit für die andern Sachen. Und du weißt, mir ist es egal, ob du deine Tage hast oder nicht«, entgegnete er und lächelte erneut maliziös, was sie zwar nicht sehen, aber spüren konnte, setzte sich wieder, zündete sich eine Zigarette an und nahm die Zeitung von dem kleinen runden Tisch neben seinem Sessel.
Markus hatte sich, nachdem der erste Teller zu Boden gefallen war, mit weichen Knien auf sein Zimmer begeben, sich ans Fenster gestellt, hinausgeschaut und sich wie so oft gewünscht, irgendjemand würde kommen und ihn und seine Mutter aus diesem Horrorhaus befreien. Wie oft hatten sie sich unterhalten, wenn dieses gottverdammte Arschloch, wie er seinen Vater insgeheim titulierte, nicht da war, und sich geschworen, immer füreinander da zu sein. Und eines Tages würden sie es schaffen und abhauen, irgendwohin, wo er sie nicht finden konnte.
Und keiner dort draußen wusste, was in diesem Haus vor sich ging. Für die Nachbarn war Rolf Lura der angesehene Autohändler eines riesigen Autohauses, in dem Rolls Royce und andere Nobelmarken sowie exklusive italienische Sportwagen wie Ferrari und Lamborghini verkauft wurden. Er war ein Meister im Sich-Verstellen, nach außen der integre, seriöse, höfliche Geschäftsmann, doch in den eigenen vier Wänden der brutale Tyrann, der allein mit seiner Anwesenheit ein ums andere Mal die Atmosphäre vergiftete. Es gab nur selten Tage, an denen er sich wie ein normaler Ehemann und Vater benahm, an denen man mit ihm reden konnte, ohne gleich angefaucht oder angeschrien oder wie Markus’ Mutter verprügelt zu werden. Auch wenn seine Wutausbrüche in letzter Zeit deutlich weniger geworden waren und in Markus und auch seiner Mutter die Hoffnung keimte, es würde eines Tages doch noch schön werden. Und jetzt kam er nach Hause, und alles war wieder wie früher.
Er weinte nicht, als er am Fenster stand und in die Dunkelheit hinausstarrte, er hatte längst aufgehört zu weinen. Die Angst war so stark, dass sie keine Tränen mehr zuließ. Er wünschte sich nur einmal mehr, größer und vor allem stärker zu sein und seinen Vater so zu schlagen, wie er dies immer mit seiner Mutter machte. Er würde seine Fäuste so lange in das verhasste Gesicht schlagen, bis er blutend und um Gnade winselnd am Boden lag, in das Gesicht, in den Bauch, in die Genitalien, er würde ihn an den wenigen Haaren ziehen, bis er schrie und wimmerte und nur noch darum bettelte, am Leben gelassen zu werden. Nur einmal ihm das antun, was er seiner Mutter seit Jahren antat. Aber Markus war gerade einmal so groß wie seine Mutter und schmächtig, und es war diese furchtbare Angst, die ihn lähmte. Und es gab niemanden, der von dieser Angst wusste, außer seiner Mutter, die versuchte, so gut es ging, ihm diese Angst zu nehmen, und, wenn er seinen Vater mit den erbärmlichsten Flüchen belegte, auch noch mahnend meinte, er solle so etwas nicht sagen, schließlich sei er sein Vater und wäre ohne ihn nicht auf der Welt. Aber was war dies für eine Welt, in der er, seit er denken konnte, beinahe täglich von unsäglichen Angstzuständen geplagt wurde, Angst davor, eines Tages von der Schule nach Hause zu kommen und seine Mutter tot aufzufinden.
Wie aus weiter Ferne hörte er seinen Namen rufen, löste sich vom Fenster und ging nach unten. Der Tisch war gedeckt, Markus’ Mutter begann aufzufüllen.
»Hast du dir die Hände gewaschen?«, fragte Rolf Lura.
»Ja«, log Markus und zeigte seine Hände. Sein Vater schaute nicht einmal hin.
»Und wie war’s in der Schule? Habt ihr eine Arbeit geschrieben?«
»Nein, erst am Mittwoch.«
»Und was? Jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.«
»Englisch.«
»Du hast doch hoffentlich dafür gelernt, oder?«
»Ja.«
»Dann ist es ja gut«, sagte Rolf Lura und begann zu essen.
Markus warf seiner Mutter einen Blick zu, die diesen auch diesmal nur kurz erwiderte. Rolf Lura hasste es, wenn sie und Markus sich leise unterhielten oder sich vielsagend anschauten. Manchmal schien es, als würde er Gedanken lesen können.
Die restliche Zeit während des Essens verbrachten sie schweigend, ein Schweigen, das für Markus wie ein lauter Schrei war, den jedoch keiner außer ihm hörte, denn er spürte, es würde in dieser Nacht noch etwas geschehen, von dem er aber hoffte, es würde nicht geschehen.
Nach dem Essen räumte Gabriele Lura den Tisch ab und verstaute das Geschirr in der Spülmaschine, während ihr Mann sich eine weitere Zigarette anzündete und dabei die Tagesschau anstellte.
»Wann hast du morgen Schule?«, fragte er nebenbei seinen Sohn.
»Um acht.«
»Dann mach dich fürs Bett fertig. Ich will, dass du um halb neun in der Falle liegst. Und vergiss nicht, dir die Zähne zu putzen.«
Markus ging ins Bad, wusch sich die Hände und das Gesicht und putzte die Zähne. Auf dem Flur kam ihm seine Mutter entgegen.
»Mutti …«
»Pssst.« Sie legte einen Finger auf ihre Lippen und schob Markus in sein Zimmer. »Geh schnell ins Bett und schlaf. Versprochen?«
»Mutti, ich …«
»Keine Angst, mir wird nichts passieren. Und jetzt schlaf schön. Die Engel werden auf dich aufpassen.«
»Ich will aber, dass sie auf dich aufpassen.«
»Das tun sie schon«, sagte sie aufmunternd lächelnd und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. »Vielleicht ist bald alles vorbei. Wir dürfen nur die Hoffnung nicht aufgeben.« Und nach einer kurzen Pause, während der sie Markus liebevoll anschaute und ihm mit einer Hand übers Haar strich: »Mach dir keine Sorgen, ich glaub, seine schlechte Laune ist schon wieder vorbei. Und denk an die Engel.«
Sie hatten nicht gehört, wie Rolf Lura die Treppe hochgekommen war, in der Tür stand und fast alles mitbekommen hatte.
»Ja, ja, denk an die Engel«, sagte er mit zynischem Lächeln und trat näher an das Bett heran. »Was habt ihr beide denn wieder für Geheimnisse zu bequatschen? Wir sind eine Familie, und da sollte es doch eigentlich keine Geheimnisse geben. Also, um was ging’s?«
»Ich hab Markus nur gute Nacht gesagt, mehr nicht«, antwortete Gabriele Lura.
»Aha, mehr also nicht. Und dazu müsst ihr so flüstern. Ich wünsche meinem Sohn ebenfalls eine gute Nacht.« Und an seine Frau gewandt: »Und jetzt komm, ich hab was mit dir zu besprechen.«
»Gleich.«
»Nicht gleich, sondern sofort! Es ist halb neun, und ich habe gesagt, Markus wird um halb neun schlafen. Los jetzt!«
Markus schluckte schwer, als sein Vater an der Tür stand und seine Mutter an ihm vorbei nach draußen huschte. Rolf Lura schloss leise die Tür hinter sich, und als seine Frau wieder nach unten in den Wohnbereich wollte, hielt er sie mit brutalem Griff zurück.
»Die Richtung«, befahl er und zog wieder die Augenbrauen hoch. »Ich hab doch vorhin gesagt, dass ich etwas mit dir zu besprechen habe, und glaub ja nicht, ich hätte das vergessen. Ich vergesse nie etwas, merk dir das ein für alle Mal. Und jetzt da rein!«
Er schubste sie ins Schlafzimmer, das unmittelbar neben Markus’ Zimmer lag, und kickte die Tür mit dem Absatz zu. Gabriele Lura stand in der Mitte des großen Zimmers mit dem begehbaren Kleiderschrank, der die ganze linke Seite einnahm und dessen Vorderfront mit orientalischen Intarsien versehen war. Eine dezente Beleuchtung verlieh diesem erlesenen Schrank etwas Transparentes. Die beiden unauffälligen Türen ließen sich geräuschlos öffnen, indem man sie leicht berührte und zur Seite schob und schließlich ins Innere gelangte, wo alle Kleidungsstücke in akribischer Ordnung hingen oder lagen, denn auch darauf legte Rolf Lura großen Wert, wie überhaupt alles in seinem Leben einer von ihm geschaffenen Ordnung zu entsprechen hatte. Ein feinfloriger hellbrauner Teppichboden machte jeden Schritt unhörbar. Jedes noch so kleine Detail in dem Zimmer war edel und kostbar, so wie alles in dem Haus, das Rolf Lura vor der Hochzeit vor dreizehn Jahren in Schwanheim im Südwesten von Frankfurt bauen ließ.
Er stand jetzt etwa einen Meter vor seiner Frau, die ihm direkt in die Augen blickte. »Dürfte ich jetzt bitte erfahren, wo du dich heute Nachmittag wirklich rumgetrieben hast?«, fragte er scharf.
»Ich hab doch gesagt, dass ich im Schwanheimer Wald spazieren war. Oder soll ich in Zukunft vielleicht eine Videokamera mitnehmen und mich selbst aufnehmen, wenn ich allein unterwegs bin?«, fragte sie schnippisch. Es war in Momenten wie diesem egal, wie sie auf seine Fragen reagierte, ob demütig, ehrfürchtig oder spöttisch, seine Reaktion würde immer die gleiche sein. So auch diesmal. Sie sah die Hand kaum kommen, die auf ihre linke Wange klatschte.
»Nicht so, meine Liebe!«, zischte er mit drohendem Blick. »Also, wo warst du? Ich habe zwei Stunden lang vergeblich versucht dich zu erreichen, und du kannst mir nicht erzählen, dass du zwei Stunden lang spazieren warst. Sag die Wahrheit, oder ich werde sie aus dir rausprügeln, was ich offenbar schon viel zu lange nicht mehr gemacht habe. Dich an der langen Leine laufen zu lassen war wohl ein Fehler von mir, denn du nutzt das schamlos aus.«
»Rolf, die vergangenen Monate waren schön, wirklich. Warum willst du das jetzt alles kaputtmachen?«, sagte sie mit fester Stimme, um ihn vielleicht zu beruhigen, auch wenn dies nur ein Traum war, denn beruhigen ließ er sich in Zeiten der Rage nie.
»Ja, sie waren schön, aber nicht ich mache etwas kaputt, sondern du. Warum lügst du mich an?«
»Ich lüge dich nicht an, und das weißt du genau …«
»Ich merke sofort, wenn jemand lügt«, fuhr er sie an. »Also, sag mir ganz ehrlich, was du heute gemacht hast. Ich verlange eine Antwort … Oder muss ich sie aus dir rausprügeln?«
»Es ist doch immer wieder das Gleiche, mit deinen Fäusten und deinem Schwanz bist du stark. Aber in Wirklichkeit bist du ein …«
Er schlug sie zweimal ins Gesicht, aber nur mit der flachen Hand. Sie hatte längst aufgehört zu zählen, wie oft er sie schon geschlagen hatte. Doch diesmal hatte er bereits nach diesen zwei Schlägen genug. Seit April hatte er nicht mehr richtig auf sie eingeprügelt. Früher boxte er sie obendrein in den Bauch, auf die Arme, und wenn er ganz schlimm drauf war, trat er sie auch noch, wenn sie wimmernd am Boden lag. Und wenn die Zeit der Schläge und Tritte und der anschließenden Vergewaltigung vorüber war, stand er jedes Mal vor ihr, blickte auf sie hinab und sagte in immer dem gleichen ruhigen Ton: »Steh auf und geh dich waschen. Ich hasse es, wenn du so aussiehst.«
Die Tat und diese Worte waren ein Ritual, an das sie sich gewöhnt hatte. Doch diesmal war sie nicht hingefallen, sie lehnte nur an der Messingstange des Bettes und hielt sich fest. Natürlich, es gab immer wieder Momente, in denen sie sich nicht anders zu helfen wusste, als zum letzten Mittel zu greifen, nämlich zu beißendem Spott, um wenigstens ein klein wenig die Genugtuung zu haben, auch ihm ein paar Stiche versetzt zu haben.
»Du hast alles, was du zum Leben brauchst, und kannst mir nicht einmal ein wenig Dankbarkeit und Ehrlichkeit entgegenbringen! Aber ich werde dich noch lehren, gehorsam zu sein, das schwöre ich bei Gott!«
Er öffnete seinen Gürtel, zog ihn aus den Laschen, faltete ihn und ließ ihn ein paar Mal in seine Handfläche klatschen. »Du weißt, dass ich dich liebe. Aber mir scheint, ich muss dir diese Liebe erst einbläuen. Was bist du bloß für ein Miststück.« Er machte eine Pause, schüttelte den Kopf, öffnete den Reißverschluss seiner Hose, hielt den Gürtel weiter in der Hand und sagte mit einem seltsamen Lächeln: »Und trotzdem liebe ich dich. Ich liebe dich, obwohl du mich permanent hintergehst.«
»Ich hintergehe dich nicht«, sagte sie leise. Sie hatte Angst vor den nächsten Minuten, vor den Schlägen mit dem Gürtel.
Sie sah ihn nicht an, während er sie an den Haaren packte und aufs Bett warf. Er riss ihren Slip auseinander und zischte: »Dreh dich um!« Sie gehorchte wortlos. Er drang von hinten in sie ein, ein beinahe unerträglicher Schmerz durchflutete sie. Alles, was er jetzt tat, ließ sie willenlos über sich ergehen. Als er nach einer schier endlosen Zeit ejakulierte, sagte er: »Du wirst meine Liebe schon noch verstehen, irgendwann wirst du sie verstehen.«
»Irgendwann gehe ich weg«, erwiderte sie leise, woraufhin er hämisch lachte, sie am Kinn packte und sie zwang, ihm in die Augen zu sehen.
»Du gehst nirgendwohin. Wohin denn auch? Du hast keine Eltern, keine Geschwister, wo um alles in der Welt willst du also hin? Hier ist dein Zuhause, das sollte endlich mal in deinen kleinen dickköpfigen Schädel dringen! Und solltest du doch versuchen abzuhauen, ich werde dich finden, egal, wo auf der Welt du dich versteckst. Und dann gnade dir Gott! Ich werde dich umbringen, so wahr ich Rolf Lura heiße. Also, Liebling, vergiss es einfach, okay! Und jetzt mach dich sauber, ich hasse es, wenn du so aussiehst.« Und nachdem sie aufgestanden war: »Und wag es bloß nicht, in Markus’ Zimmer zu gehen. Und wag es auch nicht, ihm von heute Abend zu erzählen. Du weißt, ich sehe es an seinem Gesicht. Ich sehe und höre alles. Selbst die Dinge, die nicht ausgesprochen werden.«
Sie schlich ins Bad und betrachtete sich im Spiegel. In ihrem Gesicht waren kaum Spuren der Schläge zu sehen, nur ein kleiner Kratzer an der linken Wange. Dafür schmerzte ihr Unterleib, vor allem ihr Anus, als würde er sie immer noch mit seinen heftigen, gewalttätigen Stößen penetrieren. Aber auch diese Schmerzen war sie inzwischen gewohnt. Prügel und Vergewaltigung gehörten seit ihrer Eheschließung zu ihrem Leben wie essen und trinken. Er hatte sie bestimmt schon tausendmal physisch misshandelt, noch öfter jedoch war es die psychische Gewalt, die er einsetzte. Tagelang hielt er es aus, ohne ein Wort zu sprechen – morgens grußlos das Haus verlassen, abends ebenso grußlos wieder heimkommen, dazwischen immer wieder das Läuten des Telefons, doch sobald sie den Hörer abnahm, wurde am andern Ende aufgelegt. Sie wusste, es waren seine Kontrollanrufe, ob sie auch schön brav daheim war. Es war ein Spiel, dessen Regeln er bestimmte. Psychoterror. Und jeden dieser Tage verbrachte sie in der Furcht, es könnte etwas Schreckliches passieren.
Manchmal hörten diese Zustände von einer Sekunde zur andern auf, und er wurde freundlich und zugänglich, brachte ihr Blumen oder sogar größere Geschenke mit. Doch genauso plötzlich brach in ihm wieder der brutale, jähzornige Ehemann hervor. Es waren Kleinigkeiten, die in ihm den Schalter umlegten und aus dem Jekyll einen Hyde machten. Ein Telefonat mit einer Bekannten – Freundinnen hatte sie keine –, bei dem sie lachte, eine harmlose Bemerkung, wenn das Essen nicht auf die Minute genau auf dem Tisch stand oder nicht seinem Geschmack entsprach, sie sich mit ihrem Sohn allein unterhielt, vor allem aber, wenn sie am Klavier saß und spielte. Sie beherrschte außer Deutsch vier weitere Sprachen, hatte Musik studiert und war auf dem besten Weg gewesen, eine gefeierte Konzertpianistin zu werden, als er in ihr Leben trat.
Er saß bei einer Aufführung vor geladenen Gästen der feineren Gesellschaft im Publikum, sie hatten sich nach dem Konzert unterhalten, Champagner getrunken und sich für einen der kommenden Abende zum Essen verabredet. Er überhäufte sie mit Geschenken, und obwohl sie bereits einen Vertrag für eine Konzerttournee unterschrieben hatte, zerriss sie diesen wieder, nachdem er sie immer wieder gedrängt hatte, ihn doch zu heiraten. Und sie hatte nachgegeben. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade einundzwanzig Jahre alt, er zweiunddreißig.
Das erste Mal hatte er sie in der Hochzeitsnacht geschlagen, weil sie nur ein einziges Mal mit einem andern getanzt hatte, obwohl dieser andere niemand weiter als sein Bruder Wolfram gewesen war. Die Gäste waren alle gegangen, er hatte sie nach oben ins Schlafzimmer gezerrt, ihr ein paar Ohrfeigen gegeben und sie angeschrien, was sie sich einbilde, mit einem andern zu tanzen und ihn damit vor den Gästen bloßzustellen. Wie eine Hure habe sie sich aufgeführt. Anschließend hatte er sie brutal vergewaltigt. Am nächsten Morgen hatte er sich bei ihr entschuldigt und gemeint, er habe wohl ein wenig zu viel getrunken und so etwas würde ganz sicher nicht wieder vorkommen. Sie hatte ihm verziehen, aber die folgenden Tage, Monate und Jahre wurden zu einer wahren Tortur. Immer mehr und immer schneller wurde aus dem anfangs so freundlichen, aufmerksamen Rolf Lura ein Mann, der sich alles, was er wollte, mit Gewalt nahm.
Er verwaltete das gesamte Vermögen, sie selbst hatte bis vor einem halben Jahr kein eigenes Konto, keinen Einblick in die Kontoauszüge, er teilte ihr jeden Cent zu und verlangte, dass sie sämtliche Einkäufe belegte. Doch von einem Tag auf den andern war er wie ausgewechselt und ausnehmend großzügig, drückte ihr einfach tausend oder zweitausend Euro in die Hand und sagte, sie solle sich was Schönes dafür kaufen. Seit ziemlich genau einem halben Jahr tat er dies immer häufiger. Sie hatte das Gefühl, als wollte er damit sein schlechtes Gewissen beruhigen. Einen Teil dieses Geldes hatte sie bei einer kleinen Bank auf ein Sparbuch gebracht und irgendwann, so hoffte sie, würde es ausreichen, um mit Markus endlich dieser Hölle zu entfliehen. Er hatte ihr auch vor sechs Monaten zum Geburtstag einen BMW Z8 geschenkt, mit dem sie ihre Einkäufe erledigen konnte, während sie vorher immer ein Taxi nehmen und ihm anschließend die Belege vorlegen musste. Überhaupt ging irgendetwas mit ihm vor, für das sie keine Erklärung hatte. Er war seitdem nicht mehr so gewalttätig, auch wenn ihm dann und wann noch die Hand ausrutschte, aber es waren Schläge, die sie ertragen konnte. Die Stimmungswechsel wurden seltener, es gab öfter als in den Jahren zuvor Zeiten, in denen er regelrecht euphorisch und aufgedreht war. Doch das, was heute Abend geschehen war, ließ sie befürchten, dass er wieder in alte Verhaltensweisen verfiel.
Nachdem sie sich gewaschen und die Stelle, wo er in sie eingedrungen war, dick eingecremt hatte und die brennenden Unterleibsschmerzen ganz allmählich nachließen, ging sie zurück ins Schlafzimmer. Er saß auf der Bettkante, die Nachttischlampe brannte. Sie hatte sich ein Nachthemd übergezogen und legte sich auf ihre Seite.
»Ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen, ich wollte das eben nicht«, sagte er leise, schüttelte den Kopf und fuhr sich mit beiden Händen durch das immer lichter werdende Haar. »Ich weiß wirklich nicht, was auf einmal wieder in mich gefahren ist. Es wird nicht mehr vorkommen, das verspreche ich. Ich weiß, ich weiß, ich habe das schon so oft versprochen, aber die letzten Monate waren doch ganz schön, oder? Sag jetzt nichts, ich will einfach nur, dass du das von eben vergisst. Ich hatte einen miserablen Tag, wirklich, und irgendwie hab ich mich saumäßig gefühlt. Ich will doch nur, dass du glücklich bist, genau wie Markus. Verzeihst du mir diesen Ausrutscher?« Er legte sich hin, auf ihre Seite, und streichelte mit einer Hand ihr Gesicht.
»Ist schon gut«, sagte sie und starrte an die Decke. »Aber vielleicht solltest du doch mal überlegen, ob du nicht eine Therapie machen willst. Wir haben schon mal drüber gesprochen, und du …«
»Ich werde eine machen. Gleich morgen rufe ich bei einem Therapeuten an. Ich liebe dich, ich liebe dich wirklich über alles. Und allein der Gedanke, dich zu verlieren, macht mich krank. Ich will dich nicht verlieren, weil du für mich die beste Frau bist, die ich mir vorstellen kann. Und so was wie heute soll nicht mehr passieren, ich schwöre es bei Gott. Ich weiß, ich bin krank, ich muss krank sein. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich bin ein Kämpfer, und ich werde gegen meine Schwächen ankämpfen.«
»Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen.«
»Ich werde dich nicht enttäuschen, garantiert.« Er gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich möchte gerne in deinem Arm einschlafen«, sagte er.
Auch das war sie gewohnt, streckte ihren rechten Arm aus, und er legte seinen Kopf in die Achselhöhle. Er atmete ruhig und gleichmäßig, die Beine angezogen, der Körper zusammengerollt wie ein Embryo. Er benahm sich wie ein kleines Kind, bockig, jähzornig, und dann wieder suchte er ihre Wärme. Sie lag noch lange wach und starrte in die Dunkelheit, während er längst schlief. Es war fast ein Uhr, als auch ihr endlich die Augen zufielen.
Julia Durant stellte den Wagen nach einem langen und zermürbenden Arbeitstag in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung ab. Der brutale Mord an einem siebzigjährigen Rentner hatte sie und ihre Kollegen das ganze Wochenende und auch den Montag auf Trab gehalten. Ein Mord, so sinnlos wie ein Pickel am Arsch, wie Kullmer sarkastisch bemerkt hatte. Der Mann war am Donnerstag noch lebend gesehen worden. Er hatte zwei Brötchen und etwas Wurst sowie die obligatorische Zeitung und drei Zigarren gekauft. Ein stiller Mann, der seine Frau vor einem Jahr verloren hatte und jetzt allein in seinem schmucken Haus lebte. Unauffällig und ruhig. Ein pensionierter Finanzbeamter, bei den Nachbarn beliebt, der sich aber nach dem Tod seiner Frau zurückgezogen hatte. Lediglich seine Tochter kam dreimal in der Woche vorbei, um nach dem Rechten zu sehen und ihm beim Putzen und Aufräumen zur Hand zu gehen. Sie hatte ihren Vater am Freitagvormittag gefunden, der Schädel mit einem massiven Kerzenständer eingeschlagen, auf dem Teppich um den Kopf herum eine riesige Blutlache. Die Schubladen und Schränke waren durchwühlt worden, es fehlte Schmuck, ein paar Euro, die Zimmer sahen aus wie nach einem Bombenangriff. Die Haustür war nicht aufgebrochen, der Mann hatte den oder die Täter offenbar arglos eingelassen. Die Nachbarn in der Siedlung waren befragt worden, doch wie so oft hatte keiner etwas Außergewöhnliches gesehen oder gehört. Dabei war die Tat laut Rechtsmedizin gegen Mittag verübt worden, und in der Nachbarschaft wohnten vorwiegend ältere Menschen. Wenn der Polizei nicht Kommissar Zufall zu Hilfe kam, würden sie die Akten in einem, vielleicht auch erst in zwei Jahren als unerledigt schließen müssen.
Sie hatte es gerade noch geschafft, um kurz vor acht in den Supermarkt zu kommen und schnell ein paar notwendige Lebensmittel einzukaufen, eine Tüte geschnittenes Brot, ein Stück Butter, eine Dose Tomatensuppe, Salami und zwei Dosen Bier und an der Kasse eine Schachtel Gauloises, obwohl in der alten noch fünf Zigaretten waren und diese mit Sicherheit bis morgen Mittag reichen würden. Sie hatte nicht ganz mit dem Rauchen aufgehört, es jedoch geschafft, ihr Tagespensum von vierzig auf etwa zehn zu reduzieren, in Stresszeiten waren es auch mal ein paar mehr. Sie war stolz auf sich, es jetzt schon seit über einem halben Jahr durchzuhalten, und irgendwann würde sie ganz damit aufhören. Als sie den Sommerurlaub bei ihrer Freundin Susanne Tomlin in Südfrankreich verbrachte, hatte sie sogar einmal eine ganze Woche nicht geraucht. Aber dann kam der Alltag wieder und mit ihm der Griff zur Zigarette.
Im Briefkasten war keine Post wie meist am Montag. Sie stieg die Stufen nach oben, schloss die Tür auf und verzog die Mundwinkel, als sie die unaufgeräumte Wohnung, das ungespülte Geschirr, den seit zwei Wochen nicht gesaugten Boden sah. Sie wusste, es würde vielleicht eine halbe oder Dreiviertelstunde dauern, bis das Gröbste erledigt war, und nahm sich vor, es noch vor dem Abendessen zu tun. Sie fühlte sich selbst nicht wohl in dieser Unordnung. Sie hängte ihre Handtasche an die Stuhllehne und stellte die Einkaufstüte auf einen Stuhl. Dann streifte sie die Schuhe ab, ging ins Bad, um sich die Hände und das Gesicht zu waschen, und warf einen kurzen Blick in den Spiegel.
Während sie saugte, den Aschenbecher leerte, das Geschirr spülte und frische Luft von draußen hereinwehte, köchelte die Tomatensuppe auf kleiner Flamme vor sich hin. Die neueste CD von Bon Jovi hörte sie sich jetzt zum ersten Mal in voller Länge an. »Jungs, ihr habt schon bessere Musik gemacht, ihr werdet langsam alt«, sagte sie zur Stereoanlage, als sie, nachdem sie das Bett abgezogen und die Bezüge zusammen mit drei Handtüchern und etwas Unterwäsche in die Waschmaschine gestopft hatte, ein frisches Laken und Bezüge auf das Bett legte und zurück in den Küchenbereich ging. Sie sah sich um und war zufrieden. Ein Blick auf die Uhr, Viertel nach neun. Sie machte den Fernseher an, um ihre Lieblingsserie auf RTL zu schauen, Hinter Gittern, schmierte sich zwei Brote, legte auf eines vier kleine Salamischeiben und auf das andere Lachsschinken, nahm zwei Gurken aus dem Glas und schüttete die Tomatensuppe in den tiefen Teller. Bevor sie zu essen begann, schloss sie die Fenster, zog die Vorhänge zu, löschte das große Licht und machte die Stehlampe an.
Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie müde und erschöpft sie war, wie sehr dieser Tag und das zurückliegende Wochenende auf der Suche nach dem Mörder des alten Mannes sie geschlaucht hatten. Nach dem Essen lehnte sie sich zurück und zündete sich eine Zigarette an. In der ersten Werbepause klingelte das Telefon. Hellmer.
»Hi, ich will auch nicht lange stören. Nur so viel, wir haben eine heiße Spur. Ein Pfandleiher hat, kurz nachdem du weg bist, beim KDD angerufen und mitgeteilt, dass ein Achtzehnjähriger am Donnerstag Schmuck bei ihm versetzt hat, und zwar genau den Schmuck, der als gestohlen gemeldet wurde. Der Typ war so blöd, dass er auch noch seinen Ausweis vorgelegt hat. Er wird gerade abgeholt. Wohnt übrigens nicht weit von dem Alten entfernt.«
»Schön, dann lass das mal die Kollegen machen, ich bin müde. Und sollte es sich um den Täter handeln, sag mir Bescheid, aber erst morgen früh im Präsidium. Okay?«
»Schon gut, schon gut, ich wollte ja nur …«
»Gute Nacht und bis morgen«, sagte sie und legte einfach auf. Sie holte sich eine Dose Bier aus dem Kühlschrank und trank in kleinen Schlucken. Achtzehn Jahre, dachte sie und schüttelte den Kopf. Wenn er’s wirklich war, dann wird er aller Wahrscheinlichkeit nach noch nach Jugendstrafrecht verurteilt und kommt für maximal zehn Jahre in den Bau. Scheißspiel. So, und jetzt hör auf, darüber nachzudenken, bringt eh nichts.
Sie bezog das Bett, schaute sich noch einen Bericht in Extra an und ließ in einer weiteren Werbepause Wasser in die Wanne laufen. Um spätestens halb zwölf wollte sie in der Falle liegen und würde hoffentlich schnell einschlafen. Sie nahm die noch halb volle Dose Bier mit ins Bad, legte sich ins Wasser und schloss für einen Moment die Augen. Ein halbes Jahr war vergangen, seit sie zuletzt einen Mann gehabt hatte. Ein verdammt langes halbes Jahr. Am Wochenende würde sie sich schön machen und mal wieder in ihre Bar gehen und dort vielleicht einen Mann kennen lernen. Vielleicht. Sie trocknete sich ab, trank die Dose leer und putzte sich die Zähne. Um halb zwölf schlief sie ein.
Julia Durant hatte tief und fest geschlafen, fühlte sich aber dennoch nicht ausgeruht. Seit Wochen schon plagten sie Albträume, am häufigsten jener, in dem sie verzweifelt einem Zug nachrannte, ihn aber nicht mehr erreichte. Dabei wusste sie nicht einmal, weshalb sie diesen Zug unbedingt nehmen wollte oder musste, es war einfach nur erschreckend, als sie am Ende allein auf dem Bahnsteig stand und dem Zug hinterhersah. Ihr Leben war nicht in Ordnung, und mit jedem Monat mehr, der verging, meinte sie ihre Zeit vertan zu haben. Die Einsamkeit, die nur durch den Dienst unterbrochen wurde, zermürbte sie von Tag zu Tag mehr. Sie ging allein zu Bett und stand genauso allein wieder auf. Niemand, der sie in den Arm nahm, der mit ihr frühstückte oder mit dem sie am Abend vor dem Fernseher sitzen konnte. Immer öfter dachte sie, dass ihr Leben ein einziger Trümmerhaufen war, doch sie hatte keine Ahnung, wie sie auch nur das Geringste daran ändern konnte. Vor allem jetzt, mit dem Einsetzen des Herbstes, verfiel sie, wenn sie abends nach Hause kam, in eine depressiv-melancholische Stimmung, fing aus unerklärlichen Gründen an zu weinen und trank, um den Weltschmerz zu bekämpfen, gleich mehrere Dosen Bier hintereinander. Es war keine Lösung, das wusste sie, aber es gab niemanden, der ihr helfen konnte. Sie allein war für ihr Leben verantwortlich, und nur sie konnte etwas an ihrer verfahrenen Situation ändern.
Sie öffnete das Wohnzimmerfenster. Der Himmel war trüb und würde bald Regen bringen, die Temperatur war der Jahreszeit angemessen kühl. Während sie die Zeitung überflog, löffelte sie Cornflakes mit Zucker und Milch und trank zwei Tassen Kaffee. Auf die obligatorische Zigarette nach dem Frühstück wollte sie aber nicht verzichten, rauchte in aller Ruhe und bereitete sich innerlich auf den bevorstehenden Tag vor.
Als sie im Präsidium ankam, saß Berger bereits hinter seinem Schreibtisch, der jedoch schon in vier bis sechs Wochen im neuen Präsidium stehen würde. Ein Umzug, an den keiner ihrer Kollegen gerne dachte. Ihre Abteilung sollte mit zu den Ersten gehören, die umziehen würden. Sie kannte die neuen Büros schon, jedes eine perfekte Kopie des andern. Die Wände altweiß, dunkelgraue Lamellen an den Fenstern, ahornfarbene Einbauschränke, die sich die ganze Wand entlangzogen, hellgraue Schreibtische, hellgraue Sideboards, grauschwarzer PVC-Boden mit lauter hellen Pünktchen darauf, die aussahen, als wären tausende von Kippen darauf ausgetreten worden. Etwa hundertfünfzig bis zweihundert Meter lange Gänge im Karree, acht Innenhöfe mit langen Verbindungsröhren zwischen den einzelnen Komplexen und, und, und … Unpersönlich, steril, leblos. Aber es gab auch viele, denen das neue Präsidium gefiel. Sie allerdings würde lange brauchen, bis sie sich an die neue Umgebung gewöhnt haben würde, zu sehr hatte sie das alte Präsidium lieb gewonnen. Aber vielleicht hing dies auch nur damit zusammen, dass sie ein nostalgischer Mensch war und gerne in Erinnerungen schwelgte.
»Guten Morgen«, sagte Berger und schaute auf. Er schlug die Bild-Zeitung zu und faltete sie zusammen. Fast ein Jahr war seit seiner Heirat vergangen, und er sah seitdem jünger und dynamischer aus. Die große Trauer über den Verlust seiner Frau und seines Sohnes war verflogen, seine jetzige Frau Marcia war zwölf Jahre jünger, eine reizende und auf eine subtile Weise resolute Person, die ihm wieder jenen Lebensmut gegeben hatte, den er zwischenzeitlich verloren zu haben schien. Sie zeigte ihm, welchen Wert das Leben hatte, wie schön es sein konnte, wenn man es nicht allein verbrachte. Noch immer besuchte er regelmäßig den Friedhof in Sossenheim, wo sich das Grab seiner Frau und seines Sohnes befand, noch immer brachte er Blumen hin, setzte im Frühjahr und manchmal auch noch einmal im Sommer frische Pflanzen in die Erde, aber seit dem Moment, in dem sie sich näher gekommen waren, wurde er dabei von Marcia begleitet, die ihn aus seiner Isolation gerissen hatte. Bergers Tochter Andrea, die Psychologie studierte und ihren eigenen Worten zufolge eine Karriere als Kriminalpsychologin, vielleicht sogar als Profilerin anstrebte, hatte die Neue vom ersten Moment an ins Herz geschlossen und freute sich mit ihrem Vater über dessen wiedergewonnenes Glück.
»Morgen«, sagte Durant und setzte sich. »Hellmer hat mich gestern Abend noch angerufen und …«
»Ja, ja, ich weiß. Wir haben den jungen Mann. Er war’s …«
»Hat er schon gestanden?«, unterbrach sie Bergers Ausführungen.
»Das nicht, aber es spricht alles gegen ihn. Der Pfandleiher hat seine Personalien aufgenommen, der Schmuck wurde gleich nachdem er angerufen hat, dort abgeholt und der Tochter vorgelegt, die ihn eindeutig identifiziert hat. Außerdem macht die KTU noch Abgleiche von Fingerabdrücken et cetera. Würde mich wundern, wenn die nichts finden. Sie wollen sich doch bestimmt mit dem Bürschchen unterhalten, oder?«, fragte Berger und lehnte sich zurück.
»Gleich. Gibt’s sonst irgendwas Neues?«
»Reicht das nicht?«, entgegnete Berger und strich sich über den ehemals so gewaltigen Bauch, der jetzt nur noch ein Bäuchlein war. Zweiundvierzig Kilo hatte er in den letzten anderthalb Jahren abgenommen. Er hatte es selbst vor kurzem stolz verkündet, wobei er zugab, dass er dies ausschließlich der Liebe zu verdanken hatte. Er rauchte nicht mehr, trank nur noch Wasser und ernährte sich anscheinend sehr gesund.
»Doch, schon. Wo ist er?«
»Noch in seiner Zelle. Es war allerdings auch schon ein Anwalt hier, der ziemlichen Rabatz gemacht haben soll. Sie kennen das ja. Die Eltern schwören Stein und Bein, dass ihr Sohn nie zu einer solch schrecklichen Tat fähig wäre. Es müsse sich um ein Missverständnis handeln. Wer’s glaubt!«
»Ich kümmere mich um ihn«, sagte Durant und erhob sich. »Bei mir werden die Leute in der Regel gesprächig.«
Sie rief einen Beamten aus dem Zellentrakt an, um den Tatverdächtigen in ihr Büro zu bringen. Fünf Minuten später wurde der junge Mann hereingeführt. Sie schloss die Verbindungstüren zu den anderen Büros und setzte sich hinter ihren Schreibtisch, nahm die Akte, schlug sie auf, überflog die Personalangaben und sah den jungen Mann an. Er war etwa einsachtzig, sehr schlank, sein blondes Haar war kurz geschnitten, und er hatte blaue Augen. Er wirkte verschüchtert und übernächtigt. Kein Wunder, dachte Durant, auf dieser Holzpritsche könnte ich auch kein Auge zumachen. Dem Blick von Julia Durant wich er aus, als würde er sich schämen.
»Herr Scheffler, ich bin Hauptkommissarin Durant und leite die Ermittlungen im Mordfall Beck. Deshalb sind Sie auch hier. Meine Kollegen haben Sie sicherlich schon informiert, dass die Wohnung von Herrn Beck noch einmal eingehend auf Spuren untersucht wird, die belegen sollen, dass Sie dort waren. Haben Sie ihn getötet?«
Scheffler schluckte und schüttelte den Kopf.
»Soll ich das als ein Nein verstehen?«, fragte Durant.
»Ich war’s nicht, ich schwör’s«, sagte Scheffler.
»Und wie kommen Sie dann zu dem Schmuck?« Durant beugte sich nach vorn und versuchte in dem Gesicht ihres Gegenübers zu lesen. Alles, was sie sah, war Angst.
»Jemand hat ihn mir gegeben.«
»So, jemand hat Ihnen den Schmuck also gegeben. Einfach so. Sie wollen mich doch hier nicht auf den Arm nehmen, oder? Denken Sie sich bitte eine bessere Geschichte aus. Oder nennen Sie mir den Namen des großen Unbekannten.«
»Ich habe Herrn Beck nicht umgebracht, bitte glauben Sie mir …«
»Warum sollte ich Ihnen das glauben? Solange Sie nicht den Mund aufmachen, sind Sie für mich ein kaltblütiger Mörder. Sie haben die Tat geplant, Herrn Beck brutal ermordet und ihn ausgeraubt.« Sie machte eine Pause. Scheffler hielt den Blick zu Boden gesenkt.
Er hat Angst, dachte Durant, panische Angst. Aber wovor? »Sie haben also nicht mit einem Kerzenständer mehrmals auf den wehrlosen alten Mann eingeschlagen, bis das Gehirn aus dem Schädel quoll? Warten Sie, ich zeige Ihnen die Bilder vom Tatort.« Sie schlug die Akte nochmals auf, drehte sie um und legte die Tatortfotos nebeneinander. »Schauen Sie genau hin, das ist Ihr Werk. Kein Mensch möchte auf eine solch bestialische Weise sterben. Also, ich höre.«
»Ich könnte niemals einen Menschen umbringen«, sagte er leise und mit Tränen in den Augen, nachdem er einen kurzen Blick auf die Fotos geworfen hatte.
»Das sagen alle, die von sich meinen, die Polizei würde ihnen schon nicht auf die Schliche kommen …«
»Ich war’s aber nicht!«, schrie er mit sich überschlagender Stimme. »Warum glaubt mir denn keiner?«
»Weil Sie meinen Kollegen und mir bisher keinerlei Anlass dafür gegeben haben.« Sie zündete sich eine Zigarette an und hielt Scheffler die Schachtel hin, der nur den Kopf schüttelte. »Gut, ich werde Ihnen jetzt etwas sagen. Selbst wenn unsere Spezialisten keine Hinweise finden, dass Sie in der Wohnung waren, bleiben Sie dennoch der einzige Tatverdächtige, weil Sie im Besitz des Schmucks waren und ihn bei einem Pfandleiher versetzt haben. Sie werden so oder so verurteilt, es sei denn, Sie haben den Schmuck im Auftrag einer anderen Person versetzt. Gibt es eine solche Person?«
»Ich konnte doch nicht wissen, dass an dem Zeug Blut klebt«, stieß er hervor. »Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich so was niemals gemacht.«
»Wer hat Ihnen den Schmuck gegeben? Ein Freund? Ein Bekannter? Oder sind Sie unter Druck gesetzt worden?«
»Mein Vater hat gemeint, ich soll nichts ohne meinen Anwalt sagen.«
»Ach kommen Sie«, entgegnete Durant, stand auf und stellte sich mit dem Rücken ans Fenster. »Der Anwalt hält Sie für schuldig, und auch Ihr Vater scheint wohl der Auffassung zu sein, dass Sie den alten Mann umgebracht haben, sonst hätte er nicht gleich einen Anwalt eingeschaltet. Doch irgendwie kann ich mir das bei Ihnen nicht vorstellen. Sie sind einfach nicht der Typ für so was. Aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie mit der Sprache rausrücken. Wissen Sie, was Ihnen passiert, wenn Sie auspacken?« Sie machte erneut eine Pause und sah Scheffler direkt an, der zum ersten Mal den Kopf hob und ihn schüttelte. »Nichts. Rein gar nichts, vorausgesetzt, Sie haben Herrn Beck nicht umgebracht. Erzählen Sie mir einfach, was sich abgespielt hat.«
Scheffler schüttelte daraufhin immer wieder den Kopf und fuhr sich mit beiden Händen durch die kurzen Haare. »Die bringen mich um«, sagte er schließlich mit bebender Stimme.
»Gehen Sie noch zur Schule?«, fragte Durant, die letzte Bemerkung von Scheffler ignorierend.
»Ja.«
»Gymnasium also. Zwölfte Klasse?«
»Dreizehnte.«