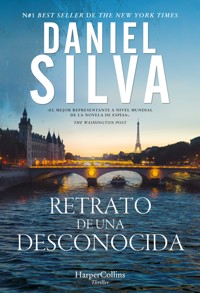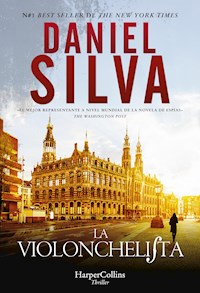11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gabriel Allon
- Sprache: Deutsch
Ein zwölfjähriges Mädchen wird auf ihrem Schulweg brutal entführt. Gabriel Allon, legendärer Agent und mittlerweile Leiter des israelischen Geheimdienstes, wird um Hilfe gebeten. Und zwar von niemand Geringerem als Khalid bin Mohammed, dem saudischen Kronprinzen. Vom Westen ursprünglich als Hoffnungsträger gefeiert, betrachtet Gabriel ihn jedoch nicht erst seit dem Bekanntwerden seines skrupellosen Vorgehens gegen Kritiker mit Argwohn. Es gibt in seinem Land viele, die bin Mohammed die neue Macht neiden, und noch mehr, die an den alten fundamentalistischen Wegen festhalten wollen. Angesichts seines eigenen tragischen Verlustes entschließt Gabriel sich, zu helfen, aber nicht zu vertrauen. Und so beginnen die ungleichen Partner mit der Jagd auf die Entführer.
»Es war schwer vorstellbar, dass Silva sich nach Der russische Spion selbst übertreffen könnte – doch ihm ist genau das gelungen.«
The Real Book Spy
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Daniel Silva
Das Vermächtnis
Spionagethriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Wulf Bergner
HarperCollins
HarperCollins®
Copyright © 2020 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Copyright © 2019 by Daniel Silva Originaltitel: »The New Girl« Erschienen bei: Harper, New York
Published by arrangement with Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Covergestaltung: bürosüd, München Coverabbildung: GettyImages / narvikk E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959675802
www.harpercollins.de
Werden Sie Fan von HarperCollins Germany auf Facebook!
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberinnen und Urheber und des Verlags bleiben davon unberührt.
Für die 54 Journalisten, die im Jahr 2018 weltweit ermordet wurden.
Und wie immer für meine Frau Jamie und meine Kinder Nicholas und Lily.
Was geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen.
MACBETH (1606), 5. Aufzug, 1. Szene
VORWORT
Im August 2018 begann ich mit der Arbeit an einem Roman über einen kämpferischen jungen arabischen Prinzen, der sein religiös intolerantes Land modernisieren und dabei den Nahen Osten und die gesamte islamische Welt umkrempeln will. Zwei Monate später legte ich das Manuskript jedoch beiseite, als das Vorbild für diese Figur, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, in die brutale Ermordung von Jamal Khashoggi, einem saudischen Regimekritiker und Kolumnisten der Washington Post, verwickelt war. Teile von Das Vermächtnis sind ganz offensichtlich von den Umständen von Khashoggis Tod inspiriert. Alles Übrige passiert nur in der imaginären Welt, die von Gabriel Allon, seinen Mitstreitern und seinen Feinden bewohnt wird.
TEIL EINSENTFÜHRUNG
1 GENF
Es war Beatrice Kenton, die die Identität der neuen Schülerin als Erste infrage stellte. Das tat sie im Lehrerzimmer, um Viertel nach drei an einem Freitag Ende November. Wie an den meisten Freitagnachmittagen war die Stimmung ausgelassen und leicht rebellisch. Es wird niemanden überraschen, dass keine Berufsgruppe das Ende der Arbeitswoche begeisterter begrüßt als Lehrer – selbst Lehrer an Eliteschulen wie der International School in Genf. Geschwatzt wurde über Pläne fürs Wochenende. Beatrice beteiligte sich nicht daran, denn sie hatte keine, was ihre Kollegen nicht zu wissen brauchten. Sie war zweiundfünfzig, unverheiratet und hatte praktisch keine Angehörigen außer einer reichen alten Tante, die ihr jeden Sommer auf ihrem Landsitz in Norfolk Zuflucht gewährte. Ihre Wochenendroutine bestand aus einem Großeinkauf im Migros und einem Spaziergang am See zugunsten ihrer Taille, die sich wie das Universum ständig ausdehnte. Die erste Stunde am Montagmorgen war eine Oase in ihrem Leeren Viertel der Einsamkeit.
Die von einer längst eingegangenen Organisation zur Förderung von Multilateralismus gegründete Geneva International unterrichtete die Kinder des hiesigen Diplomatenkorps. Die Mittelschule, an der Beatrice Literatur und Aufsatz unterrichtete, besuchten Schüler aus über hundert Nationen. Die Lehrerschaft war ähnlich vielfältig zusammengesetzt. Der Personalchef gab sich große Mühe, um den Zusammenhalt des Lehrkörpers zu fördern – Cocktailpartys, Abendessen, zu denen jeder Gast eine Speise mitbrachte, Exkursionen –, aber im Lehrerzimmer setzte sich der alte Tribalismus immer wieder durch. Die Deutschen hockten mit Deutschen zusammen, die Franzosen mit Franzosen, die Spanier mit Spaniern. An diesem Freitagnachmittag war Miss Kenton außer der Geschichtslehrerin Cecilia Halifax die einzige anwesende britische Untertanin. Cecilia hatte eine wilde schwarze Mähne und vorhersehbare politische Überzeugungen, mit denen sie Miss Kenton bei jeder sich bietenden Gelegenheit beglückte. Cecilia vertraute Miss Kenton auch Einzelheiten der heißen Affäre an, die sie mit Kurt Schröder hatte, dem Birkenstock tragenden Mathegenie aus Hamburg, das eine gut bezahlte Position in der Industrie aufgegeben hatte, um Elfjährige in Mathematik zu unterrichten.
Das Lehrerzimmer lag im Erdgeschoss des Châteaus aus dem 18. Jahrhundert, das als Verwaltungsgebäude der Schule diente. Seine Bleiglasfenster führten auf den Innenhof hinaus, auf dem jetzt die privilegierten Schüler der Geneva International in deutsche Luxuslimousinen mit Diplomatenkennzeichen stiegen. Die redselige Cecilia Halifax hatte sich neben Beatrice gesetzt. Sie schwatzte irgendetwas von einem Skandal in London, in den der MI6 und eine russische Spionin verwickelt sein sollten. Beatrice hörte kaum zu. Sie beobachtete die neue Schülerin.
Wie gewöhnlich war sie bei diesem täglichen Exodus die Letzte: eine elfenhafte Zwölfjährige, bereits eine Schönheit, mit ausdrucksvollen braunen Augen und rabenschwarzem Haar. Zu Beatrices großem Bedauern gab es an der Geneva International keine Schuluniform, nur einen Dresscode, den einige Freigeister unter den Schülern ignorierten, ohne dass das offizielle Sanktionen nach sich gezogen hätte. Nicht jedoch die Neue. Sie war von Kopf bis Fuß in teure Wolle und Plaids gekleidet, wie man sie in der Burberry Boutique bei Harrods sah. Statt eines Nylonrucksacks trug sie eine Schultasche aus Leder. Ihre Ballerinas aus Lackleder glänzten makellos. Sie war proper, die Neue, und bescheiden. Aber sie hatte noch etwas anderes an sich, fand Beatrice. Sie war aus einem anderen Holz geschnitzt. Sie wirkte königlich. Ja, das war das richtige Wort. Königlich …
Sie war einige Wochen nach Beginn des Schuljahrs im Herbst hergewechselt – nicht ganz ideal, aber an dieser Schule, deren Elternschaft wie die Wasser der Rhône fluktuierte, die natürlichste Sache der Welt. David Millar, der Direktor, hatte sie in Beatrices dritte Stunde gesteckt, die mit zwei zusätzlichen Schülern ohnehin schon überfüllt war. Die Kopie ihrer Personalakte, die er ihr gab, war selbst nach den Normen der Geneva International recht dürftig. Darin stand, die Neue heiße Jihan Tantawi und sei Ägypterin, deren Vater kein Diplomat, sondern Geschäftsmann sei. Ihr Notendurchschnitt war in keiner Weise außergewöhnlich. Sie galt als aufgeweckt, aber auf keinem Gebiet besonders talentiert. »Ein Jungvogel, der bald flügge sein wird«, hatte David in einer heiteren Randbemerkung notiert. Tatsächlich war das einzig Bemerkenswerte an dieser Akte die Eintragung im Feld »spezielle Bedürfnisse des Schülers/der Schülerin«. Die Familie Tantawi schien sehr großen Wert auf Diskretion zu legen. Sicherheitsmaßnahmen, hatte David geschrieben, hätten einen sehr hohen Stellenwert.
Deshalb war an diesem Nachmittag – wie an allen anderen Nachmittagen auch – der kompetente Sicherheitschef der Geneva International auf dem Pausenhof. Lucien Villard war ein Import aus Frankreich, ein Veteran des Service de Protection, der für den Schutz wichtiger ausländischer Besucher und hoher französischer Beamter zuständig war. In seiner letzten Position hatte er im Elysée-Palast zu den Personenschützern des französischen Präsidenten gehört. David Millar benützte Luciens beeindruckenden Lebenslauf als Beweis für das Sicherheitsbewusstsein der Schule. Jihan Tantawi war nicht die Einzige mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.
Aber niemand kam in die Geneva International oder verließ sie mit so großem Gefolge wie die Neue. Der schwarze Mercedes, in den sie schlüpfte, hätte einem Präsidenten oder Potentaten angestanden. Obwohl Beatrice nicht allzu viel von Autos verstand, vermutete sie, die Limousine sei gepanzert, ihre Scheiben schussfest. Hinter ihr folgte ein zweiter Wagen, ein mit vier finsteren Schlägertypen in dunklen Anzügen besetzter Range Rover.
»Wer sie wohl ist?«, fragte Beatrice sich, als sie beobachtete, wie die beiden Wagen auf die Straße hinausfuhren.
Cecilia Halifax war einen Augenblick lang verwirrt. »Die russische Spionin?«
»Die Neue«, stellte Beatrice richtig. Dann fügte sie zweifelnd hinzu: »Jihan.«
»Ihrer Familie soll halb Kairo gehören.«
»Wer sagt das?«
»Veronica.« Die heißblütige Spanierin Veronica Alvaret war Zeichenlehrerin und als Verbreiterin wilder Gerüchte innerhalb des Lehrkörpers beinahe so unzuverlässig wie Cecilia selbst. »Sie sagt, dass ihre Mutter mit dem ägyptischen Präsidenten verwandt ist. Seine Nichte. Oder vielleicht seine Cousine.«
Beatrice verfolgte, wie Lucien Villard den Hof überquerte. »Weißt du, was ich glaube?«
»Was denn?«
»Ich denke, dass hier jemand lügt.«
Und so geschah es, dass Beatrice Kenton, eine schlachtgestählte Veteranin mehrerer kleinerer britischer Privatschulen, die auf der Suche nach Liebe und Abenteuer nach Genf gekommen war und nichts dergleichen gefunden hatte, gänzlich private Ermittlungen aufnahm, um die Identität der neuen Schülerin festzustellen. Sie begann damit, dass sie den Namen JIHANTANTAWI in das weiße Kästchen der Suchmaschine ihres Browsers eingab. Auf dem Bildschirm erschienen mehrere Tausend Einträge, von denen jedoch keiner die bildhübsche Zwölfjährige betraf, die jeden Morgen in der dritten Stunde in Beatrices Klassenzimmer kam – nie auch nur eine Minute zu spät.
Als Nächstes durchforschte sie die verschiedenen sozialen Medien, ohne jedoch die geringste Spur ihrer Schülerin zu finden. Die Neue schien das einzige Mädchen auf Gottes weiter Erde zu sein, das kein Parallelleben im Cyberspace führte. Das fand Beatrice löblich, denn sie hatte die emotional schädlichen und entwicklungshemmenden Folgen unaufhörlicher Textnachrichten, Tweets und geteilter Fotos aus erster Hand miterlebt. Leider war dieses Verhalten nicht nur auf Kinder beschränkt. Cecilia Halifax konnte kaum aufs Klo gehen, ohne ein retuschiertes Foto von sich selbst auf Instagram zu posten.
Der Vater, ein gewisser Adnan Tantawi, blieb im Cyberreich ebenso anonym. Beatrice fand einige Hinweise auf Unternehmen wie Tantawi Construction und Tantawi Holdings und Tantawi Development, aber nichts über den Mann selbst. In Jihans Akte war eine Adresse in der eleganten Rue de Lausanne angegeben. An einem Samstagnachmittag machte Beatrice einen Spaziergang dorthin. Die Adresse war nur wenige Häuser von der Villa des bekannten Schweizer Großindustriellen Martin Landesmann entfernt. Wie viele Grundstücke in diesem schicken Viertel war es von hohen Mauern umgeben und durch Überwachungskameras gesichert. Beatrice spähte durch die Gitterstäbe des schmiedeeisernen Tors und sah einen manikürten Rasen, der sich bis zum Säulenvordach einer prunkvollen Villa im italienischen Stil erstreckte. Sofort kam ein Mann ihr auf der Zufahrt entgegengelaufen, zweifellos einer der Schlägertypen aus dem Range Rover. Er versuchte nicht einmal, die Tatsache zu verbergen, dass er unter seinem Jackett eine Pistole trug.
»Propriété privée!«, brüllte er mit starkem Akzent auf Französisch.
»Excusez-moi«, murmelte Beatrice und ging rasch weiter.
Die nächste Phase ihrer Nachforschungen begann am folgenden Montagmorgen, als sie damit begann, ihre geheimnisvolle neue Schülerin drei Tage lang genau zu beobachten. Sie bemerkte, dass Jihan manchmal nur langsam reagierte, wenn sie im Unterricht aufgerufen wurde. Sie bemerkte auch, dass Jihan seit ihrem Eintritt keine Freundschaften geschlossen hatte – und das auch weiterhin nicht versuchte. Beatrice stellte auch fest – während sie vorgab, einen ziemlich langweiligen Aufsatz in höchsten Tönen zu loben –, dass Jihan kaum etwas über Ägypten wusste. Sie wusste, dass Kairo eine Großstadt war, durch die ein Fluss strömte, aber nicht viel mehr. Ihr Vater, sagte sie, sei sehr reich. Er baute Wohnhochhäuser und Bürotürme. Außerdem war er ein Freund des ägyptischen Präsidenten, aber die Muslimbruderschaft mochte ihn nicht, deshalb lebten sie in Genf.
»Klingt völlig vernünftig, finde ich«, sagte Cecilia.
»Es klingt«, antwortete Beatrice, »wie etwas, das jemand sich ausgedacht hat. Ich bezweifle, dass sie jemals in Kairo war. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie eine Ägypterin ist.«
Als Nächstes konzentrierte Beatrice ihre Aufmerksamkeit auf die Mutter. Die bekam sie hauptsächlich durch die getönten Panzerglasscheiben der Limousine oder bei den seltenen Gelegenheiten zu sehen, wenn sie vom Rücksitz glitt, um Jihan auf dem Hof zu begrüßen. Sie hatte einen helleren Teint als Jihan und dunkelbraunes Haar – attraktiv, fand Beatrice, aber nicht ganz in Jihans Klasse. Tatsächlich fiel es Beatrice schwer, die geringste Familienähnlichkeit zwischen den beiden zu erkennen. Auch ihr Umgang miteinander war auffällig kühl. Kein einziges Mal beobachtete sie einen Wangenkuss oder eine herzliche Umarmung. Sie entdeckte auch ein deutliches Machtungleichgewicht. Von den beiden hatte Jihan, nicht die Mutter, die Oberhand.
Als der November in den Dezember überging und die Weihnachtsferien bevorstanden, schmiedete Beatrice einen Plan für ein Gespräch mit der abweisenden Mutter ihrer geheimnisvollen Schülerin. Den Vorwand dafür lieferte Jihans Ergebnis in einem Test zur Prüfung ihres englischen Wortschatzes – im unteren Drittel der Klasse, aber weit besser als der junge Callahan, der als Sohn eines US-Diplomaten angeblich ein Muttersprachler war. Beatrice schrieb eine E-Mail, in der sie Madame Tantawi um ein Gespräch bat, wann es ihr Terminkalender zuließ, und schickte sie an die Adresse in Jihans Akte. Als mehrere Tage ohne Antwort vergingen, schickte sie sie noch mal. Das trug ihr einen milden Tadel von David Millar ein. Madame Tantawi wünschte offenbar keinen direkten Kontakt mit Jihans Lehrern. Beatrice sollte ihre Bedenken in einer E-Mail an den Direktor zusammenfassen, und David würde sie dann mit Madame Tantawi besprechen. Beatrice vermutete, er kenne Jihans wahre Identität, aber sie versuchte nicht einmal andeutungsweise, dieses Thema anzusprechen. Es war leichter, einem Schweizer Bankier Geheimnisse zu entlocken als dem vorbildlich diskreten Direktor der Geneva International School.
Also blieb nur der Franzose Lucien Villard übrig, der den Sicherheitsdienst der Schule leitete. Beatrice suchte ihn eines Nachmittags während ihrer Freistunde auf. Er hatte sein Büro im Keller neben der Besenkammer, die dem verschlagenen Russen gehörte, der die Computer am Laufen hielt. Lucien war schlank und durchtrainiert und wirkte jünger als die meisten Achtundvierzigjährigen. Die Hälfte aller Lehrerinnen war scharf auf ihn, auch Cecilia Halifax, die sich mal vergeblich um Lucien bemüht hatte, bevor sie ihr Sandalen tragendes teutonisches Mathegenie erhört hatte.
»Entschuldigung«, sagte Beatrice mit gespielter Nonchalance am Rahmen von Luciens offener Bürotür lehnend, »aber ich frage mich, ob ich Sie kurz wegen des neuen Mädchens sprechen könnte.«
Lucien betrachtete sie über seinen Schreibtisch hinweg kühl. »Jihan? Wieso?«
»Weil ich mir Sorgen um sie mache.«
Lucien legte einige Papiere auf das Smartphone auf seiner Schreibunterlage. Beatrice war sich nicht ganz sicher, aber dies schien ein anderes Modell zu sein als das Handy, das er sonst benutzt. »Es ist mein Job, mir Sorgen um Jihan zu machen, Miss Kenton. Nicht Ihrer.«
»Das ist nicht ihr wirklicher Name, stimmt’s?«
»Wie kommen Sie nur auf diese Idee?«
»Ich bin ihre Lehrerin. Lehrer sehen Dinge.«
»Offenbar haben Sie die Anmerkungen in Jihans Akte über unbedachte Äußerung und Verbreitung von Gerüchten nicht genau gelesen. Ich würde Ihnen raten, sich genau an diese Anweisungen zu halten. Sonst wäre ich leider gezwungen, diese Sache Monsieur Millar zu melden.«
»Entschuldigung, ich wollte niemals …«
Lucien unterbrach sie, indem er eine Hand hob. »Keine Sorge, Miss Kenton. Dies bleibt entre nous.«
Zwei Stunden später, als die Sprösslinge der globalen diplomatischen Elite über den Innenhof des Châteaus watschelten, beobachtete Beatrice sie durch die Bleiglasfenster des Lehrerzimmers. Wie immer gehörte Jihan zu den Letzten, die das Gebäude verließen. Nein, dachte Beatrice, nicht Jihan. Das neue Mädchen … Die Kleine hüpfte leichtfüßig übers Pflaster des Schlosshofs, schwang ihre Ledertasche und schien Lucien Villard, der sie begleitete, kaum wahrzunehmen. Die Frau erwartete sie an der offenen hinteren Tür der Limousine stehend. Die Neue ging an ihr vorbei, fast ohne sie eines Blickes zu würdigen, und warf sich auf den Rücksitz. Dies war das letzte Mal, dass Beatrice sie zu Gesicht bekam.
2 NEW YORK
In dem Augenblick, als Brady Boswell den zweiten Belvedere Martini bestellte, wusste Sarah Bancroft, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Sie lunchten im Casa Lever, einem hochpreisigen Italiener in der Park Avenue, der mit Warhol-Drucken aus der großen Sammlung seines Besitzers ausgestattet war. Brady Boswell hatte ihn vorgeschlagen. Als Direktor eines bescheidenen, aber angesehenen Museums in St. Louis kam er zweimal im Jahr nach New York, um die großen Auktionen mitzuerleben und sich an den kulinarischen Genüssen der Stadt zu erfreuen – gewöhnlich auf Kosten anderer. Sarah war das perfekte Opfer. Dreiundvierzig, blond, blauäugig, brillant und unverheiratet. Noch wichtiger war, was in der inzestuösen New Yorker Kunstwelt jeder wusste: dass sie Zugang zu unbegrenzten Geldmitteln hatte.
»Wollen Sie mir nicht doch Gesellschaft leisten?«, fragte Boswell, als er das neue Glas an seine feuchten Lippen hob. Er hatte ein blasses, schwach lachsrosa gefärbtes Gesicht und eine Glatze, die er mit sorgfältig drübergekämmten grauen Haaren zu kaschieren versuchte. Seine Fliege saß ebenso schief wie seine Schildpattbrille. Hinter ihr blinzelte ein wässriges Augenpaar. »Ich hasse es wirklich, allein zu trinken.«
»Es ist ein Uhr mittags.«
»Sie trinken zum Lunch keinen Alkohol?«
Heutzutage nicht mehr, aber die Versuchung war groß, ihren Schwur, tagsüber abstinent zu sein, zu brechen.
»Ich fliege nach London«, verkündete Boswell.
»Wirklich? Wann denn?«
»Morgen Abend.«
Nicht früh genug, dachte Sarah.
»Sie haben dort studiert, nicht wahr?«
»Am Courtauld«, sagte Sarah defensiv nickend. Sie hatte keine Lust, das Mittagessen damit zu verbringen, ihren Lebenslauf zu schildern. Wie die Höhe ihres Spesenkontos gehörte er in der New Yorker Kunstwelt zum Allgemeinwissen. Zumindest ein Teil davon.
Als Absolventin des Dartmouth Colleges hatte Sarah Bancroft am berühmten Courtauld Institute of Art in London Kunstgeschichte studiert, bevor sie in Harvard promoviert worden war. Ihre teure Ausbildung, die ihr Vater, ein Investmentbanker bei der Citigroup, allein bezahlt hatte, brachte ihr den Posten einer Kuratorin der Phillips Collection in Washington ein, für den sie fast kein Gehalt bekam. Sie verließ die Phillips unter merkwürdigen Umständen und verschwand wie ein von einem geheimnisvollen japanischen Bieter ersteigerter Picasso aus dem Blick der Öffentlichkeit. In dieser Zeit arbeitete sie für die Central Intelligence Agency und führte zwei Geheimaufträge für einen legendären israelischen Agenten namens Gabriel Allon aus. Jetzt war sie nominell beim Museum of Modern Art angestellt, wo sie die Hauptattraktion des MoMA betreute – eine erstaunliche Sammlung moderner und impressionistischer Werke im Werte von fünf Milliarden Dollar aus dem Nachlass von Nadia al-Bakari, der Tochter des märchenhaft reichen saudischen Investors Zizi al-Bakari.
Das erklärte zum Teil, weshalb Sarah überhaupt mit Leuten wie Brady Boswell zum Essen ging. Sie hatte sich in letzter Zeit bereit erklärt, dem Los Angeles County Museum of Art einige weniger wichtige Werke aus der Sammlung als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Boswell wollte als Nächster an der Reihe sein. Aber das war ausgeschlossen, wie er recht gut wusste. Sein Museum war nicht renommiert, nicht prominent genug. Nachdem sie endlich ihr Essen bestellt hatten, verschoben sie die unvermeidliche Ablehnung, indem sie Small Talk machten. Sarah war erleichtert. Sie mochte keine Auseinandersetzungen, davon hatte sie für ein Leben lang genug. Sogar für zwei Leben.
»Neulich habe ich ein hässliches Gerücht über Sie gehört.«
»Nur eines?«
Brady Boswell lächelte.
»Und was hat man mir diesmal angedichtet?«
»Sie sollen ein bisschen schwarzgearbeitet haben.«
Sarah, die in der Kunst der Täuschung ausgebildet war, hatte keine Mühe, ihr Unbehagen zu verbergen. »Wirklich? Auf welchem Gebiet denn?«
Boswell beugte sich nach vorn und senkte seine Stimme zu einem vertraulichen Flüstern. »Sie sollen KBMs geheime Kunstberaterin sein.« KBM waren die international bekannten Initialen des zukünftigen Königs von Saudi-Arabien. »Sie sollen zugelassen haben, dass er eine halbe Milliarde für diesen zweifelhaften Leonardo ausgegeben hat.«
»Das ist kein zweifelhafter Leonardo.«
»Dann stimmt das Gerücht also!«
»Reden Sie keinen Unsinn, Brady.«
»Ein sehr indirektes Dementi«, stellte er gerechtfertigt misstrauisch fest.
Sarah hob die rechte Hand, als lege sie einen feierlichen Eid ab. »Ich bin nicht Khalid bin Mohammeds Kunstberater, bin’s nie gewesen.«
Boswells Zweifel waren nicht ausgeräumt, das sah man ihm an. Bei den Antipasti brachte er das Gespräch endlich auf seinen Herzenswunsch. Sarah spielte die Leidenschaftslose, bevor sie Boswell mitteilte, sie würde ihm unter keinen Umständen auch nur ein einziges Gemälde aus der Nadia al-Bakari Collection leihen.
»Wie wär’s mit ein, zwei Monets? Oder einem der Cézannes?«
»Sorry, aber das kommt nicht infrage.«
»Einen Rothko? Sie haben so viele, dass Sie das gar nicht merken würden.«
»Brady, bitte.«
Sie beendeten ihren Lunch in gutem Einvernehmen und verabschiedeten sich auf dem Gehsteig der Park Avenue. Sarah beschloss, zu Fuß ins Museum zurückzugehen. Nach einem der wärmsten Herbste seit Menschengedenken war der Winter endlich nach Manhattan gekommen. Gott allein wusste, was das neue Jahr bringen würde. Der Planet schien von einem Extrem ins andere zu taumeln. Sarah ebenfalls. Gestern noch geheime Kämpferin im globalen Krieg gegen den Terrorismus, heute Kuratorin einer der größten Kunstsammlungen der Welt. Ihr Leben kannte keinen Mittelweg.
Aber als Sarah auf die East Fifty-Third Street abbog, wurde ihr plötzlich klar, dass sie sich endlos langweilte. Die gesamte Museumswelt beneidete sie, das stimmte. Aber bei allem Glamour und dem Hype um ihre Eröffnung funktionierte die Nadia al-Bakari Collection weitgehend autark. Sarah war wenig mehr als ihr attraktives Gesicht. In letzter Zeit war sie zu oft mit Typen wie Brady Boswell lunchen gegangen.
Gleichzeitig hatte ihr Privatleben gelitten. Trotz eines Terminplans voller Empfänge und Sponsorendinners hatte sie noch keinen Mann im richtigen Alter und mit den richtigen Qualifikationen kennengelernt. Oh, sie war vielen Männern Anfang vierzig begegnet, aber keiner war an einer Dauerbeziehung – Gott, wie sie diesen Ausdruck hasste! – mit einer Frau in seinem Alter interessiert. Männer Anfang vierzig wollten eine graziöse Nymphe von dreiundzwanzig Jahren, eine dieser jungen Frauen, die in ihren Leggings und mit ihren Yogamatten lässig durch Manhattan stolzierten. Sarah fürchtete, sie trete allmählich ins Reich der Zweitfrauen ein. In ihren dunkelsten Augenblicken sah sie sich am Arm eines reichen Mannes von dreiundsechzig Jahren, der sich das Haar färbte und regelmäßig Botox- und Testosteronspritzen bekam. Die Kinder aus seiner ersten Ehe würden sie als Zerstörerin ihrer Familienidylle hassen. Nach langer Behandlung mit Fertilitätshormonen würden sie und ihr alternder Mann es schaffen, ein Kind zu bekommen, das Sarah allein aufziehen würde, nachdem ihr Mann bei seinem vierten Versuch, den Mount Everest zu besteigen, verunglückt war.
Das Stimmengewirr der Menschenmenge im MoMA-Foyer trug dazu bei, Sarahs Stimmung vorübergehend zu bessern. Die Nadia al-Bakari Collection residierte im ersten Stock; Sarah hatte ihr Büro im dritten. Ihr Telefon zeigte zwölf verpasste Anrufe an. Die übliche Kost: Presseanfragen, Einladungen zu Cocktailpartys und Vernissagen, ein Reporter eines Boulevardblatts, der nach Informationen angelte.
Der letzte Anruf kam von einem gewissen Alistair Macmillan. Mr. Macmillan schien eine Privatführung außerhalb der normalen Öffnungszeiten zu wünschen. Er hatte keine Rückrufnummer angegeben. Aber das war nicht nötig, denn Sarah gehörte zu den wenigen Menschen weltweit, die seine Privatnummer hatten. Jetzt zögerte sie, bevor sie die Nummer wählte. Seit Istanbul hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen.
»Ich habe schon gefürchtet, Sie würden nie zurückrufen.« Sein Akzent war eine Mischung aus Arabisch und Oxfordenglisch. Er sprach ruhig, aber seine Stimme klang leicht erschöpft.
»Ich war beim Lunch«, antwortete Sarah gelassen.
»Bei einem Italiener in der Park Avenue. Mit einem Trottel namens Brady Boswell.«
»Woher wissen Sie das?«
»Zwei meiner Leute haben in Ihrer Nähe gesessen.«
Sarah hatte sie nicht bemerkt. In den acht Jahren, seit sie die CIA verlassen hatte, hatte ihre Fähigkeit, Beschatter zu erkennen, offenbar abgenommen.
»Können Sie das arrangieren?«, fragte er.
»Was denn?«
»Eine Privatführung durch die al-Bakari Collection, versteht sich.«
»Schlechte Idee, Khalid.«
»Genau das hat mein Vater auch gesagt, als ich ihm erzählt habe, dass ich den Frauen unseres Landes das Autofahren erlauben will.«
»Das Museum schließt um halb sechs.«
»Dann sollten Sie mich um sechs erwarten«, sagte er.
3 NEW YORK
Es war die Tranquillity, angeblich die zweitgrößte Privatjacht der Welt, die selbst seine standhaftesten Verteidiger im Westen nachdenklich werden ließ. Wie berichtet wurde, sah der zukünftige König sie erstmals von der Terrasse des väterlichen Ferienhauses auf Mallorca aus. Von den schnittigen Linien der Jacht und ihren charakteristischen neonblauen Lauflichtern fasziniert, entsandte er sofort einen Emissär, der feststellen sollte, ob sie zu verkaufen sei. Ihr Besitzer, der milliardenschwere russische Oligarch Konstantin Dragunow, erkannte seine Chance und verlangte fünfhundert Millionen Euro. Der zukünftige König war unter der Voraussetzung einverstanden, dass der Russe und seine große Gästeschar die Jacht sofort räumten. Dazu benutzten sie den mitverkauften Hubschrauber des Schiffs. Der Kronprinz, selbst ein skrupelloser Geschäftsmann, berechnete dem Russen exorbitante Treibstoffkosten.
Der zukünftige König hoffte, vielleicht etwas naiv, sein Kauf der Jacht werde geheim blieben, bis sich ihm eine Gelegenheit bot, seinen Vater darüber zu informieren. Aber nur achtundvierzig Stunden nachdem er Besitzer des Schiffs geworden war, brachte ein Londoner Boulevardblatt einen bemerkenswert genauen Bericht über seinen Kauf – vermutlich auf Informationen des russischen Oligarchen basierend. Die offiziellen Medien im Heimatland des zukünftigen Königs, das Saudi-Arabien war, ignorierten die Story, die aber in den sozialen Medien und Untergrund-Blogs hohe Wellen schlug. Wegen des weltweiten Verfalls des Ölpreises hatte der Kronprinz seinen verhätschelten Untertanen strenge Sparmaßnahmen verordnet, die ihren einst sehr behaglichen Lebensstandard stark reduziert hatten. Selbst in Saudi-Arabien, wo königliche Verschwendungssucht ein permanenter Aspekt des öffentlichen Lebens war, kam die Habgier des zukünftigen Königs nicht gut an.
Mit vollem Namen hieß er Khalid bin Mohammed bin Abdulasis Al Saud. Nach seiner Kindheit in einem luxuriösen Palast von der Größe eines Straßenblocks besuchte er eine Schule für Knaben der königlichen Familie und ging dann nach Oxford, wo er Betriebswirtschaft studierte, westlichen Frauen nachstellte und reichlich verbotenen Alkohol trank. Am liebsten wäre er im Westen geblieben. Aber als sein Vater den Thron bestieg, kehrte er nach Saudi-Arabien zurück, um Verteidigungsminister zu werden; eine bemerkenswerte Karriere für einen Mann, der nie eine Uniform getragen und außer seinem Falken noch keine Waffe eingesetzt hatte.
Der junge Prinz zettelte prompt einen verlustreichen und kostspieligen Krieg mit Anhängern des Iraks im benachbarten Jemen an und verhängte gegen das aufmüpfige Katar eine Wirtschaftsblockade, die die Golfregion in eine Krise stürzte. Vor allem intrigierte und konspirierte er jedoch am Königshof, um seine Rivalen zu schwächen – alles mit dem Segen seines Vaters, des Königs. Der alte und zuckerkranke Herrscher wusste, dass er nicht mehr lange auf dem Thron bleiben würde. Im Hause Saud war es üblich gewesen, dass der Bruder dem Bruder nachfolgte. Aber der König brach mit dieser Tradition, indem er seinen Sohn zum Kronprinzen ernannte und damit zu seinem Nachfolger bestimmte. Mit nur dreiunddreißig Jahren wurde er der De-facto-Herrscher über Saudi-Arabien und Oberhaupt einer Familie mit einem geschätzten Vermögen von über einer Billion Dollar.
Der zukünftige König wusste jedoch, dass das Familienvermögen größtenteils eine Fata Morgana war, dass die Familie Unsummen für Paläste und Luxusgüter verschleudert hatte und dass das Öl unter Saudi-Arabien in zwanzig Jahren, wenn die Energiewende abgeschlossen war, so wertlos sein würde wie der Sand, unter dem es lag. Sich selbst überlassen würde das Königreich wieder werden, was es früher war: eine wasserlose Einöde mit kriegerischen Wüstennomaden.
Um seinem Land diese elende Zukunft zu ersparen, beschloss er, es mit brachialer Gewalt aus dem siebten Jahrhundert ins einundzwanzigste zu holen. Mithilfe einer amerikanischen Beratungsfirma produzierte er einen ökonomischen Masterplan, dem er den großartigen Titel Der Weg Vorwärts gab. Geplant war eine moderne saudische Wirtschaft, die durch Innovation, ausländische Investitionen und Unternehmertum florierte. Seine verwöhnten Untertanen würden zukünftig nicht mehr auf staatliche Jobs und eine Vollversorgung von der Wiege bis zur Bahre zählen können. Stattdessen würden sie sich ihren Lebensunterhalt tatsächlich durch Arbeit verdienen und andere Bücher studieren müssen als den Koran.
Dem Kronprinzen war bewusst, dass die Arbeiterschaft dieses neuen Saudi-Arabiens nicht nur aus Männern bestehen konnte. Auch die Frauen würden gebraucht werden, was bedeutete, dass die religiösen Fesseln, in denen sie fast als Sklavinnen gehalten worden waren, gelockert werden mussten. Er gewährte ihnen das lange ersehnte Recht, Auto zu fahren, und erlaubte ihnen, zu Sportereignissen zu gehen, bei denen Männer anwesend waren.
Aber er gab sich nicht mit kleinen religiösen Reformen zufrieden, sondern wollte den Glauben selbst reformieren. Er verpflichtete sich dazu, den Geldstrom zu unterbrechen, der die weltweite Verbreitung des Wahhabismus, der saudischen puritanischen Version des sunnitischen Islams, förderte, und die private saudische Unterstützung dschihadistischer Terrorgruppen wie IS und al-Qaida zu unterbinden. Als ein wichtiger Kolumnist der New York Times ein schmeichelhaftes Porträt des jungen Kronprinzen und seiner Ambitionen zeichnete, kochte die Ulema, die Versammlung der saudischen Religionsgelehrten, vor heiligem Zorn.
Der Kronprinz ließ einige der religiösen Heißsporne einsperren, aber unklugerweise auch einige der Moderaten. Ebenfalls einsperren ließ er Vorkämpfer für Demokratie und Frauenrechte und jeden, der töricht genug war, ihn zu kritisieren. Er trieb sogar über hundert Mitglieder der königlichen Familie und die Elite der saudi-arabischen Wirtschaft zusammen und sperrte sie im Hotel Ritz-Carlton ein. Dort wurden sie scharfen Verhören unterzogen, manchmal durch den Kronprinzen persönlich. Irgendwann kamen alle frei, aber erst nachdem sie über hundert Milliarden Dollar herausgerückt hatten. Der zukünftige König behauptete, sie hätten sich dieses Geld durch Bestechlichkeit und Vorteilsnahme angeeignet. Mit den alten Methoden im Geschäftsleben des Königreichs sei jetzt Schluss, erklärte er.
Außer natürlich für den zukünftigen König selbst. Er häufte in schwindelerregendem Tempo ein riesiges Vermögen an, das er verschwenderisch ausgab. Er kaufte, wonach ihm der Sinn stand, und was er nicht kaufen konnte, nahm er sich einfach. Wer sich weigerte, ihm zu Willen zu sein, bekam einen Umschlag mit einer einzelnen Patrone Kaliber .45.
Dies alles bewirkte, vor allem im Westen, dass seine Rolle kritisch hinterfragt wurde. War KBM tatsächlich ein Reformer, fragten sich führende Politiker und Nahostexperten, oder nur ein weiterer machtgieriger Scheich aus der Wüste, der seine Gegner einsperrte und sich auf Kosten seines Volkes bereicherte? Wollte er die saudische Wirtschaft tatsächlich umbauen? Die Unterstützung des Königshauses für islamische Eiferer und Terroristen einstellen? Oder versuchte er lediglich, die eleganten Zirkel in Georgetown und Aspen zu beeindrucken?
Aus Gründen, die Sarah ihren Freunden und Kollegen in der Kunstwelt nicht erklären konnte, hatte sie anfangs zu den Skeptikern gehört. Deshalb zögerte sie verständlicherweise, als Khalid bei einem Besuch in New York den Wunsch äußerte, sie kennenzulernen. Sie stimmte letztlich zu, aber erst nachdem sie den Sicherheitsdienst in Langley informiert hatte, der aus der Ferne über sie wachte.
Sie trafen sich in einer Suite des Hotels Four Seasons zu einem Gespräch, bei dem weder Assistenten noch Leibwächter anwesend waren, Sarah hatte die positive Berichterstattung der New York Times über KBM verfolgt und Fotos gesehen, auf denen er die traditionelle saudische Robe und Kopfbedeckung trug. In seinem maßgeschneiderten englischen Anzug war er jedoch weit eindrucksvoller: eloquent, kultiviert, gebildet, Selbstbewusstsein und Machtfülle ausstrahlend. Und er war natürlich reich. Unvorstellbar reich. Einen kleinen Teil dieses Reichtums wollte er dafür verwenden, eine Kunstsammlung von Weltrang aufzubauen. Und dafür wollte er Sarah Bancroft als Beraterin.
»Was haben Sie mit diesen Gemälden vor?«
»Ich will sie in einem Museum zeigen, das ich in Riad bauen werde. Es soll«, sagte er mit großer Geste, »der Louvre des Nahen Ostens werden.«
»Und wer wird Ihren neuen Louvre besuchen?«
»Dieselben Leute, die den in Paris besuchen.«
»Touristen?«
»Ja, natürlich.«
»In Saudi-Arabien?«
»Warum nicht?«
»Weil die einzigen Touristen, die Sie ins Land lassen, die muslimischen Pilger sind, die Mekka und Medina besuchen.«
»Vorerst noch«, sagte er pointiert.
»Wieso ich?«
»Sind Sie nicht die Kuratorin der Nadia al-Bakari Collection?«
»Nadia war eine Reformerin.«
»Und ich bin ein Reformer.«
»Sorry«, sagte sie. »Kein Interesse.«
Ein Mann wie Khalid bin Mohammed war es nicht gewöhnt, abgewiesen zu werden. Er verfolgte Sarah Bancroft systematisch – mit Anrufen, Blumen und teuren Geschenken, die sie alle zurückschickte. Als sie schließlich doch nachgab, bestand sie darauf, unentgeltlich zu arbeiten. Obwohl der als KBM bekannte Mann sie faszinierte, gestattete ihre Vergangenheit ihr nicht, von dem Haus Saud auch nur einen einzigen Riyal anzunehmen. Außerdem musste ihre Verbindung in beider Interesse strikt geheim bleiben.
»Wie soll ich Sie nennen?«, fragte Sarah.
»Königliche Hoheit ist immer gut.«
»Versuchen Sie’s noch mal.«
»Wie wär’s mit Khalid?«
»Viel besser.«
Sie kauften rasch und aggressiv von Privatleuten und bei Auktionen: Nachkriegskunst, Impressionisten, Alte Meister. Sie feilschten nie lange. Sarah nannte ihren Preis, und einer von Khalids Vertrauten kümmerte sich um das Finanzielle und den Versand. Obwohl ihre Einkaufsorgie unter größter Geheimhaltung stattfand, brauchte die Kunstwelt nicht lange, um zu merken, dass ein potenter Käufer auf dem Markt unterwegs war – vor allem nachdem Khalid eine satte halbe Milliarde Dollar für Leonardo da Vincis Salvator Mundi hingeblättert hatte. Sarah hatte ihm von diesem Kauf abgeraten. Kein Gemälde, argumentierte sie, außer vielleicht der Mona Lisa, sei so viel wert.
Während sie die Sammlung aufbauten, war sie viele Stunden mit Khalid allein. Er sprach mit ihr über seine Pläne für das zukünftige Saudi-Arabien, wies ihr die Rolle einer wohlwollenden Kritikerin zu. Im Laufe der Zeit schwand ihre Skepsis. Khalid war weit davon entfernt, perfekt zu sein, fand sie, aber wenn er’s schaffte, Saudi-Arabien dauerhaft umzumodeln, würden der Nahe Osten und der Islam im weitesten Sinn nie mehr wie früher sein.
Alles das änderte sich mit dem Tod von Omar Nawwaf.
Nawwaf war ein prominenter saudischer Journalist und Dissident, der in Berlin Zuflucht gesucht hatte. Als Kritiker des Hauses Saud hatte er eine besonders schlechte Meinung von Khalid, den er für einen Scharlatan hielt, der leichtgläubigen westlichen Politikern orientalische Märchen ins Ohr flüsterte, während er sich selbst bereicherte und seine Kritiker einsperrte. Vor zwei Monaten war Nawwaf im saudi-arabischen Generalkonsulat in Istanbul brutal ermordet und anschließend zerstückelt worden, um seine Leiche besser beseitigen zu können.
Die empörte Sarah Bancroft gehörte zu denen, die jegliche Verbindung zu dem einst vielversprechenden jungen Prinzen mit den Initialen KBM kappten. »Sie sind genau wie alle anderen«, erklärte sie Khalid in einer letzten Sprachnachricht. »Und im Übrigen hoffe ich, Königliche Hoheit, dass Sie in der Hölle brennen werden.«
4 NEW YORK
Die erste Durchsage kam um 17.05 Uhr. Eine höfliche Stimme wies die Besucher darauf hin, dass das Museum bald schließen werde, und forderte sie auf, sich allmählich in Richtung Ausgang zu begeben. Um 17.25 Uhr waren alle dieser Aufforderung gefolgt außer einer zerstreut wirkenden Frau, die sich nicht von van Goghs Sternennacht losreißen konnte. Der Wachdienst brachte sie freundlich in den Spätnachmittag hinaus, bevor er einen Saal nach dem anderen absuchte, um sicherzustellen, dass sie frei von versteckt zurückbleibenden Kunstdieben waren.
Das »Alles geräumt«-Signal wurde um 17.45 Uhr gegeben. Um diese Zeit war das Verwaltungspersonal größtenteils schon gegangen. Deshalb war niemand Zeuge, wie auf der West Fifty-Third Street drei schwarze SUVs mit Diplomatenkennzeichen vorfuhren. Khalid, in Geschäftsanzug und dunklem Mantel, stieg aus dem zweiten Wagen und überquerte rasch den Gehsteig zum Eingang. Sarah Bancroft ließ ihn nach kurzem Zögern ein. Sie musterten einander in dem um diese Zeit nur schwach beleuchteten Foyer, bevor Khalid die Hand zur Begrüßung ausstreckte. Sarah ignorierte sie.
»Mich überrascht, dass man Sie ins Land gelassen hat. Ich dürfte mich wirklich nicht mit Ihnen sehen lassen, Khalid.«
Seine Hand blieb ausgestreckt. »Ich bin nicht für Omar Nawwafs Tod verantwortlich«, sagte er ruhig. »Das müssen Sie mir glauben.«
»Früher einmal habe ich Ihnen geglaubt. Wie so viele andere Leute in diesem Land. Wichtige Leute. Kluge Leute. Wir wollten glauben, Sie seien irgendwie anders und würden Ihr Land und den Nahen Osten verändern. Und Sie haben uns alle zum Narren gehalten.«
Khalid zog seine Hand zurück. »Was geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen, Sarah.«
»Wozu sind Sie dann hier?«
»Ich dachte, das hätte ich am Telefon deutlich gesagt.«
»Und ich dachte, ich hätte Ihnen unmissverständlich erklärt, dass Sie mich nie mehr anrufen sollen.«
»Ah, richtig, ich erinnere mich.« Er zog sein Smartphone aus der Manteltasche und spielte Sarah ihre letzte Sprachnachricht vor.
Und im Übrigen hoffe ich, Königliche Hoheit, dass Sie in der Hölle brennen werden.
»Bestimmt«, sagte Sarah, »war ich nicht die Einzige, die eine Nachricht hinterlassen hat.«
»Natürlich nicht.« Khalid steckte das Smartphone wieder ein. »Aber Ihre hat am meisten geschmerzt.«
Sarah zog die Augenbrauen hoch. »Weshalb?«
»Weil ich Ihnen vertraut habe. Und weil ich dachte, Sie verstünden, wie schwierig es sein würde, mein Land zu verändern, ohne es in politisches und religiöses Chaos zu stürzen.«
»Das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, jemanden zu ermorden, nur weil er Sie kritisiert hat.«
»So einfach ist die Sache nicht.«
»Wieso nicht?«
Er gab keine Antwort. Sarah merkte, dass ihm etwas zusetzte, das über die Demütigung hinausging, als die er seinen jähen Fall in Ungnade empfunden haben musste.
»Darf ich sie sehen?«, fragte er.
»Die Sammlung? Sind Sie wirklich ihretwegen hier?«
Er spielte den leicht Gekränkten. »Ja, natürlich.«
Sie führte ihn nach oben in den Al-Bakari-Flügel. Nadias Porträt, nicht lange nach ihrem Tod im Leeren Viertel Saudi-Arabiens gemalt, hing im Eingangsbereich.
»Nadia war echt«, stellte Sarah fest. »Keine Mogelpackung wie Sie.«
Khalid funkelte sie an, bevor er sich auf das Porträt konzentrierte. Nadia saß ganz in Weiß am Ende einer langen Couch, trug eine Perlenkette und hatte Brillantringe an den Fingern. Über einer Schulter leuchtete das Zifferblatt einer Uhr wie ein Mond. Zu ihren bloßen Füßen waren Orchideen verstreut. Der Malstil vereinte geschickt moderne und klassische Elemente. Zeichnung und Komposition waren makellos.
Khalid trat einen Schritt näher und betrachtete die untere rechte Ecke der Leinwand. »Es ist nicht signiert.«
»Dieser Künstler signiert seine Werke nie.«
Khalid deutete auf die Bronzeplakette neben dem Rahmen. »Und hier wird er auch nicht erwähnt.«
»Er wollte anonym bleiben, um Nadia nicht in den Schatten zu stellen.«
»Er ist berühmt?«
»In bestimmten Kreisen.«
»Sie kennen ihn?«
»Ja, natürlich.«
Khalid betrachtete wieder das Porträt. »Hat sie ihm dafür gesessen?«
»Tatsächlich hat er sie ganz aus dem Gedächtnis gemalt.«
»Er hatte nicht mal ein Foto?«
Sarah schüttelte den Kopf.
»Bemerkenswert. Er muss sie bewundert haben, um etwas so Schönes malen zu können. Leider hatte ich nie das Vergnügen, sie kennenzulernen. In jungen Jahren hatte sie einen ziemlichen Ruf als Playgirl.«
»Nach dem Tod ihres Vaters hat sie sich sehr verändert.«
»Zizi al-Bakari ist nicht gestorben. Er ist im Vieux Port von Cannes von einem israelischen Killer namens Gabriel Allon eiskalt ermordet worden.« Khalid funkelte Sarah sekundenlang an, bevor er den ersten Raum des Flügels betrat – einen der vier Säle mit Impressionisten. Er blieb vor einem Renoir stehen und betrachtete ihn neidisch. »Diese Gemälde gehören nach Riad.«
»Nadia hat sie dem MoMA vermacht und mich als Kuratorin der Sammlung bestimmt. Die Bilder bleiben dort, wo sie jetzt hängen.«
»Vielleicht kann ich sie Ihnen abkaufen.«
»Sie sind nicht zu verkaufen.«
»Alles ist zu verkaufen, Sarah.« Er lächelte flüchtig. Das kostete ihn eine Anstrengung, das war offensichtlich. Er blieb vor einer Landschaft von Monet stehen und sah sich im Saal um. »Nichts von van Gogh?«
»Nein.«
»Merkwürdig, finden Sie nicht auch?«
»Was ist merkwürdig?«
»Dass eine Sammlung wie diese eine so markante Lücke aufweist.«
»Ein qualitätsvoller van Gogh ist schwer zu bekommen.«
»Von meinen Informanten höre ich etwas anderes. Tatsächlich weiß ich aus sehr guter Quelle, dass Zizi für kurze Zeit Besitzer eines wenig bekannten van Goghs mit dem Titel Marguerite Gachet an ihrem Toilettentisch war. Er hat es in einer Londoner Galerie gekauft.« Khalid beobachtete Sarah aufmerksam.
Sarah gab keine Antwort.
»Die Galerie gehörte einem gewissen Julian Isherwood. Damals hat eine Amerikanerin bei ihm gearbeitet. Zizi war anscheinend sehr von ihr angetan. Er hat sie zu seinem alljährlichen Wintertörn in der Karibik eingeladen. Seine Jacht war viel kleiner als meine. Sie hieß …«
»Alexandra«, unterbrach Sarah ihn. Dann fragte sie: »Wie lange wissen Sie das schon?«
»Dass meine Kunstberaterin eine CIA-Agentin ist?«
»War. Ich arbeite nicht mehr für die Agency. Und auch nicht für Sie.«
»Was ist mit den Israelis?« Er lächelte. »Glauben Sie wirklich, ich hätte Sie in meine Nähe gelassen, ohne Sie gründlich überprüfen zu lassen?«
»Und trotzdem haben Sie sich um mich bemüht.«
»Ganz recht.«
»Wieso?«
»Weil ich wusste, dass Sie mir eines Tages bei mehr als nur meiner Kunstsammlung würden helfen können.« Khalid ging wortlos an Sarah vorbei und blieb wieder vor Nadias Porträt stehen. »Wissen Sie, wie ich ihn erreichen kann?«
»Wen?«
»Den Mann, der dieses Porträt gemalt hat, ohne auch nur ein Foto als Vorlage zu besitzen.« Khalid deutete auf die rechte untere Ecke des Gemäldes. »Den Mann, dessen Name hier stehen müsste.«
»Sie sind der saudi-arabische Kronprinz. Wozu soll ich mich Ihretwegen an den Direktor des israelischen Geheimdiensts wenden?«
»Wegen meiner Tochter«, antwortete er. »Jemand hat meine Tochter entführt.«
5 ASHTARA, ASERBAIDSCHAN
Sarah Bancrofts Anruf bei Gabriel Allon blieb an diesem Abend unbeantwortet, wie es so oft der Fall war, wenn er eine Mission durchführte. Weil es sich um einen streng geheimen Auftrag handelte, kannten nur der Ministerpräsident und eine Handvoll zuverlässiger hochrangiger Mitarbeiter seinen Aufenthaltsort – eine nicht allzu große, ockergelb gestrichene Villa am Strand des Kaspischen Meers. Hinter der Villa erstreckten sich rechteckige Felder bis zu den Ausläufern des östlichen Kaukasus. Auf einem der Hügel stand eine kleine Moschee. Fünfmal am Tag rief der knackende Lautsprecher im Minarett die Gläubigen zum Gebet. Trotz seines langen Kampfes gegen radikale Islamisten fand Gabriel die Stimme des Muezzins tröstlich. In diesem Augenblick hatte er keine besseren Freunde auf der Welt als die muslimischen Aserbaidschaner.
Offiziell gehörte die Villa einer in Baku ansässigen Immobilienholding. Ihr wahrer Eigentümer war jedoch die Hausverwaltung, die Abteilung des israelischen Geheimdiensts, die sichere Wohnungen kaufte und verwaltete. Dieses geheime Arrangement hatte den Segen des Chefs des aserbaidschanischen Sicherheitsdiensts, zu dem Gabriel eine ungewöhnlich enge Beziehung aufgebaut hatte. Aserbaidschans südlicher Nachbar war die Islamische Republik Iran. Tatsächlich war die iranische Grenze nur fünf Kilometer von der Villa entfernt, was erklärte, weshalb Gabriel sie seit seiner Ankunft nicht mehr verlassen hatte. Hätte die Iranische Revolutionsgarde von seiner Anwesenheit erfahren, hätte sie versucht, ihn zu entführen oder zu ermorden. Gabriel verübelte ihr nicht, dass sie ihn hasste. Das waren die Spielregeln in einem Problemviertel. Hätte er seinerseits die Chance bekommen, den Kommandeur der Revolutionsgarde zu liquidieren, hätte er bereitwillig abgedrückt.
Die Villa am Meer war nicht die einzige logistische Einheit, über die Gabriel in Aserbaidschan verfügte. Seine Organisation – die für alle, die ihr angehörten, immer nur »der Dienst« war – unterhielt auch eine kleine Flotte aus Fischerbooten, Frachtern und Schnellbooten, alle vorschriftsmäßig in Aserbaidschan registriert. Diese Schiffe verkehrten regelmäßig zwischen aserbaidschanischen Häfen und der iranischen Küste, wo sie israelische Agenten und Kommandotrupps absetzten und wertvolle Iraner abholten, die bereit waren, für Israel zu arbeiten.
Vor einem Jahr war einer dieser Informanten, der im Zentrum des geheimen iranischen Atomwaffenprogramms arbeitete, von einem Schnellboot in die Villa des Diensts in Ashtara gebracht worden. Dort hatte er Gabriel von einem Lagerhaus in einem öden Gewerbegebiet am Stadtrand von Teheran berichtet. In dem Lagerhaus standen zweiunddreißig Tresore aus iranischer Produktion. Sie enthielten Hunderte von Datenträgern und Hunderttausende von Dokumenten. Der Informant behauptete, dieses Material beweise, was der Iran stets geleugnet hatte – dass er methodisch und unermüdlich daran gearbeitet hatte, einen nuklearen Gefechtskopf zu entwickeln und mit einem Trägersystem zu kombinieren, das Israel und noch entferntere Ziele erreichen konnte.
Den größten Teil des vergangenen Jahres hatte der Dienst damit verbracht, das Lagerhaus durch Agenten und Minikameras überwachen zu lassen. So hatte er festgestellt, dass die Frühschicht des Wachpersonals um 7 Uhr zur Arbeit kam. Und er wusste auch, dass das Lagerhaus etwa ab 22 Uhr nur durch den Zaun und seine Schlösser gesichert war. Gabriel und Jaakov Rossman, Chef der Abteilung Special Operations, waren sich darüber einig, das Team solle das Gebäude spätestens um fünf Uhr morgens verlassen. Der Informant hatte ihnen genau aufgezeichnet, welche Tresore sie öffnen und welche sie ignorieren sollten. Wegen der Öffnungsmethode – mit Schweißbrennern, deren Flamme tausendfünfhundert Grad heiß war – ließ der Einbruch sich unmöglich geheim halten. Daher hatte Gabriel das Team angewiesen, das relevante Material nicht zu kopieren, sondern gleich zu stehlen. Kopien ließen sich leicht abstreiten. Originale waren schwieriger zu erklären. Außerdem würde das kühne Unternehmen, das iranische Atomarchiv zu stehlen und außer Landes zu bringen, das Regime in den Augen der unruhigen Bevölkerung blamieren. Gabriel tat nichts lieber, als die iranische Führung in Verlegenheit zu bringen.
Der Diebstahl von Originaldokumenten ließ das Risiko des Unternehmens jedoch exponentiell ansteigen. Verschlüsselte Kopien ließen sich auf ein paar USB-Sticks mit großem Speicher außer Landes bringen. Die Originale würden erheblich schwieriger zu verstecken und zu transportieren sein. Ein iranischer Agent des Diensts hatte dafür einen Volvo-Lkw gekauft. Hielt das Wachpersonal des Lagerhauses sich an seinen normalen Dienstplan, würde das Team zwei Stunden Vorsprung haben. Seine Route würde vom Stadtrand Teherans übers Elburs-Gebirge zum Kaspischen Meer hinunterführen. Die Anlegestelle für das Fluchtboot war ein Strand in der Nähe der Küstenstadt Babolsar. Die Ausweichstelle lag einige Kilometer östlich von Chazar Abad. Die sechzehn Angehörigen des Teams würden miteinander an Bord gehen. Die meisten waren Farsi sprechende iranische Juden, die leicht als Perser durchgehen konnten. Geführt wurde das Team jedoch von Michail Abramow, einem in Moskau geborenen Offizier, der schon viele gefährliche Einsätze geleitet hatte – darunter auch die Ermordung des wichtigsten iranischen Atomwissenschaftlers auf offener Straße in Teheran. Wegen seiner Erscheinung stellte Michail ein Manko für das Unternehmen dar. Aber wie Gabriel aus Erfahrung wusste, brauchte jedes Unternehmen wenigstens eines.
Früher hätte Gabriel zweifellos zu jedem Team dieser Art gehört. Er stammte aus der Jesreel-Ebene, einem fruchtbaren Landstrich, der viele der besten Krieger und Spione Israels hervorgebracht hatte. Im September 1972 war er Student an der Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem gewesen, als ein gewisser Ari Schamron ihn aufgesucht hatte. Wenige Tage zuvor hatte eine Terroristengruppe, die sich Schwarzer September nannte, bei den Olympischen Spielen in München elf israelische Sportler und Trainer ermordet. Ministerpräsidentin Golda Meir hatte Schamron und den Dienst angewiesen, »die Jungs loszuschicken«, um die Verantwortlichen aufspüren und liquidieren zu lassen. Gabriel, der fließend Deutsch mit Berliner Anklängen sprach und sich überzeugend als Künstler ausgeben konnte, sollte Schamrons Instrument der Rache sein. Mit jugendlichem Trotz hatte Gabriel ihn aufgefordert, sich einen anderen zu suchen. Aber Schamron hatte ihm – nicht zum letzten Mal – seinen Willen aufgezwungen.
Das Unternehmen erhielt den Decknamen »Zorn Gottes«. Drei Jahre lang stellten Gabriel und ein kleines Agententeam in Westeuropa und im Nahen Osten ihrer Beute nach, töteten nachts und am helllichten Tag und lebten in ständiger Sorge, sie könnten verhaftet und wegen Mordes angeklagt werden. Insgesamt fielen ihnen zwölf Mitglieder des Schwarzen Septembers zum Opfer. Sechs der Terroristen erschoss Gabriel persönlich mit einer Beretta Kaliber .22. Möglichst mit elf Schüssen, einen für jeden ermordeten Juden. Als er endlich nach Israel zurückkehrte, waren seine Schläfen von Stress und Übermüdung grau. Schamron nannte sie Aschespuren am Fürsten des Feuers.
Gabriel hatte seine Künstlerlaufbahn fortsetzen wollen, aber wenn er vor der Staffelei stand, sah er immer nur die Gesichter der Männer, die er erschossen hatte. Deshalb reiste er als ein im Ausland aufgewachsener Italiener namens Mario Delvecchio nach Venedig, um die Kunst des Restaurierens zu erlernen. Nach Abschluss seiner Ausbildung kehrte er von Schamron sehnsüchtig erwartet in den Dienst zurück. Als talentierter, wenn auch schweigsamer Restaurator, der europaweit tätig war, eliminierte er einige der gefährlichsten Feinde Israels und leitete einige der berühmtesten Unternehmen in der Geschichte des Diensts. Auch das heutige würde dazu zählen. Und wenn es fehlschlug? Dann würden sechzehn gut ausgebildete Agenten des Diensts verhaftet, gefoltert und wahrscheinlich öffentlich hingerichtet werden. Gabriel würde zurücktreten müssen, ein jämmerliches Ende einer Karriere, an der seine Nachfolger sich würden messen lassen müssen. Vielleicht würde er sogar den Ministerpräsidenten mit sich in den Abgrund reißen.
Im Augenblick konnte Gabriel nichts anderes tun, als zu warten und sich halb zu Tode zu sorgen. Das Team war am Vorabend in der Islamischen Republik Iran gelandet und hatte sich auf ein Netz aus sicheren Wohnungen in Teheran verteilt. Um 22.15 Uhr Teheraner Zeit erhielt Gabriel von der Einsatzzentrale am King Saul Boulevard die verschlüsselte Meldung, der letzte Mann des Wachpersonals habe das Lagerhaus verlassen. Gabriel ließ das Unternehmen anlaufen, und um 22.31 Uhr war das Team im Lagerhaus. Nun blieben ihm noch sechs Stunden und neunundzwanzig Minuten, um die richtigen Tresore aufzuschweißen und das Nukleararchiv sicherzustellen. Das war eine Minute weniger, als Gabriel gehofft hatte. Ein kleiner Rückschlag, denn jede Sekunde zählte, wie er aus Erfahrung wusste.
Gabriel war von Natur aus mit Geduld gesegnet, eine Eigenschaft, die ihm als Restaurator und Geheimagent oft genützt hatte. Aber in dieser Nacht am Kaspischen Meer verließ sie ihn völlig. Er tigerte in der nur spärlich möblierten Villa auf und ab, murmelte irgendwelches Zeug und fauchte seine beiden langmütigen Personenschützer aus belanglosen Anlässen an. Vor allem malte er sich sämtliche Gründe aus, aus denen sechzehn seiner besten Agenten nicht mehr lebend aus dem Iran rauskommen würden. Gewissheit gab es nur in einem Punkt: Falls das Team von Iranern gestellt wurde, würde es sich nicht ohne Weiteres ergeben. Gabriel hatte Michail, einem ehemaligen Offizier der israelischen Elitetruppe Sajeret Matkal, freie Hand gelassen, sich den Rückweg notfalls freizukämpfen. Falls die Iraner intervenierten, würden viele von ihnen sterben.
Um 4.46 Uhr Teheraner Zeit kam endlich die sehnlich erwartete Eilmeldung: Das Team hatte das Lagerhaus mit den erbeuteten Geheimunterlagen verlassen und den Rückzug angetreten. Die nächste Meldung um 5.39 Uhr besagte, das Team sei ins Elburs-Gebirge unterwegs. Gemeldet wurde jedoch auch, einer der Wachmänner sei frühzeitig zum Dienst gekommen. Eine halbe Stunde später erfuhr Gabriel, die iranische Staatspolizei NAJA habe alle Ordnungskräfte im Land alarmiert und errichte überall Straßensperren.
Er verließ unauffällig die Villa und ging im morgendlichen Zwielicht zum Strand hinunter. Auf den niedrigen Hügeln hinter ihm rief der Muezzin die Gläubigen zum Gebet. Beten ist besser als schlafen … In diesem Augenblick hätte Gabriel dem nicht überzeugter zustimmen können.
6 TEL AVIV
Als Sarah Bancrofts Anruf und ihre nachfolgenden Textnachrichten unbeantwortet blieben, gelangte sie zu dem Schluss, ihr bleibe nichts anderes übrig, als New York zu verlassen und nach Israel zu fliegen. Khalid unternahm es, ihre Reise zu organisieren. Deshalb flog sie privat und in ungewohntem Luxus, wobei die einzige Unannehmlichkeit ein kurzer Tankstopp in Irland war. Weil sie keine ihrer früheren CIA-Identitäten benutzen durfte, reiste sie auf dem Ben Gurion Airport unter ihrem richtigen Namen ein – ein Name, den die Sicherheits- und Geheimdienste des Staates Israel gut kannten – und fuhr mit einer Limousine mit Chauffeur zum Tel Aviv Hilton. Khalid hatte die größte Suite des Hotels für sie gebucht.
Dort schickte sie eine weitere Textnachricht an Gabriels Privathandy, um ihm mitzuteilen, sie sei aus eigener Initiative nach Tel Aviv gekommen, um eine dringende Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Wie alle anderen blieb auch diese Nachricht unbeantwortet, was Gabriel nicht ähnlich sah. Vielleicht hatte seine Handynummer sich geändert, oder er hatte sein privates Handy abgeben müssen. Möglich war auch, dass er einfach zu beschäftigt war, um sie zu empfangen. Schließlich war er der Direktor des israelischen Geheimdiensts und damit einer der mächtigsten und einflussreichsten Männer des Landes.
Für Sarah blieb Gabriel Allon jedoch der kalte, unnahbare Mann, dem sie erstmals in einem eleganten Klinkerhaus in der N Street in Georgetown begegnet war. Er hatte in sämtlichen verschlossenen Räumen ihrer Vergangenheit herumgeschnüffelt, bevor er sie gefragt hatte, ob sie bereit sei, für die Jihad Incorporated zu arbeiten, womit er Zizi al-Bakari meinte, den Finanzier und Förderer des islamischen Terrors. Sarah hatte das nachfolgende Unternehmen nur mit Glück überlebt und sich anschließend mehrere Monate in einem sicheren CIA-Haus im Pferdezuchtland Northern Virginia erholen müssen. Aber als Gabriel einen letzten Baustein für ein Unternehmen gegen den russischen Oligarchen Iwan Charkow brauchte, hatte Sarah begierig die Chance ergriffen, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können.
Irgendwann hatte sie’s auch geschafft, sich ziemlich in ihn zu verlieben. Und als sie entdeckte, dass er vergeben war, begann sie eine unkluge Affäre mit Michail Abramow, einem Geheimagenten des Diensts. Ihre Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil beide theoretisch kein Verhältnis mit Offizieren anderer Dienste haben durften. Selbst Sarah musste zugeben, als sie die Situation ehrlich analysierte, dass diese Affäre ein durchsichtiger Versuch war, Gabriel dafür zu bestrafen, dass er sie abgewiesen hatte. Wie abzusehen gewesen war, endete sie schlimm. Sarah hatte Michail seither nur einmal wiedergesehen: auf der Party zur Feier von Gabriels Ernennung zum Generaldirektor. Er hatte eine bildhübsche französisch-jüdische Ärztin am Arm gehabt. Statt ihm die Wange zum Kuss hinzuhalten, hatte Sarah ihm kühl die Hand gegeben.
Als eine weitere Stunde ohne Antwort von Gabriel verstrich, fuhr Sarah nach unten, um einen Spaziergang auf der Promenade zu machen. Die Luft war mild, und ein paar dicke weiße Wolken segelten wie Luftschiffe über den blauen levantinischen Himmel. Sie ging nach Norden, an schicken Strandcafés vorbei, zwischen den Sportgestählten und den Sonnengebräunten hindurch. Mit ihrem blonden Haar und ihren angelsächsischen Gesichtszügen wirkte sie nur leicht fehl am Platz. Die Stimmung war weltlich und südkalifornisch, Santa Monica am Mittelmeerstrand. Schwer vorstellbar, dass gleich jenseits der Grenze in Syrien Chaos und Bürgerkrieg herrschten. Oder dass kaum fünfzehn Kilometer östlich von hier auf einer felsigen Hügelkette einige der unruhigsten Palästinensersiedlungen im Westjordanland lagen. Oder dass der Gazastreifen, ein schmales Band aus menschlichem Elend und Ressentiments, keine Autostunde weit entfernt im Süden lag. Im hippen Tel Aviv, dachte Sarah, war es verständlich, wenn manche Israelis glaubten, der zionistische Traum habe sich ohne Kosten für irgendjemanden erfüllt.
Sie wandte sich landeinwärts und streifte scheinbar ziellos durch die Straßen. Tatsächlich wollte sie etwaige Beschatter entdecken, wobei sie Techniken anwandte, die ihr die Agency und der Dienst beigebracht hatten. Als sie in der Dizengoff Street einen Drogeriemarkt mit einer Flasche Shampoo verließ, die sie nicht brauchte, wurde ihr klar, dass sie beschattet wurde. Das hatte keinen speziellen Grund, sie hatte niemanden gesehen, aber sie hatte das nagende Gefühl, beobachtet zu werden.
Sie ging im kühlen Schatten von Paternosterbäumen weiter. Auf den Gehsteigen drängten sich vormittägliche Shopper. Dizengoff Street … Der Name klang vertraut. Auf der Dizengoff Street war etwas Schlimmes passiert, davon war Sarah überzeugt. Dann fiel es ihr ein. Auf der Dizengoff Street hatte sich im Oktober 1994 ein Selbstmordattentäter der Hamas in die Luft gesprengt und zweiundzwanzig Menschen mit sich in den Tod gerissen.
Sarah kannte sogar eine der damals Verletzten: eine Terrorismusexpertin des Diensts namens Dina Sarid. Dina hatte ihr einmal den Anschlag geschildert. Die Sprengladung hatte aus zwanzig Kilogramm TNT und mit Rattengift präparierten Nägeln bestanden. Sie war um neun Uhr im Bus Nummer 5 gezündet worden. Der Detonationsdruck hatte menschliche Gliedmaßen in die umliegenden Cafés geschleudert. Von den Blättern der Paternosterbäume hatte noch lange Blut getropft.
An jenem Morgen hat es auf der Dizengoff Street Blut geregnet, Sarah …
Aber wo genau war das passiert? Der Bus hatte eben auf dem Dizengoff Square Fahrgäste aufgenommen und war nach Norden weitergefahren. Sarah ließ sich auf ihrem iPhone ihre Position anzeigen. Dann überquerte sie die Straße und ging nach Süden weiter, bis sie einen kleinen grauen Gedenkstein am Fuß eines Paternosterbaums erreichte. Der Baum war viel jünger und kleiner als die anderen an dieser Straße.
Sarah blieb vor dem Gedenkstein stehen und versuchte, die Namen der Opfer zu lesen. Aber sie waren hebräisch geschrieben.
»Kannst du sie lesen?«
Sarah drehte sich überrascht um und sah hinter sich einen Mann im gescheckten Sonnenlicht stehen. Er war groß und schlaksig, blond und auffällig blass. Eine Sonnenbrille verdeckte seine Augen.
»Nein«, antwortete Sarah schließlich. »Leider nicht.«
»Du sprichst kein Hebräisch?« Der Mann sprach Englisch mit unüberhörbar russischem Akzent.
»Ich habe angefangen, es zu lernen, aber dann wieder aufgehört.«
»Warum?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
Der Mann ging vor dem Gedenkstein in die Hocke. »Hier sind die Namen, die du suchst. Sarid, Sarid, Sarid.« Er sah zu Sarah auf. »Dinas Mutter und ihre beiden Schwestern.«
Er richtete sich auf und schob die Sonnenbrille hoch, sodass seine Augen sichtbar wurden. Sie waren blaugrau und durchsichtig – wie Gletschereis, fand Sarah. Sie hatte Michails Augen immer geliebt.
»Wie lange beschattest du mich schon?«
»Seit du das Hotel verlassen hast.«
»Warum?«
»Um zu sehen, ob dich sonst jemand beschattet.«
»Gegenüberwachung.«
»Wir haben ein anderes Wort dafür.«
»Ja«, sagte Sarah. »Ich erinnere mich.«
Ein schwarzes SUV hielt neben ihnen am Randstein. Der Beifahrer, ein junger Mann in einer Kakiweste, stieg aus und öffnete die hintere Tür.
»Steig ein«, sagte Michail.
»Wohin fahren wir?«
Michail gab keine Antwort. Beim Einsteigen sah Sarah einen Bus Nummer 5 an ihnen vorbeirumpeln. Wohin wir fahren, ist unwichtig, dachte sie. Jedenfalls wird es eine sehr lange Fahrt.
7 TEL AVIV – NETANJA
»Hätte Gabriel nicht jemand anderen finden können, der mich abholt?«
»Ich habe mich freiwillig gemeldet.«
»Wieso?«
»Ich wollte eine weitere peinliche Szene vermeiden.«
Sarah sah aus ihrem Fenster. Sie fuhren mitten durch Israels Version des Silicon Valley. In der Sonne glänzende neue Bürogebäude säumten einen modernen Super-Highway. Israel hatte seine sozialistische Vergangenheit binnen weniger Jahre gegen eine vom Technologiesektor beflügelte dynamische Wirtschaft eingetauscht. Von einem Großteil dieser Innovationen profitierten das Militär und die Sicherheitsdienste, was Israel einen klaren Vorteil gegenüber seinen Gegnern im Nahen Osten verschaffte. Selbst Sarahs frühere Kollegen in der CIA-Abteilung Terrorismusbekämpfung hatten die Hightech-Fähigkeiten des Diensts und seiner Nachrichteneinheit 8200 – Israels Abhör- und Cyberkriegstruppe – bewundert.
»Dann ist das hässliche Gerücht also doch wahr.«
»Welches hässliche Gerücht meinst du?«
»Dass du diese hübsche kleine Französin geheiratet hast. Entschuldige, aber ich kann mir ihren Namen einfach nicht merken.«
»Natalie.«
»Nett«, sagte Sarah.
»Das ist sie.«
»Sie arbeitet weiter als Ärztin?«
»Eigentlich nicht.«
»Was macht sie heutzutage?«
Durch sein Schweigen bestätigte Michail Sarahs Vermutung, die hübsche französische Ärztin habe sich von dem Dienst anwerben lassen. In Sarahs von Eifersucht getrübter Erinnerung war Natalie eine exotische Schönheit, die sich leicht als Araberin ausgeben konnte.
»So ergeben sich vermutlich weniger Komplikationen. Alles ist einfacher, wenn beide Ehepartner beim selben Dienst arbeiten.«
»Das war nicht der einzige Grund für unsere …«
»Lassen wir das, Michail. Ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht.«
»Wie lange?«
»Mindestens eine Woche.«
Sie fuhren unter dem Highway 5 hindurch, der sicheren Straße zwischen der Küstenebene und Ariel, einer jüdischen Siedlung tief im Westjordanland. Diese Abzweigung war als Glilot Interchange bekannt. Hinter ihr standen ein modernes Einkaufszentrum mit einem Multiplexkino, aber auch ein neuer, teils hinter dichten Bäumen verborgener Bürokomplex. Sarah hielt ihn für die Zentrale eines weiteren israelischen Hightech-Giganten.
Sie betrachtete Michails linke Hand. »Hast du ihn schon verlegt?«
»Was denn?«
»Deinen Ehering.«
Michail schien über sein Fehlen verwundert zu sein. »Ich habe ihn vor dem letzten Einsatz abgezogen. Wir sind gestern Nacht spät zurückgekommen.«
»Wo warst du?«
Michail sah sie ausdruckslos an.
»Komm schon, Darling. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, du und ich.«
»Die Vergangenheit ist vergangen, Sarah. Du gehörst jetzt nicht mehr dazu. Außerdem wirst du’s bald genug erfahren.«
»Du könntest mir wenigstens sagen, wo du warst.«
»Das würdest du mir nicht glauben.«
»Jedenfalls muss es dort schlimm gewesen sein. Du siehst schrecklich aus.«
»Das Ende war blutig.«
»Hat’s Verletzte gegeben?«
»Nur bei den bösen Kerlen.«
»Wie viele?«
»Jede Menge.«
»Aber das Unternehmen war ein Erfolg?«
»Eines für die Geschichtsbücher«, sagte Michail.
Die Hightech-Bürogebäude gingen in den reichen Tel Aviver Vorort Herzlia über. Michail las etwas auf seinem Smartphone. Er wirkte wie meistens gelangweilt.
»Bestell ihr schöne Grüße«, verlangte Sarah spitz.
Michail steckte sein Smartphone ein.
»Erzähl mir etwas, Michail. Weshalb hast du dich wirklich freiwillig dafür gemeldet, mich abzuholen?«
»Ich wollte dich privat sprechen.«
»Wozu?«
»Um mich dafür zu entschuldigen, wie’s zwischen uns ausgegangen ist.«
»Ausgegangen?«
»Dafür, wie ich dich zuletzt behandelt habe. Ich habe mich schlecht benommen. Wenn du dich dazu überwinden könntest, mir zu …«
»Hat Gabriel dich damals angewiesen, mit mir Schluss zu machen?«
Michail wirkte ehrlich überrascht. »Wie kommst du bloß auf diese Idee?«
»Das habe ich mich schon immer gefragt.«
»Gabriel hat mir geraten, nach Amerika zu gehen und den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen.«
»Wieso hast du seinen Rat nicht angenommen?«
»Weil dies meine Heimat ist.« Michail sah auf den Flickenteppich aus Feldern vor seinem Fenster hinaus. »Israel und der Dienst. Selbst mir dir hätte ich nie in Amerika leben können.«
»Ich hätte hierher übersiedeln können.«
»Das hiesige Leben ist nicht so einfach.«
»Besser als die Alternative.« Sie bereute das Gesagte sofort. »Aber die Vergangenheit ist vergangen – hast du das nicht selbst gesagt?«
Er nickte langsam.
»Hast du’s jemals bereut?«
»Dass ich dich verlassen habe?«
»Ja, du Idiot.«
»Natürlich.«
»Und bist du jetzt glücklich?«
»Sehr.«
Sarah war überrascht, wie tief seine Antwort sie verwundete.
»Vielleicht sollten wir das Thema wechseln«, schlug Michail vor.
»Ja, bitte. Worüber sollen wir reden?«
»Über den Grund deines Besuchs.«
»Sorry, darüber kann ich nur mit Gabriel sprechen. Außerdem«, sagte sie lächelnd, »habe ich das Gefühl, dass du’s bald genug erfahren wirst.«
Sie hatten den Süden von Netanja erreicht. Die weißen Wohntürme, die den Strand säumten, erinnerten Sarah an Cannes. Michail sprach kurz mit ihrem Fahrer. Wenig später hielten sie am Rand einer breiten Esplanade.
Michail zeigte auf ein heruntergekommenes Hotel. »Dort ist im Jahr 2002 das Passah-Massaker passiert. Dreißig Tote, hundertvierzig Verletzte.«
»Gibt es in diesem Land einen Ort, an dem kein Anschlag verübt worden ist?«
»Ich hab dir gesagt, dass das hiesige Leben nicht einfach ist.« Michail nickte zu der Esplanade hinüber. »Mach einen Spaziergang. Den Rest erledigen wir.«
Sarah stieg aus, ging über den Platz davon. Die Vergangenheit ist vergangen … Einen Augenblick lang glaubte sie das beinahe.
8 NETANJA
In der Mitte der Esplanade lag ein blauer Spiegelteich, um den mehrere orthodoxe Jungen mit fliegenden Schläfenlocken lärmend Fangen spielten. Sie sprachen nicht Hebräisch, sondern Französisch. Das taten auch ihre Perücken tragenden Mütter und die beiden Hipster in schwarzen Hemden, die Sarah von ihrem Tisch vor der Brasserie Chez Claude aus bewundernd anstarrten. Wären die leicht heruntergekommenen kakifarbenen Mauern und der grelle nahöstliche Sonnenschein nicht gewesen, hätte Sarah glauben können, sie überquere einen Platz im XX. Pariser Arrondissement.
Plötzlich merkte sie, dass jemand ihren Namen rief – allerdings auf der zweiten Silbe betont. Als Sarah sich umsah, winkte ihr eine zierliche Schwarzhaarige von der anderen Seite des Platzes aus zu. Die Frau kam leicht hinkend näher.
Sarid, Sarid, Sarid …
Dina küsste Sarah auf beide Wangen. »Willkommen an der israelischen Riviera.«
»Leben hier nur Franzosen?«

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)