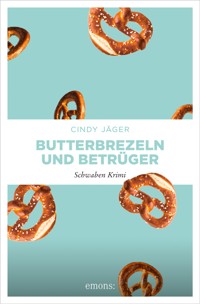3,99 €
Mehr erfahren.
Ein altes Erbe, ein gut gehütetes Familiengeheimnis und zwei Freundinnen, die alles daran setzen, Licht ins Dunkel zu bringen Die Familie von Barthow hat ihre glanzvolle Zeit schon lange hinter sich. Denn sie verdankte ihren Reichtum einem Edelstein, der seit Generationen verschwunden ist. Als die Familienälteste stirbt, droht ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht zukommen. Durch Zufall geraten die Freundinnen Freya und Sevim mitten in die Suche nach dem Familienerbstück. Aber nicht alle Familienmitglieder sind glücklich über ihre Einmischung. Können Freya und Sevim die Rätsel der Vergangenheit lösen und so die Zukunft lenken?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Vermächtnis der Gräfin
Die Autorin
Cindy Jäger wurde 1980 geboren und schreibt sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Dafür plündert sie die Detektivgeschichten ihrer Kindheit, Popsongs und ihre Zeitgenossen. Sie lebt derzeit in der Nähe von Stuttgart, dort überprüft sie die Qualität von Schleim, Schaltkreisen und Spielfiguren und beschert möglichst vielen Katzen ein sorgloses Leben.
Das Buch
Ein altes Erbe, ein gut gehütetes Familiengeheimnis und zwei Freundinnen, die alles daran setzen, Licht ins Dunkel zu bringen
Die Familie von Barthow hat ihre glanzvolle Zeit schon lange hinter sich. Denn sie verdankte ihren Reichtum einem Edelstein, der seit Generationen verschwunden ist. Als die Familienälteste stirbt, droht ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht zukommen. Durch Zufall geraten die Freundinnen Freya und Sevim mitten in die Suche nach dem Familienerbstück. Aber nicht alle Familienmitglieder sind glücklich über ihre Einmischung. Können Freya und Sevim die Rätsel der Vergangenheit lösen und so die Zukunft lenken?
Cindy Jäger
Das Vermächtnis der Gräfin
Zwei Freundinnen ermitteln
Kriminalroman
Midnight by Ullsteinmidnight.ullstein.de
Originalausgabe bei MidnightMidnight ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinSeptember 2019 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Umschlaggestaltung:zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © Dorothe LundeE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95819-249-2
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Danksagung
Leseprobe: Leichenschmaus im Herrenhaus
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
1970
»Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns aus dem traurigen Grund des Ablebens der Gräfin Sybille Louise von Barthow hier zusammengefunden und als ihr Testamentsverwalter habe ich nun die ehrenvolle Aufgabe, ihren letzten Willen auszuführen.«
Er legte pietätvoll eine Pause ein, so wie er es nach diesem salbungsvollen ersten Satz immer tat, und blickte in die Runde der Hinterbliebenen. Die verstorbene Gräfin hatte es so gewollt, dass sich alle im Kaminzimmer des Ostflügels versammelten, welches von den insgesamt sechsunddreißig Zimmern des Schlosses ihr liebstes gewesen war.
Nur gut, dass nicht mehr viele Leute Anspruch auf das Erbe der von Barthows erheben können, dachte er sich.
Seitens der Gräfin gab es nur zwei Cousinen, die bereits zu gebrechlich waren, um den weiten Weg auf sich zu nehmen, und die außerdem ihre Katzen nicht alleine lassen wollten. Die Zwei- und Vierbeiner würden bis an ihr Lebensende versorgt sein.
Alle Anwesenden entstammten ausschließlich der Familie von Barthow selbst und hatten bereits nach dem Tod des letzten Grafen auf einen Teil vom Familienvermögen gehofft. Dieser hatte jedoch alles seiner Frau hinterlassen, was dazu geführt hatte, dass in den vergangenen sieben Jahren jeder Einzelne um die Gunst der Gräfin gebuhlt hatte.
Da waren Carl Konstantin, der jüngere Bruder des verstorbenen Grafen, und seine Frau Ingrid sowie deren bereits erwachsene Kinder. Carl Alexander, der Älteste, seine Schwester Theresa und Philipp, der Jüngste. Sie hatten es sich auf den Clubsofas gleich neben dem Kamin, nun, vielleicht nicht gerade gemütlich gemacht, aber sie saßen da, als wüssten sie, dass sie dort hingehörten.
Anders ihre weitläufige Verwandtschaft. Eine Cousine des verstorbenen Grafen hatte sich bereits vor Jahrzehnten von der Familie abgewandt und den klangvollen und geschichtsträchtigen Namen von Barthow bei ihrer Heirat eingetauscht. Ihr Sohn hieß jetzt schlicht und einfach Michael Frank und er hätte alles dafür gegeben, die Entscheidung seiner Mutter rückgängig zu machen. Was ihm jedoch an standesgemäßer Erziehung fehlte, machte er durch seine Anpassungsfähigkeit wett und es war ihm gelungen, dass der verstorbene Graf ihn samt Frau und Kindern dazu einlud, auf Schloss Barthow zu wohnen. Jetzt kauerte er jedenfalls mit seiner Frau auf dem Sofa, das am weitesten vom Kamin entfernt stand.
Schließlich gab es noch Magdalena von Barthow. Sie war die jüngere Schwester des Grafen und blickte, an eine Fensterbank gelehnt, in die Ferne, als würde sie das alles nichts angehen.
Trauer konnte der Testamentsverwalter bei keiner einzigen Person entdecken. Einige rutschten nervös auf ihren gepolsterten Sitzmöbeln herum, andere blickten betont gleichgültig in die Runde.
Er seufzte leise. Seine Erfahrung ließ ihn bereits erahnen, welche der Hinterbliebenen das Testament verärgert aufnehmen und versuchen würden, ihm das Leben schwerzumachen.
Er räusperte sich vernehmlich, blickte den Anwesenden fest in die Augen und begann laut vorzulesen:
Meine lieben Verwandten! Oder sollte ich besser sagen, meine lieben Faulenzer, Schmarotzer und Tagediebe?Nichts für ungut – Ihr seid nun alle hier zusammengekommen und denkt, Ihr hättet es fast geschafft, nicht wahr? Ein jeder von Euch hat sich in den vergangenen Jahren furchtbar angestrengt, sich darin würdig zu erweisen, die Geschäfte der Familie auf Schloss Barthow fortzuführen.Ihr habt aufs Stichwort mit Eurem Wissen zur Familiengeschichte geglänzt und eifrig meine kleinen Rätsel gelöst, was wirklich amüsant war.Nun – Ihr habt Euch umsonst bemüht und ich möchte Euch freundlicherweise jetzt schon warnen: Mit mehr als einem Taschengeld werdet Ihr nicht nach Hause gehen.Erstens: Den Familienschmuck gibt es schon lange nicht mehr, ich habe die Diamanten, die Saphire und Smaragde und das reine Gold veräußern müssen, aus Gründen, die Ihr mit Sicherheit nicht versteht. Die Colliers und Armbänder, die Taschenuhren und Manschettenknöpfe, mit denen Ihr euch schmückt, sind nur buntes Glas und billiges Metall. Ich habe sie anfertigen lassen, damit der Anschein von Glanz und Überfluss gewahrt bleibt, und das ist doch das Wichtigste, meint Ihr nicht auch?
Keiner der Anwesenden hörte mehr zu.
»Das ist eine bodenlose Unverschämtheit«, empörte sich Carl Constantin von Barthow, ein distinguierter Herr in seinen Sechzigern.
»Sie hat die Schmuckstücke versteckt und uns versprochen, der Finder darf sie behalten«, brauste Ingrid von Barthow, seine Ehefrau, auf. »Und wir haben ihre Spielchen mitgespielt, über ihren Wortspielen gegrübelt und wie Idioten das Haus und den Garten abgesucht, und jetzt ist alles gar nichts wert? Das alles war umsonst?«
Sie befingerte ungläubig den enormen tropfenförmigen grünen Stein, der an einer Goldkette um ihren gut gepflegten Hals hing.
Jutta Frank nahm ihre Ohrringe ab und ihr Ehemann betrachtete kritisch seine Manschettenknöpfe.
»Es lässt sich ganz einfach herausfinden, ob die Steine echt sind«, ließ sich Magdalena vernehmen. Sie trug gar keinen Schmuck und war auf eine schlichte, zweckmäßige Art gekleidet, die darauf schließen ließ, dass sie sich regelmäßig die Finger schmutzig machte.
»Ach ja?«, erwiderte Carl Constantin. »Interessierst du dich auf einmal doch für etwas anderes als die Gäule, die uns nur die Haare vom Kopf fressen?«
»Die equine Tradition gibt es in unserer Familie seit 1681 …«
»Was Tante Magdalena meint«, fuhr Philipp dazwischen, »ist sicher, dass wir versuchen könnten, einen der Steine zu zerstören. Wenn er bricht, ist es eindeutig Glas und Tantchen hat uns alle an der Nase herumgeführt.« Der Gedanke schien ihn zu amüsieren – im Gegensatz zu seinen Verwandten.
»Nimm deine Kette ab, Ingrid«, befahl ihr Mann.
»Warum denn ich?«, erwiderte diese und krallte ihre Faust um das tropfenförmige Schmuckstück.
»Dieses ganze Theater ist unserer Familie unwürdig«, fuhr eine junge Frau dazwischen. Sie löste ihr Armband, an dem sich vermeintlich Saphire aneinanderreihten, und gab es ihrem Vater.
»Vielen Dank, Theresa. Sehr vernünftig von dir.«
Ihr Bruder sah sich derweil im Raum um, bis sein Blick auf einen marmornen Briefbeschwerer fiel, der auf dem kleinen Schreibkabinett ruhte. Er brachte ihn seinem Vater.
»Nun denn, Zeit der Wahrheit ins Gesicht zu blicken.« Er hob bereits an, als seine Frau seinen Arm umklammerte.
»Nicht auf dem Tisch, Carl, das ist ein echter Georges Jacob! Wenn uns schon der Schmuck nicht bleibt, dann wenigstens das Mobiliar. Aber vielleicht hat sie ja auch das nachmachen lassen«, schloss sie grimmig.
Also trug Carl Constantin alles zu einem der massiven Fenstergesimse, breitete das Armband darauf aus und ließ den Briefbeschwerer beherzt niedersausen.
Seine Fassungslosigkeit musste wohl im gesamten Raum spürbar gewesen sein, denn plötzlich sprangen alle auf und drängten sich vor dem Fenster zusammen. Niemand sagte etwas und wer weiß, wie lange die Stille angehalten hätte, wenn nicht zwei Dinge zugleich geschehen wären.
Seine Frau Ingrid brach in Tränen und sein Sohn Philipp in Gelächter aus.
Theresa sah ihren jüngeren Bruder scharf an und führte ihre Mutter zurück zum Sofa.
»Sie wird uns auf die Straße setzen«, jammerte diese matt.
»Vielleicht hören wir uns erst einmal an, was sie uns sonst noch zu sagen hat.« Carl Alexander, der Älteste der Kinder, war auf dem Sofa sitzen geblieben und schaute drein, als würde er über allem stehen.
Nachdem sich auch die entfernten Verwandten wieder gesetzt hatten, fuhr der Testamentsverwalter fort. »Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, hier …«
Ihr denkt jetzt sicher, ich wäre eine alte, abscheuliche, gehässige Frau, aber ich bilde mir gerne ein, im Allgemeinen ganz umgänglich zu sein, diese Ehre wird also nur Euch zu teil. Nun, weiter.Zweitens: Ihr seid es gewohnt, hier im Schloss zu wohnen, entweder seit Eurer Geburt, oder weil Ihr es geschafft habt, Euch bei meinem verstorbenen Mann, Alexander Graf von Barthow, unentbehrlich zu machen. Nur Ihr wisst, was Ihr dafür auf Euch genommen habt, aber ich bin mir sicher, es war ein für Euch profitables Geschäft. Auch mir hat der Familienstammsitz sehr viel bedeutet und ich wage zu behaupten, jeden Tag, den ich hier verbringen durfte, geschätzt und genossen zu haben. Gleichwohl ist mir bewusst, dass einige, wenn nicht alle von Euch, der Meinung sind, eine wie ich hätte nie hierhergehört. Ich kann Euch nur sagen, gewöhnt Euch daran, denn ich vermache das Schloss und das angrenzende Anwesen der Stadt, zum größtmöglichen Nutzen und zur Erbauung der Bevölkerung …
»Sie wagt es«, brauste Carl Constantin auf, »mein Bruder hat sie aus der Gosse in unsere Familie geholt und sie wagt es …«
»Darf sie das denn so einfach?«, ereiferte sich nun auch Michael Frank. »Unsere Familie wohnt seit zweihundertachtundvierzig Jahren hier auf Schloss Barthow und jetzt soll jeder Hinz und Kunz ein- und ausgehen dürfen?«
»Das hätte der Graf nie zulassen dürfen, warum hat er alles ihr vermacht?«, meldete sich nun Jutta Frank, seine Frau, zum ersten Mal zu Wort. »Hat er denn gar nicht an die Familie gedacht? Was soll jetzt bloß aus uns werden …«
»Mein Bruder war schon immer viel zu großherzig und zu modern«, fuhr Carl Constantin dazwischen, »das Schloss war ihm doch völlig egal, wenn er sich nur in der Weltgeschichte herumtreiben konnte!«
»Bitte, Vater«, erwiderte Carl Alexander eisig, »wir wollen es doch hinter uns bringen.« Er nickte dem Testamentsverwalter barsch zu.
… zum größtmöglichen Nutzen und zur Erbauung der Bevölkerung. Und ich möchte an Dich, liebe Theresa, die Aufgabe herantragen, Dich als zukünftige Verwalterin um den Familiensitz zu kümmern. Der Stadt lasse ich eine entsprechende Anordnung zukommen. Du bist eine kluge junge Frau und hast sogar studiert, aber durch Deinen Standesdünkel und die vererbte Wichtigkeit hast Du es nicht für nötig gehalten, Dich in der Welt zu beweisen. In dieser Stadt gibt es nicht viel, worauf die Leute stolz sein können. Strenge Deine Kräfte an, den Familiensitz zu erhalten und den einfachen Leuten seine Kostbarkeiten ans Herz wachsen zu lassen.Aber keine Sorge, so kaltherzig, dass ich Euch einfach auf die Straße setze, von der mich mein Mann einst aufgelesen hat, bin ich nicht. Ihr sollt natürlich weiterhin hier wohnen. Genau wie die guten Geister, die hier im Schloss ihren Dienst tun. Der Ostflügel ist nur der Familie vorbehalten, auch das habe ich festgelegt.Als Verwalterin für das Gestüt und die Pferde setze ich Dich ein, Magdalena. Du hast Dich über fünf Jahrzehnte um die Pferde hier gekümmert und sie wie Kinder geliebt. Nun liegt es an Dir zu entscheiden, ob diese Familientradition mit Deinem Leben endet, oder ob Du eine würdige Nachfolge findest.Michael und Jutta, Ihr lagt meinem verstorbenen Mann sehr am Herzen. In seinem Sinne habe ich für jedes Eurer Kinder ein Treuhandkonto einrichten lassen, mit dem Geld sollen sie einmal studieren – oder aber sie werfen alles in kurzer Zeit aus dem Fenster. Es liegt an Euch, die nächste Generation der von Barthows angemessen auf das Leben vorzubereiten.Zusätzlich zu Eurem lebenslangen Wohnrecht, vermache ich jedem von Euch fünfunddreißigtausend Mark. Das scheint für Euch nicht viel zu sein, aber es ist mehr als andere Menschen jemals in ihrem Leben auf einmal zu sehen bekommen. Ihr könnt das Geld investieren, versuchen etwas damit aufzubauen und Euch einmal anzustrengen.Zu guter Letzt: Das Feuer des Nordens. Ihr fragt euch sicher, was daraus werden soll, und hier ist meine Antwort. Ich habe die Familie von seinem Fluch befreit, macht Euch also keine Gedanken mehr darum. Es wird mit seinem Finder vereint sein, bis in alle Ewigkeit, und keiner von Euch wird es jemals wieder in den Händen halten. Ich rate Euch, vergesst es einfach und macht Euch daran, Euer eigenes Feuer zu finden, genau wie Eure Vorfahren.
Der Testamentsverwalter senkte das Blatt und hoffte, dass der Sturm der Entrüstung nicht allzu heftig über ihn hereinbrechen würde.
»Das ist alles? Über sechshundert Jahre Familiengeschichte und das war es jetzt?« Ingrid von Barthow sah plötzlich um Jahre gealtert aus und fühlte sich auch so.
Jutta Frank erwiderte: »Aber damit kann man doch etwas anfangen, oder? Es ist doch besser als nichts?«
»Besser als nichts?«, erwiderte Carl Alexander mühsam beherrscht. »Das ist unsere Familie, unser Familiensitz, unsere Geschichte – es ist in unserem Blut und sie wirft einfach alles weg, obwohl es ihr gar nicht gehört! Besser als nichts? Sie hat es sich hier gut gehen lassen mit ihren Partys und Gesellschaften und hat sich wichtig gemacht und dafür unser Erbe versetzt. Und jetzt sollen wir mit einem Almosen auskommen und uns durch ihre Gnade alle im Ostflügel zusammenpferchen? Besser als nichts – was weißt du denn schon? Du bist doch nicht besser als diese alte Hexe, deren einzige Großtat es gewesen ist, meinen Onkel dazu zu bringen, sie zu heiraten.«
»Carl Alexander, bitte«, ermahnte ihn seine Mutter schniefend. »Wir wollen auch in einer Situation wie dieser unsere guten Manieren nicht vergessen …«
»Aber das Feuer des Nordens«, erwiderte Philipp, »wo kann es nur sein? Lesen Sie die betreffende Stelle noch einmal vor«, befahl er dem Testamentsverwalter.
»Das Feuer des Nordens. Ihr fragt Euch sicher, was daraus werden soll, und hier ist meine Antwort. Ich habe die Familie von seinem Fluch befreit, macht Euch also keine Gedanken mehr darum. Es wird mit seinem Finder vereint sein, bis in alle Ewigkeit …«
»Ja, ja, schon gut«, winkte er ungeduldig ab.
»Aber unser Onkel hat es gefunden und der ist seit sieben Jahren tot«, meinte Theresa ratlos.
»Vielleicht ist das ihr letztes Rätsel«, erwiderte Ingrid hoffnungsvoll. »Und wer das Feuer des Nordens findet, darf es behalten? Wir sollen uns ja schließlich anstrengen.«
Carl Alexander beobachtete seine Familie, einige sahen aus dem Fenster, sie würden vermutlich im Garten oder den Stallungen suchen. Andere vielleicht im ehemaligen Arbeitszimmer, oder sie würden im Gemälde des Grafen, das den Treppenaufgang im Westflügel zierte, nach Hinweisen forschen.
»Vielleicht hat sie es unter seinen alten Sachen versteckt«, mutmaßte Carl Constantin. »Ihr bleibt hier, ich werde in seinen ehemaligen Räumen nachsehen.«
»Kommt nicht infrage«, entgegnete Michael Frank, »wir suchen alle danach.«
»Vielleicht ist es bei seinen Überresten in der Familiengruft«, flüsterte seine Frau.
Sie sprangen auf und zerstreuten sich in alle Richtungen.
»Ich sehe nach den Pferden«, erklärte Magdalena tonlos und ging gemessen hinaus.
Nur Carl Alexander blieb. Er klammerte sich an die Hoffnung, dass der rote Beryll doch noch auftauchte. Aber insgeheim wusste er, das Feuer des Nordens war längst fort.
Carl Alexander wartete ungeduldig darauf, dass der Testamentsverwalter die letzten Worte der Gräfin an ihre Bediensteten überbrachte. Lange musste er nicht in der Vorhalle ausharren, denn bereits nach zwanzig Minuten öffnete sich die Tür und die guten Geister traten wieder aus dem Kaminzimmer, wo sie unbehaglich auf den Sofas und Sesseln gehockt hatten, was bisher in vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten undenkbar gewesen war. Einige tupften sich die Augen, andere hielten den Blick gesenkt oder gingen stoisch wieder an ihren Arbeitsplatz. Das Leben musste ja weitergehen.
Einfalt kann doch ein Segen sein, dachte Carl Alexander ohne Hohn. Der um sein Erbe Gebrachte wusste genau, wen aus der Dienerschar er sich herauspicken musste.
»Georg, auf ein Wort«, wies er den Gärtner an, der seit 1945 in Diensten von Graf und Gräfin gestanden hatte.
Dieser betrachtete ihn gleichgültig und sagte kein Wort.
»Von allen Bediensteten hatten Sie in den letzten Wochen am häufigsten mit meiner Tante zu tun.«
Der Gärtner ließ keine Regung erkennen.
»Die Gräfin hat Sie zu sich ans Bett rufen lassen und Sie haben Botengänge und andere Dinge für sie erledigt.«
Sein Gegenüber nickte kurz und Carl Alexander wurde ungeduldig. Noch war er schließlich wer, hier im Schloss.
»Ich bin mir sicher, sie hat Ihnen bestimmte Dinge anvertraut, Dinge, von denen keiner sonst weiß.«
»Ach ja?«
Carl Alexander ließ ihm die Respektlosigkeit durchgehen und antwortete nur: »Ja. Dinge, die für die Familie von Bedeutung sind.«
»Davon weiß ich nichts.«
Carl Alexander zwang sich zur Ruhe. »Sie stehen seit fünfundzwanzig Jahren im Dienste unserer Familie und waren immer ein treuer und zuverlässiger Teil des Haushalts. Bestimmt liegt Ihnen das Fortkommen der von Barthows nicht fern?«
»Nun, so wie ich es verstanden habe, unterscheiden sich die von Barthows nicht mehr sehr vom Rest der Bevölkerung.«
»Immer noch genug!« Carl Alexander baute sich vor ihm auf. »Und du willst doch bestimmt keinen Ärger mit uns. Was hat die Alte dir aufgetragen und wo ist der Stein? Raus mit der Sprache, sonst …«
»Was sonst?« Der Gärtner war zwar einen halben Kopf kleiner als er, aber ziemlich drahtig und seine Miene war undurchdringlich. Mit der rechten Hand fuhr er sich über die Narbe, die er sich im Zweiten Weltkrieg zugezogen hatte, und die sich von seinem Kinn bis zum Ohr zog.
Carl Alexander sah ein, dass keine seiner Drohungen an das heranreichen würde, was Georg nicht schon erlebt, wenn nicht sogar überlebt hatte. Zu wissen, wann einem seine Abstammung weiterhalf und wann nicht, gehörte zu seinen Strategien, das Leben zu meistern.
»Ich behalte dich im Auge. Und jetzt wieder an die Arbeit, aber plötzlich.«
Der Kerl wagte es noch, unverschämt zu grinsen, und ging davon.
Carl Alexander bebte. Das war das Ende. Graf Alexander von Barthow hatte keine Nachkommen, der Titel war erloschen, das Schloss verloren. Die Geschichte der Familie endete hier und jetzt im Jahre 1970.
Kapitel 1
2018
Das erste Mal seit Jahren freute sich Freya so richtig auf ihren Geburtstag.
Sie freute sich sogar so sehr, dass sie sich den Tag freigenommen und nicht nur alle eingeladen hatte, die ihr am Herzen lagen, sondern aus Versehen auch Sevims Schwester Seyhan.
Freya fragte sich, wie das passieren konnte. Sevim war seit der Grundschule ihre beste Freundin und Freya war bei ihrer Familie, den Caners, ein- und ausgegangen. Und die Einzige, die sie nicht mochte, war Sevims jüngere Schwester. Diese hatte schon immer ein einnehmendes Wesen gehabt, den Hang, sich immer und überall die Rosinen herauszupicken und alle anderen dabei herumzukommandieren. In der Wohnung, die sich Freya und Sevim seit Studentenzeiten teilten, war Seyhan dann auch ein sehr seltener Gast gewesen.
Jetzt malträtierte sie aber auf ihre forsche Art die Türklingel und Freya war sich unschlüssig. Was, wenn ich einfach nicht aufmache?, dachte sie sich und schaute sehnsüchtig ins Wohnzimmer. Dort saßen ihre Gäste schon am eingedeckten Tisch, schlürften Milchkaffee und unterhielten sich angeregt. Doch Sevim drückte gleichzeitig Summer und Klinke und sie hörten Seyhan nach oben stapfen.
»Hallo, alle miteinander, schön, dass ihr da seid«, rief Sevims Schwester durch die offene Wohnzimmertür, als hätten sich alle ihretwegen versammelt. »Ich sag’s aber gleich, ich hab’ wirklich nicht viel Zeit!«
»Ja, toll!«, entgegnete Freya begeistert. Und als Seyhan sie ungläubig anblickte, fügte sie hinzu: »Äh … toll, dass du trotzdem da bist. Wie lange bleibst du denn?«
»Äh …«
»Warum gehen wir nicht erst mal ins Wohnzimmer?«, meinte Sevim.
Ihre Schwester rümpfte die Nase. »Wollt ihr euch nicht mal eine andere Bleibe suchen, oder wenigstens neue Möbel? Ihr wohnt ja immer noch wie Studentinnen. Dabei hast du jetzt deine eigene Agentur, wo du Leute berätst, und Freya hat auch endlich einen richtigen Job …«
»Ich berate die Leute am Telefon, sie werden unsere Wohnung nie zu Gesicht bekommen, und du hörst dich an wie unsere Mutter«, versuchte Sevim sie abzuwürgen.
»Gar nicht«, erwiderte ihre Schwester, »ich meine nur, wenn man es endlich zu etwas bringt, muss man es auch zeigen. Wozu sonst das Ganze? Und ihr seid ja sogar ein bisschen berühmt in der Stadt, nachdem ihr letztes Jahr das Bild wiedergefunden habt …«
Freya sog hörbar die Luft ein. Die Sache mit dem Bild war immer noch ein wunder Punkt. Sie arbeitete nämlich in einer Galerie, in der die Privatsammlung der Ackermanns, einer wohlhabenden und einflussreichen Familie, öffentlich ausgestellt wurde. Und vor gut einem Jahr, gerade als Freya dort angefangen hatte zu arbeiten, war in ihrem Beisein ein Gemälde entwendet worden. Mit Sevims Hilfe hatte sie es nach Monaten schließlich wiedergefunden und Sonja Ackermann, ihre Chefin, hielt es ihr auch gar nicht vor. Aber trotzdem wollte Freya lieber nicht an diese Zeit zurückdenken.
Seyhan bemerkte Freyas Unbehagen natürlich nicht. »Also jetzt schreibt natürlich keiner mehr über euch«, fuhr sie munter fort. »Wollt ihr nicht bald mal wieder ein Verbrechen aufklären?«
»Oder wir schneiden die Torte an«, erwiderte Freya grimmig, denn das war der Plan gewesen, bevor Seyhan zu ihrer Klingelarie angesetzt hatte.
»Oh ja, ich hab’ in meinem Bauch extra Platz für die Torte freigehalten!«, meinte Freyas gute Bekannte Suzette, die im selben Haus wohnte und im Erdgeschoss außerdem einen Second-Hand-Laden betrieb. Sie betrachtete lüstern das dreistöckige Kunstwerk, das Freya zwei Wochen lang geplant, und dann selbst gebacken und dekoriert hatte.
Nach der Torte waren die Geschenke dran, Freya hatte sie auf einer Kabelrolle aus Holz, die nun als Sofatischchen diente, gestapelt.
Sie griff nach einem goldgelben Köfferchen, das ihre Chefin ihr gestern Abend in die Hand gedrückt hatte. Freya löste die Verschlüsse und der Koffer teilte sich in zwei Hälften, sodass auf jeder Seite zwei versetzte Schübe zu erkennen waren. In jedem steckten zehn Glasbehälter mit andersfarbigem Inhalt. »Zuckerstreusel in vierzig verschiedenen Farben, Wahnsinn«, flüsterte Freya gerührt.
Von Suzette bekam sie einen schwarzen Ledergürtel, der nicht zu lang und nicht zu kurz war, nicht zu schmal und nicht zu breit, nicht zu glänzend, aber auch nicht zu matt, nicht zu braun oder blau, sondern einfach nur perfekt. Freya konnte es nicht fassen, seit Jahren hatte sie nach so etwas gesucht und immer wieder etwas auszusetzen gehabt und jetzt hielt sie den perfekten schwarzen Ledergürtel in der Hand.
Von ihrer besten Freundin bekam Freya eine winzige Tube mit Ölfarbe – das schwärzeste Schwarz, das Sevim nur im Ausland bestellen konnte und auf dessen Lieferung sie monatelang gewartet hatte.
»Ich werde mir genau überlegen, was ich damit male«, versicherte Freya.
Nadja und Yun, die Sevim und Freya noch von der Uni kannten, schenkten ihr ein Vakuumiergerät. Damit waren alle ihre Hobbys bedacht, und Freya höchst zufrieden.
»Du hast mein Geschenk noch gar nicht aufgemacht«, meinte Seyhan.
Also widmete sich Freya dem grob in Packpapier eingeschlagenen und scheinbar hundertfach mit Tesa gesicherten Paket.
Sie selber packte jedes Geschenk akribisch ein, Papier, Schleifenband, Anhänger alles passend zum Geschenk und zur beschenkten Person, und dies war ein persönlicher Affront. Ich hätte es zuerst auspacken sollen, dann wäre alles nur noch besser geworden, dachte sie sich, während sie danach suchte, wo das Klebeband seinen Anfang nahm.
»Meine neuen Kollegen haben mich gefragt, ob ich mit zum Flohmarkt komme. Die stehen total auf Shabby Chic.« Sie sah sich missbilligend in Freyas und Sevims Wohnzimmer um. »Aber sonst sind sie ganz nett. Und ich dachte mir, na ja, vielleicht erzählen sie ja etwas über die Arbeit, wovon man wissen sollte.«
Das sah Seyhan ähnlich, dass sie in einer Situation nur auf ihren Vorteil bedacht war.
»Ich selber würde mir ja nichts kaufen, das andere Leute schon benutzt haben, aber wenigstens habe ich dort etwas für dich gefunden«, fuhr Seyhan fort. »Du magst doch sinnlose Sachen. Als ich das Ding gesehen habe, musste ich jedenfalls sofort an dich denken.«
Nur völlig fantasielose Menschen wie Sevims Schwester konnten auf die Idee kommen, liebevoll aus Resten zusammengebastelte Möbel und Alltagshelfer als sinnlos zu bezeichnen.
Sevim seufzte, egal was ihre Schwester da besorgt hatte – Freya würde es schon aus Prinzip nicht mögen. Diese hatte sich jetzt durch das Klebeband gekämpft und wickelte mehrere Lagen Packpapier auf den Boden.
Zum Vorschein kam eine schwarz lackierte Holzschatulle, ungefähr halb so groß wie ein Schuhkarton. Der untere Teil war wie ein Sockel geformt, über dem sich einzelne Holzleisten rundherum wie ein Zaun aneinanderreihten und oben von einem filigran geschnitzten Deckel abgeschlossen wurden.
Freya versuchte, das Kistchen zu öffnen, aber ganz gleich, von welcher Seite sie den Deckel anheben wollte, er ließ sich nicht bewegen. Wie sie das Kistchen auch drehte und wendete – es blieb verschlossen. Freya war wider Willen fasziniert!
Seyhan hielt sich schließlich an ihr Versprechen bald wieder zu gehen, und stürzte noch schnell ein Glas Sekt hinunter, bevor sie sich auch schon verabschiedete. Freya atmete auf und konnte den Tag in Ruhe ausklingen lassen.
»Es kann doch nicht sein, dass man das Ding nicht aufbekommt«, meinte Yun und reichte die Schatulle an Suzette weiter.
Das Kästchen hatte bereits mehrmals die Runde gemacht. Sie hatten versucht, den Deckel zu heben, oder zu verschieben, hatten es auf den Kopf gestellt und geschüttelt – aber nichts war passiert. Schließlich hatte Freya ihren Werkzeugkoffer geholt und fuhr mit einer Specksteinfeile vorsichtig an den Stellen entlang, an denen die Holzteile aufeinandertrafen, auch das vergebens.
»Ich will es nicht kaputt machen, aber ich will auch wissen, was darin ist …«
»Es hat nicht mal ein Schloss, dann könnte man es zu einem Schlüsseldienst bringen«, meinte Nadja.
»Hm … da wüsste ich jemanden«, meinte Suzette und sah Sevim vielsagend an.
»Ja, klar!« Sevim nickte. »Bernd.«
»Wenn jemand das Kästchen öffnen kann, dann er. Als mir mein Schlüsselbund in den Gulli gefallen ist, hat Bernd sowohl meine Laden- und die Wohnungstür als auch die Tür von meinem Micra geknackt«, erklärte Suzette. »Und meine Ladenkasse, nicht zu vergessen, und irgendwann den Gullideckel!«
»Ich melde uns gleich für morgen in seiner Werkstatt an«, antwortete Sevim und dachte nach. Bernd kannte Freya ja noch nicht und er mochte es gar nicht, wenn Fremde in seiner Werkstatt ein- und ausgingen. Ob er neue Leute immer noch einem Kennenlerntest unterzog? Und war es noch der gleiche, den sie selbst damals gemacht hatte?
Sie musste Freya auf jeden Fall auf das Treffen vorbereiten. Ihre Freundin schreckte ja auch immer davor zurück, neue Leute kennenzulernen, und Bernd war da noch einmal eine ganz andere Hausnummer als der durchschnittliche Fremde. Sevim kicherte. Das Aufeinandertreffen würde interessant werden.
Bernd war ein Mensch, der im Chaos aufblühte.
In seiner Fahrradwerkstatt wuselten jede Menge Leute herum, von denen Sevim nie wusste, ob es andere Kunden waren, oder Typen, die gerade keine Bleibe hatten. Manchmal fand sie Bernd auch gar nicht im Gewimmel, dann war er unterwegs, um jemandem billig das Auto zu reparieren – so hatte Suzette ihn kennengelernt – oder er brachte den Kaffeeautomaten im Café gegenüber wieder zum Laufen oder er betätigte sich als »Schlüsseldienst«, was auch immer das gerade hieß.
Sevim hatte seine Bekanntschaft gemacht, nachdem sie gerade als Lehrerin angefangen hatte. Wie immer wollte sie in aller Herrgottsfrühe mit dem Rad in die Schule aufbrechen, als ihr beim Aufsteigen die Kette riss.
»Mist«, entfuhr es ihr, »warum gerade heute?!«
»Was ist denn los, Kleine?« Der Zufall wollte es, dass auf dem Balkon im ersten Stock Suzette gerade ihren Morgenkaffee genoss, bevor sie unten im Laden alles für den Tag herrichten würde.
Suzette hatte sie schließlich mit ihrem Nissan Micra zur Schule gebracht und sie für den Nachmittag in Bernds Fahrradwerkstatt angemeldet, wo sich Sevim erst einmal Bernds Eingangsfragen hatte stellen müssen.
Und nun war Freya an der Reihe, Bernd Rede und Antwort zu stehen. Sevim hatte sie den halben Abend darauf vorbereitet und konnte nur hoffen, dass ihre Freundin mit der Situation fertig wurde.
»Weltfrieden oder Heilmittel gegen Krebs?«, fragte Sevim probehalber, während sie Bernds Werkstatt betraten.
»Weltfrieden«, antwortete Freya brav, »dann gibt es automatisch mehr Ressourcen für die medizinische Forschung.«
»Ich glaube, die Begründung will er gar nicht hören.« Sie schlängelten sich an ein paar Leuten vorbei, die Sevim schon vom letzten Mal kannte, überstiegen zwei Hunde und entdeckten Bernd schließlich an einer Werkbank.
»Und ihr kennt euch seit der Schulzeit«, begrüßte er Sevim, während er Freya eingehend musterte.
Sevim nickte. »Seit der dritten Klasse. Wir haben da ein Problem mit …«
»Moment. Ich hab’ da erst ein paar Fragen …«
Freya wappnete sich.
»Lieber fluchen oder lieber tratschen?«
»Ähhhh … fluchen?«
»Das frag’ ich dich!«
»Ja, dann … fluchen …«
Freya verfluchte sich gerade selbst, bestimmt war sie viel zu langsam und schon jetzt durchgefallen.
»Was ist schlimmer: Rauchen oder Ruhestörung?«
Nachdem Freya die persönlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte gegeneinander abgewogen hatte, fiel ihr auf, dass es in der Werkstatt nicht nach Rauch roch und an jeder Wand mindestens ein Schild mit durchgestrichener Zigarette hing. »Rauchen«, sagte sie endlich.
»Letzte Frage. Was kann man eher verzeihen, Diebstahl oder Fahrerflucht?«
Da musste Freya nicht lange überlegen: »Diebstahl.«
Bernd musterte sie eine Weile schweigend und schloss dann die Augen.
Hilfe suchend blickte Freya zu ihrer Freundin, aber diese zuckte nur mit den Schultern. Sevim hatte keine Ahnung, wie seine Entscheidung ausfallen würde, oder was Bernd mit seinen Fragen bezweckte. Sie hegte allerdings einen Verdacht, nämlich dass er es einfach mochte, wenn ihn ein Geheimnis umgab und ihn seine Mitmenschen nicht einschätzen konnten.
»Super!«, rief Bernd schließlich und riss die Augen auf. »Wir gehen besser nach hinten.«
Freya fragte sich, ob schon einmal jemand den Test nicht bestanden hatte und von Bernd als Bekanntschaft abgelehnt worden war.
»Oh, Moment noch«, hielt Bernd sie davon ab, die Werkbank zu umrunden. Er wickelte sich eine dicke Wollschlange vom Hals, die sich als Hose entpuppte, und schlüpfte hinein. Danach winkte er sie durch die Tür, die in sein Hinterzimmer führte.
»Wie findet ihr meinen neuen Kaftan?«, fragte er, als er es sich in einem abgewetzten Sessel in seinem Hinterzimmer gemütlich machte.
»Ein Kaftan geht für gewöhnlich bis zu den Kniekehlen, das da ist eher eine Tunika«, entgegnete Freya, wie aus der Pistole geschossen.
»Kaftan oder Tunika?«, erwiderte Bernd.
»Äh …«
»Kleiner Scherz. Also, was habt ihr für mich?«
Freya holte die Schatulle aus ihrer Umhängetasche und stellte sie zögerlich vor Bernd auf das kleine Campingtischchen, auf dem unzählige Kaffeeringe bereits ein psychedelisches Muster bildeten.
Bernd drehte sie mit schmutzigen Fingern mal in die eine, mal in die andere Richtung, stellte sie auf die Seite und auf den Kopf und betrachtete das Objekt jedes Mal schweigend. Jetzt hatte er die Augen geschlossen, die Hände in seinem Schoß.
Sevim sah sich interessiert um und Freya tat es ihr gleich. Aber neben Reifen, Sätteln, Lenkern verschiedener Formate und viel Staub und Dreck gab es nichts Besonderes zu entdecken. Freya versuchte die staubbedeckten Fensterbänke und den ungekehrten Boden nicht allzu eingehend zu betrachten. Auch wenn es in ihrer Wohnung ähnlich chaotisch aussah, war doch alles immer porentief rein.
»Wie spät ist es?«, fuhr Bernd plötzlich aus seiner meditativen Haltung auf.
»Kurz vor acht«, meinte Sevim nach einem Blick auf die Wanduhr hinter ihm.
»Dann muss ich euch jetzt leider rausschmeißen, die Werkstatt schließt gleich.«
Freya griff nach der Schatulle, aber Bernd war schneller. »Lass’ das Ding besser hier, ich werde eine Weile brauchen, es zu knacken.«
Freya traute sich nicht zu widersprechen.
»Und, wie findest du Bernd?«, wollte Sevim wissen, als sie auf dem Heimweg im Pizza Palazzo Halt machten.
Freya war immer noch ein bisschen mitgenommen.
»Er ist schon irgendwie komisch.«
Sevim schwieg darauf. Die Ironie wollte es, dass etliche Menschen auch Freya für komisch hielten.
»Hat er eigentlich deine Handynummer?«
Sevim schüttelte den Kopf.
»Und meine wollte er auch nicht haben. Meine Schatulle sehe ich bestimmt nie wieder.«
Das war nicht das einzige Mal, dass sich Freya in Bernd täuschen sollte.
Vier Wochen hörten Freya und Sevim nichts von Bernd. Als die fünfte Woche dem Ende zuging, fing Suzette sie im Treppenhaus ab. Sie sollten morgen am frühen Vormittag in die Werkstatt kommen und ihre Fahrräder mitbringen.
Bernd hatte kein Telefon und kein Handy, weil ihm das zu unsicher war, und seiner Meinung nach heutzutage jeder abgehört wurde. Stattdessen benutzte er ein Netzwerk von Personen, denen er bedingungslos vertraute, um Nachrichten zu überbringen. Suzette war eine davon. Bernd hatte sie außerdem über Freya und Sevim ausgehorcht. Zögerlich hatte Suzette ihm das ein oder andere preisgegeben. Nicht so sehr, weil sie es gut fand zu tratschen, sondern vielmehr, weil sie wusste, wie misstrauisch Bernd war und sie nicht wollte, dass er sich die Informationen über ihre Nachbarinnen vielleicht anderweitig besorgte. Bernd schien auf jeden Fall zufrieden mit dem gewesen zu sein, was ihm Suzette zu berichten hatte.
»Früher Vormittag – wann soll das denn bitte sein?«, meinte Freya jetzt. »Erst lässt er einen fünf Wochen warten und dann kann er sich nicht mal auf eine Uhrzeit festlegen?« Sie war nicht gut auf Bernd zu sprechen.
Zehn Minuten nach zehn zierte sie sich dann auch, an der Werkstatttür zu klopfen, denn das Schild, das von innen an der Scheibe hing, sagte deutlich: GESCHLOSSEN.
Sevim klopfte mehrmals dezent, aber minutenlang rührte sich nichts. Sie wollten schon ins Café gegenüber gehen, als vorsichtig die Tür aufgezogen wurde.
»Wieso kommt ihr denn nicht rein? Es ist doch immer offen«, meinte Bernd noch im Nachthemd.
Freya wollte protestieren, aber Sevim schob schon ihr Rad hinein.
»Die könnt ihr gleich hier abstellen, aber schön leise, ich hab’ ein paar Leute da, die … na ja ihr wisst schon … hiervon nichts mitbekommen müssen.«
Tatsächlich war ein Schnarchen zu hören, aber Sevim konnte nicht ausmachen, woher es kam.
Bernd führte sie ins Hinterzimmer und sie wollten gerade, wie beim ersten Mal, auf dem speckigen Zweisitzer Platz nehmen, als Bernd am Regal mit den Fahrradlenkern zog und ein Durchgang sichtbar wurde.
Er winkte sie hinein. Freya musste sich leicht ducken, während es eine schmale Wendeltreppe ungefähr dreißig Stufen nach unten ging.
»Das ist mein Hinter-Hinterzimmer«, meinte Bernd ins Dunkel hinein.
»Das ist unheimlich«, flüsterte Freya Sevim zu. »Warum nimmt er uns mit hierher?«
»Willkommen im Allerheiligsten.« Bernd hatte das Licht angemacht. Von den Möbeln her sah es hier viel wohnlicher und ein bisschen sauberer aus als oben. Ein runder, mit grünem Filz bezogener Tisch beherrschte den Raum und in einer Ecke stand ein nicht völlig abgenutztes Ledersofa. Sogar eine Küchenzeile mit Kaffeeautomaten gab es.
»Ich brauch jetzt erst mal einen Kaffee. Wollt ihr auch einen? Ist Fair Trade.«
Bernd schöpfte Kaffeebohnen aus einem Umzugskarton und machte sich an der Maschine zu schaffen. Freya fiel das enorme Einmachgurkenglas auf, das danebenstand. Etwas darin bewegte sich. Waren das Käfer?
»Wenn ihr kurz mal die Augen zumachen würdet. Ist besser für euch.«
»Äh …« Das war eindeutig zu viel verlangt, fand Freya. Unruhig wand sie sich auf dem Sofa hin und her und blickte zur Wendeltreppe, die ins Licht und die Freiheit führte oder zumindest in einen Raum, in dem es Fenster gab. Was hatte sich Sevim nur dabei gedacht? Freya hatte bisher keinen Grund gehabt, an Sevims Menschenkenntnis zu zweifeln, aber jetzt musste sie sich fragen, ob sie diesem Bernd da nicht ein bisschen zu viel vertraute.
Sevim ergriff jetzt Freyas Hand und bedeutete ihr einfach mitzumachen. Freya achtete auf Schritte oder sonst irgendwelche Anzeichen, dass Bernd sie gleich in Stücke hacken würde oder etwas ähnlich Unangenehmes. Aber sie hörte nur, wie einer der Küchenschränke geöffnet und einige Sachen herausgenommen wurden und dann ein metallisches Klicken und das Öffnen einer schweren Tür. Hatte er darin vielleicht einen Tresor? Das fand Freya ziemlich spannend und sie überlegte, wo sie auch in ihrer Wohnung unauffällig einen Safe unterbringen konnte.
Währenddessen wurde der bisher vorherrschende Geruch, den Sevim noch von einer Weiterbildung zur Drogenprävention kannte, vom frischen Kaffee überdeckt. Sie hörten, wie erst die schwere Tür und dann die Schranktür wieder geschlossen wurden und Bernd etwas vor sie hinstellte.
Die beiden nahmen das als Zeichen, die Augen wieder aufzumachen. Ihr Blick fiel auf zwei Kaffeetassen und das schwarze Kistchen. Es war noch verschlossen, so wie sie es Bernd übergeben hatten.
»Das war mal eine Herausforderung, hab’ mir fast die Zähne daran ausgebissen«, meinte er und tätschelte den Deckel. »Ich hoffe, ich hab’ mir die Reihenfolge gemerkt …«
Er hielt die Schatulle an sein Ohr, kippte sie leicht nach links und es gelang ihm dadurch, den Boden zu verschieben, und zwar in die andere Richtung. Auf diese Weise war eine der Eckleisten nicht mehr zwischen Deckel und Boden eingeklemmt. Bernd schob sie nach unten und in einem Hohlraum wurde ein Schlüssel sichtbar. Er schob die Leiste und den Boden wieder in die Ausgangsposition und hielt triumphierend den Schlüssel in die Höhe.
Sevim klatschte begeistert.
Wieder hielt Bernd die Schatulle an sein Ohr und kippte sie leicht nach rechts. Nun konnte er den Deckel von sich wegschieben und die einzelnen Holzleisten, die die Front der Schatulle bildeten, hatten Bewegungsspielraum. Eine ließ sich gänzlich herausschieben und ein Schlüsselloch wurde sichtbar. Bernd schob den Deckel zurück in die Ausgangsposition und den Schlüssel ins Schloss. Mit einem leisen Knacken sprang schließlich der Deckel auf und Bernd platzierte die geöffnete Schatulle in der Mitte des Tisches.
Freya und Sevim waren aufgesprungen, um deren Inhalt in Augenschein zu nehmen. Zunächst sahen sie jedoch nur weißen Stoff und hier und da etwas zarte, aber vergilbte Spitze.
»Sieht so aus, als wäre etwas darin eingewickelt«, meinte Freya zu Bernd.
Dieser rieb sich die Hände und es schien ihn kaum auf dem Sofa zu halten. »Pack’ schon aus …«
Nachdem er den verborgenen Mechanismus zum ersten Mal bezwungen und das Kästchen einen Blick auf sein Inneres preisgegeben hatte, da juckte es ihn schon in den Fingern, sich alles genauer anzusehen. Für gewöhnlich hatte er auch keine Probleme damit, in den Sachen anderer Leute herumzuschnüffeln. Aber hier verhielt es sich anders. Das Kästchen sah alt aus. Nach Bernds Schätzung war es sicher Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte verschlossen gewesen.
Lange saß er vor der geöffneten Schatulle, brachte es aber einfach nicht über sich, ihren Inhalt als Erster zu lüften. Freya und Sevim sollten dabei sein, wenn er nach solch einer langen Zeit wieder zum Vorschein kam. Außerdem würde es mehr Eindruck machen, wenn er die Prozedur des Öffnens noch einmal vor ihren Augen vollzog. Also drückte er den Deckel wieder zu, verbarg den Schlüssel im Holz und beschloss, sich noch ein paar Tage zu gedulden.
Jetzt nahm Freya eines der Stoffpäckchen und wickelte es aus.
»Eine Muschel!? Hm.« Freya hielt sie gegen die Glühbirne, die nicht eben viel Helligkeit spendete. Die Muschel war schön und mutete exotisch an, aber warum machte sich jemand die Mühe, sie in ein Geheimkästchen zu packen?
Reihum packten sie ein Tüchlein nach dem anderen aus und bald lagen auf dem Tisch:
die Muschel
ein Kieselstein in der Form eines Herzens
ein Schweizer Taschenmesser
eine Walnuss
eine gepresste Blume
ein graublauer Stein
ein Schneckenhaus
eine Schnur mit Knoten darin
»Da ist noch ein Brief«, meinte Freya. Vorsichtig öffnete sie den Umschlag mit dem Taschenmesser aus der Schatulle, entfaltete den Briefbogen und las laut vor:
Mein Liebster,wenn ich mich in diesem letzten Brief an Dich sehr vage ausdrücke, dann geschieht dies aus Vorsicht und zu Deinem Besten. Ich kann niemandem in meiner Familie trauen und die Bediensteten, die mich über Jahrzehnte treu begleitet haben, werden immer weniger. Wenn Du diesen Brief nun in Deinen Händen hältst, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, wen ich mit der Ausführung meines letzten Wunsches betraue …
Freya hielt betroffen inne: »Oh …«
»Steht da vielleicht ein Datum?«, wollte Bernd wissen.
Freya schüttelte den Kopf.
»Lies doch erst mal weiter«, meinte Sevim sanft.
… Ich nehme unser Geheimnis mit ins Grab, auch wenn ich es die ganze Welt wissen lassen möchte. Du bist immer ein guter Mensch gewesen. Tapfer, von Grund auf anständig, so wie andere nur vorgeben es zu sein, und von ansteckender Begeisterung für Deine Profession. Jetzt wo ich zu alt bin und zu krank, um noch etwas zu ändern, macht es mich froh, dass Du all das mit mir geteilt hast, wenn auch nur für viel zu kurze Zeit. Zusammen mit diesem Brief findest Du die Überbleibsel unseres gemeinsamen Lebens. Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie viel mir deren Besitz bedeutet – mehr als alles andere. Nur Du wirst diese Dinge zu deuten wissen und Deine Schlüsse daraus ziehen.Man hat Dir Unrecht getan und Deine pragmatische Art und Dein Edelmut haben es mir verboten, es wieder geradezurücken. Aber alle, die die Wahrheit treffen könnte, sind jetzt tot. Ich habe Deine Briefe aufbewahrt, sie werden deine Ansprüche stützen. Sie befinden sich dort, wo es nur uns beide gab, in den wenigen Stunden, in denen uns dies vergönnt war.Mit meinem letzten Atemzug werde ich denken: Du warst mein größtes Glück.In Liebe
Statt eines Namens war da nur ein Symbol abgebildet, das der Muschel in dem Kistchen zu entsprechen schien.
»Wie schön«, flüsterte Bernd und wischte sich die Augen.
Gut, dass ich es nicht geschafft habe, die Schatulle selber aufzumachen, dachte Freya, dann wäre es mit der Stimmung auf meinem Geburtstag definitiv bergab gegangen.
»Aber wer hat das geschrieben? Und an wen ist der Brief gerichtet?«, fragte Sevim.
»Und was ist das für ein Unrecht?«, ergänzte Bernd. »Wir müssen herausfinden, was da passiert ist. Vielleicht kann man ja noch irgendwas machen …«
Bernd las den Brief noch einmal still, während Sevim den Inhalt der Schatulle eingehender betrachtete. Falls dieser aber einen Hinweis enthielt, dann konnte sie ihn nicht entschlüsseln. Als Nächstes nahm sie sich die Stoffquadrate vor, in die alles einzeln eingewickelt gewesen war. Sie sahen aus wie altmodische Taschentücher. Vielleicht besaß ja eines davon, wie hieß das gleich, ein Monogramm? Aber nichts da.
Mittlerweile hatte Bernd den Brief wieder in die Schatulle gelegt.