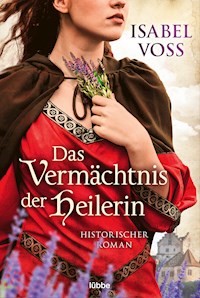
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein spannender Historischer Roman über mittelalterliche Medizin, ein geheimnisvolles Buch - und die rettende Kraft der Liebe
Mecklenburg, 1388. Eigentlich ist sie eine Grafentochter, privilegiert. Doch als ihr Vater stirbt, wird Emilia beschuldigt, eine Spionin zu sein, und muss fliehen. Dass der windige, aber kundige Wanderheiler Henricus sich ihrer annimmt, sie sogar in die Geheimnisse seines Könnens einweiht, ist ihre Rettung. Gemeinsam mit ihm reist Emilia von Mecklenburg nach Schweden - und wird erneut zur Gejagten. Denn es heißt, Henricus verfüge über ein Buch, das nicht nur ein Rezept zur Heilung aller Krankheiten enthält, sondern auch die Formel für die Herstellung von Gold ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumPERSONENVERZEICHNISPROLOGBurg Wasdow, MecklenburgBUCH IBurg Wasdow, MecklenburgBUCH IIRostock, MecklenburgBUCH IIIStockholm, SchwedenBUCH IVVätternsee, SüdschwedenBUCH VNahe Göteborg, SüdschwedenFAKTEN UND FIKTIONGLOSSARÜber dieses Buch
Als Grafentochter Emilia beschuldigt wird, eine Spionin zu sein, muss sie aus Mecklenburg fliehen. Der windige, aber kundige Wanderheiler Henricus rettet sie und bringt ihr all sein Können bei. An seiner Seite reist sie nach Schweden, wo sie ihre große Liebe findet. Doch dann verbreitet sich das Gerücht, Henricus besäße ein Buch, das nicht nur ein Rezept zur Heilung aller Krankheiten enthält, sondern auch die Formel für die Herstellung von Gold. Um ihren Liebsten und sich zu retten, muss Emilia all ihr Können und all ihren Mut aufbieten.
Über die Autorin
Isabel Voss interessiert sich für Rätsel der Geschichte, seit sie als Teenager Ein Tropfen Zeit von Daphne du Maurier las. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst als Journalistin und Übersetzerin, bevor sie ihren ersten Roman schrieb. Voss reist gern und fühlt sich überall in der Welt zuhause, deshalb sind auch ihre Bücher an mehr als einem Schauplatz angesiedelt.
ISABEL VOSS
HISTORISCHER ROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Heike Rosbach, Nürnberg
Titelmotive: © shutterstock.com: Groundback Atelier | FooTToo | Jurik Peter | ilolab | angelakatharina
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1019-0
luebbe.de
lesejury.de
PERSONENVERZEICHNIS
DIE WICHTIGSTEN HISTORISCHEN PERSONEN
Margrete I. von DänemarkKönigin von Schweden, Begründerin der Kalmarer Union, der Vereinigung der drei Nordreiche Schweden, Norwegen und DänemarkAlbrecht III., Herzog zu MecklenburgHerzog von Mecklenburg und König von Schweden bis 1389, größter Feind MargretesJohann IV., Herzog zu MecklenburgNeffe von Albrecht III. zu Mecklenburg, dessen Mitregent und StellvertreterJohann Stargard alias Johann II. zu MecklenburgCousin von Albrecht III., unterstützte diesen bei der Durchsetzung seiner Ansprüche auf den schwedischen Thron. Später möglicherweise einer der Anführer der VitalienbrüderHenrik ParowHauptmann und Heerführer in Margretes Heer, Oberbefehlshaber bei der Schlacht von FalköpingNils Svarte SkåningHauptmann und Heerführer in Margretes HeerErik Kettilsson PukeHauptmann und Heerführer in Margretes HeerBirger LotehusKanzler von Königin MargreteDIE WICHTIGSTEN FIKTIVEN PERSONEN
Emilia von HobeTochter des Grafen Burkhard von Hobe, wurde an Margretes Hof in Dänemark erzogenNikolaus von BrunnRitter in den Diensten Albrechts III. zu Mecklenburg, wurde auf der Burg von Burkhard von Hobe ausgebildetHenricus van der WeeWanderheilerVico von BrunnÄlterer Bruder von NikolausConstanze von GnoienHofdame an Margretes Hof und Freundin von EmiliaHarald HaraldsonHauptmann in den Diensten von Königin MargreteSergius von CrivitzEmilias VetterMarcellusHeruntergekommener Kapitän, der sich den Freibeutern anschließtTiberiusAbenteuerlustiger Tausendsassa: Arbiter, Wirt, Soldat, PiratPROLOG
MÄRZ 1373
Burg Wasdow, Mecklenburg
»Du kriegst mich nicht, du dummer Wicht!«
Noch bevor Emilia zu Ende gesprochen hatte, rannte sie los. Sie hatte einen winzigen Vorsprung, und den auch nur, wenn Nikolaus sich an die Vereinbarung hielt, erst bis zehn zu zählen, bevor er ihr hinterherlief. Außerdem konnte er wahnsinnig schnell bis zehn zählen. Emilia kam immer nur bis fünf, danach verhedderte sie sich, weil sie nicht mehr die Finger der linken Hand zu Hilfe nehmen konnte.
Emilia stürzte die Treppe hinauf ins obere Stockwerk, wo der große Saal und die Kemenaten lagen, hastete einen Korridor entlang, bog um die Ecke und kletterte die schmale Stiege im hinteren Teil der Burg wieder hinunter.
Neben der Tür zur Waffenkammer hing ein Wandteppich mit der Ahnentafel der Familie von Hobe, davor stand eine mächtige Eichentruhe, die so hoch war, dass sie Emilia bis zur Nasenspitze reichte. Atemlos zwängte sie sich dahinter und horchte. Ihr Herz schlug wild.
Im Korridor blieb alles still. Sie hatte Nikolaus abgehängt. Fürs Erste jedenfalls.
Trotzdem blieb Emilia in ihrem Versteck, sie hatte dieses Spiel oft genug gespielt, um zu wissen, dass sie verloren war, wenn er sie fand. Schließlich war Nikolaus schon neun Jahre alt und Knappe in den Diensten ihres Vaters. Und sie war noch nicht einmal vier.
Nikolaus war der Einzige auf Burg Wasdow, der sich hin und wieder dazu herabließ, mit Emilia zu spielen. Die anderen Knappen rümpften nur die Nase, wenn sie fragte, ob sie auch mal eins der Holzschwerter halten dürfe, mit denen sie für den Kampf übten.
Ihre Schwester Brunhild war noch ein sabberndes Kleinkind, Emilia konnte sich nicht vorstellen, dass Brunhild irgendwann einmal zu etwas zu gebrauchen sein würde. Im Augenblick taugte sie jedenfalls zu nichts, im Gegenteil, sie machte alles kaputt, was ihr in die Finger kam. Wenn die Zofe Emilia zeigte, wie man Gewänder für die Holzpuppen nähte, zerrte Brunhild an dem Stoff, bis er riss, oder stopfte sich die Knöpfe in den Mund und kaute darauf herum.
Nein, da spielte Emilia lieber mit Nikolaus, auch wenn er ihr in allem überlegen war und jedes Spiel gewann. Die Zofe hatte jüngst gemeint, Nikolaus gebe sich nur mit ihr ab, um sich bei ihrem Vater einzuschmeicheln. Er wolle Emilia heiraten, nur deshalb sei er nett zu ihr. Aber das war Unsinn. Und zwar nicht nur, weil es ihrem Vater ganz und gar nicht gefallen würde, wenn er erführe, dass der Junge mit Emilia herumtollte, statt seine Aufgaben zu erfüllen.
Nikolaus wäre kein geeigneter Gemahl für sie. Emilia war sich sicher, dass sie eines Tages einen mächtigen Fürsten heiraten würde. Das betonte ihr Vater nämlich jedes Mal, wenn sie keine Lust hatte, all die Dinge zu lernen, die man als Burgherrin können musste. Ein armer Burggraf – erst recht ein mittelloser Ritter ohne eigene Burg – käme für die Tochter des angesehenen Burkhard von Hobe nicht infrage. Nikolaus entstammte einer unbedeutenden Ritterfamilie, und er war noch nicht einmal der Erbe seines Familienbesitzes. Er hatte einen älteren Bruder, der eines Tages die Burg Weitin und die dazugehörigen Ländereien übernehmen würde.
Emilias Vater war zwar auch nur ein einfacher Burggraf, aber er war ein enger Freund von Fürst Albrecht. Er war schon mehrfach mit diesem in die Schlacht gezogen, speiste regelmäßig an dessen Tafel und ging am Hof in Schwerin ein und aus. Nein, Burkhard von Hobe würde seine Tochter niemals einem unbedeutenden zweiten Sohn zur Frau geben.
Emilia fuhr zusammen, als schwere Schritte auf der Stiege ertönten.
»Emilia, ich weiß, wo du steckst!«, rief eine vertraute Stimme.
Emilia steckte die Finger in den Mund und biss zu, um nicht zu schreien.
»Emilia! Ich komme!«
Sie biss noch fester zu, rechnete jeden Augenblick damit, dass er neben die Truhe sprang und sie an den Haaren herauszerrte. Wusste er wirklich, wo sie sich versteckt hatte? Oder war es ein Trick?
Die Schritte verstummten. Hatte Nikolaus den Treppenabsatz erreicht und war stehen geblieben? Oder schlich er sich lautlos über den nackten Steinboden an?
Vor Angst hielt Emilia die Luft an. Am liebsten wäre sie hinter der Truhe hervorgesprungen, nur um das Kribbeln in ihrem Bauch zu beenden.
Ganz dicht lief Nikolaus an ihr vorbei. Sie machte sich bereit, aber nichts geschah, die Schritte wurden leiser.
Da hielt sie es nicht mehr aus. Hastig krabbelte sie hinter der Truhe hervor und sah sich um. Im Gang war es dämmrig, nur eine einzige Fackel steckte neben der Tür zur Waffenkammer in einer Halterung an der Wand. Nikolaus stand nur wenige Schritte entfernt, er hatte ihr den Rücken zugewandt und horchte.
Jetzt drehte er sich langsam um.
Mist! Er hatte sie gehört.
Emilia griff nach dem Türknauf. Obwohl sie wusste, dass die Kammer immer abgeschlossen war, hoffte sie, die Tür möge aufgehen. Und – oh Wunder! Knarrend schwang sie auf.
»Hab ich dich!« Nikolaus sprang auf sie zu.
Kreischend stürzte Emilia in die Waffenkammer. Es war stockdunkel. Sie streckte die Hände aus, tastete sich blind vorwärts. Ihre Finger stießen gegen etwas Hartes.
Im gleichen Moment ertönte ein schrecklich lautes Poltern.
»Nein!«, rief Nikolaus hinter ihr.
Doch es war schon zu spät. Ein Schatten raste von oben auf sie zu, im gleichen Moment durchzuckte sie ein stechender Schmerz.
Sie schrie.
Nikolaus schrie.
Kurz darauf war die ganze Burg von Schreien erfüllt. Emilias Vater brüllte Befehle, die Zofe heulte und duckte sich unter den Beschimpfungen ihres Herrn, der Hofmeister schnauzte Nikolaus an.
Schließlich begutachtete ihr Vater Emilias Wunde. Eine Lanze war aus der Halterung gekippt und hatte Emilia an der Schulter verletzt. Die Wunde blutete heftig, Emilia glaubte, ein Feuer lodere unter ihrer Haut.
»Wir müssen den Medicus rufen«, sagte der Hofmeister.
»Unsinn«, widersprach der Vater. »Diese studierten Quacksalber verstehen nichts von solchen Verletzungen.« Er ließ den Waffenmeister rufen, einen alten Recken, mit dem er schon viele Male in den Kampf geritten war. Der ließ sich Nadel und Faden reichen und machte sich auf der Stelle ans Werk.
Emilia schrie und jammerte bei jedem Stich. Es fühlte sich an, als würde der Waffenmeister ihr den Rücken mit Pfeilen durchbohren.
In ihre Schreie mischten sich die Schmerzenslaute ihres Gefährten Nikolaus, den der Vater im Hof höchstselbst mit der Rute strafte.
Emilia hatte ihrem Vater unter Tränen versichert, dass sie ganz allein in die Waffenkammer gelaufen und Nikolaus ihr lediglich gefolgt sei, um sie zurück zur Zofe zu bringen. Würde Graf Burkhard je erfahren, was wirklich geschehen war, würde er Nikolaus mit Schimpf und Schande von der Burg jagen und dafür sorgen, dass kein Ritter in Mecklenburg, der etwas auf sich hielt, den Jungen unter seine Fittiche nahm. Nicht einmal der eigene Vater würde ihn zurücknehmen, denn es war allgemein bekannt, dass Graf Sewolt von Brunn ein unnachgiebiger Mann war.
Während der Schmerz allmählich abklang und einem unangenehmen Pochen Platz machte, stellte Emilia sich vor, wie ihre Schmerzensschreie sich auf dem Burghof mit denen von Nikolaus vereinten und wie sie gemeinsam über das Land wanderten bis an die Küste des großen Meeres und dort von den Felsen zurückgeworfen würden. Noch während sie darüber nachdachte, was aus den Schreien würde, wenn sie zu ihnen zurückkehrten, und sie sich fragte, ob sie es wohl spüren würde, wenn sie wieder in ihren Körper hineinsprängen, schlief sie vor Erschöpfung ein und träumte von kleinen roten Schmerzmännchen, die auf wilden Rössern über das Land galoppierten.
BUCH I
FÜNFZEHN JAHRE SPÄTER,OKTOBER 1388
Burg Wasdow, Mecklenburg
Emilia hatte sich Sonne und einen strahlend blauen Himmel für ihren großen Tag gewünscht, und am Morgen hatte tatsächlich goldenes Licht wie ein kostbarer Teppich über den Feldern gelegen und die Warbel verheißungsvoll schimmern lassen. Doch nun brauten sich dunkle Wolken am Horizont zusammen.
Vielleicht geduldete sich der Regen ja noch ein paar Stunden. Wenn die Trauungszeremonie vor der Kapelle im Burghof und der Gottesdienst beendet waren und alle Gäste sich für das Festmahl im großen Saal versammelt hatten, mochte der Himmel seine Schleusen öffnen.
Emilia betrachtete das Kleid, das auf ihrem Bett lag, dann die Kammer, in der man sie untergebracht hatte. Noch immer kam ihr auf der Burg ihrer Kindheit alles fremd vor. Zwölf Jahre hatte sie in der Fremde gelebt, wo sie an Margretes Hof in Dänemark erzogen worden war. Ein Friedenspfand war sie gewesen im Streit um den dänischen Thron, ebenso wie ihre Schwester und eine Reihe anderer Töchter mecklenburgischer Adliger, die als Zeichen des guten Willens zur Erziehung an den Hof der dänischen Regentin geschickt worden waren.
Margrete residierte nicht an einem festen Ort. Ständig reiste sie zwischen der Vordingburg, die auf einer der vielen Inseln ihres Reiches lag, der norwegischen Burg Bohus, dem schwedischen Handelsposten Lödöse und vielen weiteren Festungen hin und her. Nicht immer nahm die Regentin ihren ganzen Hofstaat mit, wenn sie reiste, vor allem nicht, wenn geheime Verhandlungen anstanden. Trotzdem war Emilia in den letzten Jahren viel in Margretes Reich herumgekommen, das Norwegen und Dänemark umfasste. Auch auf Schwedens Thron erhob Margrete Anspruch, und seit ihr Sohn, für den sie regierte, im vergangenen Sommer gestorben war, spitzte sich die Lage zu. Krieg lag in der Luft. Nicht der einzige Grund, weshalb Emilia nach Mecklenburg zurückgeholt worden war.
Ihr Vater lag siech, sein Geist hatte sich in den vergangenen Monaten mehr und mehr umwölkt, Burg Wasdow brauchte einen neuen Herrn. Und so hatte Herzog Albrecht beschlossen, Emilia mit ihrem Vetter Sergius zu verheiraten und ihm das Lehen anzuvertrauen.
Bei ihrer Anreise in der vergangenen Woche war Emilia Sergius zum ersten Mal begegnet. Er war ein schneidiger Mann mit einem blassen, schmalen Gesicht, das seine dunkelbraunen Augen deutlich hervortreten ließ. Ein wenig erinnerte er Emilia an Olaf, den Sohn Margretes. Emilia war ihm nur wenige Male begegnet, und seine fast überirdische Blässe hatte sie jedes Mal erschreckt. Er war von Kindesbeinen an kränklich gewesen, und die Leibärzte ließen ihn regelmäßig zur Ader, um sein Blut zu reinigen, eine Prozedur, die seine Haut noch bleicher hatte erscheinen lassen.
Glücklicherweise war Sergius dem verstorbenen Thronfolger nur äußerlich ähnlich, denn er strotzte vor Gesundheit. Gestern beim Turnier, das zur Zerstreuung der aus allen Teilen des Landes angereisten Hochzeitsgäste veranstaltet worden war, hatte er eine gute Figur abgegeben und sogar den Sieg davongetragen. Allerdings hegte Emilia den Verdacht, dass die anderen Ritter ein wenig nachgeholfen hatten, um dem Bräutigam die Ehre zu erweisen.
Emilia öffnete die Truhe, die am Fußende ihres Bettes stand. Auf ihrer Wäsche lag ein Buch. Es war kaum größer als ihre Handfläche und in feinstes Hirschleder gebunden. An Margretes Hof hatte sie nicht nur Nadelarbeit, lesen und schreiben, sondern auch die Kunst der Buchmalerei erlernt, und sie hatte sich als sehr begabt erwiesen. Als sie erfahren hatte, dass sie bald heiraten würde, hatte sie mit der Arbeit an diesem Buch begonnen. Es bestand aus nur wenigen Seiten, auf denen sie in ihrer schönsten Handschrift den Psalm 23 niedergeschrieben hatte, der mit den Worten »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen« begann.
Genau so sollte es sein zwischen Sergius und ihr. Bald würde er ihr Herr sein, und ihr würde es an nichts mangeln, und wenn die Zeiten auch schwer sein mochten, Sergius würde sie beschützen, und sie würde ihm ein treues Weib sein und ihm viele gesunde Kinder gebären.
Die Ränder neben dem Text hatte sie mit farbenfrohen Zeichnungen von Ranken, Blüten und Vögeln verziert. Das Buch würde ihr Geschenk an ihren Bräutigam sein.
Es klopfte, und die Zofe trat ein. Es war keine der adligen jungen Frauen, die mit ihr aus Dänemark angereist waren, sondern eine Grafentochter, die Sergius eigens für Emilia in seine Dienste genommen hatte.
»Es wird Zeit, Euch anzukleiden, Herrin«, sagte sie.
»Ja, sicherlich.« Emilia klappte die Truhe zu.
Jetzt, wo die Vermählung unmittelbar bevorstand, wurde sie ein wenig nervös. Wie gern hätte sie Brunhild an ihrer Seite gehabt! Sie hatte immer davon geträumt, dass ihre Schwester ihr eines Tages beim Anziehen des Brautkleides helfen würde. An Margretes Hof hatten sie wie Pech und Schwefel zusammengehalten, hatten sich blind aufeinander verlassen können. Sie hatten sogar eine Geheimsprache erdacht, mit der sie sich verständigen konnten, ohne dass jemand anderes wusste, wovon sie sprachen.
Emilia war sechs gewesen, ihre kleine Schwester sogar erst vier, als man sie von zu Hause fortbrachte. Brunhild hatte tagelang geweint, zumal sie die Mutter erst Wochen zuvor verloren hatten. Die Geheimsprache war aus einem Spiel entstanden, das Emilia mit Brunhild gespielt hatte, um sie abzulenken. Sie hatte den Dingen Fantasienamen gegeben und ihre kleine Schwester raten lassen, was sie meinte. Im Laufe der Jahre war ihre Sprache immer ausgefeilter geworden, und sie hatten ganze Gespräche führen können, ohne dass ein Fremder auch nur ein Wort davon verstand.
Doch dann hatte Brunhild Fieber bekommen und war innerhalb weniger Tage vom Herrn abberufen worden. Sie war nur zehn Jahre alt geworden.
Während die Zofe sie ankleidete und frisierte, wurde Emilia immer unruhiger. Hoffentlich machte sie bei der Zeremonie alles richtig! Hoffentlich stellte sie sich auf dem Brautlager nicht zu dumm an! Und hoffentlich war es nicht so ekelig, wie einige Hofdamen behaupteten! Aber diese Schnattergänse erzählten ja immer die unglaublichsten Geschichten. Sergius würde ihr alles zeigen, er war ein erfahrener Mann, der schon viel von der Welt gesehen hatte.
Endlich war die Zofe fertig. Emilia drehte sich im Kreis, das hellblaue Kleid flatterte, die Silberstickereien schimmerten im Licht, Emilias dunkelbraune Locken flogen um ihren Kopf. Zum letzten Mal durfte sie sie heute offen tragen, in Zukunft würde sie ihre Haare sittsam unter einer Haube verbergen, so wie es der Brauch verlangte. Jeder würde daran erkennen, dass sie verheiratet war.
»Wie sehe ich aus?«, fragte sie, ein wenig schwindelig vom Herumwirbeln.
»Wie die Braut eines Prinzen.« Die Zofe lächelte.
Im Hof hatten sich bereits die Gäste versammelt. Emilias Vater führte sie am Arm, um sie dem Bräutigam zu übergeben, auch wenn Emilia ihn dabei stützen musste und er ganz offenbar nicht begriff, was gerade geschah. Er schlurfte neben ihr her, ohne sie zu kennen, ohne sich zu erinnern, wer sie war. Es brach ihr beinahe das Herz. Burkhard von Hobe war immer ein stolzer, unbeugsamer Mann gewesen, der streng, aber gerecht über sein Lehen geherrscht hatte. Nun war er ein sabbernder Greis, der nicht einmal mehr seine eigene Familie erkannte.
Emilia schluckte die Tränen hinunter und richtete den Blick nach vorn, wo ihr Bräutigam neben dem Priester vor dem mit Blumengirlanden geschmückten Eingang der Burgkapelle stand und ihr entgegenlächelte. An seinem Lächeln hielt sie sich fest, während sie durch das Spalier der jubelnden Hochzeitsgäste schritt.
Als sie neben Sergius trat, ergriff ein Diener den Arm ihres Vaters und führte ihn zur Seite. Emilia sah ihm nach, doch er hielt den Blick gesenkt, murmelte Worte vor sich hin, die er vermutlich nicht einmal selbst verstand.
Rasch wandte Emilia sich ab und sah den Priester an, der den Mund öffnete, jedoch sofort wieder zuklappte, als unter lautem Geschrei ein Reiter auf den Burghof preschte.
»Aufhören! Sofort aufhören!«, brüllte er und glitt aus dem Sattel.
»Was in aller Welt …«, murmelte Sergius und fuhr herum.
Schwer atmend bahnte sich der Reiter einen Weg durch die erstaunte Menge.
»Was fällt Euch ein, hier unangekündigt einzudringen?«, herrschte Sergius ihn an und trat ihm einige Schritte entgegen. »Wo sind die Wachen? Warum ist das Tor nicht verschlossen?«
»Beschuldigt nicht Eure Wachleute, Sergius von Crivitz, sie waren nicht nachlässig. Ich bin mit den Spielleuten eingelassen worden, die eben eingetroffen sind.«
Sergius kniff die Augen zusammen. »Was wollt Ihr?«
»Ich komme mit dringenden Nachrichten. Sie dulden keinen Aufschub.«
»So dringend, dass ich nicht einmal meine Braut zum Weib nehmen kann, bevor Ihr mich unterrichtet?«
»Ich fürchte ja, Herr.« Der Fremde verneigte sich. »Mehr noch, es wäre nicht klug, die Vermählung zu vollziehen, bevor Ihr mich angehört habt.«
Sergius warf Emilia einen Blick zu. Argwohn lag auf seinem Gesicht.
Emilia fühlte sich mit einem Mal unbehaglich. Wollte der Fremde etwa ein Ehehindernis vorbringen? Aber es gab keins! Sie hatte sich nichts zuschulden kommen lassen, sich allzeit anständig und keusch verhalten, wie es sich für eine Hofdame gebührte.
Nein, es musste etwas anderes sein. Es musste mit Albrecht und Margrete zu tun haben. Vielleicht war der Krieg bereits ausgebrochen, vielleicht wurde ihr Bräutigam von seinem Herzog gebraucht.
Das Stimmengewirr unter den Gästen war mehr und mehr angeschwollen. Alle redeten durcheinander, viele musterten voller Misstrauen abwechselnd Emilia und den Boten.
Sergius hob die Hände. »Verehrte Gäste. Bitte verzeiht die Verzögerung. Sicherlich können wir gleich fortfahren. Habt einen kurzen Augenblick Geduld. Meine Diener werden Euch die Wartezeit mit Leckereien versüßen.«
Er klatschte in die Hände. Sofort sprangen Mägde herbei, die Krüge mit Wein sowie Tabletts mit Gebäck und Pasteten herumtrugen. Die Gäste stürzten sich auf die angebotenen Speisen. Auch der Priester langte mit großem Appetit zu.
Niemand dachte daran, der Braut etwas anzubieten. Fröstelnd stand Emilia abseits der anderen und sah Sergius und dem Boten hinterher, wie sie im Palas verschwanden. Als die beiden nicht mehr zu sehen waren, wanderte Emilias Blick nach oben. Die dunklen Wolken, die vorhin noch fern am Horizont gestanden hatten, hingen nun tief über Wasdow. Ein scharfer Wind war aufgekommen.
Plötzlich war Emilia sicher, dass es heute keine Hochzeit geben würde. Etwas Düsteres braute sich über ihr zusammen, und es war mehr als ein Herbstgewitter.
Eines musste Nikolaus von Brunn seinem Gegner lassen: Madruzzo ritt wie der Teufel. Was für ein Heißsporn! Ohne auf Verstärkung zu warten, hatte Madruzzo die Verfolgung aufgenommen. Wahrscheinlich wollte der junge Recke seine Scharte auswetzen. In der Bernsteinschänke am Rostocker Hafen, wo die Koggen lagen, hatte Nikolaus dem Italiener zuvor ein Pergament aus der Ledertasche gestohlen, während dieser mit einer Magd geschäkert hatte. Immerhin war er so geistesgegenwärtig gewesen, dass er Nikolaus auf dem Fuß gefolgt war.
Vorerst hatte Nikolaus ihn in den engen Gassen, die er in- und auswendig kannte, abgehängt, aber es gab nur einen Weg nach Süden aus der Stadt hinaus: das Kuhtor. Das Steintor war geschlossen, und an den anderen Toren bildeten sich lange Schlangen, da die Wachen angehalten waren, jeden gründlich zu kontrollieren. Allerlei Gesindel war unterwegs, Räuber, Diebe und vor allem Spione der Dänen.
Gott sei Dank waren die Wachen am Kuhtor, die gerade mit der Abfertigung eines Handelszuges beschäftigt waren, seit seiner Ankunft nicht ausgewechselt worden. Nikolaus hatte mit ihnen einen Plausch gehalten, als er in die Stadt gekommen war, und ihnen einen kräftigen Schluck aus seinem Weinschlauch gegönnt. Als er im zügigen Trab auf sie zukam, hielten sie einen Wagen auf und winkten ihn durch.
In der letzten Zeit waren die Hansestädte an der Ostsee nervös. Man munkelte, Albrecht III. von Mecklenburg würde bald zum Krieg gegen Margrete von Dänemark rüsten, die ihm den schwedischen Thron streitig machte. Nikolaus wusste, dass das keine Gerüchte waren. Albrecht hatte ihn in seine Pläne eingeweiht.
Und Nikolaus hatte es geschafft, einen besonders heiklen Auftrag von seinem Herrn zu erhalten: Er sollte den Codex der Macht suchen, ein Buch, das den kommenden Krieg entscheiden konnte, weil darin, so hieß es, die Formel zur Herstellung von Gold niedergeschrieben war.
Nikolaus scherte sich nicht um Gold und andere Reichtümer, er suchte das Buch aus einem ganz anderen Grund. Doch das hatte er dem Herzog nicht auf die Nase gebunden.
Dafür hatte er schnell gemerkt, dass nicht nur er, sondern eine ganze Reihe Leute hinter dem Buch her waren. Kein Wunder, das Rezept zur Herstellung von Gold würde seinen Besitzer unermesslich reich und mächtig machen.
Wie die meisten anderen hatte Nikolaus keine Ahnung, wie das Buch aussah. Er wusste nur, was darin stehen musste. Nicht nur die Formel für Gold nämlich, sondern auch medizinische Rezepturen, vor allem eine für ein Heilmittel gegen den Schwarzen Tod. Nikolaus würde nicht ruhen, bis er den Codex gefunden hatte, denn er hatte es Eva geschworen.
Das war ihr Vermächtnis, ihr letzter Wunsch gewesen: »Finde das Heilmittel! Erlöse die Menschen von der Geißel dieser Krankheit, damit niemand mehr unter solch schrecklichen Qualen zugrunde gehen muss, wie ich sie erleide.«
Nikolaus löste eine Hand vom Zügel, wischte sich eine Träne aus dem Gesicht und legte die Hand auf sein Herz, wo er in einem Lederbeutel die Haarsträhne verwahrte, die Eva ihm nach der Hochzeitsnacht geschenkt hatte.
Der Schwarze Tod war vor drei Jahren in einigen Städten an der Ostsee kurz aufgeflackert und rasch wieder erloschen. Seit der großen Seuche vor mehr als zwei Jahrzehnten geschah das immer wieder, und jedes Mal verbreitete sich die Angst vor dem massenhaften Sterben schneller als die Krankheit selbst.
Nikolaus und die meisten anderen waren verschont geblieben. Doch wer sich angesteckt hatte, war verloren gewesen, die Krankheit tötete ausnahmslos jeden, den sie befallen hatte. Er hatte zusehen müssen, wie Eva unter unsäglichen Schmerzen dahinschied. Danach war er wochenlang rastlos von einer Schänke zur anderen gewankt, immer auf der Suche nach dem nächsten Becher Wein. Irgendwann war er aus dem Nebel der Verzweiflung aufgewacht und hatte beschlossen, sein Gelübde zu erfüllen.
Anfangs hatte er es für unmöglich gehalten, dass es ein Heilmittel gegen den Schwarzen Tod geben könnte. Er hatte Heiler aus aller Herren Länder befragt, jeder hatte abgewinkt. Sein Beichtvater hatte ihn zurechtgewiesen, es sei gotteslästerlich, etwas heilen zu wollen, das der Herr als Strafe über die Menschen gebracht habe, und er solle sich überlegen, ob Eva nicht eine Ketzerin gewesen sei. Verzweifelt war Nikolaus aus der Kirche gestürzt. Niemand konnte ihm helfen.
Doch dann hatte er von dem Codex der Macht gehört.
Nach und nach hatte er die Geschichte des magischen Buches ergründet. Angeblich handelte es sich um die Abschrift eines alten Manuskripts aus dem Morgenland, die vor vielen Jahren von Mönchen in einem italienischen Kloster angefertigt worden war. Von dem Kloster war sie in den Besitz der Adelsfamilie de Luca aus Lasino in Norditalien gekommen, die das Geheimnis über viele Generationen hinweg hütete. Vor einigen Jahren sollte das Buch dann von Mitgliedern der Familie de Luca nach Norden gebracht worden sein, weil der Deutsche Orden es kaufen wollte. Dort war es jedoch nicht angekommen. Verschiedene Leute wollten es seither an etlichen Orten in Mecklenburg und Pommern gesehen haben.
Mehr als zwei Jahre war Nikolaus jeder Spur gefolgt. Ohne Ergebnis. Madruzzos Pergament, das Nikolaus in seiner Satteltasche verwahrte, konnte endlich das Blatt wenden. Wenn nötig, würde er es mit seinem Leben verteidigen. Doch so weit war es noch lange nicht.
Nikolaus preschte über die Landstraße nach Süden. Immer wieder warf er einen Blick über die Schulter, Madruzzo war noch nicht in Sicht. Vielleicht war Nikolaus seinem Verfolger ja entwischt. Oder Madruzzo hatte sich besonnen und organisierte bereits Verstärkung. Als Nikolaus etwa vier Bogenschüsse vom Kuhtor entfernt war, hörte er Gebrüll. Er wandte sich um. Madruzzo. Der Mann hatte eine Stimme so laut wie ein Bär.
Mit einem Tritt in die Seite brachte Nikolaus sein Pferd in gestreckten Galopp. Es preschte los, aber nicht schnell genug. So bald wie möglich würde Nikolaus die Straße verlassen müssen, denn Madruzzos Araberhengst war seinem Wallach haushoch überlegen. Wie kam der Bursche bloß an dieses edle Tier? Er musste einen reichen Auftraggeber haben. Araberhengste kosteten ein Vermögen, doppelt so viel wie ein gutes Schlachtross, für das man etwa zehnmal so viel bezahlen musste wie für Nikolaus’ Wallach.
Nikolaus hoffte inständig, dass es nicht der Papst war, der Madruzzo entsandt hatte. Denn das würde bedeuten, dass man alles, was man Madruzzo entwendete, zugleich dem Papst stahl. Herzog Albrecht würde Nikolaus in diesem Fall nicht helfen, falls er gefasst würde. Denn der Papst würde den Herzog auf der Stelle exkommunizieren, wenn er erführe, dass dieser Nikolaus beauftragt hatte, sich an seinem Eigentum zu vergreifen.
Egal, wer der Auftraggeber war, erst einmal musste Nikolaus seinem Verfolger entkommen, um sich in Ruhe über den Inhalt des Pergaments in Kenntnis setzen zu können. Nikolaus hatte bislang nur einen kurzen Blick darauf werfen können. Er wusste, dass es sich um den Grundriss eines Gebäudes handelte, und er hoffte, dass darauf das Versteck des Buches verzeichnet war.
Endlich kam Wald in Sicht. Nikolaus blickte über die Schulter. Madruzzo hatte bereits aufgeholt. Vielleicht fünfhundert Fuß trennte sie noch. Auf der Straße würde Nikolaus Madruzzo nicht entkommen. Sein Pferd hatte schon Schaum an den Flanken und vor dem Maul, während Madruzzos Hengst sich anscheinend gerade erst warmgelaufen hatte. Nikolaus musste versuchen, im Unterholz zu verschwinden.
Sobald er den Waldsaum erreichte, parierte er durch und lenkte den Wallach ins Dickicht. Hier nützte Madruzzo die Geschwindigkeit seines Hengstes nicht, hier war der kräftige Körperbau von Nikolaus’ Pferd von Vorteil. Er trieb es voran, hob eine Hand vor das Gesicht, um es vor Ästen und Zweigen zu schützen. Nach wenigen Minuten erreichte er eine lang gezogene Lichtung. Nikolaus gab dem Wallach die Sporen, er sprang los, doch im gleichen Moment knickte er mit einem Bein ein und stürzte. Geistesgegenwärtig rollte Nikolaus sich zur Seite, bevor der schwere Körper auf ihm landete. Rasch begutachtete er den Schaden. Der Wallach war in ein Loch getreten und hatte sich das Bein gebrochen. Sein Todesurteil.
Nikolaus beugte sich hinunter, strich ihm über den Kopf, sagte: »Verzeih mir, mein Guter.« Er nahm sein Messer und schlitzte dem Pferd die Kehle auf.
Ein Schauder überlief das Tier, dann sackte es tot in sich zusammen.
Nikolaus richtete sich auf und zog sein Schwert.
Im selben Moment erschien Madruzzo auf der Lichtung, zögerte nicht und griff an, gab dem Hengst die Sporen, das Schwert wild über dem Kopf schwingend.
Nikolaus hatte nicht viel Zeit, um zu überlegen. Dass Madruzzo ihn gestellt hatte, war zwar unangenehm, hatte aber auch einen Vorteil: Es bot ihm die Gelegenheit, an ein neues Pferd zu kommen, jetzt, wo sein eigenes tot war. Er musste Madruzzo besiegen, ohne das Tier zu verletzen.
Schon galoppierte Madruzzo heran. Nikolaus hielt sein Schwert hoch über den Kopf erhoben. Schwang er es zu früh, war er tot. Schwang er es zu spät, ebenfalls.
Madruzzo holte zum Hieb aus.
Nikolaus sah, dass sein Gegner noch unerfahren war, drehte sich halb um seine Achse und ließ seine Klinge auf Madruzzos krachen. Jetzt kam es darauf an, wer mehr Kraft in den Armen hatte.
Madruzzos Schwert flog in hohem Bogen davon. Diese Frage war geklärt. Aber der Aufprall war Nikolaus durch den ganzen Körper gegangen wie der Schlag eines Schmiedehammers. Er musste sich einen Moment sammeln. Die Zeit nutzte Madruzzo, um vom Pferd zu springen und sein Schwert wieder aufzunehmen.
Nikolaus drang sofort auf ihn ein. Madruzzo war ein guter Reiter, aber im Schwertkampf musste er noch einiges lernen. Nikolaus trieb ihn mit wuchtigen Schlägen immer weiter an den Rand der Lichtung. Schließlich stand Madruzzo mit dem Rücken zu einem Baum. Mit einer letzten Finte schlug Nikolaus ihm das Schwert aus der Hand und setzte ihm die Spitze seiner Klinge an die Kehle.
Madruzzo erstarrte.
Nikolaus schöpfte Atem. Es war nicht mehr als eine Übungseinheit gewesen, aber dennoch war es um Leben und Tod gegangen. Er hatte all seine Kraft und Konzentration einsetzen müssen, um Madruzzo zu besiegen, ohne ihn oder das Pferd zu töten. Denn er brauchte beide lebend. Vorerst. Wenn sich der Bursche schon nicht abschütteln ließ, sollte er ihm wenigstens mit Informationen nützlich sein.
»Am Schwert müsst Ihr noch einiges lernen, werter Signor Madruzzo. Aber reiten könnt Ihr wahrhaft ausgezeichnet. Ich bezeichne mich bei aller Bescheidenheit als guten Reiter. Doch selbst wenn ich ein Pferd hätte, das so schnell ist wie das Eure, wärt Ihr mir überlegen. Respekt.«
»Spart Euch Eure Schmeichelei und tötet mich schnell.« Madruzzos Miene war versteinert, er trug den Trotz eines Grünschnabels zur Schau.
»Bevor ich das tue, bitte ich Euch, mir zu verraten, was das Pergament beinhaltet, das ich mir von Euch ausgeborgt habe. Wegen unserer kleinen Hatz hatte ich leider noch keine Zeit, es mir genauer anzusehen. Ach ja, und Euren Auftraggeber möchte ich ebenfalls wissen.«
»Fahrt zur Hölle, von Brunn, und mit Euch Eure ganze Brut. Der Doge wird Euch vernichten.«
Nikolaus seufzte. Madruzzo war wirklich ein Anfänger. Der Doge also. Venedig. Warum schickte einer der mächtigsten Männer Europas einen Jüngling auf die Suche nach einem solchen Buch? Vielleicht war es gar nicht so bedeutend? Vielleicht war es nur eine Legende?
Mit einer Bewegung, der Madruzzo nicht folgen konnte, schlitzte Nikolaus seinem Widersacher das Wams auf, vom Saum bis zum Hals. »Ihr glaubt nicht, dass ich es ernst meine? Euch einen schnellen Tod zu gewähren wäre die reinste Verschwendung. Wisst Ihr, wie lange es dauert, bis Euch der Herr erlöst, wenn ich Euch den Bauch öffne? Wenn ich es besonders geschickt anstelle, zwei Tage mindestens. Aber vorher würde ich Euch von dem nutzlosen Fleischbrocken zwischen euren Beinen trennen. Ach ja, und wenn Ihr dann elendiglich krepiert seid, werde ich Euch den Kopf abschlagen. Damit ist Euch der Zugang zum Paradies verwehrt.«
Madruzzo wurde bleich. »Das würdet Ihr nicht tun! Das ist –«
Nikolaus verpasste Madruzzo einen kleinen Schnitt oberhalb des Nabels. Madruzzo zuckte zusammen, aber er schrie nicht. Ein wirklich tapferer Mann. Dumm, aber furchtlos. Und damit überaus nützlich. Wie schade, dass er auf der falschen Seite stand.
»Falls das nicht reicht, Euch meine Ernsthaftigkeit zu demonstrieren, kann ich gern bei weniger wichtigen Teilen Eures Körpers weitermachen. Wie wäre es mit dem rechten Ohr?« Nikolaus wartete nicht auf eine Antwort. Er holte mit der Klinge aus.
»Nein!«, schrie Madruzzo entsetzt.
»Was heißt ›Nein‹?«
Madruzzo schwitzte, schluckte, er war bereit.
»Es ist der geheime Plan der Katakomben der Nikolaikirche in Rostock. Was Ihr sucht, befindet sich zwischen den Knochen der Toten. Wo genau, weiß ich nicht.« Madruzzo ließ den Kopf hängen. Gerade war er zum Verräter geworden. Erfuhr der Doge davon, würde Madruzzo als Fischfutter im Canal Grande landen. Falls er es zurück nach Venedig schaffte.
»Grämt Euch nicht, Signor Madruzzo. Ich habe noch niemanden gesehen, der der Folter widerstanden hätte. Und ich werde Euch nicht töten.«
Madruzzo schwieg. In seinen Augen glomm Rachsucht. Er machte Nikolaus für sein Versagen verantwortlich und er würde es ihm vermutlich heimzahlen, sobald sich die Gelegenheit bot. Es war ein Fehler, Madruzzo zu verschonen. Aber Nikolaus tötete keinen Unbewaffneten. Zudem verlieh es der Hatz einen zusätzlichen Reiz zu wissen, dass einem der Verfolger im Nacken saß.
Zu leicht würde Nikolaus es Madruzzo allerdings nicht machen. Er würde ihn an einen Baum binden; Madruzzo würde Stunden brauchen, um sich zu befreien. Bis auf sein Geld würde Nikolaus ihm alles nehmen: Pferd, Schwert und Verpflegung. Bis Madruzzo ihn verfolgen konnte, wäre Nikolaus längst mit seiner Trophäe in Schwerin, hinter den sicheren Mauern der uneinnehmbaren Burg seines Herrn Albrecht.
Madruzzo ließ die Fesselung ohne Gegenwehr über sich ergehen. Er hatte begriffen, dass Nikolaus ihm ein Schlupfloch gelassen hatte und er es nur nutzen konnte, wenn er sich nicht mit ihm anlegte.
Nikolaus schwang sich in den schmalen Sattel, der auf dem Rücken des Hengstes festgezurrt war. Er hatte einige Mühe, das feurige Tier unter seine Kontrolle zu bringen, aber da er sich mit Pferden auskannte, dauerte es nicht lange, bis der Araber ihn als Herrn anerkannte und ohne Gegenwehr parierte.
»Nun, Signor Madruzzo, muss ich mich verabschieden. Es hat mich gefreut, Eure Bekanntschaft zu machen. Ich wünsche Euch alles Gute und hoffe, dass wir uns nie wiedersehen.«
Henricus van der Wee band den Esel an einen Baum und vergewisserte sich, dass die Plane des Wagens gut verschlossen war, bevor er sich den Menschen näherte, die sich vor dem Tor des Gutshofs versammelt hatten. Fahrende Händler, die auf Geschäfte hofften, Knechte, Mägde und Handwerker, die nach mehr oder weniger dringend benötigten Waren Ausschau hielten oder sich einfach über die Abwechslung freuten. Es wurden Stoffe, Zwirn und Knöpfe feilgeboten, die von den jungen Frauen des Guts kritisch beäugt wurden, zudem Seifen, Bürsten, billige Talglichter, teure Kerzen aus Bienenwachs, medizinische Tränke und verschiedene Wundermittel, inklusive kleiner Fläschchen mit dem Pulver gemahlener Gebeine von Heiligen sowie duftende Gewürze und allerlei farbenfroher Tand aus dem Orient.
Henricus trat zu den zwei Männern, die Heilmittel verkauften, und räusperte sich. »Ich habe gehört, der Herr des Hauses liegt schwer krank darnieder«, sagte er möglichst beiläufig.
Die Männer drehten sich zu ihm um. Der eine war alt, älter als Henricus selbst, der bereits fast sechzig Lenze zählte, aber deutlich dürrer und gebrechlicher. Er trug ein Tablett vor dem Bauch, auf dem Tiegel mit widerlich stinkenden Pasten standen, die er als Wunderrezeptur aus dem Reich der Mongolen anpries. Das Zeug hatte er in der heimischen Küche selbst zusammengebraut, darauf hätte Henricus geschworen. So wie viele fahrende Medizinhändler, die mit der Angst der Menschen vor Krankheit und Tod ihren Lebensunterhalt verdienten.
Der andere Mann war jünger und kräftiger gebaut und hatte die geübten Hände eines tüchtigen Chirurgicus, der schon so manchen Knochen eingerenkt und so manches Körperglied amputiert hatte.
»Wer will das wissen?«, fragte der Chirurgicus.
»Ein Medicus, der weit gereist ist, um seine Heilkünste zu verfeinern.«
Der Chirurgicus lachte. »Ihr könnt gern Euer Glück versuchen, wenn Ihr tollkühn genug seid. Dem Letzten, der an ihm herumgepfuscht hat, hat der feine Herr die Hand abhacken lassen.«
Henricus verzog das Gesicht. »Woran leidet er denn?«
»Fieber schüttelt ihn, seit er sich beim Holzspalten mit der Axt ins Bein fuhr. Es heißt, der Unterschenkel sei geschwollen und inzwischen so dick wie ein Baumstamm.« Der Chirurgicus spuckte auf den Boden. »Da hilft nur die Säge, aber ich rühr den Kerl nicht an. Ohne meine Hände kann ich mich gleich aufhängen.«
Henricus strich sich über den Bart und warf einen Blick durch das geöffnete Hoftor, dann zu seinem Karren. Er brauchte dringend Geld. Aber er hatte keine Lust, die rechte Hand zu verlieren. Andererseits hatte er schon weitaus gefährlichere Situationen überstanden. Auch solche, in denen er lieber gestorben wäre. Ein gotteslästerlicher Gedanke, aber leider nur zu wahr. Er schob den Gedanken weg, er wollte nicht an den Fluch denken, der ihn dazu verdammte zu leben, während andere grauenvoll gestorben waren.
Nachdenklich schlenderte er zu seinem Wagen zurück. Er musste es geschickt anstellen und danach rechtzeitig über alle Berge sein. Nur zur Sicherheit. Entschlossen packte er den Esel am Zaumzeug und führte ihn durch das Tor.
Ein Knecht trat ihm entgegen. »Wohin des Weges, Alter?«
»Ich bringe Heilung für Euren Herrn.«
Der Knecht musterte ihn argwöhnisch. »Ach ja? Und wer seid Ihr?«
»Henricus van der Wee, Heilkundiger und Weissager, der bis in den fernen Orient gereist ist, um die Kunst der Medizin zu studieren.« Das war glatt gelogen, Henricus war nie weiter südlich als in Bremen gewesen. Und dennoch enthielt das Gesagte einen wahren Kern.
»Wartet hier«, wies der Knecht ihn an. Im Laufschritt verschwand er im Gutshaus.
Noch bevor Henricus es sich anders überlegen konnte, kehrte der Knecht zurück. »Folgt mir. Den Karren lasst stehen.« Er winkte einem Burschen, der Henricus den Zügel abnahm.
Henricus fischte seine Tasche unter der Plane hervor, sandte ein stummes Stoßgebet zum Himmel und folgte dem Knecht unter den neugierigen Blicken des Gesindes ins Wohnhaus.
Emilia fühlte sich wie eine Verbrecherin, als sie von den zwei Wachmännern in die Burg eskortiert wurde. Die Bewaffneten handelten auf Sergius’ Befehl, der mit finsterer Miene auf der Treppe zum Palas stand und auf sie wartete.
Die Hochzeitsgäste waren verstummt, alle beobachteten sie. Manche warfen ihr mitfühlende Blicke zu, doch die meisten betrachteten sie mit einer Mischung aus Häme und Sensationslust. Kein einziges bekanntes Gesicht machte sie in der Menge aus. Die meisten Anwesenden waren ihr ohnehin fremd. Außer ein paar alten Mägden und Knechten gab es niemanden auf Burg Wasdow, der sie noch aus Kindertagen kannte. Lediglich die Hofdamen, die sie aus Dänemark herbegleitet hatten, waren ihr vertraut, doch sie konnte keine von ihnen unter den Hochzeitsgästen entdecken.
»Folgt mir!«, befahl Sergius, kaum dass sie vor ihm stand.
»Aber was –?«
»Tut einfach, was ich sage.« Seine Stimme klang hart und streng.
Benommen taumelte sie hinter ihrem Bräutigam her die Treppe hinauf. So lange hatte sie auf diesen Tag gewartet, so aufgeregt war sie gewesen, so bang vor dem, was sie erwartete; doch bei allem, was sie sich ausgemalt hatte, war sie nie auf den Gedanken gekommen, dass bereits vor der Vermählung etwas schiefgehen könnte.
Vor ihrer Kemenate blieb Sergius stehen. Eine Wache stand gegenüber der Tür, der Fremde daneben. »Ist das die Kammer, in der Ihr seit Eurer Ankunft genächtigt habt?«
»Ja.« Emilia brachte kaum mehr als ein Flüstern hervor. Sie versuchte, sich zu erinnern, ob es irgendetwas in der Kammer gab, das den Ärger ihres Vetters erklären könnte, aber ihre Gedanken stoben wie Pfeile auf einem Schlachtfeld in verschiedene Richtungen davon, ohne dass sie einen davon festhalten konnte.
Sergius stieß die Tür auf. »Geht vor!«
Sie trat in die Kammer. Alles sah so aus, wie sie es nach dem Ankleiden zurückgelassen hatte. Der Kamm und das Gewand, das sie am Morgen getragen hatte, lagen auf dem Bett. Die Zofe hatte beides noch nicht fortgeräumt, vermutlich, weil sie bei der Hochzeitsfeier nichts verpassen wollte.
Sergius drehte sich zu ihr um. »Dieser Mann …« Er deutete auf den Fremden, der ihnen in den Raum gefolgt war. »… behauptet, dass Emilia von Hobe vor Jahren am dänischen Hof verstorben ist.«
Emilia fasste sich an die Brust. »Das ist nicht wahr.«
»Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie sie zu Grabe getragen wurde.« Sergius nickte dem Mann zu. »Ist es nicht so?«
»In der Tat, Herr.«
»Ihr müsst Euch täuschen! Ich bin Emilia von Hobe. Meine Schwester ist gestorben, Brunhild von Hobe. Ihr müsst zugegen gewesen sein, als sie beerdigt wurde.«
»Ich irre mich keineswegs. Mir ist bekannt, dass beide Schwestern verstarben.« Der Fremde sprach mit leicht näselnder Stimme und einem fremd klingenden Akzent.
»Aber wenn es so wäre, hätte man dann nicht meinen Vater unterrichtet? Er müsste doch …« Emilia brach ab. Selbst wenn Burkhard von Hobe vor Jahren einen Brief bekommen hätte, der ihn über den Tod seiner Tochter in Kenntnis setzte, würde er sich heute nicht mehr erinnern. Er schien ja nicht einmal mehr zu wissen, dass er eine Tochter hatte.
»Ihr seid eine dänische Spionin!« Der Fremde sah sie finster an.
»Nein!«, rief Emilia empört. »Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung. Habt Ihr Beweise dafür?«
Sergius trat vor und klappte den Deckel der Truhe auf. Er fischte das Büchlein heraus. Sein Hochzeitsgeschenk. »Und was ist das hier?«
Emilia öffnete den Mund, doch Sergius schnitt ihr mit einer Handbewegung das Wort ab.
Er hielt ihr das Büchlein entgegen wie eine Waffe. »Das ist der Code, mit dem Ihr Eure Nachrichten an diese dänische Möchtegernkönigin verschlüsseln solltet. Eine Schande seid Ihr, eine Verräterin!«
Emilia schluckte. Wie so viele Männer seines Standes konnte Sergius nicht lesen. »Nein, Vetter, Ihr täuscht Euch! Zeigt das Buch dem Priester, er wird bestätigen, dass nichts als ein Psalm darin steht.«
»Ach ja?« Für einen Augenblick wirkte Sergius verunsichert. Doch er hatte sich schnell wieder im Griff. »Wache!«
Der Wachmann, der vor der Tür gewartet hatte, trat ein.
Emilia wich angstvoll zurück.
Sergius deutete auf das Bett. »Holt sie heraus!«
Der Wachmann bückte sich und zog etwas unter dem Bett hervor. Als er zur Seite trat, erkannte Emilia, dass es ein Käfig war, in dem zwei Tauben saßen.
Sergius verschränkte die Arme. »Und was wolltet Ihr mit denen? Soll ich die auch dem Priester zeigen?«
Emilias Knie wurden weich. Brieftauben! Sie hatte keine Ahnung, wie die Tiere unter ihr Bett gekommen waren, und sie war sicher, dass sie sich am Morgen noch nicht dort befunden hatten. Aber das spielte keine Rolle. Sie war verloren.
Im Inneren des Gutshauses roch es nach verbrannten Kräutern. Henricus van der Wee stapfte hinter dem Knecht die Treppe hinauf in eine abgedunkelte Kammer. Als er über die Schwelle trat, wich er entsetzt zurück, so bitter war der Gestank, der ihm entgegenschlug. Fäulnis, Exkremente und der Pestgeruch des nahen Todes hingen derart schwer in der Luft, dass auch das halbe Dutzend Schälchen mit schwelenden Kräutern nicht dagegen ankam.
Henricus straffte die Schultern und trat in die Kammer. Er befahl dem Knecht, die Fensterläden zu öffnen. Er brauchte Licht. Und frische Luft.
Dann wandte er sich dem Mann zu, der in dem Bett lag und leise stöhnte. Der Kranke war kaum älter als dreißig, doch seine Wangen waren totenbleich, die Augen schwarz gerändert, und fiebriger Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Er zitterte und stieß unentwegt unflätige Flüche aus.
Ohne sich um den Protest des Mannes zu scheren, schlug Henricus die Bettdecke zurück. Das rechte Bein war tatsächlich dick wie der Stamm einer Eiche. Bestialischer Gestank stieg aus der notdürftig verbundenen Wunde auf.
»Wie hat man das Bein bisher behandelt?«, fragte Henricus.
»Der Chirurgicus aus Gnoien hat dafür gesorgt, dass es gut eitert, und ihn einige Male zur Ader gelassen«, erwiderte eine helle, klare Stimme von der Tür her.
Henricus blickte auf und entdeckte eine junge Frau mit Haube auf dem Kopf und Säugling auf dem Arm. Offenbar die Gemahlin des Hausherrn.
»Dachte ich mir«, brummte er. »Wann war das?«
»Vergangene Woche. Gestern kam er erneut, doch mein Gemahl hat ihn davongejagt und gedroht, ihm die Hand abzuhacken, wenn er sich ihm noch einmal nähert. Mein Hans sagt, seit der Chirurgicus ihn behandelt hat, geht es ihm schlechter. Er ist im Wahn. Das Fieber.« Sie senkte den Blick.
Henricus betrachtete erst den Patienten, dann die Frau. »Bringt eine Kerze, kochend heißes Wasser und saubere Tücher. Und Wein brauche ich auch.«
»Das könnte dir so passen, du elender Quacksalber, mir die Vorräte wegzusaufen!«, fauchte ihn der Hausherr mit überraschend lauter Stimme an.
»Ich kann auch gehen, Herr, und Euch Eurem Schicksal überlassen.«
»Das wäre meiner Gesundheit vermutlich zuträglicher. Zu viele Idioten haben schon an mir herumgepfuscht.«
Henricus nickte der Frau zu, die eilig verschwand, dann beugte er sich über seine Tasche und holte einen glitzernden Umhang hervor, der mit allerlei geheimnisvollen Symbolen bestickt war, Sternbildern, Halbmonden, Zirkeln sowie verschiedenem Getier.
»Was ist das?«, fragte der Kranke argwöhnisch.
»Das Gewand der Gilde der Heiler von Konstantinopel. Nur Ärzte, die dort studiert haben, dürfen es tragen.«
»Du hast in Konstantinopel studiert, Alter?«
Henricus verneigte sich.
»Das ist doch nur irgendein Hokuspokus!«, stieß der Kranke hervor, doch er schien beeindruckt.
Henricus holte ein reich verziertes Bronzeschälchen aus seiner Tasche und stellte es auf die Truhe neben dem Bett. Er warf einige Kräuter hinein und entzündete sie mit der Kerze, die eine Magd soeben gebracht hatte. Es krachte und zischte, grünlicher Rauch stieg aus der Schale auf. Ein scharfer Geruch verbreitete sich und überdeckte den Gestank im Raum.
Die Magd bekreuzigte sich und eilte davon. Der Mann im Bett grummelte unverständliche Worte vor sich hin.
Henricus machte sich daran, den schmutzigen Verband von der Wunde zu entfernen, ohne auf die Schmerzenslaute zu achten, die der Kranke ausstieß. Er war gerade fertig, als die junge Hausherrin zurückkehrte, eine dampfende Schüssel in der Hand und einen Stapel Leinentücher über dem Arm.
Ängstlich äugte sie in die Schale, in der die Kräuter noch immer qualmten. »Wo soll ich die Schüssel abstellen?«
»Auf dem Stuhl dort, und die Tücher hängt über die Lehne. Und dann nehmt Ihr die alten Verbände und verbrennt sie.«
»Aber …«
»Wenn Ihr nicht wollt, dass Euer Kind ebenfalls Fieber bekommt, tut Ihr, was ich sage.«
»Wie Ihr meint, Meister.« Sie hob die eitergetränkten Verbände vom Boden auf. »Der Wein kommt sofort.«
»Vergesst nicht, auch noch einen Becher zu bringen. Und lasst ihn unverdünnt!«
Die Frau musterte ihn einen Moment schweigend, dann verschwand sie.
Henricus beugte sich über die Schüssel und wusch sich gründlich die Hände. Dann tauchte er eines der Tücher ins Wasser und wrang es aus.
In dem Moment kehrte die Frau zurück.
»Flößt Eurem Gemahl von dem Wein ein, so viel Ihr könnt«, befahl Henricus.
Die Frau füllte den Becher und hielt ihn ihrem Mann an die Lippen. Der spuckte, keuchte und fluchte, doch den größten Teil des Getränks schluckte er gierig. Der Inhalt eines zweiten Bechers verschwand in seinem Rachen, dann zeigte Henricus der Frau an, dass es genügte.
»Haltet sein Bein fest«, bat er.
Während die Frau den Oberschenkel umklammerte, säuberte Henricus die Wunde mit dem feuchten Tuch, bis der gesamte Eiter verschwunden war. Dabei sang er leise ein Wiegenlied im Dialekt seiner Heimat.
Die Frau beobachtete ihn ängstlich. Sicherlich hielt sie das einfache Lied für eine magische Formel. Das sollte sie auch. Der Umhang, die dampfende Schüssel und der Singsang verfehlten gewöhnlich ihre Wirkung nicht. Und da, wo Henricus’ Heilkünste versagten, half manchmal der Glaube an vertriebene Dämonen dem Kranken wieder auf die Beine.
Endlich war die Wunde sauber. Henricus warf das Tuch auf den Boden und zog ein Messer aus dem Gürtel.
»Was habt Ihr vor?«, fragte die Frau erschrocken.
»Der Teufel ist ihm ins Fleisch gefahren«, erklärte Henricus. »Ich muss ihn wegbrennen.«
»Gütiger Himmel!« Die Frau bekreuzigte sich und schlug die Hände vors Gesicht.
»Bein herunterdrücken!«, befahl Henricus streng.
Er hielt die Klinge in die Kerzenflamme. Dann machte er sich daran, die Wundränder sauber abzuschneiden.
Der Mann brüllte wie am Spieß. Die Frau presste sich mit ihrem ganzen Gewicht auf seinen Oberschenkel. Henricus erhob erneut die Stimme, sang sein Wiegenlied und schnitt das tote Gewebe vom Bein seines Patienten. Als er fertig war, griff er nach einem weiteren sauberen Tuch und goss Wein darauf, ohne seinen Gesang zu unterbrechen. Mit dem getränkten Stoff reinigte er die Wunde. Der Kranke stöhnte nur noch leise.
Zum Schluss verband Henricus die Wunde mit einem Stück sauberen Stoff und verknotete die Enden. Er hob die Hände zum Himmel und sagte den Spruch auf, den ihm sein Mentor beigebracht hatte. Er war auf Arabisch und niemand außer Henricus verstand, was er bedeutete: »Lass deine Träume immer deine Ängste überwinden, und lass deine Taten lauter erschallen als jedes Wort.«
Als er geendet hatte, verneigte er sich.
»Der Gehörnte hat seinen Leib verlassen. Nun ist er bereit zur Heilung«, verkündete er mit feierlicher Stimme. »Habt Ihr gesehen, wie ich die Wunde mit Wein gereinigt und frisch verbunden habe?«
»Ja, Meister«, flüsterte die Frau.
»Genau so müsst Ihr es auch machen, zweimal am Tag. Und nehmt immer nur saubere Tücher. Dann geht es Eurem Gemahl bald besser.«
»Und der Leibhaftige ist wirklich fort?«, fragte sie besorgt.
»Auf und davon.« Das hoffte er zumindest.
Die Entzündung im Bein war schon weit fortgeschritten. Der Chirurgicus, der draußen vor dem Tor stand, hatte recht. Um ganz sicherzugehen, hätte man das Bein amputieren müssen. Aber dabei konnte viel schiefgehen, der Patient hätte verbluten können. Und die Folgen hätten sich sofort gezeigt. Zu riskant für Henricus’ Geschmack. So immerhin hatte der Hausherr die Aussicht, völlig zu gesunden und weiterhin mit beiden Beinen durchs Leben zu schreiten. Und wenn nicht, wäre Henricus über alle Berge, bevor sich der Zustand des Patienten erneut verschlechterte.
Henricus zog den Umhang aus und packte ihn samt dem Schälchen mit den Kräutern in seine Tasche. Dann wusch er das Messer in der Schüssel, hielt es erneut in die Flamme und schob es zurück in die Scheide an seinem Gürtel.
»Euer Gemahl sollte jetzt ruhen«, erklärte er.
»Ja, Meister.« Die Frau schob die Bettdecke zurecht.
Ihr Gemahl hatte die Augen geschlossen und schien bereits eingenickt zu sein.
»Nun denn.« Henricus schloss die Tasche.
»Wollt Ihr mit uns zu Mittag speisen?«, fragte die Frau. »Ihr habt es Euch redlich verdient.«
Henricus zögerte. Ein warmes Mahl kam ihm sehr gelegen. Bei dem Gedanken an eine heiße Suppe oder gesottenes Fleisch und Gemüse lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Aber er wollte nicht riskieren, länger als nötig auf dem Gutshof zu verweilen.
»Habt Dank, gute Frau, doch ich muss weiterziehen. Ich werde in Rostock erwartet, wo ein reicher Kaufmann schwer erkrankt ist und auf meine Dienste wartet.«
»Dann wünsche ich Euch eine gute Reise. Was bin ich Euch schuldig für die Behandlung?«
»Zehn Groschen.« Der Wochenlohn eines einfachen Handwerkers.
Ohne mit der Wimper zu zucken, griff die Frau in den Beutel, der an ihrem Gürtel hing, und zählte die Münzen ab.
Henricus fluchte lautlos. Er hätte ohne Probleme das Doppelte verlangen können. Bei diesen Bauern wusste man nie, woran man war. Manche sahen arm aus und hüteten ein Vermögen, andere lebten auf großem Fuß und nannten nicht einmal den Teller ihr Eigen, von dem sie aßen. Dankend nahm er das Geld entgegen und eilte zurück auf den Hof, wo der Knecht mit seinem Karren wartete.
Während er den Esel durch das Tor führte, pfiff er ein Liedchen vor sich hin. Alles in allem konnte er zufrieden sein. Er hatte mit großer Wahrscheinlichkeit einem Mann das Leben gerettet und dabei noch so gut verdient, dass er eine Woche davon leben konnte, wenn er gut haushielt, sogar zwei. Und Futter für den Esel sprang auch noch davon raus. An Tagen wie diesem war er geneigt zu glauben, der Herr im Himmel halte trotz all der schrecklichen Prüfungen, die er ihm auferlegt hatte, seine schützende Hand über ihn. An anderen jedoch kam es ihm eher so vor, als wolle er mit den gelegentlichen Freuden seine Qualen nur verschlimmern.
Unruhig lief Emilia im Zimmer auf und ab. Der Wachmann, den Sergius bei ihr zurückgelassen hatte, beobachtete sie argwöhnisch. Ihr Bräutigam war mit dem Fremden losgegangen, um Zeugen zu suchen, die bestätigen konnten, dass sie Emilia kannten. Sie hatte darum gebeten, auch den Vater bringen zu lassen. Vielleicht hatte er ja einen hellen Moment und konnte bezeugen, wer sie war.
Sie tastete nach dem Medaillon, das um ihren Hals hing. Wenn man es aufklappte, kam ein winziges Porträt zum Vorschein, das ihre kleine Schwester und sie zeigte. Das Bild war vor vielen Jahren am Hof von Margrete angefertigt worden. Doch auch wenn sie dem Mädchen auf dem Bildnis noch immer ähnelte, war es kein Beweis, dass sie tatsächlich Emilia von Hobe war.
Endlich hörte sie polternde Schritte. Kurz darauf trat Sergius ein, gefolgt von einem alten Knecht, der ihren Vater am Arm führte. Emilia kannte den Alten, doch sie erinnerte sich nicht an seinen Namen.
»Du kennst mich doch«, sprach sie ihn an. »Du hast mich oft aus den Ställen vertrieben, wenn ich heimlich bei den Pferden war. Erinnerst du dich?«
Der alte Knecht blickte verunsichert zwischen ihr, Sergius und ihrem Vater hin und her.
»Nun sprich schon!«, forderte Sergius ihn auf. »Kennst du sie? Ist das Emilia, die Tochter deines Herrn?«
Der Knecht begann zu zittern. »Ich weiß nicht«, stammelte er. »Ich bin nicht mehr der Jüngste, meine Augen sind schwach. Und Emilia war ja noch ein kleines Mädchen, als sie uns verließ.«
»Ha!« Sergius stieß ihn zur Seite.
Emilia stürzte zu ihrem Vater und packte ihn an seinem Surcot. Man hatte ihn für die Hochzeit in festliche Gewänder gesteckt, die er offenbar vor Jahren zum letzten Mal getragen hatte. Der Stoff schlabberte um seinen abgemagerten Körper.
»Vater!«, rief Emilia. »Erkennst du mich? Weißt du, wer ich bin?«
»Agnes? Bist du das?«
Emilia schluchzte auf. Agnes war der Name ihrer verstorbenen Mutter. »Bitte, Vater, du musst mich doch erkennen.«
»Aber das tue ich doch, Agnes.« Er tätschelte ihre Wange. »Wie jung und hübsch du bist.«
Sergius deutete auf den Knecht. »Führ deinen Herrn in seine Kammer.«
Der Knecht gehorchte. Als die beiden fort waren, tauchte der Hofmeister auf, zwei junge Frauen im Schlepptau.
»Das sind zwei der Damen, mit denen sie angereist ist«, sagte er zu Sergius.
Erleichtert atmete Emilia auf. Es waren Mechthild und Constanze. Die beiden kannten sie seit Jahren, sie wussten, wer sie war. Constanze war einige Jahre älter als sie und stammte ebenfalls aus Mecklenburg. Sie war erst mit vierzehn an den dänischen Hof gekommen und hatte alle mit ihren gewandten Umgangsformen und ihrer Schönheit für sich eingenommen. Anfangs hatte Emilia nicht viel mit dem älteren Mädchen anfangen können, aber nach Brunhilds Tod hatte Constanze sie liebevoll getröstet, und sie hatten sich angefreundet.
»Constanze, bitte steht mir bei!«, flehte Emilia die Freundin an. »Hier liegt bestimmt ein schreckliches Missverständnis vor. Ihr müsst mir helfen, es aufzuklären.«
Constanze runzelte die Stirn und wandte sich an Sergius. »Was geht hier vor?«, fragte sie mit scharfer Stimme.
»Wer seid Ihr?«, fragte Sergius ebenso scharf zurück.
»Constanze von Gnoien, Tochter des Grafen von Gnoien.« Sie reckte das Kinn.
»Könnt Ihr bestätigen, dass dies Emilia von Hobe ist? Seid Ihr mit ihr am dänischen Hof erzogen worden?«
Constanzes Augen flackerten. »Ich verstehe nicht …«
»Beantwortet meine Frage. Könnt Ihr beschwören, dass dies hier die Tochter des Burkhard von Hobe ist?«
»Diese Frau wurde mir am dänischen Hof als Emilia von Hobe vorgestellt. Aber ich kann nicht beschwören, dass sie es wirklich ist.«
Emilia starrte ihre Freundin entsetzt an. Doch diese mied ihren Blick.
Sergius wandte sich an Mechthild. »Was sagt Ihr dazu?«
»Mechthild von Praunheim ist mein Name.« Mechthild knickste eifrig. »Ich kann bestätigen, was Constanze gesagt hat.« Sie senkte den Kopf und studierte ihre Schuhspitzen.
»Das genügt! Verschwindet! Raus hier, alle!« Sergius wedelte mit den Armen.
»Constanze!« Emilia rannte zur Tür, um ihrer Freundin den Weg zu versperren. »Warum tut Ihr mir das an? Ihr wisst doch, wer ich bin!«
Eine derbe Hand packte sie an der Schulter und riss sie zurück. Sie zuckte zusammen. Aber nicht wegen der Grobheit. Ihre Narbe schmerzte! Die Narbe – warum hatte sie nicht gleich daran gedacht?
Sie drehte sich um. Der Wachmann stand so dicht vor ihr, dass sie erschrocken zurückzuckte. Sie wandte sich ihrem Vetter zu.
»Sergius!«, rief sie. »Ihr müsst mich anhören! Ich kann beweisen, wer ich bin!«
Sergius winkte ab. »Ich habe genug von Euren Beweisen. Ich werde herausfinden, was hier vorgeht, verlasst Euch drauf. Ich werde sofort einen Boten nach Schwerin schicken. Morgen mache ich mich in aller Frühe höchstselbst auf den Weg dorthin, um mich mit Herzog Albrecht zu beraten.« Er nickte dem Wachmann zu. »Führt sie in den Kerker. Sorgt dafür, dass es ihr an nichts mangelt. Lasst ihr Speis und Trank und eine warme Decke bringen. Und passt gut auf sie auf. Ich möchte nicht, dass ihr ein Leid geschieht, solange wir nicht wissen, welches Spiel hier gespielt wird.«
Emilia fühlte sich wie in einem Albtraum, als sie von zwei Wachmännern in das Kellergeschoss eskortiert wurde. Im Gewölbe brannte eine Fackel, doch in dem Kerker, in den man sie schubste, war es stockdunkel, und es stank nach Fäulnis und Exkrementen.
Als die Tür hinter ihr zugeschlagen wurde und der Schlüssel sich quietschend im Schloss drehte, kam es Emilia vor, als hätte man sie lebendig begraben.
In Windeseile war Nikolaus zurück in der Stadt. Die Wachen am Kuhtor sahen ihn zwar misstrauisch an, aber er grüßte einfach fröhlich, zeigte in den Himmel und sagte, dass es doch schön sei, dass die Sonne so herrlich scheine. Sie hoben verdattert den Blick in den Himmel, und Nikolaus ritt unbehelligt an ihnen vorüber.
Die Nikolaikirche lag nur vierhundert Fuß vom Kuhtor entfernt. Der Chor war hoch gebaut, ein Schwibbogen erlaubte es, die Kirche zu unterqueren. Nikolaus betrachtete das Hauptportal. Hier gingen ständig Leute ein und aus, niemand würde es wagen, ein Pferd zu stehlen. Sollte allerdings Madruzzo wie durch ein Wunder hier auftauchen, würde er sein Pferd sofort erkennen und Alarm schlagen. Dann müsste Nikolaus erklären, woher er den Hengst hatte. Selbst mit Albrechts Vollmachten würde man ihn als Pferdedieb aus der Stadt werfen und das Tier dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Dass Madruzzo das Recht an dem Pferd verloren hatte, weil Nikolaus ihn ritterlich besiegt hatte, würde nicht zählen, denn es gab keine Zeugen.
Er stieg ab und führte das Pferd bis an die Stadtmauer. Dort entdecke er eine einsame Nische, in die der Hengst hineinpasste. Er band ihn an, bat Gott, er möge Diebe fernhalten, und zog das Dokument aus der Tasche. Er rollte es auf. Ohne Madruzzos Erklärung hätte er nie herausgefunden, dass dies der Plan der Katakomben der Nikolaikirche war. Zwar erkannte er den Grundriss einer Kirche mit drei Schiffen, aber davon gab es in der Gegend Dutzende. Nikolaus hatte nicht einmal gewusst, dass sich unter dieser Kirche Katakomben verbargen. Er war davon ausgegangen, dass solche unterirdischen Beinhäuser nur in Rom oder Paris existierten.
Er suchte einen Hinweis auf den Eingang in die Unterwelt, fand aber nichts. Stattdessen stand über dem Ostschiff der Kirche ein Satz: »Wer bei Ägidius von Keltow zu Gast ist, der ist bei den Toten zu Gast.«
Nikolaus überlegte. Der Spruch bedeutete ganz offensichtlich, dass Ägidius von Keltow tot war und auf dem Friedhof begraben lag. Aber das allein konnte nicht gemeint sein, es wäre zu banal. Der Friedhof der Wohlhabenden grenzte an das Ostschiff. War dort auch der Eingang zu den Katakomben zu finden?
Nikolaus umrundete die Kirche, betrat den Friedhof, auf dem Grabplatten den Eingang zu den Familiengruften markierten. Doch nirgends konnte er den Namen Ägidius von Keltow entdecken. Also hatte er sich getäuscht und das Rätsel war schwieriger zu lösen, als er gedacht hatte. Missmutig kickte er einen kleinen Stein beiseite, der in einem Gebüsch landete und einen seltsamen Laut von sich gab: als treffe Stein auf Stein.
Nikolaus sah sich um. Er war allein. Rasch schritt er um den Busch. Dahinter kam eine weitere Grabplatte zum Vorschein: die des Ägidius von Keltow.
Mit beiden Händen packte er die Platte. Wenn sie tatsächlich den Eingang zu den Katakomben markierte, müsste er sie ohne Probleme bewegen können. Doch sie rührte sich nicht vom Fleck. Entweder irrte Nikolaus sich, oder der Mechanismus war komplizierter, weil der Erbauer der Katakomben nicht wollte, dass jeder Fremde hinabsteigen konnte.
Nikolaus tastete die Platte ab, doch das Grab gab sein Geheimnis nicht preis. Er suchte weiter. Ägidius’ Grab lag nahe der Kirchenmauer, vielleicht fand er dort einen versteckten Hebel oder einen anderen Eingang. Er erhob sich und betrachtete die Backsteinmauer genau. Tausende Steine. Tausende Möglichkeiten für einen versteckten Mechanismus.





























