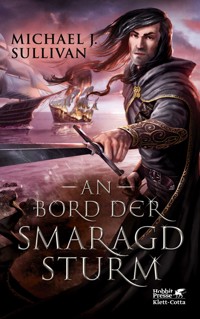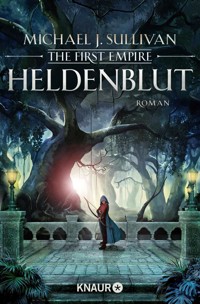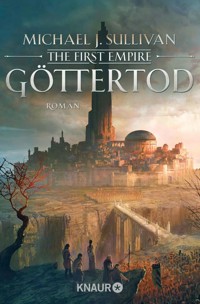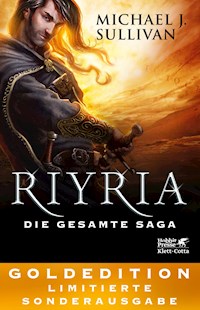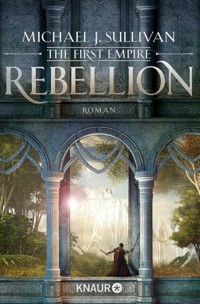13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Riyria-Chroniken
- Sprache: Deutsch
»Ryiria bietet alles, was man sich nur wünschen kann. Die Protagonisten gehören zu den besten, denen ich in der Fantasyliteratur begegnet bin. Erzählerisch top. Ein absolut überzeugender Plot. Dieser Band ist der befriedigendste Abschluss einer Reihe, den ich je gelesen habe.« Barnes & Nobles Fantasyblog Als Gabriel Winters Tochter Genevieve kurz nach ihrer Hochzeit mit einem Grafen auf mysteriöse Weise verschwindet und für tot gehalten wird, sinnt der reiche Whiskey-Baron auf Rache. Da er während des berüchtigten Jahres der Angst in Colnora gelebt hat, heuert er den einzigen Mann an, von dem er weiß, dass er sie entweder finden, oder blutige Vergeltung üben kann – Royce Melborn. Royce und Hadrian, der zynische Ex-Assassine und der idealistische Ex-Söldner, reisen daraufhin in die geheimnisvolle Stadt Rochelle. Diese ist voller Adliger, die angeblich von der kaiserlichen Aristokratie abstammen, aber offenbar jeder hat etwas zu verbergen. Ist die junge Gräfin noch zu retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Michael J. Sullivan
Das Verschwinden der Wintertochter
Die Riyria-Chroniken 4
Aus dem Amerikanischen von Wolfram Ströle
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Disappearance of Winter’s Daughter«
im Verlag RIYRIA ENTERPRISES
© 2017 by Michael J. Sullivan
Für die deutsche Ausgabe
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung einer Illustration von © Larry Rostant
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98216-9
E-Book ISBN 978-3-608-11855-1
Inhalt
1
Die blaue Weste
2
Die Rückkehr des Vergil Puck
3
Der Whiskey-Baron
4
Rochelle
5
Mercator
6
Bei Lamm und Dünnbier
7
Frühstück
8
Die Geschichte zweier Soldaten
9
Gold essen
10
Der stehende Venlin
11
Klein-Gur-Em
12
Einhörner und Tupfen
13
Grom Galimus
14
Der Kutscher
15
Vogeljagd
16
Wegsehen
17
Die Versammlung
18
Der Rasa
19
Der lebende Beweis
20
Jäger und Gejagter
21
Der Herzog
22
Der Morgen danach
23
Ein Gebet zu Novron
24
Ruhelos
25
Schlüssel und Münzen
26
Geschacher
27
Das Frühlingsfest
28
Versteckspiel
29
Winters Tochter
Nachwort
Für Royce und Hadrian,
zwei Diebe, die Herzen gestohlen
und Träume erfüllt haben.
1
Die blaue Weste
Devon De Luda fragte sich nicht zum ersten Mal, ob Genevieve Hargrave, die Herzogin von Rochelle, womöglich verrückt war.
»Halt! Halt!«, schrie sie und hämmerte mit der Faust gegen das Dach der Kutsche.
Sie warf Devon einen scharfen Blick zu und befahl: »Sagt ihm, er soll anhalten!« Dann steckte sie den Kopf durch das Fenster und schrie zum Kutscher hinauf: »Bringt die Biester zum Stehen, bei Maribor! Sofort!«
Der Kutscher, der offenbar von einem Notfall ausging, hielt so abrupt, dass Devon auf die gegenüberliegende Sitzbank flog. Im selben Moment, in dem die Räder stehen blieben, oder sogar noch ein wenig davor, stürzte die Herzogin aus der Tür und entfernte sich im Laufschritt mit gerafften Röcken und klappernden Absätzen.
Der sprachlos zurückbleibende Devon rieb sich das angeschlagene Knie. Als Schatzmeister des herzoglichen Haushalts von Rochelle drehte sich seine Welt sonst um Münzen und Geldscheine. Dass er sich jetzt auch noch um einen so impulsiven Wirbelwind kümmern sollte, behagte ihm gar nicht. Er bevorzugte ein geordnetes, planbares Dasein. Aber seit der Ankunft der neuen Herzogin war in der Stadt nichts mehr normal.
Vielleicht ist sie doch verrückt, zumindest ein kleines bisschen. Es würde so vieles erklären.
Er überlegte, ob er einfach in der Kutsche warten sollte, aber wenn ihr etwas zustieß, würde man ihm die Schuld daran geben. Mit einem schicksalsergebenen Seufzer stieg er aus und folgte ihr.
Es war früh dunkel geworden, die Frühlingstage waren noch kurz. Die Jahreszeit der Erneuerung hielt wie der Wohlstand nur langsam Einzug in Alburn. Zwar hatte es aufgehört zu regnen, aber vom Meer zog ein abendlicher Nebel herein und alles war feucht und klamm. Das Pflaster glänzte im Licht der Straßenlaternen und die Welt außerhalb der Kutsche roch nach Holz, Rauch und Fisch. Vereinzelte Pfützen machten den Weg für Devons neue Schuhe zum Hindernislauf. Vorsichtig steuerte er zwischen ihnen hindurch und zog den Kragen seines Mantels fester um den Hals. In der Kutsche war es schon nicht warm gewesen, aber draußen war die Luft bitterkalt. Sie hatten auf dem Boulevard des Jahrhunderts angehalten, der auf beiden Seiten von herrschaftlichen dreistöckigen Kaufmannshäusern gesäumt war. Am Straßenrand standen Dutzende Karren, in denen fahrende Händler ein Sammelsurium von Waren feilboten. Da gab es bunte Schals zu kaufen und daneben bestickte Sättel und frisch gebratenes Schweinefleisch. Wie immer schwärmten massenweise verwahrloste Gestalten durch das Labyrinth der Stände, von denen die meisten sich allerdings mit sehnsüchtigen Blicken auf die Schals und mit dem bloßen Duft des gebratenen Fleisches begnügen mussten.
Die Herzogin eilte an den Ständen entlang und drängelte sich zwischen den Passanten hindurch, während diese verwundert auf die korpulente Dame in Satin und Perlen starrten, deren Absätze so laut klapperten wie die Hufe eines Pferdes.
»Hoheit!« Devon setzte ihr nach. »Wohin wollt Ihr?«
Die Herzogin blieb nicht stehen und wurde auch nicht langsamer. Erst an einem klapprigen Karren, der Kleider verkaufte, hielt sie schwer atmend an und betrachtete die Auslage.
»Wunderbar.« Sie klatschte in die Hände. »Die Weste da, die mit der Vorderseite aus Satin und dem Blumenmuster, seht Ihr die? Sie ist zwar überhaupt nicht mein Geschmack, nein, aber Leo findet sie bestimmt wunderbar. Das Muster ist so kühn und lebendig. Und sie ist blau! Genau das, was er für das Frühlingsfest braucht. Damit fällt er auf jeden Fall auf. Niemand könnte diese Weste tragen, ohne aufzufallen.«
Devon hatte keine Ahnung, wovon sie sprach, und vielleicht wusste sie es ja selbst nicht. Bei der Herzogin spielte das nur selten eine Rolle. Devon hatte zwar mehr Zeit mit Ihrer Hoheit verbracht als andere, aber so viel nun auch wieder nicht. Die Herzogin suchte ihn lediglich auf, wenn sie seinen Rat in den Finanzangelegenheiten des Herzogtums brauchte, und das war bisher nur wenige Male der Fall gewesen – in letzter Zeit allerdings häufiger, weil sie sich zunehmend unternehmerisch betätigte. Trotzdem wusste er nach einem Dutzend Vorladungen, einigen Kutschfahrten und ein oder zwei Gesprächen nicht genug, um sagen zu können, dass er die neue Herzogin kannte, von verstehen ganz zu schweigen. Er bezweifelte, dass selbst der Herzog die Unternehmungen seiner neuen Frau verstand.
»He, Ihr da!«, sprach sie den Händler an, einen dunkelhäutigen Calier mit verschlagenem Blick. Für Devon waren alle Calier gleich, nämlich falsch und verdorben. Zwar kleideten sie sich ehrbar, aber damit täuschten sie niemanden. »He! Wie viel für die Weste? Die blaue da an dem Ständer, mit den glänzenden Messingknöpfen.«
Der Mann sah sie mit einem anzüglichen Grinsen an. »Für Euch, meine Teuerste, nur zwei Goldtaler.« Er sprach mit einem starken fernöstlichen Akzent, der ihn allein schon verdächtig machte und Devons Erwartungen vollständig entsprach – einer Stimme, wie sie perfekt zu einem Betrüger passte.
»Unverschämt!«, rief Devon empört und trat von hinten näher. Das war das Problem mit diesen fahrenden Händlern: Sie betrogen die Unschuldigen und Unerfahrenen. Sie taten, als handelte es sich um eine einmalige Gelegenheit, und später musste der betrogene Käufer dann feststellen, dass der Diamant nur ein Quarz war oder der Wein Essig.
»Ich gebe Euch sieben Silbertaler«, sagte die Herzogin. »Devon, gebt dem Mann sieben Silbertaler und …«
Der Händler runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Für sieben Silbertaler habe ich ein schönes Kopftuch für Euch. Die Weste könnte ich Euch für einen Goldtaler und acht Silbertaler überlassen.«
»Hoheit, es ziemt sich nicht für die Herzogin von Rochelle, auf der Straße mit einem Händler zu feilschen, der …« Er sah den Händler finster an, der auf die Beleidigung wartete, die aber ausblieb. De Luda war sonst nicht schüchtern, aber er hatte in den vergangenen drei Monaten festgestellt, dass die Herzogin es nicht mochte, wenn andere in ihrer Gegenwart beleidigt wurden, auch wenn sie es noch so sehr verdient hatten.
»Ist mir egal. Leo wird begeistert sein und, ach, ich kann es gar nicht erwarten, ihn in dieser Weste zu sehen! Glaubt Ihr nicht auch, er wird darin fabelhaft aussehen?« Als der Händler das Kleidungsstück vom Haken nahm, entdeckte sie einen dahinter versteckten leuchtend gelben Mantel. »Bei Maribor! Seht Euch diesen Mantel an! Der ist ja noch göttlicher!«
Sie packte Devons Arm und schüttelte ihn, von Begeisterung überwältigt, heftig. Es war nicht das erste Mal, aber er wusste, dass ein solcher Klammergriff einer Umarmung noch bei Weitem vorzuziehen war. Ihre Umarmungen waren berüchtigt. Die Herzogin verteilte sich so freigiebig und so gewaltsam – sogar beim Personal –, dass viele einen Umweg machten, wenn sie ihr irgendwo in den herzoglichen Gemächern begegneten.
»Ich muss unbedingt beides haben. Leo hat bald Geburtstag, und in diesem Mantel wird er sich wieder jung fühlen. Ihr müsst wissen, dass er vierzig wird, und diese Schwelle überquert niemand gern. Ich habe an dem Morgen, als ich dreißig wurde, fast geweint. Die Zeit schleicht sich so an einen heran, nicht wahr? Springt einen wie eine bösartige Katze aus dem Hinterhalt an, wenn man am wenigsten damit rechnet. Und dreißig ist ein kleiner Graben verglichen mit der Schlucht von vierzig. Aber das muss ich Euch ja nicht sagen. Jedenfalls braucht Leo die Weste und er wird den Mantel lieben. Das sind nicht die Kleider eines langweiligen, unbedeutenden vierzigjährigen Herzogs. So zieht sich ein junger gutaussehender Mann an, dessen Stern noch im Aufgehen ist.« Die Herzogin sah den Händler böse an. »Ein Goldtaler und kein Silber für Mantel und Weste.«
Der Händler legte die Weste vor ihnen auf die Theke und schüttelte den Kopf. »Gnädigste, das ist importierte Seide aus Ost-Calis, ein ganz außergewöhnlicher Stoff, der monatelang mit einer Karawane durch den von Panthern und Kobras verseuchten Dschungel im schrecklichen Gur Em unterwegs war.« Er begleitete seine haarsträubende Geschichte mit Gesten wie bei einem Theaterstück für Kinder und krümmte, als er von Panthern sprach, sogar die Finger wie Krallen. »Der Transport dieses seltenen und herrlichen Stoffes hierher hat viele Menschenleben gekostet. Und nur die besten Schneiderinnen bekommen ihn, denn ein einziger falscher Schnitt könnte einen katastrophalen Verlust bedeuten. Aber Ihr wisst natürlich die Fähigkeiten zu schätzen, die man zur Herstellung eines solchen Meisterwerks braucht, deshalb werde ich Euch die Weste für einen Goldtaler und sechs Silbertaler überlassen und den Mantel für weitere zwei Goldtaler.«
Die Herzogin strich mit ihrer feisten Hand über den schimmernden Stoff. »Ich glaube Euch nicht, aber das mit den Schneiderinnen war ein origineller Einfall.« Sie lächelte ihn freundlich an – das einzige Lächeln, das sie beherrschte. »Das ist ganz gewöhnliche Vintu-Seide, hergestellt im kalischen Tiefland an der Südküste des Ghazel-Meers. In Dagastan wird sie an jeder Ecke für fünf Silber-Din die Elle verkauft. Manchmal, vor allem im Frühling, bekommt man sie sogar für vier Din und ein paar Zerquetschte. Die Seide dieser Weste wurde wahrscheinlich von der Gewürzhandelskompanie von Vandon importiert. Sie wurde in großen Mengen für drei Silber-Din die Elle eingekauft und in weniger als zwei Wochen auf dem üblichen Handelsweg hierher transportiert. Zugegeben, die Aufschläge der Gewürzhandelskompanie sind exorbitant, was den Preis beträchtlich erhöht haben dürfte, aber Panther, Kobras und Todesopfer hat es nicht gegeben.«
Devon sah sie entgeistert an. Die neue Frau von Herzog Leopold, die mit Genny angesprochen werden wollte statt des formelleren Genevieve, steckte voller Überraschungen – die meisten verstörend und hochnotpeinlich –, aber in Handel und Gewerbe kannte sie sich zweifellos bestens aus.
Doch der Calier ließ sich nicht beirren. Er runzelte die Stirn, breitete die Hände aus und schüttelte den Kopf. »Ich bin nur ein armer Händler. Für eine so vermögende Dame wie Euch kommt es auf ein paar kleine Münzen mehr oder weniger nicht an. Ich dagegen könnte von diesem Verkauf meine Frau und meine armen Kinder wochenlang ernähren.«
Devon war überzeugt, dass der Calier mit diesen Worten gewonnen hatte. Er hatte die Herzogin richtig eingeschätzt und die Schwachstelle in ihrer Verteidigung ausgemacht.
Genny ging einen Schritt auf den Mann zu und blickte eindringlich auf ihn hinunter. Ihr immer gegenwärtiges Lächeln wurde schärfer. »Es geht hier nicht um Geld«, sagte sie, und ihre Augen funkelten. »Das wissen wir beide. Ihr wollt mich übers Ohr hauen, und ich will Euch herunterhandeln. Es ist ein Spiel, das wir beide lieben. Niemand kann Euch dazu bringen, für weniger als Euren Mindestgewinn zu verkaufen, und Ihr könnt mich nicht zwingen, mehr zu zahlen, als ich bereit bin. In diesem Wettstreit sind wir gleichberechtigt. Ihr habt wahrscheinlich nicht einmal eine Familie. Die wäre sonst hier und würde Euch helfen …«
Im Gedränge der Passanten kam Unruhe auf. Ein magerer und schmutziger kleiner Junge rannte zwischen den Einkäufern hindurch. Geschickt schlängelte er sich durch den Wald von Beinen, einen Brotlaib an die Brust gedrückt. Das Geschrei hatte die Stadtwache alarmiert, und zwei Soldaten bekamen ihn zu fassen, als er auf ein kaputtes Gullygitter zukroch. Sie rissen ihn hoch, bis seine Beine vom Boden abhoben und in der Luft zappelten. Seine nackten Füße waren schwarz wie Teer. Er war nicht älter als zwölf, wand sich und biss wie eine Wildkatze. Die Wachen schlugen auf ihn ein, bis er bewegungslos auf dem Pflaster lag und nur noch leise wimmerte.
»Aufhören!« Die Herzogin stürzte mit erhobenen Händen auf sie zu. Als große Frau in einem wallenden Gewand war sie sogar auf dem belebten Boulevard des Jahrhunderts schwer zu übersehen. »Lasst das Kind in Ruhe! Was denkt Ihr Euch dabei? Gar nichts, stimmt’s? Nein, Ihr denkt überhaupt nicht nach! Natürlich nicht. Man schlägt ein halb verhungertes Kind doch nicht. Was ist in Euch gefahren? Also wirklich!«
»Er ist ein Dieb!«, sagte der eine Soldat, während der andere einen Lederriemen hervorzog und ein Ende um das linke Handgelenk des Jungen wickelte. »Das kostet ihn die Hand.«
»Lasst ihn los!«, rief die Herzogin. Sie ergriff das Kind und wickelte den Lederriemen eigenhändig ab. »Ich kann nicht fassen, was ich hier erlebe. Devon, habt Ihr das gesehen? Ist das wirklich schon passiert? Unerhört! Kinder brutal zu verstümmeln, nur weil sie Hunger haben?«
»Doch, Hoheit«, sagte Devon. »Laut Gesetz … laut dem Gesetz Eures Mannes verliert ein Dieb beim ersten Verstoß die linke Hand, beim zweiten die rechte und beim dritten den Kopf.«
Die Herzogin starrte ihn entgeistert an. »Im Ernst? Leo würde niemals so grausam sein. Das Gesetz gilt doch wohl sicher nicht für Kinder.«
»Leider doch, es macht keine Ausnahmen. Diese Männer tun nur ihre Pflicht. Sie sollten sie ihre Arbeit machen lassen.«
Der Junge schmiegte sich in die Falten ihres Rocks.
Die Wachen ergriffen ihn wieder.
»Halt!«, gebot die Herzogin. Ihr Blick war auf einen Mann mit einer mehlbestäubten Schürze gefallen. »Gehört das Brot Euch?«
Der Bäcker nickte.
»Bezahlt ihn, Devon.«
»Entschuldigung?« Devon zögerte.
Die Herzogin stützte die Hand in die Hüfte und presste die Lippen zusammen. Obwohl er nur ab und zu für sie arbeitete, wusste er doch, was das bedeutete: Ihr habt mich gehört!
Er seufzte, ging zu dem Bäcker und öffnete seine Geldbörse. »Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Junge das Gesetz gebrochen hat.«
Die Herzogin richtete sich zu ihrer vollen Größe auf – die schon für einen Mann beträchtlich war, für eine Frau aber vollkommen außergewöhnlich. »Ich habe den Jungen gebeten, mir einen Laib Brot zu holen. Offenbar hat er das Geld verloren, das ich ihm gegeben habe, und da er nicht mit leeren Händen zurückkehren wollte, bediente er sich der einzigen möglichen Alternative. Ich ersetze nur das Geld, das er verloren hat. Da er auf meine Bitte gehandelt hat, habt Ihr es mit mir zu tun, nicht mit ihm. Zögert nicht, Euch mit etwaigen Beschwerden an den Herzog zu wenden. Ich bin überzeugt, mein lieber Mann wird das Richtige tun.«
Der Bäcker starrte sie einen Augenblick lang an und öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch dann behauptete sich sein Überlebensinstinkt und er unterdrückte die Bemerkung.
Die Herzogin sah die anderen an. »Noch jemand?« Sie musterte die Wachen finster. »Nein? Na dann, gut.«
Die Soldaten wandten sich verdrossen ab. Während Devon den Bäcker bezahlte, hörte er einen von ihnen murmeln: »Schnapsdrossel.« Er sagte es leise, aber auch wieder nicht so leise. Die Herzogin sollte es hören.
Die Kutsche fuhr weiter, und die Herzogin saß zusammengesunken auf der Sitzbank. Als große Frau hatte sie wenig Platz zum Zusammensinken, bevor ihre Knie an die Bank gegenüber drückten. »Das war doch noch ein Kind! Sehen die das nicht? Natürlich sehen sie es, aber kümmert es sie? Was für Unmenschen sind das! Sie hätten dem Jungen die Hand abgeschlagen – womöglich gleich an Ort und Stelle auf dem Hocker des Seidenhändlers. So barbarisch geht es in dieser Stadt zu? Kinder werden zu Krüppeln gemacht, weil sie Hunger haben? So kann man kein Herzogtum führen. Leo weiß bestimmt gar nicht, wie falsch seine Anordnungen umgesetzt werden. Ich werde mit ihm sprechen, und er wird klarstellen, wie das Gesetz gemeint ist. Kein Wunder geht es mit Rochelle bergab, solange es so blödsinnige Gesetze gibt. Sie schüren doch nur die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Wird der Junge mit nur einer Hand ein besserer Bürger sein?«
»Das war kein normaler Junge«, sagte Devon, der im Rhythmus der Kutsche schwankte. Von draußen drang das Geklapper der Hufe herein.
»Wieso nicht?«
»Der Dieb war kein Mensch, meine ich. Sondern ein Mir. Habt Ihr nicht seine spitzen Ohren gesehen? Wahrscheinlich gehört er einer kriminellen Vereinigung an. Die gehen vor wie Rattenkolonien, die ihre Beute in ein zentrales Nest bringen.«
»In Colnora haben wir auch Mir, Devon. Die Abstammung des Jungen ändert nichts. Er ist deshalb trotzdem ein notleidendes Kind. So einfach ist das.«
»Einfach, meint Ihr?« Devon hatte wie der Bäcker Mühe, höflich zu bleiben. Am liebsten hätte er ihr gesagt, sie sei naiv, aber das wäre zu weit gegangen. Die Herzogin äußerte oft Dinge, die ihn verstimmten, und als Folge davon sagte er gewöhnlich zu viel. Zum Glück hatte sie ihm Bemerkungen durchgehen lassen, die die meisten Leute in ihrer Position unannehmbar gefunden hätten. Bei jemand anderem hätte er vielleicht die Beherrschung verloren. Doch ihm war klar, dass er ironischerweise von derselben Einstellung profitierte, die das Mirkind gerettet hatte. »Ihr seid noch nicht lange bei uns, Hoheit, und versteht Rochelle noch nicht. Ich meine, wie das Herzogtum funktioniert. Rochelle ist nicht Colnora. Hier ist nichts einfach. Wir haben die Probleme jeder anderen großen Stadt, wohnen aber zusätzlich noch besonders dicht zusammen und beherbergen vier verschiedene Völker.«
»Die Calier sind kein anderes Volk, nur eine andere Nation.«
»Trotzdem ist Rochelle mit seiner explosiven Vielfalt einzigartig, und dazu kommen noch die starren Bräuche und Traditionen der Vergangenheit. Die Stadt hat sich den Veränderungen im Lauf der Jahrhunderte verweigert. Wir sind ein See, in dem sich viele Schichten ablagern. Ganz unten sind die Mir, und das nicht ohne Grund.«
»Ihr missbilligt, dass ich diesem Jungen geholfen habe?«
»Diesem Mir.«
Die Herzogin runzelte die Stirn. »Ihr findet es wahrscheinlich falsch, dass ich ihm auch noch Fleisch und Käse mitgegeben habe. Hätte ich ihn lieber mit einem Schulterklopfen und Winken wegschicken sollen? Oder, noch besser, hätte ich einfach zulassen sollen, dass man ihm die Hand abschlägt? Glaubt Ihr, man sollte den Mir aus dem Weg gehen, weil sie unattraktiv und primitiv sind … weil sie sich nicht einfügen? Ja?«
Die Herzogin sprach nicht mehr von dem Jungen, und Devon würde ihr nicht in die Falle gehen. »Ich finde einfach, Ihr hättet diese schreckliche Weste kaufen und Eurem Mann schenken sollen.«
Der Herzogin verschränkte die Arme vor ihrem mächtigen Busen und brummte ein lautes Hm. »Was ist daran falsch, ein Kind zu retten?«
Devon schüttelte den Kopf. »Die Mir sind nicht wie wir, Hoheit, genauso wenig wie die Zwerge oder die Calier. Sie wurden von anderen Göttern geschaffen, geringeren Göttern, und es ist falsch, ihnen dieselben Rechte zuzubilligen wie den Gesegneten Maribors und seines Sohnes Novron.«
»Da irrt Ihr Euch. Sie sind die Zukunft dieser Stadt!«, erklärte die Herzogin mit Nachdruck. »Wenn auf Eurem Acker goldener Weizen wild wachsen würde, würdet Ihr ihn hegen und pflegen und hoffen, ihn eines Tages ernten zu können. Das wäre nur vernünftig. In unserer verzweifelten Lage muss man alles nutzen, was man hat … nicht nur das, was schön aussieht.« Sie machte ein böses Gesicht, und ihre Lippen wurden von den feisten Wangen zusammengedrückt. »Vermutlich billigt Ihr auch nicht, was ich vorhin zur Zunft der Kaufleute gesagt habe. Ein wenig spät, Eure Meinung zu äußern, Devon. Wollt Ihr Euch auch zu meiner Ehe mit Leo äußern? Sie ist erst drei Monate alt. Vielleicht könnt Ihr den Herzog ja überreden, seine Meinung zu ändern, und er bittet den Bischof, sie zu annullieren.«
De Luda seufzte und rieb sich die Schläfen. »Ich gebe lediglich zu bedenken, dass Ihr unerfahren und gutgläubig seid.«
»Unerfahren? Gutgläubig?« Die Herzogin ließ ein kehliges Lachen hören. »Ich habe auf einem Piratenschiff bei Sturm Verträge ausgehandelt und dabei einen Schnaps nach dem anderen gekippt. Daheim in Colnora habe ich einen Nachbarn, der zu den prominentesten Dieben der Welt gehört und bei sommerlichen Grillfesten angeblich Rivalen die Amberfälle hinunterstürzt. Zugleich ist er ein sehr guter Kunde, und die Leute, die er zum Essen einlädt, sind auch keine Unschuldslämmer, ich drücke bei seinen Vergehen also ein Auge zu. Was meine vermeintliche Gutgläubigkeit betrifft: Sehe ich wirklich aus wie eine Debütantin mit rosigen Wangen?« Sie wartete, aber Devon schwieg. »Eben nicht. Ich bin eine nicht mehr ganz junge Kuh, die zu alt zum Melken ist und zu zäh zum Schlachten. Glaubt Ihr, ich habe es so weit gebracht, weil ich blind bin? Ich bin nicht hübsch, nicht kultiviert und ganz gewiss keine Qualitätsware, wie man so schön sagt. Ich bin eine Schnapsdrossel. Hat der Soldat mich nicht so genannt? So nennen mich alle, stimmt’s? Ich weiß, was die denken. Ich kenne die Gerüchte, warum Leos Wahl auf mich gefallen ist. Aber ich habe schon Schlimmeres gehört, glaubt mir. Ich bin eine Frau. Frauen hören immer Schlimmeres. Die Stutzer in ihren gestärkten Hemden und Strumpfhosen sind wie Pusteblumen neben denen, mit denen ich gewöhnlich zu tun habe.«
Devon musste tief Luft holen und dann gleich noch einmal. »Ich meinte ja nur, dass Ihr nicht wisst, wie es in Alburn und besonders in Rochelle zugeht. Wir leben in einer schwierigen und gefährlichen Stadt. Euer Colnora ist eine freie und offene Gemeinde, deren Kaufleute stolz auf ihre Unabhängigkeit sind. Rochelle dagegen ist alt und übervölkert. Es erstickt an Traditionen und Bürokratie. Es ist voller versteckter Winkel und dunkler Geheimnisse, zu vieler Geheimnisse. Und es verzeiht keine Fehler. Wir glauben noch an die alten Bräuche und die Ungeheuer der alten Welt. Aus Eurem Interesse an der blauen Weste schließe ich, dass Ihr von unserem mordenden Geist gehört habt.«
»In meiner Heimatstadt gibt es ebenfalls schwarze Männer, Devon. Ich habe selbst erlebt, wie die Stadt einen ganzen Sommer lang in Panik war, weil Menschen aller Schichten grausam ermordet wurden.«
»Der Mörder war ein Mensch?«
»Was sonst?«
Devon nickte. »An vielen Orten ist Aberglaube eine bloße Angewohnheit. Wenn in Colnora zum Beispiel jemand, der versehentlich etwas verschüttet hat, Salz über die Schulter wirft, erwartet er nicht wirklich, dass er damit einen bösen Geist abwehrt, der sich von hinten an ihn anschleicht.«
»Soll das heißen, es gibt in Rochelle Geister, die sich an Menschen anschleichen?« Die Herzogin hob die Augenbrauen und lächelte skeptisch. »Mit spitzen Zähnen und Fledermausflügeln? Spucken sie Feuer?«
»Ich sage nur, dass kluge Leute nachts zu Hause bleiben und ihren Kindern etwas Blaues anziehen, um das Böse abzuwehren. Und trotzdem geschieht den Bürgern dieser Stadt immer wieder Leid – in letzter Zeit sogar sehr häufig. Legenden haben oft einen wahren Kern, und wir …«
Die Kutsche hielt abrupt an. Sie war noch nicht über die Brücke zur herzoglichen Residenz gefahren. »Warum bleiben wir …?«
Die Tür auf Devons Seite wurde aufgerissen und ein Schwall kalter, klammer Luft drang herein. Aus dem Dunkel starrten ihn zwei grausame, bösartige Augen an. Er fuhr zurück und wollte entkommen, aber vergeblich. Er starb – die Schreie der Herzogin in den Ohren.
2
Die Rückkehr des Vergil Puck
Royce wusste, was gleich kommen würde.
Hadrian hatte schon über ein Dutzend Mal zu ihrem Gefangenen zurückgeblickt, obwohl sich nichts geändert hatte. Vergil Puck ging weiter hinter den Pferden von Royce und Hadrian her und war mit einem Seil gefesselt, dessen eines Ende fest um seine Handgelenke geschlungen und dessen anderes Ende an Hadrians Sattelhorn befestigt war. Trotzdem waren die Pausen zwischen Hadrians besorgten Blicken geschrumpft und die Dauer der Blicke spürbar gewachsen. Wenn Royce diese Entwicklung hochrechnete, konnte er voraussagen, wann genau …
»Und wenn er die Wahrheit sagt?«, fragte Hadrian.
Royce runzelte die Stirn und fühlte sich betrogen. Die Frage war viel schneller gekommen, als er erwartet hatte. Hadrian hatte sich nicht so sehr geändert, wie er gehofft hatte. »Tut er nicht.«
»Es klingt aber so, als könnte es sein.«
»Ich sage die Wahrheit«, bestätigte Puck so laut, dass man ihn über dem Schlurfen seiner Füße hörte – er folgte ihnen nur widerstrebend.
»Er unterscheidet sich nicht von anderen, denen man ein Verbrechen vorwirft. Die behaupten doch alle, sie seien unschuldig.« Royce machte sich nicht die Mühe zurückzublicken. Alles, was er wissen musste, sagte ihm der Spannungsgrad des Seils. Ihm entnahm er, dass Puck noch gefesselt war. Etwas anderes interessierte ihn nicht.
Die drei waren in gemächlichem Tempo auf dem ländlichen Abschnitt der Straße des Königs unmittelbar nördlich der Stadt Medford unterwegs. Es war warm. Der meiste Schnee des Jahres war inzwischen geschmolzen, aber das Schmelzwasser war immer noch zu den Seen und Flüssen unterwegs. Überall in ihrer Umgebung hörte Royce das Wasser gluckern. Jede Jahreszeit hatte ihre eigenen unverwechselbaren Geräusche: der Sommer das Summen der Insekten, der Herbst das Schreien der Gänse und der Winter den Wind. Im Frühling waren es Vogelgezwitscher und das Gluckern des Wassers.
»Aber er ist kein Verbrecher oder Mörder, nicht einmal ein Dieb. Ich meine, genau genommen wirft man ihm doch vor, dass er etwas gegeben hat, nicht genommen.«
Royce hob die Augenbrauen. »Baron Hildebrandt wäre da anderer Meinung. Man hat seiner Tochter Tugend und Reinheit genommen.«
»Ich bitte Euch!«, rief Puck aufgebracht. »Das ist doch lächerlich. Habt Ihr die Baronesse Hildebrandt überhaupt schon einmal gesehen? Den Namen Beatrix hat sie nicht von ihren Liebhabern, seid versichert. Sie ist dreiundvierzig, sieht aus wie neunundachtzig, hat das Gesicht eines grob geschnitzten Kürbiskopfs und die Figur eines aus zwei Kugeln bestehenden Schneemanns. Ganz zu schweigen von ihrer bissigen Zunge und ihrem absurd gackernden Lachen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie sich ihre Tugend auf dieselbe Art bewahrt, auf die eine faulige Melone verhindert, dass sie gegessen wird. Niemand, der Beatrix Hildebrandt von Sansbury je kennengelernt hat, könnte sich vorstellen, zu ihr ins Bett zu steigen. Lieber würde ich mich zu einem kranken Seeteufel legen. Vielleicht wenn mir jemand ein Messer an die Kehle gehalten hätte, dann …«
Seine Pause veranlasste Royce, sich umzudrehen.
Vergil Pucks missgestalte Nase stand schief im Gesicht und endete in einer Knolle ähnlich dem Knauf eines Spazierstocks. Abgesehen davon war er großgewachsen, mager und mit langen blondgelockten Haaren gesegnet, wie sie Frauen aller gesellschaftlichen Klassen Seufzer entlockten. Bekleidet war er mit einem dicken Kittel, Kniehosen und Stiefeln. Der Kittel war senkrecht blau-weiß gestreift, die Stiefel waren gelb wie die Brust eines Kanarienvogels. In einem hatte Hadrian recht. Vergil sah nicht aus wie der normale Allerweltsverbrecher.
Aber Verbrecher ist ein relativer Begriff, und was ist schon normal?
Vergil blickte zu Boden und schüttelte mit angewiderter Miene den Kopf. »Nein, ich muss gestehen, dass nicht einmal das ausreichen würde. Ich sage es Euch jetzt zum dritten Mal, Ihr habt den Falschen. Der echte Missetäter muss entweder taub und blind sein oder pervers bis zur völligen Unzurechnungsfähigkeit.«
Hadrian drehte sich um, schob die Spitze des auf seinen Rücken geschnallten Schwerts ein wenig zur Seite und stützte sich mit der Hand auf den Rumpf seines Pferdes. »Seid Ihr ein Adliger?«
»Wenn Ihr damit meint, ob blaues Blut in meinen Adern fließt, lautet die Antwort nein. Warum fragt Ihr?«
»Ihr redet so … gebildet … kompliziert. Und Ihr verwendet seltsame Wörter wie Missetäter und pervers.«
»Das kommt daher, dass ich Dichter bin«, rief Puck theatralisch. Er wollte eine tiefe Verbeugung anschließen, doch das Seil war zu straff gespannt, um das zuzulassen. »Ich verdiene meinen Lebensunterhalt, indem ich von Schloss zu Schloss ziehe und meine Gastgeber mit Liedern und Geschichten unterhalte. Ich erzähle von Liebesglück und -leid. Vom unglaublichen Liebesabenteuer der Persephone mit Novron bis zum tragischen Liebeswerben von Baronin Mummenschanz und Ritter Marotte. Ich bringe die Leute zum Lachen und zum Weinen, begeistere sie, bilde sie und …«
»Verführe sie?«, ergänzte Royce. »Frauen haben eine Schwäche für Dichter. Habt Ihr Beatrix Hildebrandt mit Worten umgarnt?«
Puck wollte vor Empörung stehen bleiben, doch wurde er von Hadrians Pferd weitergerissen. »Ihr hört mir nicht zu. Ich habe sie nicht verführt. Das würde ich für alles Gold von Avryn nicht tun. Lieber würde ich mit einem tollwütigen Frettchen Unzucht treiben. Ich sage Euch, wenn wir erst in Sansbury sind, werdet Ihr sie sehen und mich verstehen. Und sie belohnt Euch für Eure Mühe hoffentlich mit Umarmungen und nassen Küssen. Dann werdet Ihr das Ausmaß Eures Fehlers erkennen. Sie ist wie ein hässlicher alter Köter, der sich noch für einen Welpen hält, auch wenn ihm der Geifer in langen zähen Fäden vom Maul hängt. Und wenn sie den Mund aufmacht, um Euch zu danken, werdet Ihr ihre Zunge sehen, ein Organ, das für jedes vernünftige Lebewesen dieser Erde viel zu lang ist.«
»Die Baronesse ist schwanger«, sagte Royce. »Irgendwie muss das passiert sein.«
Puck grinste. »Ich habe auch schon kleine Stachelschweine gesehen – keine Ahnung, wie das möglich war.«
»Er klingt wirklich …« Hadrian suchte nach Worten. »Unschuldig.«
»Bei den Göttern! Das liegt daran, dass ich die Wahrheit sage!«, rief Puck mit zum Himmel erhobenen Gesicht. »Ihr beide seid … Ihr seid … was genau? Keine Ahnung. Polizisten? Kopfgeldjäger? Was auch immer, egal, Ihr habt so etwas bestimmt schon oft gemacht. Bestimmt habt Ihr schon Dutzende von Missetätern festgenommen und ihrer gerechten Strafe zugeführt. Ihr müsstet doch wissen, was das für Menschen sind und wie sie sich benehmen. Habe ich mich verdächtig verhalten, als Ihr mich aus der Schenke in Ostmark gezerrt habt? Ich vermute doch eher, die meisten Verbrecher würden abhauen. Habe ich das getan? Habe ich Euch überhaupt Widerstand geleistet? Nein. Was habe ich stattdessen getan?«
»Ihr habt nach der Polizei gerufen«, sagte Hadrian. Er warf Royce einen Blick zu und nickte kaum merklich.
»Ja! Richtig! Ich habe das getan, weil ich glaubte, Ihr wolltet mich dumm anmachen. Nur Schläger holen Leute aus einer Schenke und fesseln sie. Und wenn ein Polizist mich gehört hätte, würdet Ihr jetzt an einem Strick hängen – einem kürzeren als dem hier.«
Hadrian sah grübelnd zwischen Puck und Royce hin und her.
»Egal«, sagte Royce schnell, um dem Gedanken, der im Kopf seines Partners bereits Gestalt annahm, zuvorzukommen.
»Aber wenn er unschuldig ist, sollten wir ihn dann wirklich Baron Hildebrandt übergeben? Wenn er schuldig gesprochen wird, wird ihn kein adliges Blut schützen. Der Baron wird ihn töten.«
»Egal.«
»Mir ist das nicht egal!«, widersprach Vergil.
»Warum ist es egal?«, fragte Hadrian.
»Mich interessieren nur die acht Goldtaler, die Hildebrandt uns zahlt.«
»Das ist gefühllos, Royce«, sagte Hadrian.
»Nein, das ist das Leben. Beklag dich nicht bei mir. Mach es mit Maribor aus, mit dem Universum oder der Natur. Nach denselben Gesetzen, nach denen ein Spatz im Winter verhungert, wird Puck für ein Verbrechen hängen … selbst wenn er es nicht begangen hat. Aber das ist nicht unser Problem. Damit haben wir nichts zu tun.«
»Wie bitte?«, meldete sich wieder Puck. »Ich muss Euch darauf hinweisen, dass Ihr mich an den Händen gefesselt habt und Ihr mich gerade gnadenlos einem Schicksal zuführt, das ich nicht verdiene. Es ist Euer Pferd, nicht das von Maribor oder das des Universums oder der Natur, und mit einem blöden Spatzen hat es schon mal gar nichts zu tun.«
»Acht Goldtaler.« Royce sah Hadrian unverwandt an. »Sprich die beiden Wörter laut aus. Wiederhole sie so oft, bis die Labertasche hinter uns nicht mehr zu hören ist.«
Hadrian wirkte nicht überzeugt.
»Gut, dann versuche es so: Wir haben Baron Hildebrandt versprochen … wir haben ihm unser Wort gegeben, dass wir Puck fangen und zu ihm zurückbringen.« Royce hatte Mühe, die Worte mit unbewegter Miene herauszubringen.
Als Hadrian nur ernst nickte, musste er sich auf die Lippen beißen, um nicht loszulachen. Sie waren jetzt seit drei Jahren zusammen unterwegs, arbeiteten offiziell als ein Unternehmen namens Riyria, das man für verschiedene gröbere, nicht gerade legale Arbeiten mieten konnte – und Hadrian glaubte immer noch, man müsse Versprechen halten. Er war jung, Anfang zwanzig, hatte aber in mehr als nur einem Krieg gekämpft und Royce konnte nur staunen, wie weltfremd er immer noch war.
Puck richtete seine Aufmerksamkeit auf Royce. »Mehr ist mein Leben nicht wert? Nur ein paar lumpige Goldmünzen? Und wenn ich Euch nun mehr biete als das, was Baron Hildebrandt zu zahlen bereit ist? Würde das die Waage in Eurer verkehrten Welt ausgleichen, einer Welt, an der Ihr nicht beteiligt sein wollt, obwohl Ihr die Zügel in der Hand haltet?«
Royce runzelte die Stirn. »So viel Geld habt Ihr nicht. Sonst hätten wir uns schon in Ostmark geeinigt.«
»Ich könnte es beschaffen.«
»Nein, könnt Ihr nicht. Ihr seid Dichter. Dichter verdienen nichts, und sie sparen ganz gewiss nicht für schlechte Zeiten. Ihr verschwendet Euer Geld für unnütze Dinge – wie zum Beispiel Eure Kleider.«
»Stimmt, aber ich habe auch nicht von meinem Geld gesprochen«, sagte Puck. »Ich schwöre, dass ich Beatrix nicht angefasst habe, aber ich habe in meiner Zeit mit einigen vornehmen Damen geschäkert. Einige haben mich recht lieb gewonnen. Ich bin überzeugt, Frau von Martel würde zehn Goldtaler zahlen, um mir das Leben zu retten.«
»Frau von Martel? Meint Ihr Baron Hemleys Frau?«, fragte Royce.
»Ebendiese.«
Royce lächelte. »Ich bezweifle, dass Eure Fähigkeiten im Bett zehn Goldtaler wert sind.«
»Ihr missversteht mich. Meine Beziehung zu ihr ist von einer anderen Art. Ich meine, ich hätte mit ihr schlafen können. Sie sieht zwar auch nicht so toll aus, ist aber wenigstens geistig anregend und findet das auch von mir. Ich bin sicher, zehn Taler wären für sie ein kleiner Preis, um den Fortbestand unserer Gespräche zu sichern. Unsere Verwandtschaft beruht auf unserer gemeinsamen Liebe zum geschriebenen Wort. Erst letzten Sommer habe ich eine ganze Nacht bei ihr verbracht, sogar in ihrem Schlafzimmer, und nur getrunken und ihre Bibliothek erkundet.«
»Ist das ein beschönigender Ausdruck für etwas anderes oder sprecht Ihr tatsächlich von Büchern?«, fragte Royce.
»Ah, Ihr habt also davon gehört! Ja, von Büchern. Frau von Martel hat viele Interessen und eine kleine Bibliothek, die unmittelbar an ihr Schlafzimmer grenzt. Sie besitzt Exemplare von Beringers Lied und den Pilgergeschichten, was eindrucksvoll ist, aber auch wieder nicht so ungewöhnlich. Das interessanteste Werk in ihren Regalen ist ein merkwürdiges kleines Tagebuch.«
Royce zügelte abrupt sein Pferd und drehte sich im Sattel um. »Sie hat Euch ihr Tagebuch gezeigt?«
Puck hob erschrocken den Kopf. Royce hatte nicht drohend klingen wollen, konnte seine Wirkung aber nur schwer kontrollieren.
»Gut, ja, es war nicht ihr Tagebuch. Es gehörte einem Typen namens Falkirk de irgendwas, der eine wunderschöne Handschrift hat und einen altertümlichen Schreibstil. Frau von Martel meinte, sie hätte es gestohlen, aber ich bezweifle das. Ich meine, wer hätte je von einer Adligen gehört, die stiehlt? Sie war damals ziemlich betrunken, deshalb habe ich ihre Worte nicht ernstgenommen.«
»Hat sie gesagt, wo sie diesem Falkirk begegnet ist?«, fragte Royce.
»Nein, sie hat es gar nicht von ihm, sondern von einem Mönch, mit dem sie ein Schäferstündchen hatte. Eines Nachts, als er schlief, entdeckte sie das Tagebuch und nahm es an sich, weil sie mehr über seine wirklichen Gefühle für sie erfahren wollte. Erst später merkte sie, dass das Tagebuch von diesem Falkirk stammte. Sie wollte es zurückgeben, aber da war der Mönch schon verschwunden. Sie sah ihn nie wieder.«
»Ihr sagtet, der Stil sei altertümlich. Habt Ihr es also gelesen?«
Puck nickte. »Zumindest versucht. Es hat mich ehrlich gesagt gelangweilt. Warum interessiert Euch das so?«
Royce schwieg und Hadrian antwortete an seiner Stelle: »Wir übernehmen ganz verschiedene Arbeiten. Eine war es, dieses Tagebuch von Frau von Martel zu beschaffen. Danach behauptete sie, es sei gar nicht entwendet worden. So etwas lässt Royce nicht zur Ruhe kommen. Er sieht überall Verschwörungen und böse Absichten.«
Royce fixierte Vergil. »Was kann …«
Pferdegetrappel lenkte ihn ab. Acht Reiter kamen auf sie zu. Sie trugen weiße Wappenröcke über Kettenhemden und Schwerter, die klappernd an ihre Schenkel schlugen. Als sie näher kamen, wurden sie langsamer, machten aber keinen feindseligen Eindruck. Royce und Hadrian hatten an diesem Vormittag schon ein Dutzend Reisegruppen überholt, oder sie waren von anderen überholt worden, darunter Bauern, Händler und Kaufleute. Dies war die erste Gruppe mit Schwertern und die Wappenröcke wirkten offiziell. Solche Patrouillen bedeuteten gewöhnlich Ärger, aber diesmal waren Royce und Hadrian ausnahmsweise nicht im Begriff, ein Gesetz zu brechen, sondern sie handelten im Auftrag eines geachteten Adligen von Melengar. Trotzdem spannte Royce unwillkürlich seine Muskeln an.
»Entschuldigt die Störung«, sagte der Anführer der Reiter und brachte sein Pferd zum Stehen. Er trug keinen Helm, die Bartstoppeln in seinem Gesicht waren erst einen Tag alt und er lächelte. Royce wusste nicht, was er von ihm halten sollte. »Darf ich fragen, wie Ihr heißt?«, fuhr der Reiter fort. »Und warum Ihr diesen Mann gefesselt auf der Straße des Königs mit Euch führt?«
Royce zögerte aus einem Dutzend Gründen, unsicher, ob einer davon gut oder gar vernünftig war. Er mochte es einfach nicht, angehalten zu werden. Und Fragen zu beantworten, mochte er noch weniger.
Sein Partner füllte die Pause. »Ich bin Hadrian. Wie geht es Euch?«
»Ausgezeichnet«, sagte der Mann. »Wie heißt der?« Er zeigte auf den Gefangenen.
»Ich bin Vergil.«
»Ach ja?« Der Reiter nickte, stieg ab und trat Puck gegenüber. »Habt Ihr auch einen Nachnamen?«
»Puck. Vielleicht können die Herren mir helfen. Diese beiden Burschen scheinen einem Missverständnis aufzusitzen. Sie werfen mir vor, ich hätte mich der Baronesse Beatrix Hildebrandt unsittlich genähert – was ich keineswegs getan habe. Ich werde fälschlich angeklagt. Wenn Ihr mir …«
Der Mann im Wappenrock zog ohne Vorwarnung sein Messer und stach es Puck in die Brust. Bevor Vergil noch einen Schrei ausstoßen konnte, ging er schon zu Boden.
Royce und Hadrian wichen zurück, während ihre Pferde nervös tänzelten und wieherten. Auch sie zogen ihre Waffen. Hadrian griff nach seinem Anderthalbhänder, Royce nach seinem weißen Dolch Alversten. Hadrians scheuendes Pferd zog Pucks Leiche von seinem Mörder weg und hinterließ dabei eine blutige Spur. Der Mann wirkte vollkommen ungerührt. Er zog ein Taschentuch heraus und wischte das Blut von sich und seinem Messer ab.
Vergil röchelte gurgelnd und zuckte, aber nur wenige Male. Der Dichter war sofort tot gewesen, als die Klinge sein Herz durchbohrt hatte. Es schien nur ein Weilchen zu dauern, bis die Nachricht alle Teile seines Körpers erreichte.
Royce und Hadrian warteten, aber keiner der anderen Reiter griff zur Waffe. Der Mann, der Puck getötet hatte, steckte sein Messer ein und stieg wieder aufs Pferd.
»Warum habt Ihr das getan?«, wollte Hadrian mit erhobenem Schwert wissen.
»Befehl des Königs«, erwiderte der Mann gelassen. Sein Blick fiel auf Hadrians Schwert, und er lächelte belustigt. »Hat nichts mit Euch beiden zu tun.«
Hadrian sah Royce an und dann wieder den Mann. »König Amrath hat den Tod von Vergil Puck angeordnet?«
Der Mann blickte auf die Leiche hinunter, die jämmerlich am Straßenrand lag und immer noch mit dem Seil an Hadrians Sattel festgebunden war. Er zuckte mit den Schultern. »Sicher, warum nicht?« Dann trat er seinem Pferd in die Flanken, und der Trupp setzte sich in Bewegung und ritt davon.
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit trafen Royce und Hadrian in der Schiefen Straße ein.
Sie wären früher gekommen, aber Hadrian hatte unbedingt noch für Pucks Beerdigung sorgen wollen. Royce, der schon einige Orte mit Leichen verunziert oder auch verziert hatte, konnte seiner Logik nicht folgen. Warum sollten sie die Sauerei beseitigen? Für die Leiche war – nachdem sie sie von Hadrians Pferd losgebunden hatten – die Natur zuständig. Sie waren an Pucks Tod nicht schuld, warum also damit Zeit verschwenden, die Überreste zu entsorgen, von den Kosten ganz zu schweigen? Aber Hadrian stand mit der Logik manchmal auf Kriegsfuß oder, vielleicht genauer, er hatte seine eigene Logik, die Royce nicht verstand und nach drei Jahren auch nicht mehr zu verstehen hoffte.
Die Schiefe Straße war ein Morast mit einem Dutzend Tümpeln und tiefen Wagenspuren. In der schattigen Ecke zwischen dem Laden des Gerbers und der DORNIGEN ROSE hielt sich außerdem noch ein schmutziger Fleck grauen Schnees. Aber die Dächer waren frei, und das MEDFORDHAUS leuchtete mit seinem frischen blauen Anstrich wie eine Blume im Frühling. Die letzten Sonnenstrahlen fielen auf die Veranda des Bordells, das in letzter Zeit zunehmend wie ein vornehmes Hotel aussah.
»Geduld ist nicht ihre Stärke, was?«, sagte Hadrian. »Ich dachte, sie wollte auf wärmeres Wetter warten.«
Die Haustür ging auf, und Gwen DeLancy trat auf die Veranda. Sie trug ein Kleid in fast demselben Blau wie die Farbe des Hauses. Vermutlich war das Absicht, dachte Royce. Er hatte das Kleid immer gemocht, aber nicht wegen der Farbe. Gwen lächelte und breitete stolz die Arme aus. »Na, was meint ihr? Sie haben erst heute angefangen und sind noch nicht weit gekommen, nur diese eine Wand. Aber ist es nicht eine herrliche Farbe?«
»Es ist Blau«, sagte Hadrian. »Wäre eine andere Farbe nicht besser fürs Geschäft? Also zum Beispiel Rosa?«
»Aber nein, es muss Blau sein!«, erwiderte Gwen ungeduldig. »Das MEDFORDHAUS sollte von Anfang an blau sein. Es hat nur eine Weile gedauert, bis ich das Geld dafür zusammenhatte.«
Hadrian nickte. »Sieht teuer aus.«
Die beiden stiegen ab. Die Pferde brauchten sie nicht anzubinden. Die Tiere kannten das Prozedere schon und warteten geduldig darauf, dass man ihnen die Sättel und Taschen abnahm.
»Das ist sie auch.« Gwen legte die Arme an und vollführte eine halbe Drehung, um das Haus zu bewundern, das sie gebaut hatte. Ihr Rock blähte sich auf, und sie zog die Schultern hoch, um sich vor dem kalten Wind zu schützen. Sie war barfuß, hatte das Gewicht auf ein Bein verlagert und das andere angewinkelt.
Royce sah sie unverwandt an und wünschte sich, die Zeit möge stehenbleiben.
»Royce?«, fragte Hadrian.
»Was?«
»Deine Satteltaschen.«
»Was ist mit ihnen?«
»Du hast sie in den Morast gestellt. Sie werden schmutzig.«
Royce blickte hinunter. Die Taschen waren irgendwie im Morast gelandet, einer Mischung aus Mist und Schlamm. »Igitt!«, rief er voller Abscheu, packte sie und stellte sie auf die Treppe. »Wie sind die da hingekommen?« Er sah Hadrian anklagend an.
»Sieh mich nicht so an. Das warst du selbst.«
»Sei nicht albern. Warum sollte ich das tun?«
»Habe ich mich auch gefragt. Deshalb habe ich dich ja darauf hingewiesen.«
Royce betrachtete die Taschen missmutig, als seien sie irgendwie dafür verantwortlich.
»Vielleicht hat die schöne neue Farbe dich abgelenkt«, sagte Gwen und drehte sich zu ihnen um. Wieder blähte sich ihr Rock. Die Sonne fiel auf ihr Gesicht mit den schwarz umrandeten Augen, und auf ihren glänzenden Lippen lag ein bescheidenes Lächeln.
Hadrian schnaubte belustigt. »Bestimmt war es das.« Er stellte seine Satteltaschen ebenfalls auf die Verandatreppe und nahm Royce’ Zügel. »Geht schon mal rein. Ich versorge die Pferde.«
Gwen schüttelte den Kopf. »Das brauchst du nicht. Ich sage Dixon, er soll sich darum kümmern. Albert wartet drinnen.«
»Ach ja?« Hadrian wechselte einen verwirrten Blick mit Royce.
Gwen nickte. »Und zwar bestens gelaunt. Sagt, ihr wärt bezahlt worden.«
»Bezahlt? Wofür?«, fragte Royce.
Gwen zuckte ihre überwiegend nackten Schultern, und Royce hätte sie am liebsten gleich noch einmal gefragt. »Vermutlich für den Auftrag, den ihr gerade erledigt habt.«
»Das verstehe ich nicht.« Royce sah Hadrian an. »Du etwa?«
»Vielleicht solltet ihr mit ihm sprechen«, meinte Gwen.
Hadrian begann die Stufen hinaufzusteigen, aber Royce rührte sich nicht. Tage waren vergangen, seit er Gwen zuletzt gesehen hatte, und er wollte sie einfach nur ansehen, die ganze Zeit mit ihr zusammen sein. Dieses Bedürfnis war nicht normal, sah ihm überhaupt nicht ähnlich. Er fühlte sich unbehaglich. Offenbar war Gwen noch eine viel bessere Diebin als er. Sie konnte einen ganzen Menschen stehlen, hatte sein altes Selbst geklaut, es ihm weggenommen wie eine Geldbörse, auf die er nicht aufgepasst hatte. In ihrer Gegenwart war alles anders. Verwirrend anders, denn er empfand sowohl Erregung wie inneren Frieden. Die Verwandlung machte ihn nachdenklich. Ging es ihm damit besser oder schlechter? Hatte er sich verloren oder ein besseres Ich gefunden?
»Kommt doch rein«, sagte Gwen. »Hier draußen wird es kalt, und Albert will wahrscheinlich mit euch beiden reden.«
Acht Goldtaler. Acht! Royce betrachtete die gelb glänzenden Scheiben mit dem aufgeprägten Bild Amraths. Oder vielleicht handelte es sich auch um den Vater des Königs. Die beiden sahen einander offenbar ähnlich, oder vielleicht auch nicht und der Schatzmeister des Königs hatte es sich einfach gemacht und den Münzer nur einige kleine Veränderungen an den alten Prägestöcken vornehmen lassen. Egal. Entscheidend war, dass sie echt waren und acht an der Zahl. Royce, Hadrian und Vicomte Albert saßen im Dunkelzimmer, so genannt, weil es keine Fenster hatte und dort Geschäfte abgewickelt wurden, die das Tageslicht scheuten. Albert hatte die Münzen auf den Tisch geschüttet, sich dann auf den dem Kamin nächsten Stuhl gesetzt und die bestrumpften Füße in Richtung Feuer gestreckt. Auf seinem Gesicht lag ein zufriedenes Lächeln.
»Das verstehe ich nicht«, sagte Royce.
»Es ist nicht schwer zu verstehen, wir wurden bezahlt.« Albert zeigte mit einer theatralischen Geste auf das Geld. Der Vicomte hatte zu dem Zeitpunkt, als er der Verbindungsmann der beiden zum Adel geworden war, praktisch alles außer seinem Titel verloren. Die herablassende und unbekümmerte Art derer, die ohne Furcht vor einem natürlichen Feind leben, hatte er allerdings beibehalten.
Hadrian stellte seine Satteltaschen ab und setzte sich ebenfalls ans Feuer. »Aber wir haben den Auftrag nicht zu Ende geführt. Wir haben Puck nicht einmal nach Sansbury zurückgebracht. Ein Trupp von Reitern hat ihn auf der Straße des Königs getötet.«
Albert schob nachdenklich die Lippen vor und machte schließlich eine abschätzige Handbewegung. »Baron Hildebrandt war ganz offensichtlich mit dem Ergebnis zufrieden. Er wollte den armen Kerl wahrscheinlich sowieso hinrichten, und Ihr habt ihm die Mühe erspart.«
Hadrian zog seinen Stuhl neben Albert und den Tisch mit den Münzen, nahm eine und wendete sie in den Fingern hin und her. »Aber woher …?« Er sah Royce an. »Er kann unmöglich schon wissen, dass Vergil tot ist.«
»Natürlich kann er das.« Albert beugte sich vor und runzelte verärgert die Stirn, als stelle Hadrian seine Leistung infrage. Er zupfte wie ein sich putzender Pfau an den Spitzenmanschetten seiner berüschten Ärmel. »Die Männer, die ihn getötet haben, arbeiten vermutlich für Hildebrandt. Sie sind zu ihm zurückgekehrt, haben die vollbrachte Tat gemeldet und …«
»Puck ist nördlich von hier gestorben, unweit der Abzweigung der Südstraße von der Straße des Königs. Das ist fünfundzwanzig Meilen von Sansbury entfernt.« Royce, der noch stand, schüttelte den Kopf. »Da hätte jemand schon erstaunlich schnell reiten müssen, um jetzt schon dort zu sein. Und dann müsste er ja auch noch … Wann wurdet Ihr bezahlt, Albert?«
»Heute am frühen Morgen.«
Royce und Hadrian sahen einander verwirrt an.
»Heute Morgen?«, wiederholte Hadrian. »Da hat Puck noch gelebt. Wir haben einen netten kleinen Spaziergang von Ostmark aus gemacht.«
Albert, dem allmählich die Wahrheit dämmerte, hob die Augenbrauen. »Also das … ist schon ziemlich seltsam.«
»Wer hat Euch bezahlt, Albert?«, fragte Royce.
Der Vicomte setzte sich auf, zog seine Füße unter den Stuhl und rückte seine Weste gerade. »Baronin Constance. Wir haben uns heute Morgen in Tildens Teestube auf dem Platz des Hohen Viertels getroffen. Wunderbar gemütlich und direkt neben der Bäckerei gelegen, man bekommt also …«
»Constance?«, sagte Royce laut. Der Name kam ihm bekannt vor, und er fühlte sich wie ein Jagdhund, der zum zweiten Mal an einer Fährte schnuppert. »Den Namen habe ich schon gehört.«
Hadrian nickte. »Ich auch. Albert hat sie ein paarmal erwähnt.«
»Richtig, das habe ich. Ich bekomme die meisten unserer Aufträge über sie. Neben ihr wirken die anderen Hofdamen wie Mauerblümchen. Diese Frau kennt alle, und alle kennen sie. Sie stammt aus Warric und hat Verbindungen nach Maranon, bevorzugt aber die Feste hier in Melengar.«
»Hat sie uns nicht für den Auftrag auf Gut Hemley engagiert?«, fragte Royce. »Wo es um das Tagebuch von Frau von Martel ging?«
Albert nickte.
»Aber sie wollte das Tagebuch nicht für sich selbst?«
»Meines Wissens nein. Genauso wie ich Euch vertrete, vermittelt die Baronin für ihre Leute … äh, Kundinnen … hm, Freundinnen … wie immer man sie nennen will. Sie hat zwar nichts gesagt, aber ich vermute, dass sie etwas auf unser Honorar aufschlägt und das dann für sich behält. Sie muss ja auch von etwas leben.«
»Sie ist doch eine Adlige?«
»Schon, aber ich war auch in Not, als wir uns kennengelernt haben, Ihr müsstet also wissen, dass nicht alle Adligen reich sind. Sie war mit Baron Linder von Maranon verheiratet. Warum, könnte sie vermutlich nicht einmal selbst sagen. Er hatte kein Land, war nicht wohlhabend und nicht einmal besonders attraktiv.«
»War? Er lebt nicht mehr?«
»Nein. Neben seinen anderen Defiziten konnte er offenbar auch nicht mit einer Lanze umgehen. Er wurde schon ein halbes Jahr nach der Hochzeit bei einem Turnier zu Wintertid von Ritter Gilbert von Lyle getötet. Wie die Baronin sich jetzt einen so aufwendigen Lebensstil leisten kann, ist allen bei Hof ein Rätsel und Gegenstand vieler Spekulationen.« Albert machte eine nachdenkliche Pause. »Ich wüsste ja gern, was für Gerüchte über mich umgehen.« Er wischte die Frage mit einer Handbewegung beiseite. »Jedenfalls hat sie sich für ihre Bekanntschaften wohl so nützlich gemacht wie ich mich für Euch.«
»Ihr habt sie nie danach gefragt?«
Albert wirkte entsetzt und gekränkt zugleich. »Bei Maribor, nein! Genauso wenig, wie sie mich nach meinen Geschäften fragt. Wir wollen nichts über die Angelegenheiten des anderen wissen, und das macht unsere Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern zu einem Vergnügen.«
»Ihr habt mit ihr geschlafen«, sagte Hadrian. Es klang weder anklagend noch billigend, sondern war lediglich eine Feststellung.
Albert lächelte verschmitzt. »Wir sind nicht nur nicht neugierig, sondern frei von Moralvorstellungen, und wir teilen eine Abneigung gegen lästige Bindungen. Aber diese Leere füllt eine gesunde sinnliche Begierde. Es ist ein wunderbares Arrangement, wir ergänzen uns auf das Schönste.«
Royce, der immer noch seine Satteltaschen in der Hand hielt, sah sich nach einem Platz um, an dem er sie abstellen konnte. Da die Unterseiten der Taschen noch voller Schmutz waren, stellte er sie schließlich auf den Herd neben dem knisternden Feuer. »Ihr wisst also nicht, wer uns eigentlich beauftragt hat, das Tagebuch zu stehlen?«
»Nein, leider nicht.«
»Und Vergil Puck?«
»Der ist eine ganz andere Sache. Natürlich steckt Baron Hildebrandt dahinter. Sonst wäre es ja schrecklich peinlich gewesen, mit Puck bei ihm aufzutauchen und …« Alberts Blick bekam einen abwesenden Ausdruck, während er die Teile des Puzzles zusammenfügte.
Er war ein exzellenter Vermittler, gutaussehend und in allen Feinheiten der Etikette bewandert, die man brauchte, um die gefährlichen Gewässer der Aristokratie von Avryn zu befahren. Er war tüchtig und beredt, litt aber an der Krankheit aller Adligen, einer Abstumpfung der Sinne, die auf zu viele Privilegien zurückzuführen war. Haustiere hatten dieselbe Störung. Von einem Hund, der in einem Haus aufgewachsen war, konnte man nicht erwarten, dass er sich in der Wildnis zurechtfand, genauso wenig wie von einer Kuh oder einem Huhn. Haustieren fehlte ein grundsätzlicher Instinkt, die ständige Angst vor der möglichen Katastrophe, die ihren weniger verhätschelten Artgenossen das Überleben ermöglichte. Royce wusste, was dem zutiefst erschütterten Albert gerade durch den Kopf ging: Nein … so was passiert den anderen, nicht mir.
»Also hat Puck die Wahrheit gesagt. Er hatte nichts mit Beatrix Hildebrandt zu tun. Ich bin in dieser Hinsicht wohl ein besserer Menschenkenner als du.« Hadrian lächelte strahlend, allerdings verging ihm das Lächeln schnell wieder. Vermutlich in dem Moment, dachte Royce, in dem seinem Partner klar wurde, dass er dazu beigetragen hatte, einen Unschuldigen zu töten.
Royce wusste es besser. Puck war nicht unschuldig, niemand war das. Er hatte irgendjemandem etwas angetan, und Royce wollte nur wissen, ob dieses Etwas Auswirkungen auf ihn haben könnte.
»Wer hat Vergil also töten lassen und warum?«, fragte Hadrian.
»Das werden wir nie herausfinden«, sagte Royce. »Es wäre wie ein doppelter Blindversuch. Oder ein vierfacher, wenn man Albert und Constance dazuzählt. Wir haben den Dichter unter einem falschen Vorwand festgenommen, der nicht so abwegig war, dass er Verdacht erregt hätte – nicht einmal bei jemandem wie mir. Dann wurde eine zweite Gruppe engagiert, um ihn zu ermorden, und sie bekam wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte zu hören. Deshalb wäre es sehr schwer, die Verantwortlichen oder das eigentliche Motiv in Erfahrung zu bringen.«
»Also ich will ja nicht gefühllos sein, was das Ableben von Herrn Puck betrifft, aber …«, Albert betrachtete die Münzen auf dem Tisch, »aber ich brauche unbedingt ein neues Wams und eine neue Hose. Die äußere Erscheinung muss stimmen, und ich …«
»Nur zu.« Royce nickte. »Nimm einen Taler, aber die neuen Kleider müssen warten. Wir müssen Gwen noch für die Nutzung des Zimmers bezahlen und auch die letzten Stallgebühren begleichen.«
»Dann haben wir insofern Glück, als ich schon den nächsten Auftrag beschafft habe.«
»Hoffentlich nicht über Baronin Constance. Diesmal wäre mir etwas Einfacheres lieber. Ein Auftrag, bei dem ich weiß, auf was ich mich einlasse, bevor ich damit anfange.«
»Äh … nein, diesmal kommt er nicht von Constance, aber er ist …« Albert machte eine Pause. »Ungewöhnlich.«
Royce verschränkte die Arme. Davon hatte er genug gehabt. »Inwiefern?«
»Sonst muss ich mich immer erst umhören und nach Aufträgen suchen, aber dieser Mann kam zu mir, oder eigentlich sucht er Euch.« Albert sah Royce vielsagend an.
»Mich?« Der ungewöhnliche Auftrag klang immer weniger verlockend.
Albert nickte. »Er ist im Hohen Viertel abgestiegen. Wollte mir seinen Namen nicht verraten und auch nicht sagen, worum es ging. Er meinte nur, er würde es wissen, wenn Ihr wieder da seid, und dann vorbeikommen.«
»Er würde es wissen?«
Albert nickte. »Das waren seine Worte.«
»Na, da wird mir ja richtig warm ums Herz. Hat er gesagt, woher er weiß, dass ich in Melengar lebe, oder woher er mich kennt?«
»Nein, er sagte nur, er sei aus Colnora und auf der Suche nach …« Albert überlegte. »Es war ein seltsamer Name, ich musste dabei an etwas Glänzendes denken. Von Riyria sprach er nicht, aber als ich es tat, kannte er das Wort. Hm, wenn ich mich doch an den Namen erinnern könnte.« Er runzelte die Stirn und dachte angestrengt nach.
»Keine Sorge deswegen«, sagte Royce und wünschte, er hätte den Rat selbst beherzigen können. Aber er wusste ganz genau, dass der Fremde aus Colnora ihn Brilli genannt hatte.
3
Der Whiskey-Baron
Es dauerte nur wenige Stunden, bis der geheimnisvolle Mann in der DORNIGEN ROSE auftauchte. Davor hatten sie noch Zeit für ein Bad und eine warme Mahlzeit. Hadrian leerte zwei Krüge Bier, Royce dagegen wollte lieber einen klaren Kopf behalten. Sonst entspannte er sich nach einem Auftrag mit einem oder zwei Gläsern Montemorcey, und es ärgerte ihn, dass der Wein diesmal warten musste. Albert hatte Gwen veranlasst, den möglichen Kunden in die Rautenstube zu bringen und keine anderen Gäste hereinzulassen, damit sie ungestört waren.
Der Fremde, ein älterer Mann mit grauen Haaren und einem zerklüfteten Gesicht wie eine Meeresklippe, setzte sich in den hinteren Teil. Er war nicht groß. Wenn er stand, dachte Royce, etwa so groß wie er selbst. Dafür war er umso breiter, mehr als stämmig und auch mehr als beleibt. Der Stuhl verschwand unter ihm, und die Nähte seiner Reisekleider waren zum Zerreißen gespannt. Der Kittel, den er trug, war zwiegenäht, das Blumenmuster auf der Brust mit eisernen Nieten besetzt. Über der Lehne des Stuhls neben ihm hing ein schwerer zweilagiger Wollmantel, der neu aussah. Er hatte auch teure kalbslederne Handschuhe, die auf dem Tisch vor ihm lagen und dasselbe Blumenmuster trugen wie sein Kittel. Alles passt zusammen, dachte Royce.
Der Besucher blickte Royce und Hadrian forschend entgegen, als müsste er sich später noch an sie erinnern. Er stand nicht auf und hielt ihnen auch keine Hand hin. Geduldig und ohne ein Wort zu sagen, wartete er, bis Royce und Hadrian sich auf die Hocker ihm gegenüber gesetzt hatten.
Dann wandte er sich an Royce. »Seid Ihr es? Seid Ihr Bril…«
Royce unterbrach ihn mit erhobener Hand. »Ich gebrauche diesen Namen nicht mehr.«
Der Mann nickte. »Wie Ihr meint. Wie soll ich Euch dann nennen?«
»Royce, und mein Gefährte heißt Hadrian.«
Die beiden Männer nickten sich zu.
»Wer seid Ihr?«, fragte Royce.
»Ich bin jemand, der im Jahr der Angst in Colnora gelebt hat.«
Royce ließ seine Hand vom Tisch rutschen. Neben ihm stellte Hadrian seine Füße seitlich neben seinem Hocker flach auf den Boden. Der Alte wirkte in keiner Hinsicht furchterregend, aber der Blick in seinen Augen war unmissverständlich: Er wollte Rache. Und er wollte sie nicht nur, er war gekommen, um sie zu nehmen.
»Ich bin Gabriel Winter.«
Royce kannte den Namen, konnte ihn aber nicht einordnen. Soweit er sich erinnerte, hatte er sich nie mit jemandem namens Winter angelegt.
»Ihr habt Colnora in Angst und Schrecken versetzt. Die ganze Stadt war durch Eure Gräueltaten wie gelähmt. Fliegende Händler, Straßenkehrer, Ladenbesitzer, wohlhabende Geschäftsleute und alle anderen bis hinauf zum Stadtrat waren in Panik. Sogar der tapfere Graf Simon floh in diesem Sommer nach Aquesta. Was der Moral nicht gutgetan hat, kann ich Euch sagen.« Das Doppelkinn des Mannes zitterte beim Sprechen, aber sein Blick blieb fest und seine Stimme gefasst und ruhig. Seine beiden Hände mit den zehn dicken Fingern waren die ganze Zeit zu sehen, lagen neben den Handschuhen und der halb heruntergebrannten Kerze auf dem Tisch. Zwischen Royce und Winter war nur die Tischplatte, keine Tasse und kein Becher – der Mann hatte nichts zu trinken bestellt.
In der Rautenstube kehrte Stille ein. Der Raum gehörte nicht zum ursprünglichen Wirtshaus, sondern war wegen der wachsenden Beliebtheit der Schenke erst vor Kurzem angebaut worden. Er füllte den länglichen Platz zwischen der DORNIGEN ROSE und dem MEDFORDHAUS aus, weshalb das Zimmer Rautenstube hieß. Die einzigen Geräusche kamen von den beiden Schankmägden, die im anderen Gastraum Becher abspülten.
»Was wollt Ihr?«, fragte Royce. Er schob die Finger in seinen Mantel und schloss sie um den Griff von Alversten.
»Ich möchte Euch engagieren.«
Das war natürlich zu erwarten gewesen, schließlich hatte Albert von einem potenziellen Kunden gesprochen. Aber die Begegnung war bisher alles andere als beruhigend gewesen. »Mich engagieren?«
»Ja«, antwortete der Mann ganz ruhig, und ein Lächeln spielte um seine Lippen, als wüsste er um ein Geheimnis oder die Pointe eines Witzes, den noch niemand kannte.
»Um was zu tun?«
»Dasselbe, was Ihr in Colnora getan habt. Nur dass diesmal die Stadt Rochelle bluten soll.«
Hadrian setzte sich anders hin und stellte die Füße auf die Zehenspitzen. »Warum?«
Der Mann stieß sich vom Tisch ab und verschränkte die Arme über seiner Brust, als müsste er überlegen, was er als Nächstes sagen sollte, oder vielleicht auch nur, um den Mut zu sammeln, es zu tun. Manche Dinge kosteten Überwindung. Royce wusste das sehr gut, und aus dem elenden Gesichtsausdruck des Mannes schloss er, dass er das, was er gleich sagen würde, womöglich zum ersten Mal in Worte fasste.
»Meine Frau ist vor zehn Jahren gestorben. Seitdem bin ich mit meiner Tochter allein. Ein braves Mädchen, meine Genny, eine treue Seele, fleißig, blitzgescheit und zäh. Wir zwei sind gut miteinander klargekommen. Sie brachte mich durch die schweren Zeiten, von denen es viele gab. Aber vor weniger als vier Monaten brannte sie mit einem Adligen aus Rochelle durch. Einem Burschen namens Leo Hargrave.«
Hadrian beugte sich vor. »Leopold Hargrave?«
»Genau der.«
Royce sah Hadrian fragend an.
»Er ist der Herzog von Rochelle. Das liegt in Alburn, südöstlich von hier. Ich habe da drunten in König Reinholds Armee gedient, bevor ich nach Calis gegangen bin.«
»Reinhold ist tot«, sagte Winter.
»Der König von Alburn ist gestorben?«
»Er und seine ganze Familie. Bischof Tynewell wird beim kommenden Frühlingsfest einen neuen König krönen. Genny hat mir das geschrieben. Sie hat mir seit der Hochzeit dreimal in der Woche geschrieben. Und dann plötzlich nichts mehr.« Der Mann runzelte die Stirn und senkte den Blick auf die Tischplatte. Mit dem Daumennagel kratzte er an einer abgenutzten Stelle und versuchte, einen Splitter abzuziehen.
Royce nickte. »Und? Glaubt Ihr, sie ist tot?«
»Ich weiß es.«
»Weil sie keine Briefe mehr schreibt?«, fragte Hadrian. »Sie hat eben erst geheiratet, wohnt in einer neuen Stadt, einer ganz anderen Stadt, und ist jetzt Herzogin. Vielleicht ist sie einfach nur zu beschäftigt. Oder sie hat Briefe geschrieben, aber der Kurier ist im Schnee verloren gegangen. Es ist noch nicht Frühling, und die Bergpässe können tückisch sein. Euer Schluss ist voreilig.«
Gabriel Winter sah ihn fest an. »Ich habe einen Brief bekommen, aber nicht von meiner Genny. Hargrave hat mir geschrieben und mitgeteilt, sie sei verschwunden.«
»Gut, verschwunden ist … ist auch nicht gut, aber es heißt noch nicht, dass sie tot ist.«