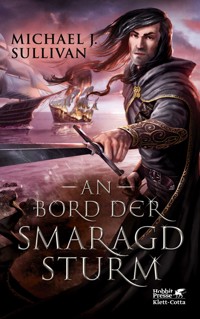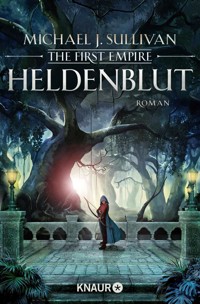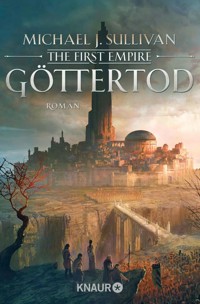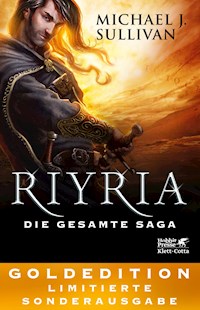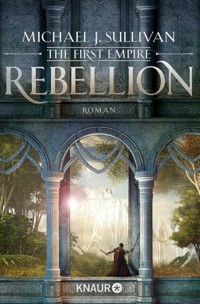9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Serie: Zeit der Legenden
- Sprache: Deutsch
Einigkeit oder Untergang – die Rebellion gegen die falschen Götter wird zur Zerreißprobe Immer auswegloser erscheint der Aufstand der Menschen gegen ihre falschen Götter, die Fhrey. Die Magie des Feindes ist zu mächtig, die Clans der Menschen zu zerstritten. Da fasst Stammesführerin Persephone einen verzweifelten Plan: Sie will die Hilfe eines Volkes erbitten, das wie kein zweites die Kunst des Waffenschmiedens beherrscht. Doch die Dherg, vor langer Zeit unter die Erde vertrieben, knüpfen ihre Hilfe an eine unmögliche Bedingung. Persephone soll den Dämon vertreiben, der in den Tiefen der verlassenen Stadt lauert, älter und grauenhafter als die Zeit selbst … "The First Empire" geht in die zweite Runde: mit "Zeitenfeuer" kehren die Leser in die Welt der falschen Götter von Bestseller-Autor Michael J. Sullivan zurück. "Epische Fantasy aus der Feder eines meisterhaften Geschichtenerzählers" - The Library Journal Der Amerikaner Michael J. Sullivan, Autor der »Riyria-Chroniken«, hat mit »The First Empire« erneut ein mitreißendes High-Fantasy-Epos um wahren Mut, große Kämpfe und bitteren Verrat geschaffen. Die High-Fantasy-Saga ist in folgender Reihenfolge erschienen: • »Rebellion« • »Zeitenfeuer« • »Göttertod« • »Heldenblut« • »Drachenwinter«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 874
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Michael J. Sullivan
Zeitenfeuer
The First Empire II – Roman
Aus dem Englischen von Marcel Aubron-Bülles
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Immer auswegloser erscheint der Aufstand der Menschen gegen ihre falschen Götter, die Fhrey: Zu mächtig sind die magischen Waffen des Feindes, zu zerstritten die Clans der Menschen. Da fasst der junge Revolutionsführer Raithe einen verzweifelten Plan: Er schickt drei seiner wichtigsten Verbündeten, unter ihnen die seherisch begabte Suri, auf eine gefährliche Reise. Sie sollen die Hilfe eines Volkes erbitten, das wie kein zweites die Kunst des Waffenschmiedens beherrscht. Doch die Dherg, vor langer Zeit unter die Erde vertrieben, haben für die Menschen ebenso wenig übrig wie für die Fhrey …
Inhaltsübersicht
Der Sturm
Riesige Probleme
Der Feuerkreis
Rapnagar
Kleine Lösungen
Der Prinz
Der Weg nach Tirre
Der Ritt der Steingöttin
Unter der Rosenbrücke
Etwas, woran man glauben kann
Unter der Wolle
Die Ratsversammlung von Tirre
Der Weg über die Brücke
Der Albtraum
Caric
Lang vergangen
Gronbach
Die Wahl von Schwert und Schild
Neith
Verrat
Gesichtsverlust
Die Agave
Die Gula-Rhunes
Balgargarath
Makareta
Die Herausforderung
Kampf mit dem Dämon
Der Schrittweise Tod
Nachspiel
Das Wesen der Zwerge
Der Keenig
Der Plan
Glossar
1
Der Sturm
Viele glauben, dass die erste Schlacht des Großen Kriegs in Grandford stattfand, zu Beginn des Frühlings, aber in Wahrheit erfolgte der erste Angriff an einem Sommertag in Dahl Rhen.
– Das Buch Brin
»Sind wir sicher?«, rief Persephone zu der Eiche hinauf.
Magda war der älteste Baum im Wald, wuchtig und majestätisch zugleich. Vor ihr zu stehen war wie der Blick auf einen Ozean oder einen hohen Berg – in beiden Fällen fühlte sich Persephone klein. Ihr wurde bewusst, dass ihre Frage zu schlicht, zu ungenau formuliert sein könnte, und fügte hinzu: »Was müssen wir noch tun, um mein Volk vor den Fhrey zu schützen?«
Persephone wartete auf eine Antwort.
Eine Brise kam auf, die den Baum schüttelte, und ein großer Ast fiel herunter.
Persephone sprang zur Seite, kurz bevor er neben ihr aufschlug. Der Ast, der aus großer Höhe herabgefallen war, hatte sie nur um wenige Zentimeter verfehlt und hätte sie mit Sicherheit getötet. Abgebrochene Äste, die hoch oben im dichten Laubdach hingen, nannte man Witwenmacher. Da Persephone bereits ihren Ehemann verloren hatte, schien es sich bei dem toten Holz neben ihr um ein besonders ehrgeiziges Exemplar zu handeln.
»Was will sie mir damit sagen?«, fragte Persephone Suri.
Die junge Seherin mit dem weißen Wolf warf einen Blick auf den Ast und zuckte die Achseln. »Ich glaube, das war bloß der Wind. Es fühlt sich an, als ob sich ein Sturm zusammenbraut.«
Als Persephone zum ersten Mal den Rat des großen Baums erbeten hatte, hatten Magdas Worte ihr Volk gerettet. Jetzt stand sie wieder hier und stellte ein weiteres Mal ihre Fragen. Seit ihrem letzten Besuch waren Monate vergangen, und das Leben in Dahl Rhen bewegte sich wieder in seinen üblichen Bahnen. Die Spuren des Kampfes zwischen den Miralyith hatten sie zwar beseitigt, aber Persephone wusste, dass der eigentliche Konflikt dadurch nicht verschwunden war. Es gab immer noch Fragen – Fragen, die weder Mensch noch Fhrey beantworten konnten. Und trotzdem …
Persephone blickte auf den herabgefallenen Ast. Es ist kein gutes Zeichen, dass Magda unser Gespräch damit beginnt, dass sie mich zu zerquetschen versucht.
»Was nicht stimmen?«, fragte Arion. Die Fhrey mühte sich redlich, die Sprache der Rhunes zu lernen. Sie stand neben Suri und Minna und beobachtete die Szene mit großem Interesse. Sie trug den grünen Hut, den Padera für sie gehäkelt hatte. Das grobe, etwas eigenwillige Ding ließ die Miralyith zugänglicher erscheinen, weniger göttlich, vielmehr – menschlich. Arion war mit ihnen gekommen, um das Orakel im Einsatz zu erleben, obwohl Persephone zugegebenermaßen mehr Worte und weniger Einsatz erwartet hatte.
Suri blickte zu dem Baum hinauf. »Weiß nicht.«
»Was will Magda uns sagen?«, rief Persephone Suri zu, um den lauter werdenden Wind zu übertönen.
So sollte es eigentlich ablaufen. Persephone stellte dem Baum Fragen, und die Seherin erläuterte dann seine Antworten, nachdem sie dem Rascheln der Blätter und Äste gelauscht hatte. Aber Arion hatte recht, irgendetwas stimmte nicht. Suri sah perplex aus – das war mehr als bloße Verwirrung. Sie wirkte besorgt.
»Bin mir nicht sicher«, antwortete das Mädchen.
Persephone zupfte sich eine Haarsträhne vom Mund. »Warum nicht? Spricht sie in Rätseln oder ignoriert sie dich einfach?«
Suri verzog frustriert das Gesicht. »Oh, sie redet jede Menge, aber so schnell, dass ich ihre Worte nicht verstehen kann. Sie brabbelt eigentlich nur. Habe sie noch nie so erlebt. Sie wiederholt die ganze Zeit ›Flieht … flieht schnell … flieht weit weg. Sie jagen euch.‹«
»Sie? Wer? Redet sie mit uns? Ist das die Antwort auf meine Fragen?«
Suri schüttelte den Kopf. Ihre kurz geschnittenen Haare flatterten über den Tätowierungen auf ihrer Stirn hin und her. »Nein. Sie hat schon geschrien, bevor du auch nur ein Wort gesagt hast. Ich glaube nicht, dass sie dich gehört hat. Ich bin mir nicht mal sicher, woher Magda das Wort ›fliehen‹ kennt. Mal ganz ehrlich, woher soll ein Baum wissen, was das bedeutet?«
»Willst du mir sagen, dass der Baum hysterisch ist?«
Suri nickte. »Sie fürchtet sich zu Tode. Ich kenne Mäuse, deren Geplapper mehr Sinn ergeben hat. Jetzt spricht sie nicht einmal mehr Wörter, sondern macht nur noch Geräusche.« Suris Augenbrauen zuckten nach oben, ihr Gesicht verzog sich vor Anspannung – zusammengekniffene Augen, zusammengekniffener Mund.
»Was ist los?«, fragte Persephone.
»Es ist nie gut, wenn ein Baum schreit.«
Das hohe Gras peitschte gegen Persephones Beine. Ihr Kleid klatschte laut flatternd auf ihre Haut. Die abgerissenen Eichenblätter verdunkelten die Luft, wie es sonst nur in einem Schneesturm geschah. Persephone konnte den Himmel durch Magdas dichte Laubkrone nicht sehen, aber der Sturm hatte noch an Kraft gewonnen. Als sie unter dem Baum hervortrat, sah Persephone, dass der eben noch wolkenfreie blaue Himmel einem stürmischen Grau gewichen war. Dunkle Wolken schoben sich brodelnd übereinander und verwandelten den helllichten Tag in ein düsteres Zwielicht. Ein seltsamer grüner Schimmer hatte sich über den Wald gelegt und tauchte alles in einen gespenstischen, widernatürlichen Ton.
»Was passiert?«, fragte Arion.
»Baum in Panik«, antwortete Suri.
»Vielleicht sollten wir zum Dahl zurückkehren«, sagte Arion und sah nach oben. »Ja?«
Minna winselte und drängte sich so dicht an Suri, dass sie das Mädchen beinahe umstieß. Die Seherin kniete sich hin, um ihre Wölfin zu beruhigen. »Nicht gut, oder, Minna?«
Arion wirkte nun wesentlich ernster. Sie gab es auf, Rhunisch zu sprechen, und wechselte wieder in ihre Muttersprache. »Wir müssen …« Sie wurde von einem grellen Blitz und ohrenbetäubendem Krachen unterbrochen.
Minna jaulte auf und flüchtete den Abhang hinab.
Persephone schwankte. Das Nachbild des Blitzes hinterließ ein strahlendes, fleckiges Band vor ihren Augen. Sie versuchte es wegzublinzeln, doch ohne Erfolg. Ihre Nase füllte sich mit dem Geruch von brennendem Holz, und sie spürte Hitze, die direkt vor ihr aufflackerte.
Magda brennt!
Arion lag auf dem Rücken zwischen Magdas Wurzeln, beide Hände schützend über den Kopf gehoben. Die Miralyith rief ein einziges Wort – keines, das Persephone wiedererkannte, aber es klang wie ein Befehl. Das Feuer, das die alte Eiche eben noch mit züngelnden Flammen umschlossen hatte, verschwand mit einem lauten Knall. An seine Stelle trat ein furchtbares Zischen und Rauch, der von einem böswilligen Wind gen Himmel gewirbelt wurde. Magdas Stamm war in der Mitte gespalten. Eine hässliche, rußgeschwärzte, klaffende Wunde mit leuchtend roten Rändern, die bei jedem Windstoß aufglühten. Die uralte und erstaunliche Mutter aller Bäume war durch die Hand der Götter getötet worden.
Persephone half Arion auf die Beine.
»Wir müssen fliehen«, sagte die Fhrey.
»Was? Warum?«
Arion packte sie am Handgelenk und zog sie mit sich. »Jetzt!«
Persephones Schädel prickelte, als Arion sie den Hügel hinabzerrte, fort von der Lichtung und hinein in die dichten Schatten des Sichelwaldes. Suri und Minna rannten ihnen ein gutes Stück voraus.
Krack!
Ein Blitz fuhr irgendwo hinter ihnen in die Erde.
Krack! Krack!
Zwei weitere Blitze durchzuckten die Luft, nah genug, dass Persephone ihre Hitze spüren konnte. Seite an Seite rannten Persephone und Arion hinter Suri und Minna her, die sich bereits, ohne noch einmal zurückzusehen, in Dornen, Dickicht und Gestrüpp stürzten. Persephone japste nach Luft und warf einen hastigen Blick über die Schulter. In einer direkten Linie zwischen ihnen und der Eiche schwelten mehrere Brandflecken.
Krack!
Sie alle zuckten zusammen, als es direkt über ihren Köpfen laut krachte. Wie schon zuvor die alte Eiche fing nun auch das Laubdach über ihnen Feuer. Ein riesiger Ast fiel wie eine gigantische Fackel herab – noch ein überehrgeiziger Witwenmacher.
»Brauchen Schutz«, sagte Arion und zerrte erneut an Persephones Handgelenk.
»Rhol in der Nähe«, rief Suri. »Hier lang.« Das Mädchen rannte tiefer in den Wald hinein, Minna dicht an ihrer Seite.
Persephone mochte zwar die Sprache der Bäume nicht verstehen, aber sie verstand Angst und Qual. Der Wald kreischte vor Schmerzen. Äste knickten ab, Baumstämme ächzten, und der gesamte Wald jaulte auf, als der Sturm sein grünes Sommerkleid von den Zweigen riss. Dann ertönte ein neues Geräusch, ein lautes, allumfassendes Dröhnen, das von allen Seiten zu kommen schien. Zuerst dachte Persephone, dass es wohl heftig zu regnen begonnen hatte, aber dafür war das Geräusch viel zu laut, viel zu aggressiv. Faustgroße Eiskugeln brachen wie Geschosse durch Blätter und Geäst, zerrissen, was vom Laubdach übrig war, und prallten an Ästen und Stämmen ab. Persephone riss die Arme über den Kopf und schrie auf, als sie von zwei großen Eisstücken am Rücken getroffen wurde – nur gestreift, doch der Schmerz war beißend wie ein Gertenhieb und von stumpfer Gewalt wie ein Faustschlag zugleich.
Weiter vorn blieb Suri am Fuß einer steilen, felsigen Klippe stehen und hieb mit der offenen Hand auf die steinerne Oberfläche. Zu Persephones großer Erleichterung öffnete sich ein Spalt im Fels und gab den Blick auf einen kleinen, sorgsam aus dem massiven Stein herausgemeißelten Raum frei. Die Seherin sprang hinein, dicht gefolgt von ihrer Wölfin. Von der Schwelle aus winkte sie die anderen beiden Frauen mit weit ausholenden Armen zu sich, in Sicherheit. Die Stammesführerin von Dahl Rhen und die Miralyith hasteten Seite an Seite hinein, wobei sie sich ducken mussten, um sich nicht die Köpfe zu stoßen.
Als sie sicher in der Felskammer angekommen waren, drehte Persephone sich um, um die Zerstörung mit eigenen Augen zu sehen.
Krack!
Ein weiterer Blitz durchzuckte die Luft, und für einen Augenblick durchschnitt ein flirrender Strahl durchscheinender Grüntöne das Blattwerk – ein Licht, greller als die Sonne.
Krack!
Eine nahe stehende Pappel ging in Flammen auf. Der Baum brach in einem Funkenregen entzwei, gespalten, brennend. Der Sturmwind fachte die Brände weiter an und verwandelte die Welt rund um den Rhol in ein Inferno – Eis und Feuer, Sturm und Trümmer. Persephone starrte in das Unwetter hinaus und wusste nicht, ob sie Entsetzen oder Ehrfurcht empfand.
Suri schlug auf den Scheitelstein, und die Tür schloss sich langsam.
Draußen knallten weiter die Blitze herab, und Hagel prasselte krachend auf den Boden, doch die Geräusche waren nur noch aus sicherer, gedämpfter Ferne zu hören. Noch keuchend von ihrer rasanten Flucht sahen die drei Frauen sich an und realisierten erst jetzt, dass sie die tosende Gewalt dort draußen praktisch unversehrt überlebt hatten. Eine Woge der Erleichterung spülte über Persephone hinweg … bis sie bemerkte, dass sie nicht allein waren.
Gifford würde niemals einen Wettlauf gewinnen. Ihm selbst wurde das erst recht spät im Leben klar, doch alle anderen wussten es seit dem Tag seiner Geburt. Er konnte sein linkes Bein praktisch nicht spüren oder belasten und musste es hinter sich herschleifen. Sein Rücken machte es ihm nicht gerade leichter, denn er war stark verdreht, was Giffords Hüfte in die eine Richtung zwang und seine Schultern in die entgegengesetzte. Die meisten Leute bedauerten Gifford, und manche verachteten ihn sogar. Keins von beidem hatte er jemals verstanden.
Roan bildete die Ausnahme. Was alle anderen als hoffnungslosen Fall betrachteten, nahm sie als Herausforderung.
Die beiden saßen vor Giffords Rundhütte, und Roan befestigte gerade ihre aus Holz und Blech gefertigte Vorrichtung mit Lederriemen an seinem linken Bein. Sie kniete vor ihm im Gras und trug ihre Arbeitsschürze. Auf ihrer Nase hatte Holzkohle einen schmalen schwarzen Strich hinterlassen. Sie hatte ihr dunkelbraunes Haar zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammen- und so hochgebunden, dass er wie ein Hahnenkamm aussah.
Dutzende Schnitte, die sie sich bei der Arbeit mit scharfem Metall zugezogen hatte, bedeckten ihre kleinen, geschickten Hände. Gifford wollte sie festhalten, ihre Wunden küssen und ihr den Schmerz nehmen. Einmal hatte er das versucht – ihre Hand zu nehmen, aber das war nicht gut verlaufen. Sie war mit großen, entsetzten Augen zurückgewichen, einen Ausdruck des Grauens auf ihrem Gesicht. Roan hatte eine starke Abneigung gegen Berührungen – Gifford hatte das gewusst, aber er hatte es einen Augenblick lang einfach vergessen. Ihre Reaktion beschränkte sich immerhin nicht auf ihn. Sie ertrug die Berührung von niemandem.
Roan zog kräftig am Fußgelenkriemen und nickte entschlossen. »Das müsste reichen.« Sie stand auf und klopfte sich ihre sauberen Hände symbolisch an der Schürze ab. In ihrer Stimme schwang Begeisterung, aber auch Ernsthaftigkeit. »Bist du so weit?«
Gifford antwortete ihr, indem er sich an seiner Werkbank in den Stand hochzog. Die Vorrichtung an seinem Bein, die Roan aus Holzstäben und metallenen Gelenken konstruiert hatte, quietschte dabei – ein Geräusch, als ob sich eine sehr kleine Tür öffnete.
»Belastest du es deinem gesamten Gewicht? Versuch’s mal. Ich will sehen, ob es hält.«
Für Gifford war jeder Versuch, sein linkes Bein als Stütze zu benutzen, gleichbedeutend damit, sich auf Wasser zu lehnen. Aber für Roan würde er mit Freuden auf die Nase fallen. Vielleicht schaffte er es ja, sich abzurollen und sie damit zum Grinsen zu bringen. Wäre er mit zwei ordentlichen Beinen geboren worden, gesund und kräftig, er hätte für sie getanzt und wäre herumgewirbelt wie der letzte Narr, nur um sie zu unterhalten. Vielleicht hätte er sie sogar zum Lachen bringen können, wie sie es so selten tat. In ihrem Kopf war Roan immer noch eine Sklavin, weniger wert als nichts. Gifford wünschte sich sehnlichst, sie könnte sich so sehen, wie er sie sah, aber mit seinem kaputten Körper gab er nur einen sehr schlechten Spiegel ab, der ein zerbrochenes Bild reflektierte.
Gifford drehte seine Hüfte und verlagerte ein wenig Gewicht auf sein lahmes Bein. Er fiel nicht hin. Gifford spürte, wie sich die Riemen um seinen Oberschenkel und seine Wade spannten und dehnten, aber das Bein gab nicht nach. Sein Unterkiefer klappte herunter, seine Augen wurden groß, und Roan lächelte tatsächlich.
Bei Mari, was für ein bezaubernder Anblick.
Er konnte nicht anders, er musste ihr Lächeln erwidern. Er stand aufrecht – oder so aufrecht, wie sein verdrehter Rücken es erlaubte. Mithilfe der magischen Rüstung, die Roan ihm geschmiedet hatte, war Gifford kurz davor, einen Sieg zu erringen, den er nie im Leben für möglich gehalten hätte.
»Geh einen Schritt.« Roan hatte ihre Hände vor Begeisterung zu Fäusten geballt.
Gifford verlagerte sein Gewicht auf die rechte Seite und hob das linke Bein, um es nach vorn zu schwingen. Die Gelenke quietschten erneut. Er ging einen Schritt, wie ihn normale Menschen millionenfach hinter sich brachten. In diesem Moment gab die Vorrichtung nach.
»Oh nein!«, keuchte Roan, als Gifford stürzte und die frisch glasierten Tassen, die noch in der Morgensonne trockneten, nur um Haaresbreite verfehlte.
Gifford krachte mit Wange und Ohr auf den gestampften Boden. Sein Schädel dröhnte von dem Aufprall. Doch sein Ellbogen, die Hand und die Hüfte fingen die meiste Kraft ab. Sein Sturz musste für Roan unglaublich schmerzhaft ausgesehen haben, aber Gifford hatte zu fallen gelernt. Das tat er nämlich schon sein ganzes Leben lang.
»Es tut mir so leid, es tut mir so, so leid.« Roan kniete sich neben ihn und beugte sich über ihn, als er sich auf die Seite drehte. Ihr Lächeln war fort und die Welt ein wenig düsterer.
»Mi- geht’s gut, kein Pwoblem. Hab die Tassen nicht e-wischt.«
»Das Metall hat nachgegeben.« Roan versuchte gegen ihre Tränen anzukämpfen, während ihre verletzten Hände die Stütze abtasteten. »Das Blech ist einfach nicht stabil genug. Es tut mir so leid.«
»Es hat eine Zeit lang gehalten«, sagte er, um sie aufzumuntern. »Mach weite-. Du kwiegst das hin. Ich weiß es.«
»Wenn du gehst, wirken stärkere Kräfte. Ich hätte das zusätzliche Gewicht einrechnen müssen, wenn du das andere Bein anhebst.« Sie schlug sich mehrfach gegen den Kopf. Bei jedem Schlag zuckte sie zusammen. »Ich hätte daran denken müssen. Das hätte ich wirklich. Wie konnte ich nur …«
Intuitiv packte Gifford ihr Handgelenk, um sie daran zu hindern, sich weiter zu schlagen. »Hö- auf da- …«
Roan schrie auf, riss sich los und wich panisch vor ihm zurück. Als sie sich wieder beruhigt hatte, sahen die beiden sich peinlich berührt an. Der Augenblick dehnte sich unangenehm in die Länge und endete erst, als sich Gifford zu einem Lächeln zwang. Nicht gerade sein bestes, aber mehr gelang ihm nicht.
Um die unangenehme Stille zu überbrücken, nahm er ihr Gespräch an dem Punkt wieder auf, an dem sie stehen geblieben waren, als ob nichts geschehen wäre. »Woan, du kannst nicht alles wissen, wenn du etwas Neues machst. Beim nächsten Mal wi-d es besse- sein.«
Roan blinzelte zweimal, dann sah sie weg. Nicht an irgendeinen bestimmten Punkt; nein, sie dachte nach. Manchmal war Roan so in Gedanken vertieft, dass Gifford sie beinahe hören konnte.
Schließlich blinzelte sie erneut und tauchte aus ihrer Geistesabwesenheit auf, ging hinüber zu Giffords Werkbank und nahm eine seiner Tassen in die Hand. Der peinliche Augenblick war vorüber, als ob es ihn nie gegeben hätte.
»Das ist eine neue Form, oder?«, fragte sie. »Glaubst du, sie wäre genauso stabil, wenn du sie um einiges größer machst? Wenn wir einen Weg finden könnten …«
Giffords Lächeln kam von ganzem Herzen. »Du bist ein Genie, Woan. Hat di- das jemals jemand gesagt?«
Sie nickte, und ihr kleiner Hahnenkamm wippte. »Ja, du.«
»Weil es die Wah-heit ist«, sagte er.
Sie wirkte wieder einmal verlegen wie jedes Mal, wenn er ihr ein Kompliment machte, wie immer, wenn jemand etwas Freundliches zu ihr sagte – ein inzwischen vertrautes Unbehagen. Ihr Blick richtete sich wieder auf die Stütze an seinem Bein, und sie seufzte. »Ich brauche etwas Stärkeres. Ich kann es nicht aus Stein machen. Ich kann es nicht aus Holz machen.«
»Ton wü-de ich auch nicht vo-schlagen«, sagte Gifford und forderte sein Glück mit einem weiteren Scherz heraus. »Obwohl ich di- ein wunde-schönes Gelenk gemacht hätte.«
»Das weiß ich doch«, sagte sie in aller Ernsthaftigkeit. Roan hatte es nicht so mit Scherzen. Humor entwickelte sich oft aus dem Unerwarteten, dem Absurden – wie etwa ein Gelenk aus Ton zu formen. Aber so dachte sie einfach nicht. Für Roan war einfach nichts zu absurd und keine Idee zu verrückt.
»Ich muss mir irgendwas einfallen lassen«, sagte sie, während sie ihm die Stütze wieder abnahm. »Irgendeine Möglichkeit, das Metall zu verstärken. Man kann alles besser machen, sagt Padera, und sie hat immer recht.«
Roan hatte gute Gründe, so viel von Paderas Ansichten zu halten. Die älteste Bewohnerin von Dahl Rhen hatte in ihrem Leben einfach alles gesehen. Sie hatte auch keinerlei Schwierigkeiten damit, anderen ihre Ansichten mitzuteilen, ob sie sie hören wollten oder nicht. Aus Gründen, die niemand verstand, war Padera vor allem zu Gifford immer besonders streng gewesen.
Während Roan noch mit einer Schnalle kämpfte, fegte ein heftiger Windstoß die Lappen von der Werkbank. Zwei Tassen kippten zur Seite und klirrten leise. Dicke, düstere Wolken quollen auf, verdrängten das Himmelsblau und bedeckten die Sonne. Im gesamten Dahl machten sich die Leute eilig auf den Weg zurück in ihre Hütten.
»Hol die Wäsche rein! Hol die Wäsche rein!«, brüllte Viv Baker ihrer Tochter zu.
Die Killian-Jungs rannten den Hühnern hinterher, und Bergin eilte zum Feuer, um sein frisch angesetztes Bier zu retten. »Eben hatten wir noch einen wunderschönen Tag«, grummelte er und sah zum Himmel hinauf, als ob dieser ihn hätte hören können.
Ein weiterer Windstoß ließ Giffords Tassen gegeneinanderklirren. Zwei weitere kippten zur Seite und rollten in halbkreisförmigen Bewegungen auf der Werkbank vor und zurück. Er war heute sehr produktiv gewesen, bevor Roan ihn besucht hatte, aber sie war ihm eine stets willkommene Ablenkung.
»Wir müssen deine Tassen reinbringen.« Roan verdoppelte ihre Bemühungen, ihm die Stütze abzunehmen, aber sie hatte immer noch Schwierigkeiten mit einer der Schnallen. »Hab sie zu fest gezogen.«
Der Wind nahm an Stärke zu. Auf dem Langhaus knatterten die Banner im Wind. Die Feuerschalen beim Brunnen bemühten sich redlich, nicht zu verlöschen, verloren aber beide den Kampf und übergaben ihre Flammen mit einem leisen puff dem Wind.
»Das ist nicht gut«, sagte Gifford. »Das einzige Mal, dass die beiden je ausgegangen sind, wa- an dem Tag, als sich das Dach vom Langhaus ve-abschiedet hat.«
Das Dach seines kleinen Hauses raschelte, und Gras und Dreck prasselten auf sein Gesicht und seine Arme.
Roan gab es frustriert auf, die Schnalle lösen zu wollen, griff in eine ihrer Schürzentaschen und zog eine weitere ihrer Erfindungen hervor: Zwei Messer, die sie so in Leder gewickelt hatte, dass sie zwischen ihnen Dinge zerschneiden konnte. Sie setzte sie an den Riemen der Stütze an und befreite Gifford. »So, jetzt können wir …«
Ein Blitz schlug ins Langhaus ein. Splitter, Funken und eine weiße Wolke stoben in die Luft, bevor ein so lauter Donnerschlag folgte, dass Gifford ihn durch seinen Körper fahren fühlte. Riesige Baumstämme explodierten, Stroh ging in Flammen auf.
»Hast du das ge- …«, brachte Gifford hervor, bevor ein weiterer Blitz in die andere Seite des Langhauses einschlug. »Uff!«
Er und Roan starrten einander entsetzt an, als ein dritter und dann ein vierter Blitz in das Blockhaus einschlugen. Cobb, der Schweinehüter und Teilzeit-Torwächter, reagierte als Erster. Er und Bergin schnappten sich ein paar Wasserkübel und rannten zum Brunnen. Da verwandelte ein weiterer Blitz die Winde über dem Brunnen in eine Splitterwolke, und die beiden warfen sich zu Boden.
Weitere Blitze prasselten wie Regen vom Himmel herab, innerhalb wie außerhalb des Dahls. Mit jeder Lichtsäule ertönten Schreie, brachen Feuer aus, erhob sich Rauch in die Luft. Um Roan und Gifford herum rannten die Menschen panisch in ihre Hütten. Die Galantianer, verstoßene Krieger der Fhrey, die man im Dahl willkommen geheißen hatte, stürzten aus ihren Zelten und starrten gen Himmel. Sie wirkten genauso verängstigt wie alle anderen, was fast ebenso verstörend schien wie der verheerende Sturm. Bis vor Kurzem hatten die Menschen die Fhrey noch für Götter gehalten.
Gelston, der Schäfer, rannte an Roan und Gifford vorbei. Der Blitz krachte herab, als er sich gerade zwischen dem Holzstapel und einem kleinen Feld fast reifer Bohnen im Garten der Killians hindurchzwängte. Gifford konnte wenig erkennen, nur gleißendes, blendendes Licht, das wie eine Schlange zustieß. Als er wieder sehen konnte, lag Gelston auf dem Boden, seine Haare brannten. Bergin hastete herbei und schüttete Wasser über seinen Kopf.
Gifford rief Roan zu: »Wir müssen zur Vowatsgwube. Sofo-t!«
Er griff nach seiner Krücke und stemmte sich hoch.
»Roan! Gifford!«, brüllte Raithe, als er und Malcolm auf sie zurannten. Raithe trug immer noch zwei Klingen: das zerbrochene Kupferschwert auf seinem Rücken und die aufwendig verzierte Fhrey-Waffe an seinem Gürtel. Malcolm hielt einen Speer in seinen Händen. »Weißt du, wo Persephone ist?«
Gifford schüttelte den Kopf. »Nein, aber wi- müssen in die Gwube!«
Raithe nickte. »Ich sag es allen weiter. Malcolm, hilf den beiden.«
Der ehemalige Sklave trat an Giffords Seite, schob seine Schulter unter den Arm des Töpfers und trug ihn praktisch die gesamte Strecke zur großen Vorratsgrube, dicht gefolgt von Roan. Da es bis zur ersten Ernte noch mindestens einen Monat dauerte, war die Grube fast leer. Die mit Lehmziegeln ausgekleideten Wände rochen nach schimmligem Gemüse, Getreide und Stroh. Einige Bewohner des Dahls hatten sich bereits hierher geflüchtet. Die Bakers lehnten mit ihrer Tochter und den beiden Jungen an der hinteren Wand und starrten mit großen Augen ins Halbdunkel. Engleton und Bauer Wedon spähten durch die offene Tür ungläubig auf das brutale Unwetter.
Brin, die neu ernannte Hüterin der Wege, war auch dort. »Habt ihr meine Eltern gesehen? Sie sind nicht hier«, fragte sie mit schwankender Stimme.
»Nein«, antwortete Roan.
Draußen rollte noch immer der Donner, unablässig und ohrenbetäubend. Gifford konnte sich die Blitze, die ihn begleiteten, nur vorstellen. Vom Boden der Grube aus konnte er den Platz von Dahl Rhen nicht mehr sehen, nur noch ein kleines, quadratisches Stück Himmel.
»Ich muss sie suchen.« Flink wie ein Rehkitz rannte Brin zum Ausgang. Im Gegensatz zu dem verkrüppelten Töpfer konnte Brin problemlos einen Wettlauf gewinnen, denn sie war mit Abstand die Schnellste im Dahl. Beim Mittsommerfest gewann die Fünfzehnjährige regelmäßig sämtliche Sprintwettkämpfe. Doch Gifford hatte geahnt, dass sie losrennen würde, und erwischte sie am Handgelenk.
»Lass mich los!« Sie versuchte sich mit aller Kraft zu befreien.
»Es ist zu gefäh-lich.«
»Das ist mir egal!« Bei dem erneuten Versuch, sich loszureißen, ging Brin zu Boden, doch Gifford ließ nicht locker. »Lass mich gehen!«
Giffords Beine, selbst das halbwegs vernünftige, waren im Grunde zu nichts zu gebrauchen. Seine Lippen hingen stets schief in seinem Gesicht, denn ihm fehlten die Muskeln, sie gerade zu halten. Deshalb verließ er sich im Alltag fast ausschließlich auf seine Arme und Hände, und er konnte zupacken wie ein Schraubstock. Gavin und Krier, die ihn immer drangsalierten, hatten einmal den Fehler gemacht, ihn zu einem Wettkampf im Händedrücken herauszufordern. Gifford hatte Krier gedemütigt, indem er ihn zum Weinen brachte. Gavin, der entschlossen war, nicht dasselbe Schicksal zu erleiden, hatte daraufhin gemogelt und beide Hände benutzt. Bei dem ersten Jungen hatte Gifford sich noch zurückgehalten, aber bei einem Betrüger gab es für Rücksicht keinen Grund. Er brach Gavins kleinen Finger und den schmalen Knochen, der vom zweiten Knöchel zum Handgelenk verlief.
Brin konnte sich unmöglich aus seinem Griff befreien.
Autumn, Fig, die Killians und Tressa kamen durch die Tür gestolpert, alle erschöpft und nach Atem ringend. Heath Coswall und Bergin folgten ihnen auf dem Fuß. Sie zerrten Gelston mit sich, der immer noch bewusstlos war. Der Schäfer hatte seine Haare fast vollständig eingebüßt, und auf der verbrannten Haut seines Schädels waren rote und schwarze Stellen zu sehen. Bergin war mit Erde und Gras übersät und teilte ihnen mit, dass das Langhaus brannte wie das Freudenfeuer bei Herbstmond.
»Hat jemand meine Eltern gesehen?«, fragte Brin die Neuankömmlinge.
Alle verneinten.
Als ob der Sturm und die Blitze noch nicht genug waren, prasselte nun auch noch Hagel herab. Eisbrocken in der Größe von Äpfeln krachten auf den Erdboden und hinterließen beim Aufschlag tiefe Dellen.
Immer mehr Menschen brachten sich in der Grube in Sicherheit, ihre Arme oder Körbe schützend über die Köpfe gehoben, rannten sie herein bis in die hinterste Ecke, weinend, sich gegenseitig haltend. Brin sah jedem Einzelnen ins Gesicht, der durch die Tür kam; sie suchte und suchte, ohne fündig zu werden. Schließlich stürmten Nyphron und seine Galantianer herein, die sich schützend ihre Schilde über den Kopf hielten. Sie hatten Moya, Cobb und Habet mitgebracht.
»Lass mich los!«, flehte Brin und kämpfte erneut gegen Giffords gnadenlosen Griff an.
»Du kannst nicht raus«, sagte Moya, deren Haare ein wildes Durcheinander waren. »Euer Haus brennt. Es gibt nichts, was …«
Draußen ertönte ein lautes, wütendes Brüllen, als ob ein wildes Tier in den Dahl eingedrungen wäre. Alle starrten zur Tür hinaus, als sich der Himmel noch weiter verdunkelte und der Sturm noch mehr an Kraft gewann. Ohne Vorwarnung wurde die Rundhütte der Bakers auseinandergerissen. Erst wurde das Strohdach weggefegt, dann die Pfosten aus der Erde gerissen, und schließlich gaben die Holzwände nach, die einfach in die Luft gewirbelt wurden und verschwanden. Selbst das Fundament aus Lehmziegeln wurde wild in alle Richtungen verstreut. Danach verschwand alles, was sich außerhalb der Vorratsgrube befand, in einer Sturmwolke aus Erde und Trümmern.
»Schließt die Tür!«, befahl Nyphron. Grygor, der Riese, machte sich daran, die schwere Tür ins Schloss zu zerren, als Raithe sich im letzten Augenblick durch den Spalt drückte.
»Hat jemand Persephone gesehen?«, fragte er und suchte die Menge mit Blicken ab.
»Sie ist nicht hier. Ist in den Wald gegangen«, antwortete Moya.
Raithe trat nahe an sie heran. »Bist du dir sicher?«
Sie nickte. »Suri, Arion und Persephone wollten mit Magda sprechen.«
»Diese alte Eiche steht auf einer Lichtung, mitten auf einem Hügel«, sagte Raithe zu niemand Bestimmtem. Er sah aus, als ob er sich gleich übergeben würde. Es hatte schon länger Gerüchte gegeben, dass der Dureyaner die Stammesführerin von Dahl Rhen liebte, aber viel des gängigen Klatsches hatte sich in letzter Zeit als Unsinn erwiesen. Raithes Gesichtsausdruck ließ nun allerdings keinen Zweifel mehr offen. Wäre Roan noch dort draußen gewesen, Gifford hätte genau wie er ausgesehen.
Während um sie herum das Brüllen lauter wurde, saßen oder knieten die Menschen schweigend am Boden und weinten. Da die Tür nun verschlossen war und von dem Riesen bewacht wurde, ließ Gifford Brin los, die schluchzend zusammenbrach. Die Leute zitterten, wimmerten und starrten zur Decke und fragten sich zweifellos, ob auch sie bald fortgerissen oder einstürzen würde.
Gifford stand neben Roan, die Enge im Raum drängte sie dicht aneinander. Er war ihr noch nie so lange so nahe gewesen. Er spürte ihre Wärme und roch den Duft von Holzkohle, Öl und Rauch – Dinge, die er mit Roan verband, Dinge, die gut waren. Wenn das Dach jetzt zusammenbräche und ihn tötete, er würde Mari dennoch für ihren letzten Akt der Güte danken.
Ihr Unterschlupf war wenig mehr als ein Loch im Boden, aber da er die Lebensmittelvorräte des Dahls schützte, war die Grube solide gebaut. Nur die besten Materialien waren für ihren Bau verwendet worden. Die Wände bestanden aus Erde und Steinen, und Baumstämme, die tief in den Boden getrieben worden waren, stützten die Decke. Die meisten Dinge, die Gifford herstellte, landeten hier in der Grube. Ob nun Gerste, Weizen oder Roggen, alles wurde in großen Tonamphoren gelagert und mit Wachs versiegelt, um sie vor Feuchtigkeit und Mäusen zu schützen. Auch Wein, Honig, Öl, Gemüse und geräuchertes Fleisch wurden hier aufbewahrt. Zu dieser Jahreszeit waren die meisten Amphoren leer und die Vorratsgrube nicht viel mehr als ein sauber ausgehobenes und robust abgestütztes Loch. Doch der Sturm riss an der Tür und ließ die Decke erzittern.
Nur dort, wo die Tür nicht exakt in ihren Rahmen passte, schafften es einige Lichtstrahlen in die Grube hinein. Und diese dünnen weißen Strahlen zuckten wie wild.
»Alles wi-d gut«, flüsterte Gifford Roan zu. Er sagte es so leise, als ob er ein Geheimnis mit ihr teilen wollte, und zwar mit ihr allein.
Viele in ihrer Nähe weinten, nicht nur die Frauen und Kinder. Gifford hörte, wie Cobb, Heath Coswall, Habet und Filson, der Lampenmacher, ganz unverhohlen Tränen vergossen. Nur Roan gab keinen Laut von sich. Sie war nicht wie sie. Sie war wie überhaupt niemand sonst. Das schwache Licht zeichnete die Linien ihres Gesichts nach, und sie wirkte nicht im Geringsten ängstlich. Im Gegenteil, ihre Augen leuchteten vor Neugier. Gifford war sich absolut sicher, dass Roan die Tür geöffnet hätte, wenn sich zwischen ihr und dem Ausgang nicht Dutzende von Menschen befunden hätten. Sie wollte es sehen. Roan wollte alles sehen.
Stunden schienen vergangen zu sein, als das Prasseln des Hagels endlich verstummte. Der Regen hielt noch eine Weile an, manchmal stärker, manchmal schwächer, nur um dann wieder kräftig auf das Dach zu trommeln. Doch schließlich waren auch seine letzten Tropfen gefallen. Das Heulen des Windes verstummte. Selbst das Donnern der scheinbar unaufhörlichen Blitze schwieg. Und schließlich strahlte das Licht, das durch die Ritzen der Tür fiel, hell und unbeirrt.
Nyphron schob die Tür auf und kroch nach draußen. Einen Augenblick später winkte er den anderen, ihm zu folgen.
Die Menschen kletterten zögernd aus der Grube und blinzelten, um im blendenden Sonnenlicht überhaupt etwas sehen zu können. Auf dem Boden lag eins der Banner des Langhauses. Sein Stoff war völlig zerfranst. Der Dahl war übersät mit Stroh und Baumstämmen. Keine einzige der Rundhütten hatte den Sturm überstanden. Trümmer lagen überall – Äste, Blätter, Leichen. Nichts bewegte sich mehr. Über ihnen brachen die finsteren Wolken auf, und das Blau des Himmels blinzelte hindurch.
»Ist es vorbei?«, fragte Heath Coswall aus den hinteren Reihen der Menge.
Wie zur Antwort ertönte ein lautes Krachen, und das Haupttor des Dahls erzitterte.
»Was ist das?«, fragte Moya und verlieh damit den Gedanken aller Gestalt.
Ein weiteres Krachen ertönte, und das Tor gab nach.
Der Rohl, in dem sie Zuflucht gesucht hatten, ähnelte demjenigen unter dem Wasserfall, den Suri Persephone vor so vielen Monaten gezeigt und der sie vor einem Wolfsrudel und einer tödlichen Bärin namens Grinsie geschützt hatte. Der Raum war direkt aus dem Gestein geschlagen und etwa so groß wie eine Rundhütte. Entlang der Decke waren geheimnisvolle Markierungen eingraviert. Der Rohl unter dem Wasserfall war ein wenig größer und hatte eine quadratische Grundfläche gehabt; dieser hingegen war vollkommen rund, und sechs massive Säulen umringten einen Edelstein von der Größe einer Vorratsamphore. Der Kristall war in den Boden eingelassen und gab ein unnatürliches grünes Licht ab. Sechs wuchtige Bänke standen im Kreis um ihn herum, als ob er ein Lagerfeuer und dieser Raum ein Ort war, an dem man sich versammelte, um Schauermärchen zu erzählen. Vor der Bank, die vom Eingang am weitesten entfernt war, standen drei Gestalten, die Persephone zuerst für kleine Männer hielt. Keiner von ihnen war größer als einen Meter zwanzig, und das unheimliche grüne Licht erhellte ihre Gesichter. Wären ihre Mienen nicht so deutlich von Schock und Entsetzen gezeichnet gewesen, Persephone hätte vielleicht geschrien. Ganz sicher wäre sie zurückgewichen.
»Ha…hallo«, stammelte Persephone, peinlich berührt und noch immer außer Atem. »Verzeiht, dass wir hier so hereinplatzen. Es ist ein bisschen unheimlich da draußen.«
Die drei antworteten nicht.
Regungslos wie Statuen standen sie da. Sie waren so untersetzt, dass sie fast quadratisch wirkten, und ihre großen Hände, breiten Nasen und tief liegenden Augen unter buschigen Brauen unterstützten diesen Eindruck noch. Sie trugen Hemden aus Metallringen, und mehrere metallene Kopfbedeckungen lagen auf der Bank neben ihnen. Das grüne Licht, das sich in ihren Rüstungen spiegelte, ließ sie aussehen, als ob sie im Dunklen glühten.
Dherg.
Persephone hatte bereits andere Vertreter dieser Rasse kennengelernt. Sie war mit zahlreichen Karawanen nach Dahl Tirre gereist und auch in die nahe gelegene Hafenstadt Vernes, wo die Dherg einige Geschäfte führten. Sie und ihr Ehemann Reglan hatten im Auftrag von Dahl Rhen mit den Dherg gehandelt – Geweihe, Felle und Töpferwaren im Austausch gegen ein wenig Zinn. Die Dherg waren bei Weitem nicht so einschüchternd wie die Fhrey, dafür aber sehr viel misstrauischer.
Der Dherg, der am weitesten links stand, trug einen langen weißen Bart und ein Schwert an seiner Seite. Der auf der rechten Seite trug auch ein Schwert, aber sein Bart war grau. Der Kerl in der Mitte hatte überhaupt kein Schwert, und sein Bart war kaum der Rede wert. Er trug eine riesige Spitzhacke auf seinem Rücken und einen goldenen Wendelring um seinen Hals.
»Ist das euer Rohl?«, fragte Persephone.
Die Dherg antworteten immer noch nicht. Sie sahen sie nicht einmal an. Stattdessen richteten sie ihre hass- und zugleich angsterfüllten Blicke ausschließlich auf Arion.
»Habt ihr etwas dagegen, wenn wir hierbleiben, bis der Sturm vorübergezogen ist?«, fuhr Persephone unbeirrt fort.
Immer noch keine Antwort.
Persephone überlegte, ob sie Rhunisch wohl überhaupt verstanden. Nicht alle Dherg taten das. Es gab strenggläubige Fraktionen unter ihnen, die Außenseiter und ihre fremdartigen Lebensweisen konsequent mieden, einschließlich ihrer Sprache.
»Ich muss sitzen«, sagte Arion und taumelte zu den Bänken hinüber.
Als sie sich ihnen näherte, flüchteten zwei der Dherg – die Bärtigen – in Richtung Tür. Einer schlug auf den Scheitelstein, und die Tür begann sich zu öffnen. Ohrenbetäubender Lärm erfüllte den Raum.
Es war weder prasselnder Hagel noch knisterndes Feuer, es war ein tieferes, lauteres Dröhnen. Das Tosen eines Wirbelwinds. Persephone hatte schon einmal einen gesehen. Als kleines Mädchen hatte ihr Vater sie auf der Mauer des Dahls hochgehalten, damit sie sehen konnte, wie der unstete Finger eines Gottes den Rücken Elans kratzte. Der schwarze Trichter hatte über eine Meile von ihnen entfernt ganze Bäume in die Luft gerissen. Persephone hatte sich damals gefragt, wie es wohl sein musste, als Kaninchen oder Maulwurf in dieser unglaublichen Verheerung gefangen zu sein. Nun wusste sie es. Draußen wurden Blätter, Gräser, Erde, Steine, Hagel, Äste und ganze Baumstämme durch die Luft gewirbelt und krachten gegeneinander. Irgendwo inmitten dieses Sturms ertönte ein splitterndes Knacken und Bersten – ein weiterer Baum, der in der Mitte entzweigebrochen wurde. Persephone fühlte einen Sog wie die Strömung eines mächtigen Flusses, der an ihr zerrte und die Luft aus der Türöffnung nach draußen saugte.
Der Dherg mit dem weißen Bart spürte ihn ebenfalls und klammerte sich mit beiden Armen am Türrahmen fest. Entsetzt starrte er auf den tosenden Sturm, dann sah er über die Schulter zurück zu Arion, traf eine Entscheidung. Durch seinen wild hin und her peitschenden Bart schrie er: »Zumachen! Zumachen!«
Der Graubärtige schlug mit der Hand auf den Stein. Die sich öffnende Tür änderte ihre Richtung, und der schwere Stein rollte zurück an seinen Platz, bis das Dröhnen und Tosen des Sturms ein weiteres Mal verstummte.
»Das ist dein Werk!«, brüllte der weißbärtige Dherg auf Fhrey und deutete auf die Tür, während er Arion mit seinen Blicken durchbohrte.
Arion schüttelte erschöpft den Kopf, ohne sich von ihrem Platz auf der Steinbank zu erheben. »Damit habe ich nichts zu tun. Glaub mir.«
»Ich glaube dir nicht!«
Arion beugte ihre Finger. Entsetzen und Verwirrung zeichneten sich auf ihrem Gesicht ab. Sie hob eine Hand und legte sie auf ihren Hinterkopf.
»Alles gut. Es kommt wieder.« Suri deutete auf die Runen, die man in einem dünnen Band in die Wände gemeißelt hatte. »Die Zeichen.« Es waren dieselben Zeichen wie auf dem Verband, der Arion an der Nutzung ihrer Magie gehindert hatte.
Arion nickte langsam. Obwohl sie die Stirn runzelte, schien sie erleichtert. Als sie bemerkte, dass der Dherg sie immer noch wütend anstarrte, deutete sie auf die Runen und sagte: »Das da sind eure, du weißt also ganz genau, dass ich für das da draußen nicht verantwortlich bin.«
Persephone hatte noch nie Dherg wie diese hier gesehen. Keiner der anderen, denen sie begegnet war, war in Metall gekleidet gewesen. Die Händler in Vernes trugen labbrige, leuchtend orangefarbene oder rote Wollhüte und lange gelbe oder blaue Tuniken. In den südlichen Regionen kamen Metalle nicht so häufig vor, und die Dherg begehrten es wie heilige Reliquien – ihre Art der Magie. Selbst um die kleinste Menge Zinn wurde verbissen gefeilscht. Doch es waren ihre anderen Metalle, die wahrhaft wunderbar waren: ihre erstaunliche Bronze, die man zu unbesiegbaren Waffen schmieden konnte, und ihr Gold und Silber, das mit göttlichem Schein funkelte. Persephone fragte sich, ob diese drei Herrscher der Dherg-Gesellschaft waren oder eine andere, wichtige Rolle spielten. Wer immer sie auch sein mochten, es wäre sicher ein großer Fehler, keinen guten Eindruck bei ihnen zu hinterlassen. Oder zumindest den besten, den man hinterlassen konnte, nachdem man ungeladen in ihr Haus geplatzt war.
»Ich bin Persephone, Stammesführerin von Dahl Rhen«, sagte sie, weil sie dachte, es würde vielleicht helfen, sich auf höfliche Floskeln zurückzuziehen. »Dies ist Arion von den Fhrey. Und dies« – sie deutete auf die Seherin – »ist Suri. Oh, und ihre Wölfin Minna, die äußerst freundlich ist und euch keinerlei Schaden zufügen wird.«
Nun endlich schienen die drei ihre Anwesenheit zu bemerken – vielleicht, weil ihnen klar geworden war, dass Arion hier drin keine Magie wirken konnte, oder vielleicht auch, weil Persephone die Erste gewesen war, die sie angesprochen hatte. Die Dherg musterten sie mit kein bisschen weniger Misstrauen, doch mit sehr viel weniger Angst.
»Also«, sagte Persephone und zauberte ihr freundlichstes Lächeln herbei, »darf ich euch auch nach euren Namen fragen?«
Die drei bedachten Arion mit einem letzten finsteren Blick, bevor der Weißbärtige das Wort ergriff. »Ich bin Frost von Nye. Dies ist Flut« – er schlug dem Dherg neben ihm auf die Schulter, dass der Graubärtige zusammenzuckte. »Und er« – Frost deutete auf den mit der Spitzhacke, der nicht zum Ausgang gerannt war – »wird Regen genannt. Meine Begleiter haben anscheinend die Tür nicht ordentlich bewacht.«
»Wie bitte? Was hast du denn in der Zeit gemacht?«, fragte Flut. »Warum war es unsere Aufgabe, die Tür zu bewachen?«
»Ich war damit beschäftigt, ein Steinchen aus meinem Stiefel zu entfernen.«
»Vorsicht, das könnte auch dein Gehirn sein. Wenn du den wegwirfst, dann … obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, würde man ohnehin keinen Unterschied bemerken. Also mach einfach.«
Frost verzog finster das Gesicht.
»Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen.« Persephone verbeugte sich förmlich, was sie zu überraschen schien.
»Also schön, woher wusstet ihr von unserem Rohl?«, fragte Frost. »Dies sind geheime Orte, sichere Zufluchten, die nur die Unseren kennen.«
»Suri ist eine Seherin und hat ihr ganzes Leben lang im Sichelwald gelebt.« Persephone sah zu dem Mädchen hinüber. »Sie hat uns hierhergeführt.«
Der Dherg schmunzelte. »Ihr Leben lang? Wie lang kann das denn schon sein?«
»Suri ist … nun, etwas Besonderes. Sie hat viele Rohls entdeckt. Nicht wahr?«
Suri war dabei, Minnas Hals zu kraulen, und hatte das Gespräch offenbar nicht verfolgt.
»Suri?« Persephone stupste die Seherin mit dem Ellbogen an.
»Was denn?«
»Ich habe ihnen gesagt, dass du ein Gespür dafür hast, Rohls zu entdecken. Könntest du ihnen erklären, wie du das machst?«
Suri zuckte mit den Achseln. »Leere Orte fühlen sich anders an als die, die mit Erde und Stein gefüllt sind. Es macht Spaß herauszufinden, wie die Tür sich öffnen lässt. Allerdings langweilt sich Minna, wenn ich dafür zu lange brauche. Stimmt’s, Minna?«
»Wir sind nur hergekommen, um Schutz vor dem Sturm zu suchen«, sagte Persephone. »Wir wussten nicht, dass ihr hier sein würdet. Ich hoffe, dass ihr nichts dagegen habt, aber wie ihr sehen könnt, ist der Sturm … nun, der Sturm …« Ihr kam plötzlich ein Gedanke, der nicht lange allein blieb. Nach und nach setzte sich ein Bild zusammen: der plötzlich auftretende Sturm, Arion, die ihnen zu fliehen befahl, und die Spur rauchender Löcher, die sich von hier bis zur alten Eiche zog.
Sie wandte sich der Miralyith zu und sprach auf Fhrey: »Arion, woher wusstest du es?«
Die kahlköpfige Frau saß vornübergebeugt auf der Bank und hatte ihren Kopf erschöpft in die Hände gestützt. »Was wusste ich?«
»Du hast uns befohlen zu fliehen. Und diese Blitze, das … das war doch kein Zufall. Ich weiß nicht, wie, aber sie haben versucht, uns zu treffen. Oder?«
»Ja«, sagte die Fhrey und sah zu ihr auf. Die Erleichterung, die nach Suris Erklärung auf ihrem Gesicht gelegen hatte, war verschwunden und wurde ersetzt durch einen schmerzerfüllten Ausdruck, während Arion sich ihren gehäkelten Hut über den kahlen Schädel zog.
»Genauso war es im Krieg.« Frost schien mit seinen Begleitern zu reden, doch er benutzte die Sprache der Fhrey. »Wenn die Fhrey uns angriffen, suchten wir Schutz in unseren Rohls.«
»Du kannst unmöglich irgendetwas über den Krieg wissen«, sagte Arion. »Ich war damals jung, aber ich kann mich erinnern. Du nicht. Du kennst nur die Geschichten. Dherg leben nicht so lange.«
»Nenn mich nie wieder einen Dherg … du … du … Elbe!« Frosts Hand flog zum Schwertgriff.
Beim Klang des Wortes Elbe hoben sich Arions Augenbrauen.
»Langsam, langsam«, sagte Persephone. »Vielleicht sollten wir uns alle ein wenig beruhigen. Ich bin mir sicher, dass Arion nicht respektlos sein wollte. Der Sturm ist viel zu gefährlich, als dass irgendeiner von uns hinausgehen könnte, also lasst uns das Beste daraus machen. Wir wissen ja nicht, wie lange wir hier gemeinsam festsitzen.«
Über ihnen ertönte Donnergrollen und das Heulen des Sturms.
Als Persephone zu Arion hinüberging, um sich neben sie zu setzen, erinnerte die Bewegung sie schmerzhaft daran, dass der Hagel sie am Rücken getroffen hatte. Zudem hatte sie nun die Gelegenheit, die vielen Kratzer an ihren Händen und Beinen zu bemerken, die sie sich auf ihrer Flucht durch das Dornendickicht zugezogen hatte. Auch ihr linkes Ohr schmerzte. Warum, wusste sie allerdings nicht.
»Ihr könntet euch ebenso gut wieder hinsetzen«, schlug Persephone den dreien vor.
Frost und Flut sahen einander an und kehrten dann auf ihre Bank auf der anderen Seite des grün schimmernden Edelsteins zurück. Regen, der seit ihrer ersten Erwähnung schweigend die Runen begutachtet hatte, war derweil tiefer in die Schatten des Rohls eingetaucht. Er stand mit hoch erhobenem Kopf an der hinteren Wand und musterte eingehend die eingravierten Zeichen.
»Entschuldigt die Frage, aber wenn Dherg … ähm … das, was Arion gesagt hat, nicht der richtige Begriff ist, um euresgleichen zu bezeichnen, wie heißt ihr dann? Ich habe noch nie ein anderes Wort gehört.«
»Dherg ist ein Wort der Fhrey und bedeutet ›dreckiger Wühler‹. Wie würde es dir gefallen, wenn ich euch als Rhunes bezeichnete?«, fragte Frost. »Das stammt auch aus dem Fhrey. Du weißt, was es bedeutet, oder? ›Barbarisch‹, ›primitiv‹, ›ungehobelt‹? Möchtest du so genannt werden?«
Persephone hatte noch nie darüber nachgedacht. Für sie und die meisten Mitglieder der Zehn Clans – von denen die wenigsten Fhrey sprachen – war Rhunes nur ein gewöhnlicher Begriff, ein Name eben. Erst jetzt, wo Frost sie darauf ansprach, wurde ihr klar, dass es sich schon immer um eine Beleidigung gehandelt hatte. »Wie nennt ihr euch denn selbst?«
»Belgriclungreianer«, sagte Frost.
Persephone atmete tief durch. »Wirklich? Das … ähm … ist ja schon ein Zungenbrecher, nicht wahr? Und was führt euch in den Sichelwald? Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen von euch so weit im Norden gesehen zu haben.«
Die drei wechselten kurze Blicke – sie schienen sich unwohl zu fühlen –, und Frost knurrte: »Das geht euch nun wirklich nichts an, oder?«
Allmählich begann sich Persephone über das Gespräch zu ärgern. Musste sie es ihr so schwer machen? Selbst die belanglosesten Freundlichkeiten schienen sie zu reizen.
Der Lärm außerhalb des Rohls nahm inzwischen stetig ab. Der wilde Sturm schien ein Ende gefunden zu haben, und es regnete nur noch. Das beständige Prasseln wurde zu einem angenehmen, beruhigenden Hintergrundgeräusch, das nichts Bedrohliches mehr an sich hatte. Bedeutet das, der Sturm ist vorbei?, dachte Persephone, und ihr wurde klar, dass sie sich dessen nicht sicher war. Ganz und gar nicht sicher.
Der Tag hatte mit einem so bezaubernden Morgen begonnen. Ein klarer Himmel, ein entspannter Spaziergang durch den Wald. Es war eine willkommene Abwechslung zu der am Horizont dräuenden Gefahr eines kommenden Kriegs gewesen. Vor nur wenigen Monaten hatte man die Fhrey noch für Götter gehalten – scheinbar unsterblich. Dann hatte Raithe aus Dureya einen von ihnen getötet und damit alles infrage gestellt. Nur wenige Wochen später tötete er auch noch Gryndal, den scheinbar allmächtigen Miralyith der Fhrey, und beseitigte damit die letzten Zweifel. Die Fhrey waren keine Götter, aber sie waren mächtig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie Rache üben würden. Allerdings hatte Persephone eine Armee erwartet, keine Blitze.
»Kopfschmerzen?«, fragte Suri, als sie bemerkte, wie sich die Fhrey die Schläfen rieb.
Arion nickte nur schwach und stand auf. Diese unerwartete Bewegung ließ die beiden bärtigen Dherg panisch aufspringen. Doch als Arion es sich auf dem Boden bequem machte und ihren Arm schützend über die Augen legte, entspannten sie sich wieder.
»Was stimmt denn nicht mit der Elbe?«, fragte Flut.
»Red nicht mit ihnen«, blaffte ihn Frost an.
»Warum nennst du sie Elbe?«, fragte Persephone.
»Weil sie das für uns sind«, sagte Frost. »Albträume.«
Persephone war verwirrt. »Aber Elbe ist doch ein Wort der Fhrey.«
»Es ergibt ja wohl keinen Sinn, sie in unserer Sprache zu beleidigen. Was für einen Nutzen sollte das haben, wenn sie nicht verstehen, was wir sagen?«
»Ihr sprecht es falsch aus«, sagte Arion. »Es heißt Ylbe, nicht Elbe.«
Persephone ging zu Arion hinüber und kniete sich neben sie. Die Fhrey rieb mit beiden Händen über ihre Augen.
»Ist der Schmerz so schlimm?«, fragte Persephone.
»Ja.«
»Kann ich …« Persephone hielt inne, als der Boden erzitterte.
Alle im Raum wechselten besorgte Blicke.
Die Erde erzitterte erneut, begleitet von einem dumpfen Krachen.
»Was ist das?«, fragte Persephone.
Sie erhielt keine Antwort.
Die Dherg waren wieder aufgesprungen und starrten zur Decke.
Ein weiteres Krachen, diesmal deutlich lauter, erschütterte den Rohl. Erde, Gesteinsbrocken und Staub regneten herab und glitzerten im grünen Schein des Edelsteins. Persephone stand auf und ging zu Frost, der gemeinsam mit Flut zurückwich – wieder in Richtung Tür.
»Haben es die Fhrey im Laufe des Kriegs jemals geschafft, in einen eurer Rohls einzudringen?«
Die beiden Dherg tauschten kurze, überaus besorgte Blicke. Persephone brauchte keine Antwort mehr.
»Wie?«, fragte sie, als der Raum ein weiteres Mal in seinen Grundfesten erzitterte. Die steinerne Decke über ihnen wurde aufgerissen. Ein großer Felsen stürzte herab, gefolgt von einem Schwall Erde. Durch die Öffnung starrte ein riesiges Auge auf sie herab.
2
Riesige Probleme
Der erste Riese, dem ich in meinem Leben begegnete, war freundlich und liebte es zu kochen. Vielleicht war es auch bei dem zweiten so. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nie gefragt. Fragen zu stellen ist nicht leicht, wenn man aus Leibeskräften schreit.
– Das Buch Brin
Das große Auge wich zurück, und eine Faust durchschlug die noch verbliebene Decke des Rohls. Die gelbbraune Hand war zehnmal so groß wie die eines normalen Menschen. Ihre rauen Knöchel waren von Erde überzogen. Persephone und die anderen stoben auseinander, als Felsen und Erdbrocken herabkrachten und auf dem Boden zerplatzten. Ein weiterer Schlag der riesigen Faust, und die Öffnung war groß genug, dass ein Auerochse hindurch gepasst hätte.
Frost und Flut waren als erste an der Tür.
»Arion!«, schrie Persephone.
Die Fhrey war immer noch am Boden. Sie hatte sich aufgesetzt, aber weiter war sie noch nicht gekommen.
Zwei riesige Hände schoben sich durch die Öffnung herein, griffen nach den Rändern und rissen die Decke nach außen heraus. Funkelndes Sonnenlicht fiel in den Rohl, und davor zeichnete sich die Silhouette eines Riesen ab. Das riesige Wesen schien zu knien und mit bloßen Händen zu graben. Es streckte seine Zunge zwischen den Zähnen heraus, ein Zeichen größter Konzentration. Der Riese warf eine weitere Handvoll des verwurzelten Waldbodens zur Seite, um anschließend sein Gesicht in die Öffnung zu stecken. Ein weiteres Mal wurde es dunkel im Rohl. Der Riese starrte angestrengt hinein, als ob er den Inhalt eines großen Sacks begutachtete. Das grüne Schimmern des Edelsteins ließ seine ohnehin schon furchterregende Visage noch schrecklicher wirken. Unter einer wuchtig vorgewölbten Stirn starrten sie die zusammengekniffenen Augen eines Wahnsinnigen an –schattenunterlaufene Täler zu beiden Seiten einer spitzen Nase, unter der sich ein gähnender Schlund mit löchrigen, grabsteinförmigen Zähnen öffnete.
»Hag-la!«, brüllte der Koloss. Sein feuchter Atem stank nach verfaultem Fleisch und Erdbeeren.
Der Kopf zog sich zurück, und erneut schob sich eine riesige Hand in den Rohl.
»Lauft!«, brüllte Persephone.
Frost und Flut waren schon nach draußen gestürzt, gefolgt von Suri und Minna, aber Arion hatte nicht die geringste Chance. Der Riese packte sie, als sie sich gerade aufzurappeln versuchte. Doch als sich die riesige Hand um ihren Körper schloss, holte Regen mit seiner Spitzhacke aus und rammte ihr spitzes Ende in die Faust des Riesen. Der Koloss ließ sofort los und riss seine Hand zurück. Er legte die andere Hand auf die Wunde, aus der das Blut hervorsprudelte, und starrte sie mit wütendem Knurren an. Persephone und Regen nutzten ihre Chance, um Arion aufzuhelfen, und gemeinsam stürzten sie Richtung Tür, während sich über ihnen der Riese erhob und mit seinem Fuß auf den Rohl stampfte. Der Boden erzitterte, und Erde und Staub schossen aus der Türöffnung hervor.
Die Bäume außerhalb des Rohls existierten nicht mehr. Einige waren entwurzelt worden, andere zerbrochen, sodass nur noch gespaltene Stümpfe übrig blieben. Inmitten des Waldes befand sich nun ein kahler Fleck, der mit den Überresten der zerstörten Bäume übersät war.
Frost und Flut sprangen über die Trümmer hinweg, um Zuflucht im Dickicht zu suchen. Suri und Minna blieben kurz auf einem umgestürzten Hickorybaum stehen und blickten zurück, während Persephone noch versuchte, in dem Durcheinander der Äste auf dem Waldboden Fuß zu fassen. Arion allerdings floh nicht. Sie saß ruhig da, die Arme zu beiden Seiten ausgestreckt, Zorn in ihrem Blick.
Der Riese heulte laut auf, als er seinen Fuß aus dem Loch zu ziehen versuchte, in dem sich noch kurz zuvor der Rohl befunden hatte. Er schien festzustecken, und er wirkte zunehmend frustrierter, als er trotz aller Bemühungen immer weiter einzusinken schien – erst bis zum Fußgelenk, dann bis zum Schienbein. Schließlich verschlang ihn der Boden bis zum Knie. Auch das andere Bein des Riesen schien ihm Schwierigkeiten zu machen, als ob sich der verstümmelte Wald in eine Teergrube verwandelt hätte.
»Arg rog!«, brüllte er in einem Tonfall, der zornig und ängstlich zugleich klang. Seine großen Hände stemmten sich in den Boden, um sich zu befreien, aber es gab keinen festen Untergrund mehr. Auch sie wurden verschlungen.
Langsam, aber sicher zog der Waldboden den Riesen nach unten, begleitet von dem gelegentlichen Knacken eines Astes und dem Säuseln der Blätter. Er sank tiefer in den Boden, erst bis zur Hüfte, dann bis zur Schulter, und erst als sich der fruchtbare, belaubte Boden schließlich um seinen Hals schmiegte, senkte Arion ihre Hände. Der Riese war gefangen.
Flut schlug Frost auf die Schulter und deutete auf die Fhrey. Zum ersten Mal sah Persephone beide grinsen.
»Hast du das gesehen?«, fragte Frost.
Flut nickte. »Vielleicht gibt es ja doch noch einen Rückweg für uns.«
Der Riese begann zu brüllen. Er stieß eine ganze Reihe an Worten aus, die Persephone nicht verstand, bevor er schließlich auf Fhrey »Hilfe!« schrie.
»Sprichst du meine Sprache?«, fragte Arion von ihrem Sitzplatz aus, einem umgestürzten Ahorn.
»Ja! Ja!«, brüllte der Riese.
»Da hast du ja Glück.« Arion stand auf und suchte sich vorsichtig einen Weg zwischen den Trümmern hindurch. Als sie den Hut entdeckte, den Padera ihr gehäkelt hatte, bückte sie sich, um ihn aufzuheben, und seufzte, denn er war voller Erde und Blätter.
»Lass mich leben«, flehte sie der Riese an. »Ich ergebe mich. Du gewinnst. Ich höre auf.«
»Womit genau hörst du auf?«, fragte Arion.
Der Riese zögerte.
Arion sah von ihrem Hut auf und blickte ihn finster an. Der Riese begann wieder tiefer zu sinken. Die Erde reichte ihm nun bis zum Kinn.
»Dich zu töten versuchen! Dich zu töten versuchen! Man hat uns geschickt, dich zu töten!«
Arion nickte, während sie mit geschickten Bewegungen ihren Hut von Erde und Blättern befreite. Dann hielt sie inne. Für einen Moment wirkte sie verwirrt, dann wurde ihr Blick schneidend vor Zorn. »Was meinst du mit – uns?«
Der schwere Querbalken, der das Tor von Dahl Rhen verriegelte, brach entzwei, und die Torflügel flogen aus ihren Angeln. In den letzten Monaten hatte Gifford einige ungewöhnliche Dinge durch dieses Tor kommen sehen – die Leiche eines Stammesführers und davor die seines Sohnes; drei Fhrey-Gruppen, von denen zwei sich einen magischen Kampf vor den Stufen zum Langhaus geliefert hatten; und Raithe, den berüchtigten Gottestöter. Gifford hatte geglaubt, er hätte nun wohl alles gesehen. Doch jetzt, als er bei der Vorratsgrube inmitten der Trümmer stand, die der Sturm hinterlassen hatte, wurde ihm klar, wie sehr er sich in dieser Hinsicht täuschte. Was an diesem Nachmittag den Dahl betrat, war ein Anblick jenseits seiner schlimmsten Albträume. Oder besser gesagt: Eigentlich hätte dieser Anblick ausschließlich in seinen Albträumen existieren sollen.
Riesen. Eine ganze Horde von ihnen.
Jeder Mensch der Zehn Stämme wusste, dass es Riesen gab, genau wie auch jeder wusste, dass es Götter, Hexen, Goblins und Krimbals gab. Dahl Rhen hatte einem von ihnen sogar Gastfreundschaft gewährt, aber Grygor, der die erste Gruppe der Fhrey begleitet hatte, hatte sich als sehr angenehm erwiesen. Grygor liebte es zu kochen und blieb ansonsten eher für sich. Diese hier waren anders: wütend und wild. Sie waren außerdem größer, wesentlich größer, und trugen Kilts und Wämser, die aus den Fellen zahlreicher Tiere unterschiedlichster Art grob zusammengestoppelt worden waren.
Da ihre Köpfe das Tor überragten, mussten sie sich unter der Brustwehr hindurch ducken. Ihre Füße waren so lang wie Giffords Bett, und sie hielten Holzhämmer in den Händen, die aussahen, als hätte man einen dicken Ast durch ein Loch in einem Baumstamm gerammt. Sie waren zu zwölft, und sie stürmten den Dahl mit gebleckten Zähnen und wild funkelnden Augen. Die Riesen holten mit ihren Hämmern aus und zertrümmerten, was von den zerstörten Rundhütten geblieben war, in winzige Bruchstücke. Sie droschen auf den vom Wind verstreuten Schutt ein und zerquetschten eine Ziege, die den Sturm zwar überstanden, aber auch den Fehler gemacht hatte, nicht wegzurennen. Einige der Riesen nahmen sich die Zeit, das Stroh hochzuheben und darunter zu schauen, und dann blickte einer in Giffords Richtung.
Die meisten Überlebenden von Dahl Rhen befanden sich noch in der Grube. Die, die bereits draußen waren, wie Gifford und Roan, sahen, wie einer der Riesen begeistert aufschrie und auf sie zeigte. Die anderen elf drehten sich um, und die Erde wankte, als sich die Gruppe geschlossen in Bewegung setzte. Die Menschen, die gesehen hatten, was mit der Ziege geschehen war, schrien auf und zogen sich panisch in die Grube zurück.
Nur Roan nicht. Sie blieb an Ort und Stelle und sah dem Feind voller Bewunderung entgegen.
Hinter ihr strömten die Fhrey-Krieger mit gezogenen Waffen aus der Vorratsgrube, als hätten sie nicht genügend Geduld, um die wenigen Sekunden zu warten, bis die Riesen herangekommen waren. Der Erste, der einen Treffer landete, war Eres, der seine beiden Speere warf. Einer durchbohrte den Hals des nächsten Riesen, den Gifford für einen weiblichen Grenmorianer hielt, denn sie hatte Brüste und einen kürzeren Bart.
Der andere Speer landete im Auge eines der größeren Angreifer und grub sich so tief in seinen Schädel, dass nur noch das hintere Ende aus der Augenhöhle hervorstand. Der Riese geriet ins Taumeln und krachte dann mit dem Gesicht voran in die Trümmer des Langhauses, wo er einen Baumstamm in die Luft katapultierte und die Erde derart erschüttern ließ, dass Gifford einen Ausgleichsschritt nach vorne machen musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Sebek, der Fhrey mit den kurzen blonden Haaren und dem blitzenden Klingenpaar, stürzte sich mitten unter die Eindringlinge. An den ersten beiden rannte er vorbei, und Gifford verstand nicht, warum, bis er erkannte, dass der Galantianer sich den größten Riesen als Ziel ausgesucht hatte. Sebek erreichte sein Opfer, rannte zwischen seine Beine und rammte ein Schwert in jeden seiner Füße. Der Riese stieß ein langes, tiefes Heulen voll Schmerz und Wut aus, das immer lauter wurde, als er nach vorne kippte und verzweifelt versuchte, seine Füße vom Boden zu lösen. Die Schwerter gaben nach, doch erst als der Riese sein Gleichgewicht bereits verloren hatte. Erneut geriet Gifford ins Stolpern und wäre beinahe gestürzt, als der Riese krachend in den Staub schlug. Flink wie ein Wiesel holte Sebek seine Waffen zurück und rannte den Bauch des Riesen hinauf, sprang über die Brust des Eindringlings hinweg und stieß beide Klingen tief in seinen Hals.
Anwir war der nächste Galantianer, der einen Treffer landete. Er zog seine geladene Schleuder hervor, ließ sie über seinem Kopf kreisen und feuerte den Stein ab. Das Geschoss brachte einen mittelgroßen Riesen ins Wanken, gerade als Tekchin ihn mit seiner langen, schmalen Klinge erreichte. Nachdem er drei Finger von der knüppelartigen Hand des Riesen abgetrennt hatte, stieß er sein Schwert in die Brust seines Gegners und schnitt einen Halbkreis hinein, bevor er die Klinge wieder herauszog.
Roan machte einen Schritt nach vorn. In ihrem Blick lag jene vertraute, unbeirrbare Neugier – eine blinde Faszination –, die Gifford einfach nicht nachvollziehen konnte. Einmal hatte sie sich den Knöchel gebrochen, weil sie einem Schmetterling hinterhergelaufen und dabei in den Sichelwaldfluss gestürzt war. Gifford wusste nicht, was sie diesmal so sehr faszinierte, aber bei einem Kampf zwischen Fhrey und Riesen spielte das wohl kaum eine Rolle. Wenn sie sich zu weit vorwagte, wenn sie versuchen sollte, an Nyphron vorbeizukommen, der sich zwischen die Riesen und die Bewohner Dahl Rhens gestellt hatte, um ihnen als letzte Verteidigungslinie zu dienen, dann würde Gifford sie am Handgelenk festhalten wie auch schon Brin. Ja, sie würde in Panik geraten und nach ihm schlagen, aber diesen Schmerz würde er mit Freuden ertragen, wenn es die einzige Möglichkeit war, für ihre Sicherheit zu sorgen.