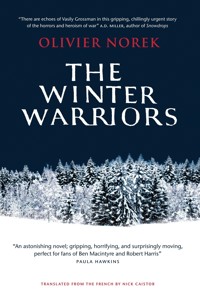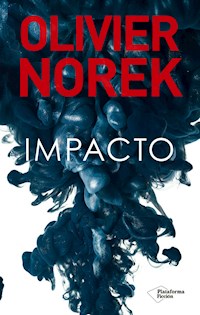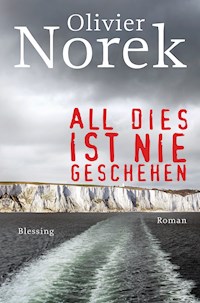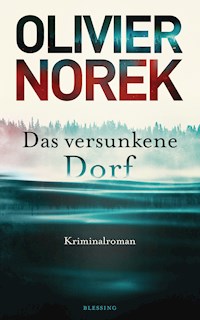
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bei der Festnahme eines Drogendealers erleidet die Kommissarin Noémie Chastain eine schwere Schussverletzung: Fortan ist eine Hälfte ihres Gesichts entstellt. Weil man ihr nicht mehr zutraut, ein Team zu führen, wird sie gegen ihren Willen aus Paris in die Provinz verbannt: Nach beschaulichen Wochen taucht auf dem See eine Tonne mit einem längst verwesten Leichnam auf, wodurch Noémie auf die Vorgeschichte Avalones stößt: Vor 25 Jahren wurde das Dorf evakuiert, überflutet, die Bewohner mussten dem neu geschaffenen Stausee weichen und wenige Kilometer entfernt im neuen Avalone leben. Doch drei Kinder kamen damals nicht mit ...
Das Spiel von Verbergen und Wiederauftauchen prägt diesen Roman, dessen raffinierte Dramaturgie Noémies Geschichte mit der des Dorfes verschränkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Bei der Festnahme eines Drogendealers erleidet die Kommissarin Noémie Chastain eine schwere Schussverletzung: Fortan ist eine Hälfte ihres Gesichts entstellt. Weil man ihr nicht mehr zutraut, ein Team zu führen, wird sie gegen ihren Willen aus Paris in die Provinz verbannt: Nach beschaulichen Wochen taucht auf dem See eine Tonne mit einem längst verwesten Leichnam auf, wodurch Noémie auf die Vorgeschichte Avalones stößt: Vor 25 Jahren wurde das Dorf evakuiert, überflutet, die Bewohner mussten dem neu geschaffenen Stausee weichen und wenige Kilometer entfernt im neuen Avalone leben. Doch drei Kinder kamen damals nicht mit …
Das Spiel von Verbergen und Wiederauftauchen prägt diesen Roman, dessen raffinierte Dramaturgie Noémies Geschichte mit der Dorfes verschränkt: Beide müssen sie den Weg von der fast gänzlichen Auslöschung zur Rückeroberung ihrer eigenen Identität beschreiten.
Zum Autor
Olivier Norek, geboren 1975 in Toulouse, arbeitete drei Jahre für Pharmaciens sans frontières und wurde Police Lieutenant in Seine-Saint-Denis. Seine Erfahrungen im Polizeidienst verarbeitete er 2013–2016 in der Capitaine-Coste-Trilogie, die ihn zu einem Star der französischen Krimiszene machten. Er wurde u.a. mit dem Prix du polar européen und mit dem »Grand Prix des lectrices de Elle, catégorie: Policiers« ausgezeichnet. 2018 erschien im Blessing Verlag sein Roman über das Geflüchtetenlager von Calais. »All dies ist nie geschehen.«
OLIVIER
NOREK
Das versunkene
Dorf
Roman
Aus dem Französischen
von Alexandra Hölscher
Blessing
Originaltitel: Surface
Originalverlag: Éditions Michel Lafon, Paris
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Olivier Norek und
Éditions Michel Lafon
Copyright © 2022 der Übersetzung
by Karl Blessing Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Leingärtner, Nabburg
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
ISBN 978-3-641-26067-5V001
www.blessing-verlag.de
Für Babeth, Yann, Corinne, Jamy und Stéphane.
Zerstört. Wiederhergestellt. Am Leben.
Für Amandine, das junge Mädchen aus dem Wasser.
Prolog
Die zwei Männer wurden im hinteren Teil des Wagens auf der rasanten Fahrt durch die Straßen von Paris hin und her geschleudert und bemühten sich gemeinsam, ihr die Waffe abzunehmen.
Überall war Blut. Viel zu viel Blut. Und dann das Gesicht. Grundgütiger, dieses Gesicht! Es glich einem Schlachtfeld. Hier und da waren durchtrennte Venen zu sehen, die nirgendwo mehr hinführten, und das Blut sprudelte immer noch aus ihnen heraus. Von ihrer rechten Wange war nicht mehr viel übrig geblieben, und das ganze Gesicht glich einer einzigen schmerzverzerrten Fratze.
»Scheiße, Mann, ich hab keine Lust, aus Versehen eine Kugel verpasst zu bekommen!«, schrie der Fahrer. »Nehmt ihr endlich die Waffe ab!«
Er raste bei Rot über die Ampel. Die Limousine, die zu ihrer Rechten aufgetaucht war, schaffte es nicht mehr, rechtzeitig abzubremsen, und riss ihnen mit verzweifelt quietschenden Reifen einen Teil des Kotflügels auf.
Mit zunehmend brachialer Gewalt versuchten sie, ihre Finger auseinanderzubiegen. Zogen daran, in alle Richtungen. Vergeblich. Denn die Hand, die den Pistolengriff umklammert hielt, war gänzlich verkrampft. Der Finger auf dem Abzug drohte bei jeder Kurve, bei jedem Ruckeln einen Schuss mit einer Neun-Millimeter-Patrone auszulösen.
»Nichts zu machen, ihre Hand ist ja wie aus Stahl!«
Der Fahrer schaute abwechselnd auf den Verkehr vor ihm und das Chaos hinter ihm. Bloß keinen Unfall bauen. Bloß keine Kugel abbekommen.
»Die ist in Schockstarre. Kugelt ihr den Daumen aus!«
Einer von ihnen griff nach dem Gewehrlauf, um ihn unter Kontrolle zu halten, der andere bog den Daumen mit aller Kraft nach hinten, bis er ihn ausgerenkt hatte.
Endlich fiel die Waffe mit einem metallenen Aufprall zu Boden.
Während der gesamten Zeit hatte sie, trotz ihrer Schmerzen und der Panik, die sie erfasst hatte, den Blick nicht ein einziges Mal von ihnen abgewandt. Gelähmt vor Angst war sie, aber bei vollem Bewusstsein. Das linke Auge hielt sie starr auf die beiden Männer gerichtet, mit dem rechten konnte sie vor lauter Blut nichts sehen.
Es kehrte Ruhe ein, und die drei Sanitäter konzentrierten sich wieder auf ihre Mission.
Es galt, eine Polizistin zu retten.
ERSTER TEIL
Mitten ins Gesicht
1
16 Minuten früher.
5.58 Uhr. Die zivile Einsatzgruppe stand vor der Tür der Wohnung Nr. 22 im schlecht beleuchteten zweiten Stock eines heruntergekommenen Gebäudes in der Pariser Banlieue. Sie mussten Punkt sechs Uhr abwarten, um legal eine vorläufige Festnahme vornehmen zu können. Wenn sie nur eine Minute vorher loslegten, würde dies als Verfahrensfehler eingestuft werden und die gesamten Ermittlungen zunichtemachen. Das Drogeneinsatzkommando hielt die Pumpgun und die Elektroschockpistolen bereit zum Einsatz. Die hydraulische Spreize wurde an jeder Seite der Tür befestigt, um sie zu gegebener Zeit in die Luft zu jagen. Die sechzig Sekunden tickten in unverhältnismäßiger Langsamkeit zur angsterfüllten Aufregung, die von den Polizisten Besitz ergriffen hatte. Die Stille lastete schwer, nur das Rascheln der Kleidung war zu hören, wenn sie ungeduldige Handbewegungen machten.
Noch einmal überprüften sie, ob ihre Magazine geladen waren. Ob ihre kugelsicheren Westen richtig saßen. Riefen sich den Einsatzplan sowie den Grundrissplan dieses Sozialbaus in Erinnerung, den ihnen das Katasteramt gestern ausgedruckt hatte: Flur. Wohnzimmer. Schlafzimmer links. Küche rechts. Bad am Ende des Flurs. Vier Fenster. Kein Hund, zumindest laut Hausmeister.
Nach all den Wochen, die sie auf diesen Moment hingearbeitet hatten, gingen sie auf dem Zahnfleisch. Sohan war ein Dreckskerl, der sein Kokain mit Heroin streckte, um seine Kunden schon mit der ersten Line süchtig zu machen. Sohan war ein bis an die Zähne bewaffneter Dealer, an dessen Händen das Blut zahlreicher Konkurrenten klebte, die er beiseitegeschafft hatte. Er gehörte dingfest gemacht. Für das Gemeinwohl.
5.59 Uhr. Noch eine Minute bis zu Aufruhr und Geschrei. Bis zur gewaltsamen Konfrontation und Adrenalinausschüttung. Sohan würde nicht einfach so klein beigeben. Das war allen klar.
5.59 Uhr und dreißig Sekunden. Im Auge des Zyklons. Die Ruhe vor dem Sturm. Hauptkommissarin Noémie Chastain stand an vorderster Front. Wie immer. Sie war Teamleiterin, und das mit Leib und Seele.
5.59 Uhr und 58 Sekunden. Mit feuchten Händen zückte sie ihre Waffe.
6 Uhr. Der hydraulische Spreizer löste eine zehn Bar starke Druckwelle aus. Zunächst knackte das Holz leise, dann flog die Tür in die Luft und gab den Blick auf einen Flur frei, der einem gähnenden schwarzen Abgrund oder einem bösen Traum glich. Noémie tastete die Wand nach dem Lichtschalter ab und betätigte ihn. Die Glühbirne leuchtete auf und zersprang. Einige Augenblicke glommen die Glühfäden nach, bevor der Raum wieder im Dunkeln lag. Noémie hastete zum Schlafzimmer. Der Strahl der kleinen Leuchte, die auf ihrem Gewehrlauf befestigt war, glitt über die Umrisse der Wohnung. Der Flur war so schmal, dass man nicht zu zweit nebeneinander hindurchpasste Durch die Anwesenheit ihrer Truppe, die in geschlossener Reihe hinter ihr stand, bestärkt und dank der Hand auf ihrer Schulter unbesiegbar, denn es war Adriels Hand, die Hand ihres ersten Offiziers, ihres Vertrauensmanns und, um es kurz zu fassen, seit zwei Jahren ihres Freunds und Liebhabers, drang sie weiter in die Wohnung vor.
Sie trat die Schlafzimmertür ein. Eine Explosion ertönte, und im gleichen Moment blitzte es auf. Noémie konnte nichts mehr sehen, nicht mal den splitternackten Dealer, der auf seinem Bett kniete und ihr mit einem Jagdgewehr gerade mitten ins Gesicht geschossen hatte. Die Druckwelle zog eine heiße Spur hinter sich, und der beißende Geruch von Schießpulver lag in der Luft. Drang ihr in die Nase, den Mund, den Hals, legte sich auf ihre Augen.
Ihr Körper wurde zurückgeschleudert. Noémie prallte gegen die Wand und fiel unnatürlich verdreht wie eine Stoffpuppe zu Boden. Einige Sekunden lang spürte sie nichts. Dann schrie sie vor Schmerz auf. Sie tastete über ihr Gesicht. Eine einzige offene Wunde. Überall war klebrige Flüssigkeit. Dann sorgte ihr Gehirn zu ihrem Schutz für einen Blackout. Noémies Hand schloss sich wie ein Schraubstock um den Gewehrlauf. Was anschließend geschah, bekam sie nicht mehr mit. Adriel hatte schon zwei Schüsse abgegeben. Ein Treffer in die linke Schulter. Ein Treffer in die rechte Schulter. Dann Sohans Festnahme. Über den ganzen Tumult hinweg schrie der neue Rekrut der Truppe panisch und fast schluchzend ins Funkgerät: »Es hat einen von unseren Leuten erwischt! Es hat einen von uns erwischt!« Ihm war soeben bewusst geworden, dass Polizisten nicht nur in Filmen starben.
Adriel, der jetzt neben ihr kniete, hatte ihren Oberkörper etwas hochgehoben, um sie in die Arme zu nehmen.
»Noémie! Scheiße, Noémie! Bleib bei mir!«
2
In dem langen Flur des Militärkrankenhauses von Percy knallte die Trage gegen die Flügeltüren und drückte sie auf wie eine heftige Sturmbö während eines Gewitters. Die Oberschwester, die fast neben der Trage herrannte, erstattete dem diensthabenden Arzt Bericht.
»Eine Polizistin.«
»Selbstmord?«, fragte der Arzt routinemäßig.
»Nein. Ein Polizeieinsatz heute Morgen. Schussverletzungen. An Kiefer, Auge, Nase und Kopfhaut.«
Der Arzt hatte nur einen einzigen Blick auf Noémies Gesicht geworfen, und das hatte ihm gereicht. Die Dringlichkeit, die hektischen Eindrücke im Flur, die Neonlichter und das ganze Blut machten es ihm unmöglich, sich ein klares Bild von dem zu machen, was er da sah. Also hielt er sich an die Beschreibung der Krankenschwester.
»Holt mir mehr Leute! Ich brauche einen Anästhesisten, einen Augenarzt, einen Unfallchirurgen, einen Kieferchirurgen, noch mal doppelt so viele Krankenschwestern und Pfleger und einen freien OP.«
…
Noémies Mannschaft saß vollzählig im Wartesaal, und niemand vom Krankenhauspersonal brachte es übers Herz, sie darauf hinzuweisen, dass hier absolutes Rauchverbot herrschte. Adriel hatte das Gesicht in den Händen vergraben und hob jedes Mal, wenn die Tür aufging, den Kopf. Jonathan, der Neue, telefonierte mit seiner Frau, und während er beruhigend auf sie einredete, rauchte er eine nach der anderen, wobei er sich mit einer zu Ende gerauchten Zigarette jeweils die nächste anzündete. »Es geht mir gut.« »Gib mir mal die Kinder.« »Es geht mir gut.« »Es geht mir gut.« Chloé weinte still vor sich hin und wischte sich die Tränen mit dem Ärmel eines rosafarbenen Pullis ab, auf dem »U.P.D. Unicorn Police Department« stand.
Der Vormittag ging vorüber. Dann der Tag. Die Sonne ging unter. Kollegen und Freunde aus anderen Polizeiwachen schauten vorbei. Von hier und aus anderen Bezirken. Mal befanden sich vier, mal dreißig Personen im Wartesaal, bei allen lagen die Nerven blank.
Die Chirurgen des Krankenhauses in Percy, das auf zerstörte Visagen und Verletzungen als Resultat von Militär- sowie Polizeieinsätzen spezialisiert war, lösten sich im Laufe der Not-OP immer wieder ab. Manchmal, weil sie müde waren, manchmal, um einem anderen Spezialisten Platz zu machen. Die Rettungsaktion dauerte siebeneinhalb Stunden.
3
Postoperative Besprechung.
Militärkrankenhaus Percy.
»Die Rettungssanitäter, um 6.37 Uhr«, antwortete der Chirurg auf die Frage des ärztlichen Direktors.
»Und weiter?«
Der Chirurg und andere Fachärzte saßen in einem großen verglasten Saal um einen Tisch, der fast den ganzen Raum ausfüllte. Er fuhr mit seinem Bericht über diesen bewegten Vormittag fort:
»Schussverletzungen im Gesicht. Sie hängt am Tropf mit Physiodose und Schmerzstillern. Den hatten die Sanis ihr schon in der Ambulanz angelegt. Alle Vitalfunktionen waren stabil, als sie in den Schockraum gebracht wurde. Wir haben sie mit dem MRI auf weitere Verletzungen untersucht, aber kein MRT gemacht, denn sie steckt voll mit Schrot, das wäre total wahnwitzig gewesen.«
»Wo haben wir Schrot?«
»Überall. In der Zunge, im Kinn, im Kiefer, in der Stirn und der rechten Wange, die vom Schuss fast vollständig zerfetzt wurde. Wir haben sie wieder zusammengenäht, die Naht ist uns gut gelungen, aber sie wird eine unschöne kreisförmige Narbe davontragen, die sich über die gesamte Gesichtshälfte zieht.«
»Wir hatten schon lange keine multidisziplinäre, derartig spannende Operation mehr«, kommentierte der Direktor zufrieden. »Erzählen Sie uns mehr. Was ist mit dem Schädel?«
Der Chirurg betätigte die Fernbedienung und schaltete den großen, an der Wand befestigten Bildschirm an, auf dem er nach und nach die Röntgenbilder und MRI-Scans präsentierte.
»Der Schädel ist unversehrt, aber rechtsseitig ist die Kopfhaut partiell verbrannt, und ich habe keine Ahnung, ob und wie die Haare nachwachsen werden. Da wir ihr für die OP sowieso den ganzen Schädel kahl rasieren mussten, werden wir das bald erfahren.«
»Was ist mit Ohr und Gehörgang?«
»Das Trommelfell ist ziemlich mitgenommen. Vielleicht mit einhergehendem temporärem Hörverlust, mal sehen.«
»Das Auge?«
»Hat eine gestillte subkonjunktivale Blutung. Sie wird ein paar Wochen ein schönes periorbitales Hämatom haben. Nur ein blaues, blutunterlaufenes Auge, wodurch ihr Sehvermögen keinen Schaden nehmen wird.«
»Die Nase?«
»Wurde durch die Druckwelle gebrochen. Ist operiert.«
»Der Kiefer?«
»Der Unterkiefer ist einseitig am aufsteigenden Ast gebrochen. Wir mussten ihn mit drei Stahlplatten verschrauben. Sie wird erst mal nicht sprechen können. Die nächsten acht bis zehn Tage wird sie durch eine Sonde ernährt, im Anschluss erhält sie drei Wochen lang eine Mischung aus fester Nahrung und Gelwasser.«
»Sie hatte offensichtlich großes Glück im Unglück.«
»Ja, fünf Zentimeter weiter links, und das ganze Gesicht wäre zerfetzt worden. So oder so wird es allerdings kein schöner Anblick sein. Die Wange musste nicht nur mit sechzig Stichen wiederhergestellt werden, auch jede einzelne Schrotkugel wird eine Narbe hinterlassen. Aus chirurgischer Sicht gibt es auf jeden Fall nichts mehr zu tun.«
Alle Blicke hefteten sich jetzt auf den Psychiater der Klinik.
»Mal was anderes als Ihre Soldaten, was, Melchior?«, kommentierte der Direktor ironisch.
»Nicht wirklich«, erwiderte der Psychiater kühl. »Ob bei einem Einsatz verletzt oder als Polizist im Außendienst. Sie unterscheidet sich in nichts von meinen Soldaten. Ich würde diesen Fall gern persönlich übernehmen, wenn niemand etwas dagegen hat.«
Vor vier Tagen war er aus dem Euphrat-Tal im Irak zurückgekehrt, wohin er die französischen Truppen der Task Force Wagram begleitet hatte. Seitdem Melchior seinen Dienst im Militärkrankenhaus Percy wiederaufgenommen hatte, wusste er in seinem Büro nichts mit sich anzufangen und tat sich schwer damit, wieder zur Tagesordnung überzugehen. Noémie Chastains Fall hatte ihn aus seiner Lethargie geholt. Mit seinen weißen, nach hinten gekämmten Haaren überragte er alle um einen Kopf und ergriff mit der natürlichen Autorität eines gestandenen Mannes, der die fünfzig überschritten hatte, das Wort:
»Ich schlage vor, sofort und parallel zur Nachsorge und Rehabilitation mit der Therapie zu beginnen. Je früher ich anfange, mit ihr zu sprechen, desto besser kann ich die psychischen Schäden einschätzen. Ich habe es hier mit mehreren Patientinnen in einer Person zu tun. Da gibt es die Polizistin, die vielleicht nie mehr in den Dienst zurückkehren kann. Die Frau, die möglicherweise Angst davor hat, nicht mehr begehrenswert zu sein. Die erwachsene Frau, die das Gesicht einer Fremden entdecken wird und damit leben muss. Und das Kind in ihr, das Todesangst haben muss. Wir müssen sie gut vorbereiten, bevor wir versuchen, sie wiederherzustellen. Aber wir dürfen sie nicht anlügen. Wann kann ich sie sehen?«
»Sobald wir sie noch mal durchs MRI geschickt haben, um sicherzugehen, dass wir keinen Fremdkörper übersehen haben, beziehungsweise sobald sie die kiefer- und gesichtschirurgische Rehabilitation hinter sich hat, wenn Sie wollen, dass sie Ihnen antwortet«, sicherte ihm der Chirurg zu.
»Sie muss noch nicht mit mir sprechen können. Ich habe ihr erst mal einiges zu erzählen«, beendete Melchior das Gespräch und schloss sein Notizbuch.
4
Als sie die Augen öffnete, brannte sich das grelle Licht der Neonleuchten wie ein Schuss in ihre Netzhaut. Ihr Gehirn assoziierte das Gefühl mit dem letzten Ereignis aus ihrem Leben, Sohan zielte wieder auf sie und drückte ab. Ihr Körper bäumte sich auf, ihr Herz schlug schneller, und das EKG geriet außer Rand und Band, was sämtliche Geräte in Aufruhr versetzte und eine Kakophonie von Alarmsignalen zur Folge hatte, die wiederum die Krankenschwestern im Eilschritt auf den Plan riefen.
Sie hasteten an den Polizisten vorbei, die ihrerseits alle aufstanden.
Sobald das Licht im Zimmer ausgemacht wurde, beruhigte Noémie sich wieder, sie schloss die Augen und driftete zurück in einen Schlaf, der durch die Nachwirkungen der Anästhesie begünstigt wurde.
»Sie können sie noch nicht sehen«, vertröstete die Krankenschwester Adriel. »Es geht ihr gut, aber sie braucht Zeit.«
…
Mitten in der Nacht wachte Noémie wieder auf. Im Dunkeln war sie jetzt ruhiger. Sie tastete über die Decke, die sich etwas rau anfühlte. Das Bettlaken unter ihren Fingern war glatter. Durch das leicht geöffnete Fenster erblickte sie den schwarzen Himmel, dann wurden die Umrisse des Zimmers sichtbar, die aufgrund der Blutung im Auge allerdings verschwommen erschienen. Sie hob die rechte Hand, sah den geschienten Daumen und erinnerte sich an die Sanitäter und ihre angsterfüllten Schreie während der rasanten Fahrt zum Krankenhaus. Mit der gesunden Hand tastete sie über ihr Gesicht, sie spürte keine Haut. Verbände und Pflaster bedeckten ihre komplette rechte Gesichtshälfte. Trotz allem begann sie zu lächeln, denn es hatte einen Moment gegeben, da hatte sie geglaubt, dass sie ihre Augen niemals wieder öffnen würde. Sie fühlte sich lebendig an, so lebendig, denn das Morphium, das durch die Venen ihres Arms floss, sorgte dafür, dass die Schmerzen in diesem Augenblick keine Rolle spielten.
Im Warteraum nur ein paar Meter weiter schlief Chloé an Jonathans Schulter gelehnt, der selbst vom Schlaf übermannt worden war und mit nach hinten gekipptem Kopf da saß. Adriel, krank vor Sorge, war als Einziger wach. Die Krankenschwester gab ihm ein Zeichen.
»Sie ist wach geworden. Ich muss die Ärzte darüber informieren, aber ich gebe Ihnen eine Minute.«
Stundenlang hatte er gegrübelt, was er ihr sagen würde. Um ihr ein gutes Gefühl zu geben. Um ihr zu zeigen, dass er da war und dass er sie liebte. Schließlich ging er hinein, setzte sich auf den Sessel, der direkt am Bett stand, legte seinen Kopf auf Noémies Bauch und brach in Tränen aus. Sanft strich sie ihm übers Haar, um ihn zu beruhigen, um ihm zu sagen, dass sie doch noch da war und dass sie ihn auch liebte.
Die Tür ging auf, und Chloé und Jonathan erschienen auf der Türschwelle, wo sie stehen blieben. Der Anblick, der sich ihnen von dort bot, war nämlich völlig ausreichend.
5
Er betrat das Zimmer, als handelte es sich um sein Wohnzimmer.
»Guten Tag, Soldatin. Ich heiße Melchior. Haben die Ärzte Sie aufgeklärt? Wissen Sie, wer ich bin?«
Noémie musterte ihren neuen Gesprächspartner rasch, dann nickte sie. Der Psychologe legte ein Tablet mit weißem Bildschirm auf ihr Bett.
»Da Sie mir immer noch nicht antworten können, fangen wir mit einer lustigen Übung an und kehren die in der Psychiatrie gebräuchliche Praxis um. Das heißt, vor allem ich werde heute reden. Sie werden sehen, ich bin ein geschwätziger Typ. Zumindest hat das meine Frau immer gesagt.«
Er setzte sich neben sie und öffnete sein Notizbuch.
»Haben Sie Familie?«
Noémie schnappte sich das Tablet und tippte.
»Eine Mutter. London.«
»Sie ist in Ihren Krankenversicherungsunterlagen nicht als Kontaktperson für den Notfall aufgeführt. Um nicht zu sagen, da ist niemand aufgeführt.«
»Zehn Jahre«, schrieb Noémie.
Der Psychologe neigte den Kopf, um direkt mitzulesen.
»Zehn Jahre … haben Sie sich nicht mehr gesehen?«
Noémie nickte.
»Und dieser hübsche junge Mann, der die ganze Zeit im Flur herumgeistert, hat der einen Namen?«
»Adriel«, schrieb sie.
»Sie sind also nicht allein. Das ist gut. Um nicht zu sagen von größter Wichtigkeit. Ich werde jetzt ganz geradeheraus mit Ihnen sein, ihr Gesicht hat schlimme Verletzungen davongetragen. In vierundzwanzig Stunden, wenn die Krankenschwestern Ihre Bandagen abgenommen haben, wissen wir mehr. Ich bitte Sie, bis dahin eine kleine Übung zu machen, um sich darauf vorzubereiten. Eine Art Projektionstraining. Ich werde Ihnen jetzt die verwundeten Stellen aufzählen, und Sie müssen sich vorstellen, wie sie heute aussehen.«
Noémie blickte zu ihm hoch. Eines ihrer Augen war hellgrün, das Grün eines jungen Laubblattes, das andere war noch schwarz vom Blut. Melchior redete mit sanfter Stimme weiter:
»Ihre Haare sind abrasiert, aber das haben Sie sicherlich schon unter ihren Fingern gespürt. Ihre rechte Wange ist fast vollständig zerfetzt gewesen und wurde wieder zusammengenäht. Ihre gebrochene Nasse wurde schon gerichtet. Sie ist noch etwas geschwollen, es sind noch einige Blutergüsse zu sehen, aber sie ist wieder heil. Die Chirurgen haben Ihnen fünfzehn über das ganze Gesicht verteilte Schrotkugeln entfernt. Jede einzelne, vom Kinn bis zur Stirn, wird eine sternenförmige Narbe hinterlassen, die sich im Laufe der Jahre abschwächen wird.«
Noémie tippte heftig auf dem Tablet.
»Wann komm ich raus?«
Melchior schmunzelte.
»Eine tapfere Soldatin, mein erster Eindruck hat mich also nicht getäuscht«, sagte er und legte sein Notizbuch nieder. »Sie haben außerdem noch einen ausgerenkten Daumen und einen gebrochenen Kiefer. So viel zu den körperlichen Verletzungen. Die psychischen Verletzungen sind noch mal eine ganz andere Geschichte. Verstehen Sie mich nicht falsch, Ihre Hülle zu reparieren, das ist kein Problem. Aber unsichtbare Schäden sind weniger greifbar, sie zu reparieren ist notgedrungen weniger vorhersehbar. Ich gehe davon aus, dass Sie das Krankenhaus in einem Monat verlassen können. Aber wir werden danach noch jede Menge Sitzungen miteinander haben. Sie und ich, wir werden uns noch sehr gut kennenlernen.«
6
Militärkrankenhaus, Percy.
Vierter Morgen.
Die Krankenschwester gab Melchior die Zeit, die er brauchte, um seiner Patientin gut zuzureden. Noémie hatte die letzten zweiundsiebzig Stunden damit verbracht, auf genau den Moment zu warten, den sie jetzt hinauszuzögern versuchte.
»Sind Sie bereit?«, fragte Melchior.
Nein. Noémie schüttelte entschieden den Kopf.
»In Ordnung. Dann lassen wir das so. Wer weiß? Vielleicht werden Bandagen diesen Sommer der letzte Schrei?«
Das Monokelhämatom war schwächer geworden, und das Schwarz um ihr Auge war einem Karminrot gewichen, was nicht wirklich schöner anzusehen war. Trotz allem spürte Melchior die Ungeduld hinter der momentanen Angst.
»Verschieben wir es auf morgen?«
Noémie griff nach seiner Hand, ganz sanft, wie ein Kind, das sich an seinem großen Bruder festhält.
Melchior ließ den in der Psychiatrie wenig üblichen Körperkontakt zu und drückte ihre Hand, um ihr zu verstehen zu geben, dass er nirgendwo hingehen würde.
So sanft, wie es nur eben ging, begann die Krankenschwester, die Bandage von ihrem Kopf zu lösen, und ein vollständig rasierter Schädel kam zum Vorschein. Nach und nach entfernte sie den großen Verband auf Wange und Kiefer, entblößte zuletzt die Stirn. Nur der Gips blieb übrig, der in Form eines T auf dem gerichteten Nasenbein lag.
Je mehr kühle Morgenluft Noémie auf den nach und nach entblößten Bereichen ihrer Haut spürte, desto schneller ging ihre Atmung. Sie führte ihre Hand bis an ihr Gesicht heran, traute sich aber nicht, die Finger daraufzulegen. Bevor sie fühlte, wollte sie sehen, und bevor sie selbst sah, wandte sie ihren Blick zu Melchior. Die Hölle, das sind und bleiben immer die Blicke der anderen, die auf uns gerichtet werden. Die prüfenden Blicke, die Blicke, die uns davon abhalten, etwas zu wagen, die uns bremsen, die uns verletzen, die dazu führen, dass wir uns lieben oder hassen. Aber der Psychologe sah sie nur mit diesem unerträglichen Wohlwollen professioneller Art an.
Sie richtete sich auf ihrem Bett auf, stellte vorsichtig die nackten Füße auf das saubere Linoleum und stand auf. Ein Meter trennte sie vom Spiegel, der an der Wand hing, und je mehr sie sich ihm näherte, desto länger schien der Meter zu werden. Als sie sich endlich im Spiegel erblickte, erkannte sie nichts. Niemanden. Dieses schreckliche Blutauge, das sie schon so oft bei verprügelten Frauen gesehen hatte und das jetzt den Gips überragte, den man sonst auf den Nasen von Boxern sah, die von ihren Gegnern niedergestreckt worden waren; der geschwollene Kiefer, der von drei Platten und zwölf Schrauben zusammengehalten wurde; die halbkreisförmige Narbe auf ihrer Wange, die aussah, als hätte sich ein tollwütiger Hund darüber hergemacht; und die fünfzehn Einschüsse, die über die gesamte rechte Gesichtshälfte verteilt waren, welche jetzt einer Notenrolle für alte Drehorgeln glich. Das alles wäre unerträglich gewesen, wenn es sich um Noémies Spiegelbild gehandelt hätte. Aber das war nicht sie.
Sie zwinkerte mit dem Auge, einmal.
Die Fremde im Spiegel zwinkerte auch.
Sie hatte sich darauf eingestellt, ihr Gesicht zu sehen, ihr entstelltes Gesicht, aber das war nicht mehr ihr Gesicht. Sie identifizierte sich nicht mit diesem anatomischen Modell ohne Haut, das sie anstarrte.
»Ich sehe mein totes Ich an.«
Mit angehaltenem Atem stand sie stocksteif da, ungläubig. Schließlich tastete sie die riesige Narbe mit den Fingern ab. Ein von Nähten durchzogener, geschwollener Halbkreis zog sich von ihrem Ohr über den Wangenknochen, an der Nase entlang, streifte ihre Lippen und zog sich weiter über den Kieferknochen bis zum Halsansatz.
Instinktiv drehte sie den Kopf so, dass sie im Spiegel nur die intakte Seite sah. Eine Träne perlte über ihre Vergangenheit. Dann drehte sie dem Spiegel ihr rechtes Profil zu. Die Frau, die sie kannte, war verschwunden und hatte einem unbekannten und entstellten Monster Platz gemacht. Auf einmal gingen die Wände auseinander, ein Abgrund tat sich auf und sog sie ein. Melchior konnte sie so gerade eben auffangen, bevor sie ohnmächtig zusammensackte.
…
Noémie lag wieder in ihrem Bett, das Laken war absichtlich so weit hochgezogen, dass verborgen blieb, was sie weder akzeptieren noch zeigen wollte, nicht mal einem Arzt wie Melchior. Sie schwieg. Zerstört, verloren, unfähig, der Realität ins Auge zu schauen.
»Ihre Narbe hat die Form einer Mondsichel. In ein paar Jahren wird nur eine feine Linie davon zu sehen sein.«
Das Bettlaken wurde noch etwas höher gezogen.
»Wussten Sie eigentlich, dass sich die Sternenkonstellation des Steinbocks aus fünfzehn ganz besonders leuchtenden Sternen zusammensetzt? Genauso viele Sterne wie in Ihrem Gesicht.«
Noémie schnappte sich das Tablet und tippte aufgebracht: »Hören Sie auf!!!«
Dann ließ sie sich mehr Zeit, um eine Wut auszudrücken, die nichts auf der Welt mehr zurückhalten konnte.
»Sie wollen mich mit Bildern beruhigen! Mein Riesenschmiss gleicht einem Mond. Meine Narben sind Sterne. Ich bin doch keine fünf mehr. Sparen Sie sich das. Ich will das nicht. Gehen Sie zur Hölle mit Ihrer Sternenkonstellation des Steinbocks.«
Melchior lächelte traurig. Da tippte Noémie verlegen: »Entschuldigung.«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Sie hätten sogar das Recht, den gesamten Planeten zu beschimpfen. Sagen Sie mir eher, was ich für Sie tun kann.«
»Ich will nach Hause. Mich verstecken. Zurück zu meiner Katze. Lassen Sie mich nach Hause gehen. Ich flehe Sie an.«
»Bald, Noémie, bald. Wir dürfen nichts übereilen. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass für heute Nachmittag ein Besuch ansteht. Sie sind aber nicht dazu verpflichtet. Sie bestimmen das Tempo. Sie entscheiden. Adriel kann noch warten.«
Noémie zuckte zusammen. Adriel! Das kam überhaupt nicht infrage! Nicht so. Nicht in diesem Zustand. Nicht mit dieser zerfleischten Fresse.
»Ich weiß, dass Sie Angst davor haben, aber Ihr Umfeld wird Ihnen mindestens genauso guttun wie die Sitzungen, die wir miteinander haben. Adriel kann für zwei stark sein, wenn Sie nicht mehr stark sein können. Schauen Sie sich nicht im Spiegel an, sondern schauen Sie sich in seinen Augen an.«
»Und wenn er das nicht aushält?«
»Sollte das passieren, dann werden wir andere finden, die für Sie da sind. Aber ich bitte Sie, ihn nicht vorschnell zu unterschätzen.«
Bevor er das Zimmer verließ, ordnete Melchior den Krankenschwestern an, ihn darüber zu informieren, sobald Besuch im Anmarsch war. Er musste ihn vorab unbedingt auf die Begegnung mit Noémie vorbereiten.
7
Der Zufall wollte es, dass Adriel während eines Schichtwechsels und der Akutversorgung eines Patienten, der an Atemnot litt, eintraf und einen menschenleeren Krankenhausflur durchquerte, bevor er an Noémies Zimmertür klopfte und irgendjemand die Gelegenheit gehabt hätte, ein paar Worte mit ihm auszutauschen und ihn darauf vorzubereiten, was ihn erwartete.
Auf der Wache hatten Chloé und Jonathan, auch ohne dass Adriel was sagen musste, verstanden, dass er sie beim ersten Mal allein sehen wollte.
Leise öffnete er die Tür und erblickte Noémie, die auf dem Bett döste. Von der Türschwelle aus war nur das linke Profil seiner Partnerin zu erkennen, aber als sie sich, durch einen Albtraum aufgeschreckt, umdrehte, zog sich sein Herz zusammen. In genau diesem Moment öffnete sie die Augen, worauf sie ihr Gesicht so schnell und so gut sie konnte versteckte. Die Tatsache, dass sie gegen ihren Willen angesehen wurde, fühlte sich wie eine Vergewaltigung an, ein Angriff, wie ein gewaltvolles Eindringen bis in ihr intimstes Inneres. Wie sollte sie Adriel mit einem Gesicht anschauen, das nicht ihres war, einem Gesicht, das sie niemals akzeptieren würde? Und auch wenn er sich schnell wieder im Griff hatte, Adriels überraschter Gesichtsausdruck und sein kaum merkliches Zurückweichen würden sich für immer in Noémies Gedächtnis einbrennen.
Sie blieb so liegen, mit der Hand, die das halbe Gesicht verbarg, als müsste sie verschämt ihre Blöße bedecken, und sie ließ es geschehen, dass ihr Freund näher kam und sich neben sie setzte.
Mit einer kleinen Geste, die fast einem Streicheln gleichkam, berührte Adriel ihre Hand, womit er sie um Erlaubnis bat, ihre Verletzungen entdecken zu dürfen.
»Unterschätzen Sie ihn nicht«, hatte Melchior gesagt.
Würde Adriel damit fertigwerden? Kostete es ihn möglicherweise Überwindung? Er ließ sich diesmal nichts anmerken und musterte gefasst eine Narbe nach der anderen. Noémie fühlte Scham in sich aufsteigen, als hätte sie sich diese Wunden selbst zugefügt. Jede Sekunde, die er sie inspizierte, war ihr unerträglich. Bliebe doch nur die Zeit stehen, und wäre es auf einmal zehn Jahre später, damit die Narben verblasst und von dem Unfall nur noch Spuren sichtbar wären, wie von einem vergangenen Krieg, wenn die Einschüsse in den Mauern einer befreiten Stadt im Laufe der Jahre verwitterten. Wenn das Zimmerfenster jetzt doch nur weit aufginge und ein Luftzug Adriel in ein anderes Land beförderte.
Aber das Fenster blieb geschlossen, und die Zeit verging so zäh wie noch nie. Ihr immer noch verschraubter Kiefer ließ kaum etwas anderes als ein albernes Gemurmel zu, und sie traute sich zusätzlich zu ihrem abstoßenden Aussehen nicht, auch noch ein unverständliches Gestammel von sich zu geben. Und da Adriel genauso stumm war wie sie, hätte sie alles darum gegeben, um auf der Stelle zu sterben.
Dann lächelte er. Es war das Lächeln, mit dem er sie während ihrer ersten Begegnung schon rumgekriegt hatte. Es folgte ein leises: »Ruh dich aus, ich komme nach meinem Dienst noch mal vorbei.« Und dann hauchte er ihr einen Kuss auf die Lippen, einen Kuss, der so weich war wie die Haut eines Neugeborenen.
»Unterschätzen Sie ihn nicht«, hatte Melchior gesagt, »Adriel kann für zwei stark sein, wenn Sie nicht mehr stark sein können.«
…
Adriels Silhouette zeichnete sich im Schein der aufgehenden Sonne im Krankenhausflur ab. Auf halber Strecke zum Fahrstuhl blieb er abrupt stehen. Er lehnte sich an die Wand, holte tief Luft und ließ seine Anstandsmaske fallen, die wie eine bleierne Ritterrüstung auf ihm gelastet hatte. Dann brach er in Tränen aus und begann, mit den Fäusten gegen die Wand zu trommeln. Aus dem Trommeln wurde richtiges Boxen, Faustschlag für Faustschlag, immer kräftiger, ohne auf den Schmerz zu achten und die Haut, die von Mal zu Mal mehr aufplatzte.
Dieses Gesicht. Es tat ihm so leid. Dieses Gesicht. Das würde er nicht schaffen.
Als Melchior seinen Dienst antrat, begegnete er einem jungen Mann, der vor Kummer überwältigt war. Sofort erkannte er Adriel, Noémies Liebsten, der seit dem Unfall im Krankenhausflur herumgeisterte.
Hatte er die Situation akzeptiert?
Oder hatte er nur so getan?
Melchior glaubte so etwas wie ein Verweigern zu spüren. Ein Aufgeben. Eine bevorstehende Flucht.
8
Militärkrankenhaus, Percy.
28. Morgen.
In den letzten vier Wochen hatten Chloé und Jonathan sie einige Male besucht. Jede Menge Zeitschriften hatten sie mitgebracht, Zigaretten und einen Abend – die Krankenschwestern hatten alle Augen zugedrückt – sogar ein Fläschchen Rum, das seine Wirkung gezeigt hatte. Die zwei fanden immer neue plausible Entschuldigungen, um Adriels unangenehme Abwesenheit zu erklären. Komplizierte Ermittlungen. Ein Einsatz in einer der Vorstadthochhaussiedlungen, der vorbereitet werden musste. Ein Spitzel, der neue Instruktionen benötigte. Aber Noémie hatte schon lange verstanden. Wahrscheinlich seit dem Kuss, den er ihr auf die Lippen gehaucht und den sie für Liebe gehalten hatte, bevor ihr klar geworden war, dass es nur ein Abschiedskuss gewesen war.
Der Gips auf der Nase war verschwunden, den rechten Daumen konnte sie wieder bewegen, und nach langen Sprechtherapiesitzungen gelang es ihr jetzt, Worte zu artikulieren, ohne dass sie beim Klang ihrer Stimme lachen musste, verstummte oder sich ihre Augen mit Tränen füllten. Übrig geblieben war nur dieses Schlachtfeld von Gesicht. Unerträglich.
Einen guten Zentimeter waren ihre Haare innerhalb der letzten achtundzwanzig Tage gewachsen, und aus der Skinhead-Glatze war die Chemo-Frisur geworden. Mittlerweile hatte sich herausgestellt, dass der Schuss die Dermis der Kopfhaut stark genug verletzt hatte, um die darin befindlichen genetischen Informationen derart durcheinanderzubringen, dass die Haare machten, was sie wollten. Das Haar über der rechten Schläfe wuchs silbergrau nach. Früher oder später würde sie also eine weiße Haarsträhne haben, die wie ein Pinselstrich ihre rote Mähne unterteilen würde.
Sie packte ihre Tasche fertig, holte noch zwei, drei Sachen aus dem Duschraum und setzte sich aufs Bett, wo sie brav wartete und dabei die Füße wie ein ungeduldiges Kind hin und her schwang. Jede ihrer Bewegungen in dem Zimmer war auf den Millimeter genau abgestimmt, um den Bereich um den Spiegel herum zu vermeiden. Sie hätte ihn auch einfach abhängen, umdrehen oder kaputt hauen können, aber er stand für die Blicke derjenigen, die sie zukünftig anschauen würden, derjenigen, denen sie begegnen würde, wenn sie einmal draußen war. Draußen würde sie zwar den Kopf senken, das Gesicht abwenden oder sich ein bisschen verstecken können, aber sie würde niemanden darum bitten können, mit nach oben gewandtem Blick an ihr vorbeizugehen, und sie würde auch nicht allen die Augen ausstechen können. Schade. Also musste sie sich besser schon mal daran gewöhnen.
Als Melchior in Noémies Zimmer trat und sie abfahrtsbereit dasitzen sah, zog sich sein Herz zusammen. Denn … »bereit« traf es nicht so ganz. Noémie hatte keine Vorstellung davon, was auf sie zukommen würde, und für ihn fühlte es sich so an, als würde er ein autistisches Mädchen vor dem Eingang einer öffentlichen Schule allein zurücklassen. Aber Noémie würde wohl niemals richtig bereit sein, und heute war so gut wie jeder andere Tag, um sie aus dem Krankenhaus zu entlassen.
»Ich gebe Ihnen Ihr Tablet zurück«, sagte sie anstelle einer Begrüßung. »Ich brauche es nicht mehr und habe alle Filme darauf gesehen. Nur französische Schwarz-Weiß-Filme. Ich sollte Sie mal ins Kino einladen, seit den 1970er-Jahren hat sich nämlich einiges getan.«
Melchior hatte sich an dieses automatische Reden gewöhnt. Gespött, Beschimpfungen, Banalitäten, als ginge die Patientin all das gar nichts an. Tatsächlich war diese Art zu reden eine reine Schutzfunktion, und das, was sich wie Geplapper anhörte, konnte auch ein tief sitzendes Trauma verbergen.
Auch wenn Noémie so tat, als wäre sie wieder kerngesund, war sie alles andere als das. Er gab ihr lieber noch einmal mit auf den Weg, wie sie zukünftig damit umgehen sollte, wenn sie anders reagierte als sonst.
»Achten Sie ganz besonders auf sich und versuchen Sie, Ihre Reaktionen zu analysieren. Wenn sie anders reagieren als früher, kann es am Unfall liegen. Dann müssen Sie etwas dagegen tun.«
»Wie soll das aussehen?«
»Das werden Sie schon sehen. Ich lasse die Probleme lieber von allein kommen, als dass ich sie anziehe. Manchmal reicht es schon, nur darüber zu reden, um ein Problem zu erschaffen. Unser Gehirn weiß so gut, wie es uns krank machen kann.«
»Und ich, ich bin Flic, und ich mag keine Überraschungen. Seien Sie bitte klar und deutlich, und lassen Sie nichts aus.«
»Wie Sie meinen, Noémie«, kapitulierte der Psychologe.
Er massierte sich die Schläfen, während er sich zurechtlegte, womit er bei all den Begleiterscheinungen anfangen sollte.
»Rechnen Sie mit einem gewissen Aggressionspotenzial. Manchmal schon bei Kleinigkeiten. Dann wiederum aber auch mit einer überraschenden Passivität bei schwerwiegenderen Ereignissen. In den gleichen Ausprägungen werden Sie es mit Angstzuständen, Gereiztheit, niedriger Frustrationstoleranzgrenze, aber auch der Unfähigkeit, Freude zuzulassen, zu tun haben.«
»Ich bin zu einer Frau geworden, an der man seine wahre Freude hat. Ich bleibe bestimmt nicht lange Single.«
»Ach ja, das auch. Beißender Humor als Schutzschild«, fuhr Melchior fort. »Das sind Abwehrmechanismen Ihrer Psyche. Ihre Persönlichkeit wird sich bis in die kleinste Zellenstruktur verändern. So, wie Sie Ihr Gesicht nicht wiedererkennen, werden Sie möglicherweise auch von Ihren Reaktionen überrascht sein, die sich anfühlen, als wären sie von einer Fremden. Aber das alles, das wird nur Ihr neues Ich sein, und ein Großteil davon wird die Frau sein, die Sie immer waren.«
»Es fühlt sich an, als hätte mein Leben in diesem Krankenhaus angefangen. Ich weiß nicht mal mehr, wer ich war, bevor ich diese Hackfresse hatte.«
Melchior zuckte bei der kruden Wortwahl zusammen. Der Verlust der Selbstliebe stand ganz oben auf der Liste der postoperativen Reaktionen, aber er ging nicht weiter darauf ein.
»Was Ihre Erinnerungen und Ihr Gedächtnis betrifft … Ihre Todeserfahrung hat sie stark traumatisiert, und Ihr Gehirn hat wie ein guter Soldat reagiert, es hat Sie davon abgeschirmt, Sie in Sicherheit gebracht, es hat versucht, einige belastende Details zu löschen. Aber das, was es vor Ihnen verbergen möchte, ist zu mächtig. Da könnte man genauso gut versuchen, ein wildes Tier in einen Pappkäfig zu sperren. Hin und wieder wird etwas durchkommen. Zwangsgedanken, Flashbacks, die allein schon durch ein Geräusch oder einen Geruch ausgelöst werden können. Vor, während und nach dem Schuss hat eine mnestische hypercaptation stattgefunden.«
»Genau das wollte ich auch gerade sagen«, spottete Noémie.
»Entschuldigung. Einfacher gesagt, wir erinnern uns zum Beispiel alle ganz genau, was wir während der Attentate am 11. September gemacht haben. Unser Gedächtnis hat diesen Moment eingefangen und für immer eingeschlossen. Aber es hat auch parasitäre Informationen eingefangen. Der Raum, in dem wir uns aufgehalten haben, die Menschen, die dabei waren, die Kleidung, die wir zu dem Zeitpunkt trugen, die Farbe des Himmels oder der Geruch einer Mahlzeit, die zubereitet wurde. Diese parasitären Informationen sind es, die wieder unter der Oberfläche auftauchen und den Weg für die traumatische Erinnerung bereiten.«
»Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass ich nichts mehr unter Kontrolle habe, korrekt?«
»Nicht mehr viel, das ist richtig. Und was Ihr Gedächtnis betrifft, besteht die Möglichkeit einer Hypermnesie, das heißt, Sie können sich einerseits an die klitzekleinsten Details eines bestimmten Moments erinnern, aber auch das Gegenteil ist möglich: ein Kodierungsfehler im Kurzzeitgedächtnis, der bewirkt, dass sie die letzten fünf Minuten oder Stunden vergessen.«
»Ich hatte sowieso nicht vor, mich die nächsten Tage unter Leute zu begeben. Mir sagt es ungemein zu, mich in meinem Bett zu verkriechen.«
»Nachts wird es nicht viel einfacher werden«, führte Melchior daraufhin weiter aus. »Sie werden Albträume haben, womöglich werden Sie den Schuss immer wieder erleben, viel zu früh aufwachen oder unter Schlaflosigkeit leiden. Mit etwas Glück sogar all das in einer einzigen Nacht!«, frotzelte er, um die Stimmung aufzulockern. »Aber ich habe Ihnen ein Beruhigungsmittel verschrieben, das Sie sich, wenn Sie gleich gehen, abholen können. Das ist zum Übergang gedacht, gewöhnen Sie sich besser nicht dran, man kann schnell nicht mehr ohne.«
»Und dieses ganze Fachchinesisch steht schon in Ihrem Bericht, ja?«, hakte Noémie besorgt nach.
»Sie denken schon daran, Ihre Arbeit wiederaufzunehmen?«, folgerte Melchior.
»Ich bin nie etwas anderes gewesen als Polizistin. Ich könnte gar nichts anderes machen. Polizistin zu sein, das füllt mein ganzes Leben aus.«
Melchior zog fragend eine Augenbraue hoch, denn es geschah selten, dass er einem Gespräch nicht mehr folgen konnte. Aber Noémie erklärte genauer, was sie damit meinte.
»Nehmen wir einen Dicken. Der ist dick, und man sieht nur das. Er ist dick. Aber ein Dicker in Uniform, das ist ein Polizist. Man sieht dann nur noch das Amt, das er bekleidet. Erinnern Sie sich an den letzten Polizisten, der Ihre Anzeige entgegengenommen hat? Versuchen Sie es erst gar nicht, Sie haben vergessen, wie er aussah. Sie haben nur gesehen, was er darstellt.«
»Und Sie glauben, dass man vergessen wird, wer Sie sind, wenn Sie sich hinter Ihrer kugelsicheren Weste verstecken?«
»Korrekt. Wenn ich mich hinter einem Beruf, einem Dienstgrad, einer Behörde, einer Knarre verstecke, bin ich keine Frau mehr und noch weniger eine entstellte Frau. Ich bin einfach nur Polizistin. Und deswegen bereitet mir Ihr Bericht etwas Sorgen.«
Vor zwei Tagen hatte sich der Psychiater in sein Pariser Appartement zurückgezogen und mit seinem eingeschalteten Computer als einzige Lichtquelle den Namen der Patientin geschrieben. Noémie Chastain. Dann hatte er einen Armagnac getrunken, eine Zigarette geraucht und noch einige Anläufe genommen, bevor er vor einer fast weißen Seite kapituliert hatte.
»Mein Bericht beinhaltet nur die vorgeschriebene dreißigtägige Rekonvaleszenzzeit zu Hause«, improvisierte er. »Wenn ich Sie davon abhalten würde, Ihren Beruf auszuüben, dann würde ich Ihnen damit nur noch weiteren Schaden zufügen. Alles andere klären Sie mit Ihren Vorgesetzten. Dennoch verdonnere ich Sie zu einer Therapiesitzung pro Woche.«
»Mit Ihnen?«
»Sie scherzen wohl. Natürlich mit mir.«
Die Aussicht darauf schien die Polizistin tatsächlich zu beruhigen, was den Doktor ein kleines bisschen stolz machte.
»War’s das ansonsten? Sind Sie fertig? Ich fühle mich, als wäre ich Rotkäppchen, das von seiner Mama gecoacht wird, bevor es durch den Wald läuft. Eigentlich wollen Sie, dass ich noch ein paar Tage bleibe, stimmt’s? Sie sind nicht gerade dabei, sich in mich zu verlieben, Melchior, oder?«
»Guten Gewissens könnte ich Sie nicht noch länger von Ihrer Katze trennen. Da fällt mir ein, Sie haben mir nie gesagt, wie Ihre Katze heißt.«
»Ich habe keine Ahnung«, antwortete sie ehrlich.
9
Noémie blieb in der Eingangshalle des Krankenhauses stehen, die sie wie ein faradayscher Käfig umgab und gegen die Blitze der Welt da draußen schützte. Melchior stand an ihrer Seite. Auf ihrem Koffer klebte noch ein Adressaufkleber mit Vor- und Nachnamen sowie Adresse ihres letzten Urlaubs mit Adriel. Bali, Indonesien, von dort hatte sie auch das geflochtene blaue Armband an ihrem Handgelenk, das sie als Souvenir mitgebracht und vor einigen Tagen schließlich abgemacht hatte.
Eine eigentlich schöne Erinnerung, die durch das Verhalten ihres Lebensgefährten zerstört worden war, weshalb sie jetzt frustriert den Aufkleber abriss. Ein kleiner Fetzen mit einem winzigen, lesbaren Ausschnitt ihrer Identität blieb auf dem Koffer zurück und zerriss ihren Namen in zwei: No.
Noémie war durch einen Schuss in einer schäbigen Vorstadtwohnung gestorben, und No schaute jetzt durch die Glasfront des Krankenhauses hinaus auf die Menschenmenge der Lebenden.
»Wenn Ihnen die Vorstellung, durch die Straßen zu gehen und die Métro zu nehmen, Angst macht, kann ich Sie beruhigen, ich habe Ihnen ein Taxi gerufen«, munterte Melchior sie auf.
Sie zögerte. Zu gehen. Ihn zu umarmen.
»Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, für all das, was Sie für mich gemacht haben, Doc.«
»Unsere Arbeit miteinander hat gerade erst richtig angefangen, Soldatin.«
…
Vor ihren Augen zog Paris dahin, turbulent und voller Menschen. Sie fühlte sich wie eine Fremde in dieser Stadt, deren Straßen und Gassen sie doch in- und auswendig kannte. Paris schüchterte sie ein und überwältigte sie, ein Gefühl, wie wenn man aus einem Flughafen hinaustritt und sich eine neue Hauptstadt, ein neues Land vor einem auftut.
Der Chauffeur setzte sie vor einem bescheidenen, vierstöckigen Gebäude in einem ruhigen Viertel ab. Während der Fahrt hatte er nicht einmal einen prüfenden Blick durch den Rückspiegel auf seine Kundin geworfen.
Noémie wusste sein Desinteresse zu schätzen.
Vor dem Eingangsbereich grüßte sie ihre Katze, die schwarz und unbeweglich für immer auf der Mauer unter der Gegensprechanlage verewigt saß, genau da, wo ein Straßenkünstler sie vor zwei Jahren hingesprayt hatte. Keiner der Mieter hatte sich darüber beschwert, und einen Pinsel hatte auch niemand in die Hand genommen, um die Katze unter einer weißen Farbschicht verschwinden zu lassen.
Eine Katze, die keine Haarbüschel auf dem Sofa hinterließ, kein stinkendes Katzenklo brauchte und nicht ständig um Aufmerksamkeit heischend miaute. Die perfekte Katze. Ihre Katze.
Noémie schloss die Wohnungstür hinter sich und fand ihre Wohnung genauso vor, wie sie sie vor achtundzwanzig Tagen zurückgelassen hatte: ein paar achtlos hingeworfene Kleidungsstücke, das Spülbecken halb voll mit Geschirr, ein verkrüppelter, eingegangener Fikus – eine typische Junggesellinnenbude. Allerdings hatte sie vor dem Unfall noch Pläne geschmiedet, ihre Wohnung aufzugeben und mit Adriel zusammenzuziehen. Ein T-Shirt, das vergessen auf dem ungemachten Bett lag, war alles, was ihr von ihrem Freund geblieben war. Während sie noch überlegte, ob sie es falten oder wegwerfen sollte, klingelte es an der Wohnungstür. Das konnte nur ihre Nachbarin sein, Madame Mersier. Sie klingelte nie einfach nur kurz, sondern ließ ihren knotigen Finger auf dem Klingelknopf liegen, als wäre sie dabei eingeschlafen.
»Wo waren Sie denn die ganze Zeit?«, fragte die alte Frau mit zittriger Stimme.
»Ich habe eine Ladung Schrot mitten in die Fresse bekommen. Ich musste vier Wochen in die Reparaturwerkstatt.« Madame Mersier, die vierundachtzig Jahre zählte und halb erblindet war, spitzte die Ohren.
»Sie haben was?«
»Ich habe gesagt, dass ich im Urlaub war. IMURLAUB!«, schrie Noémie fast, bevor sie ihr die Tür vor der Nase zuschlug.
Als sie wieder allein war, bedauerte sie kurz, dass die Welt nicht gänzlich aus desinteressierten Taxichauffeuren und halb blinden und beinahe tauben Omas bestand.
Sie begann damit, die Wohnung aufzuräumen, nahm aber die Kurve zwischen Wohnzimmer und Bad zu kurz und fand sich Aug in Aug mit einem Standspiegel wieder, der dort auf sie gelauert hatte. Diese Wunden und Nähte. Diese Narben. Und dann diese verdammte Steinbock-Sternenkonstellation. Schlagartig verging ihr die Lust, aufzuräumen und zu putzen.
Sie machte sich ein Bier auf und schluckte eine Beruhigungspille, genau das, wovon Melchior ihr abgeraten hatte. In einer Viertelstunde würde sie eine zweite Pille nehmen und sich dann in eine Decke gewickelt gepflegt auf die Couch fallen lassen, um mit Würde durch den ersten Nachmittag ihres neuen Scheißlebens zu kommen.
10
Büro der Generaldirektion der Kripo.
Das Büro des Polizeidirektors befand sich in der letzten Etage der Bastion, die seit 2017 das neue 36 quai des Orfèvres war, die berühmte ehemalige Adresse der Direktion der Pariser Kriminalpolizei. Der Polizeidirektor ließ den Leiter der vier Einheiten der Drogenfahndung hereinrufen, zu denen Noémie Chastains Mannschaft gehörte und die seit ihrer Verletzung von Adriel geleitet wurde. Auch der Psychiater des polizeipsychologischen Diensts war zu der Besprechung eingeladen worden. Da er jetzt zum ersten Mal die oberste Etage betrat, nahm er sich die Zeit, das Büro des Polizeidirektors in aller Ruhe zu betrachten: Eine Terrasse aus Stahl- und Rohholzkonstruktionen, auf der wetterresistente Ziersträucher verteilt waren, zog sich einmal um das Büro herum.Von hier oben hatte man einen Blick auf die weniger schönen Seiten der Stadt: Beton und Wolkenkratzer, Einheitsgrau und die von Autoabgasen schwere Luft der nur wenige Meter entfernten Ringautobahn.
»Noémie Chastain will ihre Einheit wieder übernehmen«, verkündete der Leiter der Drogenfahndungseinheiten in einem fast schon abschätzigen Ton.
»Ist sie denn schon seit dreißig Tagen aus dem Krankenhaus raus?«, fragte der Polizeidirektor verwundert.
»Nein, siebenundzwanzig. Aber es wird wohl kaum einen Unterschied machen, ob siebenundzwanzig oder zweiundvierzig, es heißt, ihr Anblick sei kaum auszuhalten.«
»Sorgen mache ich mir um was ganz anderes. Ein Hund, der einen Arschtritt verpasst bekommen hat, braucht eine Weile, bis er sich wieder streicheln lässt. Ein Polizist, der einen übel misslungenen Einsatz hinter sich hat, bekommt Zweifel an der Macht seiner Waffe und seiner eigenen Mannschaft. Aber gut, dass Sie ihr Aussehen ansprechen, denn ihr Gesicht, das bekommt nicht sie zu sehen, sondern wir. Es wird alle ständig daran erinnern, dass wir einen gefährlichen Job haben und dass es ein Team gab, das nicht in der Lage war, seine Vorgesetzte zu schützen. Der Anblick ihrer Verletzungen wird Angst und Schuldgefühle hervorrufen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.«
»Erfreulicherweise sind wir da also auf einer Linie. Dann sind wir uns einig, dass wir ein kleines, entspanntes Team für sie finden, vielleicht in der Brigade für Wirtschaftskriminalität oder in der administrativen Verwaltung, aber die Drogenfahndung hat sich damit für Chastain erledigt.«
»Und was ist mit der Organisierten Kriminalität?«, schlug der Polizeidirektor vor. »Immerhin war sie sechs Jahre dort im Einsatz.«
»Es geht doch nicht darum, wo sie im Einsatz war. In der O.K. werden die Ihnen auch die Ohren vollheulen. Niemand will sie haben, wir müssen sie loswerden.«
Der Psychiater wendete den Blick von der Terrasse und klinkte sich endlich mit in das Gespräch ein.
»Und wie wollen Sie vorgehen? Sie haben doch wie ich den medizinischen Bericht von Melchior, dem Oberarzt, gesehen?«
»Passen Sie mal auf«, erwiderte der Polizeidirektor genervt, »Sie sind hier der Polizeipsychologe, nicht dieser Melchior, oder? Ihre Einschätzungen werden mindestens genauso viel Gewicht haben wie seine.«
»Er ist immerhin eine Koryphäe in der psychiatrischen Rehabilitation nach wiederherstellungschirurgischen Eingriffen. Ich werde mich hüten, seine Einschätzung infrage zu stellen. Wie steh ich denn sonst da? Wenn er sagt, sie ist bereit, werde ich nicht einfach das Gegenteil behaupten.«
Das Schweigen, das sich in dem Büro ausbreitete, war voller Unmut und Enttäuschung.
»Haben Sie nicht noch ein Hintertürchen?«, wagte sich der Psychiater noch mal vor.
»Kein einziges. Es sei denn, sie verpatzt ihr Wiedereingewöhnungsschießen. Aber wir haben es mit Hauptkommissarin Chastain zu tun. Ich bezweifle, dass auch nur eine einzige ihrer Kugeln das Ziel verfehlt.«
»Ganz zu schweigen von den fünfundzwanzig Kilo reines Kokain, das bei dem Dealer Sohan Bizien gefunden wurde. Ordentlich geschnitten und grammweise weiterverkauft, kommen wir auf einen Wert von knapp neun Millionen Euro. Ist Ihnen eigentlich klar, dass wir hier über eine Heldin der französischen Kriminalpolizei sprechen?«
Der Direktor der Bastion knickte ein.
»Wir warten das Ende der angedachten dreißig Tage ab, die ärztliche Eignungsuntersuchung vor der Wiederaufnahme ihres Diensts, und wir stellen sie in den Schießstand. Dann werden wir weitersehen.«
…
Als der Polizeidirektor Noémie noch am gleichen Tag um 18 Uhr anrief, versuchte sie, sich ihre Aufregung nicht anmerken zu lassen.
»Ihr offizieller Dienstbeginn ist zwar in drei Tagen, aber Sie können sich mehr Zeit nehmen, das wissen Sie, ja?«, versuchte ihr Vorgesetzter ein letztes Mal, sie in die Untätigkeit zu locken.
»Nein, ich versichere Ihnen, ich bin bereit.«
Die Gardinen waren zugezogen, und Noémie saß im Schneidersitz auf der Couch. Mittlerweile zierte eine Kurzhaarfrisur ihren Kopf, eine Monatsration fettiger Lieferservice-Verpackungen, voller Aschenbecher und leerer Flaschen war um sie herum verteilt, und im Hintergrund lief der Fernseher mit ausgeschaltetem Ton. Seit einem Monat hatte sich ihre Kleiderauswahl auf drei vom Schlaf zerknitterte und muffige T-Shirts beschränkt. Noémie sah so bereit für das Berufsleben aus wie eine verwahrloste Einsiedlerin, die unter schwerer Depression litt.
»Also, ich bin so was von bereit.«
11
Drei Tage später.
»Ich fang heute doch nur wieder an zu arbeiten«, sagte sie sich, während sie sich noch über der Toilettenschüssel den Mund abwischte, weil ihr Magen wegen der heftigen Anspannung rebelliert hatte.