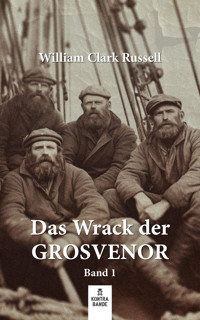3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: kontrabande Verlag, Köln
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Grosvenor - Die Entscheidung Im finalen Band der Serie stehen Kapitän und Besatzung vor der letzten, vielleicht größten Herausforderung: die Entscheidung zwischen ihrer Pflicht und dem Überlebenswillen. Während das Schiff Kurs auf gefährliche Gewässer nimmt, stellen sich die Männer der Grosvenor den Konsequenzen ihrer bisherigen Taten und müssen sich entscheiden, ob sie zusammenhalten oder endgültig auseinanderbrechen. Mit zunehmender Spannung entfaltet Russell das Finale der Grosvenor-Saga, in dem Mut, Ehre und die Kraft der Gemeinschaft über Leben und Tod entscheiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Das Wrack der Grosvenor zählt zu den eindrucksvollsten Seegeschichten des 19. Jahrhunderts. William Clark Russell erzählt die dramatische Geschichte eines Handelsschiffes, dessen Besatzung nicht nur gegen die Naturgewalten, sondern auch gegen Ungerechtigkeit und Verrat kämpfen muss.
Mit eindringlicher Präzision schildert Russell die raue Wirklichkeit des Lebens auf See, die Kameradschaft unter den Seeleuten und die Herausforderungen, die sie auf ihrer gefährlichen Reise bewältigen müssen. Ein zeitloser Klassiker, der die Härte und die Schönheit des maritimen Lebens in unvergesslichen Bildern einfängt.
Über den Autor
William Clark Russell war ein produktiver britischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, dessen Werke ihn zum Meister der Seegeschichte machten. Er wurde 1844 in New York als einer von vier Söhnen des englischen Komponisten Henry Russell und seiner Frau Isabella Lloyd geboren, die ihm ihre literarische Leidenschaft und ihren Sprachwitz vererbten. Russell verbrachte seine Schulzeit in England und Frankreich und plante sogar eine Reise nach Afrika, bevor er mit 13 Jahren die Schule verließ, um zur britischen Handelsmarine zu gehen.
Seine Jugendjahre auf See prägten ihn tief und dienten ihm später als unerschöpfliche Quelle für seine Geschichten. An Bord der „Duncan Dunbar“ lernte er die Härte und Strenge des Seemannslebens kennen und reiste bis nach Asien und Australien. Eindrücke wie die Eroberung der Taku-Festungen vor der chinesischen Küste oder die dramatische Begegnung mit einem psychisch labilen Offizier inspirierten ihn, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Diese Berichte führten schließlich zu einer Karriere als Schriftsteller, die ihm trotz gesundheitlicher Rückschläge großen Erfolg brachte.
Russells Werk ist bekannt für seine packenden Schilderungen des Lebens auf See und die Darstellung menschlicher Schicksale vor dem Hintergrund der rauen Natur. Sein bekanntestes Buch, The Wreck of the Grosvenor (1877), zählt zu den bedeutendsten Seefahrtsromanen seiner Zeit und vermittelt dem Leser Einblicke in die Gefahren und sozialen Dynamiken des viktorianischen Schiffsalltags. Russell verstand es, Spannung mit Authentizität zu verbinden und prägte damit das Genre des Seefahrerromans entscheidend.
Auch wenn sein Bekanntheitsgrad heute nicht an den seiner Zeitgenossen Charles Dickens oder Robert Louis Stevenson heranreicht, bleibt Russell für Liebhaber der Seefahrtsliteratur eine wichtige Figur. Werke wie The Frozen Pirate (1887) und An Ocean Tragedy (1890) zeigen seine Fähigkeit, Abenteuer und Übernatürliches miteinander zu verweben und die psychologische Tiefe seiner Figuren auszuloten. Neben seinen Romanen verfasste Russell zahlreiche Kurzgeschichten und Essays, die von der Seefahrt und dem Überlebenswillen der Menschen handeln.
Russells Werk umfasst auch biografische und historische Werke über die britische Seefahrtsgeschichte, die von seiner profunden Kenntnis und Leidenschaft für dieses Thema zeugen. Seine Erzählungen sind nicht nur Abenteuergeschichten, sondern auch eindrucksvolle Porträts der menschlichen Natur, von Mut und Verzweiflung bis hin zu Hoffnung und Sehnsucht. William Clark Russells Vermächtnis bleibt eine eindrucksvolle literarische Brücke in eine Zeit, als die Seefahrt noch Abenteuer und Entbehrung bedeutete und das Meer Bedrohung und Verheißung zugleich war.
Neben seinen Romanen war Russell auch für seine Kurzgeschichten und Essays bekannt, die oft in Zeitschriften veröffentlicht wurden und sich mit Themen der Seefahrt und des menschlichen Überlebenswillens befassten. Sie zeugen von seinem ausgeprägten Sinn für dramatische Erzählungen und seinem tiefen Respekt für die Menschen, die ihr Leben auf See verbrachten.
Russells literarisches Spektrum umfasste auch biografische und historische Werke, in denen er die Geschichte der britischen Seefahrt und berühmter Schiffsreisen nachzeichnete. Diese Schriften tragen zum Umfang seines Werks bei und zeugen von seinem umfassenden Wissen und seiner Leidenschaft für das Thema.
Zusammen bilden diese Werke ein beeindruckendes Vermächtnis, das den Leser in eine Zeit zurückversetzt, in der das Meer sowohl Verheißung als auch Bedrohung war - eine Welt, die Russell mit unvergleichlicher Detailtreue und erzählerischer Kraft wiedergab.
Über das Buch
Der erste Band von Das Wrack der Grosvenor beginnt mit der Einführung von Mr. Royle, dem ersten Offizier des gleichnamigen Handelsschiffes, das unter dem Kommando eines unerbittlichen Kapitäns steht. Schon bald wird deutlich, dass die Besatzung unter harten Bedingungen arbeitet und der Kapitän keinerlei Nachsicht mit seinen Männern hat. Sein erster Offizier, Mr. Duckling, ist ebenso skrupellos und führt Befehle ohne Rücksicht auf Verluste aus. Royle gerät in Konflikt mit der autoritären Schiffsführung, als er versucht, sich für die Männer einzusetzen.
Während die Grosvenor ihre Reise fortsetzt, zieht ein schwerer Sturm auf. Die Mannschaft kämpft gegen die Naturgewalten, doch gleichzeitig wächst die Unzufriedenheit unter den Seeleuten, die sich gegen die unmenschliche Behandlung durch den Kapitän zu wehren beginnen. Inmitten dieser Spannungen entdeckt man auf hoher See ein Schiff mit Schiffbrüchigen, darunter eine junge Frau und ihr Vater. Trotz des Widerstands des Kapitäns werden sie an Bord genommen.
Die Anwesenheit der Geretteten verschärft die ohnehin angespannte Lage, da sich herausstellt, dass sie von einem anderen Schiff stammen, das durch eine Meuterei übernommen wurde. Der Kapitän zeigt sich unerbittlich und weigert sich, ihnen Schutz zu gewähren. Royle, der sich zunehmend gegen seinen Vorgesetzten stellt, erkennt, dass er nicht länger untätig bleiben kann. Die Feindseligkeiten zwischen Kapitän, Offizieren und Besatzung eskalieren, und es wird deutlich, dass sich eine offene Rebellion anbahnt. Der erste Band endet mit wachsender Spannung, die sich in einer Meuterei entladen, während das Schiff weiter durch unsichere Gewässer fährt.
Im zweiten Band hat die Besatzung nach der blutigen Meuterei auf der Grosvenor das Kommando übernommen. Mr. Royle, der gezwungenermaßen die Navigation übernimmt, ist sich bewusst, dass er nur am Leben gelassen wurde, weil die Männer jemanden brauchen, der sie sicher ans Ziel bringt. Doch je näher die Grosvenor ihrem Bestimmungsort kommt, desto stärker wächst seine Furcht, dass die Meuterer ihn und die beiden Schiffbrüchigen, die er gerettet hat – die junge Mary Robertson und ihren geschwächten Vater – beseitigen werden, um keine Zeugen zu hinterlassen.
Während das Schiff seinen Kurs hält, spitzen sich die Spannungen an Bord zu. Die Mannschaft, ursprünglich von ihrem Hass auf den ehemaligen Kapitän angetrieben, ist zunehmend misstrauisch. Die Gefahr eines erneuten Gewaltausbruchs wächst. Royle und Mary erkennen, dass einige der Männer eine Intrige gegen sie schmieden. Der skrupellose Zimmermann Stevens scheint einen perfiden Plan zu verfolgen, und Royle wird klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Lage eskaliert.
In einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit sucht Royle nach einem Ausweg. Er versucht, heimlich Verbündete unter den Männern zu finden und eine Möglichkeit zur Flucht zu ersinnen. Doch die Mannschaft wird zunehmend unberechenbar, und jeder falsche Schritt könnte für ihn und die Robertsons den sicheren Tod bedeuten.
Inhalt
Cover
Kurzübersicht
Über den Autor
Über das Buch
Copyright
Disclaimer
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Hilf uns
Himmelsstürmer
Zwei Jahre vorm Mast
Nirgendwann
Der Job
Anne auf Green Gables
Guide
Contents
Start of Content
Impressum:
Erschienen im kontrabande Verlag, Köln.
Landsbergstraße 24 . 50678 Köln
Ungekürzte Ausgabe © 2025 kontrabande Verlag
Erstmals 1877 erschienen im Verlag Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, London, unter dem Titel „The Wreck of the Grosvenor“
Umschlagbild & Umschlaggestaltung: kontrabande Verlag, Köln.
Übersetzung: Mac Conin, kontrabande Verlag, Köln.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkungen nicht erkennbar. E-Book-Herstellung im Verlag.
ISBN 978-3-911831-02-4 Ebook
ISBN 978-3-911831-05-5 Taschenbuch
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.kontrabande.de
Viel Spaß beim Lesen.
Die Übersetzung wurde in Teilen leicht überarbeitet, um sie dem heutigen Sprachgebrauch anzupassen.
Kapitel I.
Die Wolkenbank, die um Mitternacht noch tief am nordwestlichen Horizont lag und flüchtig wirkte, hatte inzwischen so weit zugelegt, dass sie fast über unseren Köpfen hing. Was ihren Anblick noch bedrohlicher machte, war die stahlgraue Färbung des Himmels, die sie mit einer meist überraschend geraden, stellenweise jedoch zerklüfteten Linie von Nordosten bis Südwesten teilte. Der zentrale Bereich dieser gewaltigen Wolkenwand schimmerte in einem fahlen, fast leichenhaften Ton, der durch eine optische Täuschung konvex wirkte. In regelmäßigen Abständen zuckte ein scharfes, pfeilschnelles Licht durch die entferntesten Bereiche dieser Masse. Doch noch war kein Donner zu hören.
Unsere nächste Aufgabe war es, die Backbrassen zu bedienen und das Schiff auf einen westlichen Kurs zu bringen. Doch bevor wir uns an die Arbeit machten, blieben der Bootsmann und ich einige Minuten stehen und beobachteten den Himmel.
„Kommt der Regen vor dem Wind, reffe geschwind“, sang der Bootsmann vor sich hin. „Da steckt mehr als ein Viertel Zoll Regen drin, und hinterm Regen lauert noch was Schlimmeres.“
Das Unheilvollste an diesem herannahenden Sturm, falls es einer war, war seine langsame, fast unheimliche Annäherung.
Ich ließ mich davon jedoch nicht täuschen. Nur weil es die halbe Nacht gebraucht hatte, um sich bis zum Horizont aufzutürmen, bedeutete das nicht, dass kein Wind dahinter steckte. Ich hatte schon einmal einen Sturm dieser Art erlebt und erinnerte mich an die Worte eines Offiziers darüber: „Diese Stürme werden nicht vom Wind getrieben, sie erschaffen ihn. Sie tragen einen Orkan in sich, ziehen ziellos übers Meer und halten Ausschau nach Schiffen. Sobald sie etwas finden, das sich zu zerstören lohnt, schlagen sie zu. Lass dich nicht von ihrer gemächlichen Bewegung täuschen und halte sie nicht für gewöhnliche Gewitter. Sie brechen in völliger Windstille mit der Wucht eines Erdbebens über dir los. Sobald du einen solchen Sturm herankommen siehst, mach dein Schiff so klein wie möglich, bis zum letzten Reff, und halte ihm das Heck hin.“
„Ich überlege, Bootsmann,“ sagte ich, „ob wir das Schiff herumbringen oder es vor dem Sturm halten sollen. Was meint Ihr?“
„Da steckt ein Sturm drin, ich kann ihn riechen,“ erwiderte er. „Aber wir liegen doch sicher genug, oder?“ Er warf einen Blick nach oben zu den Masten.
„Das wird sich zeigen,“ sagte ich. „Wir können das Schiff dicht an den Wind bringen, wenn Sie wollen, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir später doch laufen müssen.“
„Das würde uns mitten in den Atlantik hinauskatapultieren, oder, Mr. Royle?“
„Ja. Ich wünschte, wir wären weiter nördlich von Bermuda. Aber egal, wir machen uns an die Rahen und versuchen unser Glück mit diesen kleinen Inseln.“
„Das sind doch fast nur Felsen, oder? Ich hab sie selber nie gesehen.“
„Ich auch nicht. Aber in Bermuda gibt es eine Werft, hab ich gehört, wo die Yankees manchmal ihre Schiffe überholen. Mehr weiß ich über die Inseln auch nicht.“
Ich bat Miss Robertson, das Ruder hart zu legen und zu halten, bis der Kompass nach Westen zeigte. Doch das Schiff hatte kaum Fahrt, da es nur wenig Segelfläche trug und der Wind schwach war. Es drehte sich so langsam, als würden wir es mit einer Boje nach Westen ziehen.
Nachdem die Rahen getrimmt und das Ruder stabilisiert war, gab es für den Moment nichts weiter zu tun. Da wir die bevorstehende Ruhepause nutzen wollten, befahl ich Cornish, das Steuer zu übernehmen, und schickte den Steward nach vorn, um das Herdfeuer zu entfachen und Kaffee für das Frühstück zu kochen.
„Bootsmann,“ sagte ich, „Sie können genauso gut unter Deck gehen und nach Ihren Holzstopfen sehen. Nehmen Sie einen Hammer mit und diese Lampe,“ ich reichte ihm das Kompass-Licht, „und schlagen Sie die Dinger ordentlich fest. Falls das Schiff später schwer arbeiten muss, könnten sie sich sonst lösen.“
Er machte sich auf den Weg, und ich wandte mich an Miss Robertson. Da es nichts mehr für sie an Deck zu tun gab, bedankte ich mich bei ihr für die große Hilfe, die sie uns geleistet hatte.
Wie gut ich mich an sie erinnere, als sie dort am Steuer stand, meinen Strohhut auf dem Kopf, ihr Kleid hochgesteckt, um sich freier bewegen zu können. Ihre kleinen Hände, durch deren weiße, klare Haut die feinen blauen Adern schimmerten, ihr blondes Haar kunstvoll aufgesteckt, doch mit etlichen Strähnen, die wie goldene Federn herausfielen. Ihr marmornes Gesicht, die Lippen blass vor Erschöpfung, und ihre wunderschönen blauen Augen, in denen trotz der Müdigkeit des langen, qualvollen Wachens und der betäubenden, allgegenwärtigen Gefahr stets derselbe mutige Geist brannte.
Unter keinen Umständen wollte ich sie länger an Deck lassen. Obwohl sie darum bat, zu bleiben, nahm ich entschlossen ihre Hand und führte sie durch das Achterdeck zu ihrer Kajütentür.
„Versprechen Sie mir hoch und heilig, dass Sie sich hinlegen und schlafen,“ sagte ich.
„Ich werde mich hinlegen, und schlafen, wenn ich kann,“ antwortete sie mit einem matten Lächeln.
„Wir haben es bis hierher geschafft, Sie zu retten,“ fuhr ich eindringlich fort. „Es wäre grausam, sehr grausam, mit anzusehen, wie Sie aus Mangel an Schlaf und Ruhe zusammenbrechen, jetzt, wo das Leben wieder eine Zukunft hat, und wo jede Stunde uns auf das Deck eines anderen Schiffes bringen könnte.“
„Sie sollten nicht meinetwegen leiden,“ erwiderte sie. „Ich werde auf Sie hören, wirklich, ich werde tun, was Sie wollen.“
Ich küsste ehrfürchtig ihre Hand und sagte, dass schon eine einzige Stunde tiefen Schlafes ihr gut tun würde. Bis dahin würde ich dafür sorgen, dass das Frühstück für sie und ihren Vater bereitstand. Dann hielt ich ihr die Kajütentür auf, bis sie eingetreten war, und kehrte an Deck zurück.
Ein außergewöhnlicher, ja fast überirdischer Anblick erwartete mich auf dem Achterdeck.
Die Sonne war hinter der riesigen Wolkenwand aufgegangen, und obwohl ihr Feuerball selbst verborgen blieb, brachen ihre goldenen Strahlen in tausend silbernen Linien über den Rand der Wolkenbank hinweg. Über uns, hinaus in den Himmel, so deutlich und scharf wie Lichtstrahlen in einem dunklen Raum.
Doch diese wundersame Helligkeit ließ das Wolkengewölbe nur noch bedrohlicher wirken. Der Kontrast zwischen den sanften, weit reichenden Sonnenstrahlen, die in silbernem Glanz durch den stahlgrauen Himmel schossen, und den blauen Blitzen, die tief in das Bauch der Wolke rissen und für einen kurzen Moment das gewaltige, düstere Gestein aus Schatten dahinter enthüllten, war gespenstisch und verstörend.
Auch das Meer stand dem Himmel in seiner düsteren Majestät in nichts nach. Die eine Hälfte lag in einem tiefen, nachtgleichen Schatten, das Wasser erschien fahl, trübe und unheimlich öde unter dem finsteren Vorhang, der sich bis dicht zum Horizont hinabzog. Doch zur Rechten glitzerte das grüne Meer in den Sonnenstrahlen, sanft wogend unter der windstillen Ruhe, die sich über uns gelegt hatte.
Als ich in die Ferne blickte, dorthin, wo der Schatten über dem Meer am dichtesten war, meinte ich, ein dunkles Objekt auszumachen. Vielleicht ein Schiff, dessen Segel durch die Entfernung zur Sonne verdunkelt wurden.
Ich wies Cornish darauf hin, und auch er erkannte es. Sofort holte ich das Fernrohr.
Man kann sich meine Überraschung und Bestürzung vorstellen, als im Sichtfeld des Glases die Umrisse eines Bootes auftauchten, das Segel tief am Mast gerefft. Ich rief laut:
„Es ist das Langboot!“
Cornish fuhr erschrocken herum.
„Mein Gott!“ rief er. „Das sind verlorene Männer!“
Ich starrte angestrengt hinüber, aber ich konnte mich nicht täuschen. Ich erkannte die Form des Stagsegelchens, das offenbar schon in Erwartung des herannahenden Sturms eingeholt worden war, und ich konnte sogar die winzigen dunklen Gestalten der Männer im Boot ausmachen.
Doch mein Erstaunen hielt nur einen Moment an. Angesichts des leichten Windes, der die ganze Nacht über geherrscht hatte, und der Möglichkeit, dass sie in der Nähe auf und ab gekreuzt waren, in der Hoffnung, auf uns oder das andere Boot zu treffen, das uns angegriffen hatte, war es nicht unwahrscheinlich, dass sie sich noch immer in unserer Nähe befanden.
Der Bootsmann kam über das Achterdeck und rief:
„Alles in Ordnung unten! Kein Leck in Sicht!“
„Komm herauf!“ rief ich ihm zu. „Dort draußen ist das Langboot!“
Als er das hörte, rannte er so schnell er konnte nach achtern und starrte in die Richtung, die ich ihm wies. Doch erst als er das Fernrohr ansetzte, erkannte er sie und rief aus: „Ja, das ist sie, ohne Zweifel! Bei allen Teufeln, wir müssen uns vielleicht noch mal auf einen Kampf gefasst machen. Sie steuert direkt auf uns zu. Und mit etwas Wind werden sie uns einholen!“
„Nein, nein,“ entgegnete ich. „Die sind nicht zum Kämpfen hier. Denen gefällt die Wetterlage nicht, Bootsmann. Die wollen an Bord, um ihr Leben zu retten, nicht um uns das unsere zu nehmen.“
„Genau das ist es, Sir!“ rief Cornish. „Ich wette, ohne Stevens gibt’s unter denen keinen Aufstand mehr. Ich leg mein Leben drauf, wenn Sie für sie anhalten und sie aufnehmen, werden sie sich einfügen und genauso arbeiten wie ich.“
Weder der Bootsmann noch ich gaben darauf eine Antwort.
So dringend wir mehr Hände an Bord gebraucht hätten, ich glaube nicht, dass ich diesen Halunken genug vertraut hätte, um sie an Deck zu lassen. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass sie, sobald der Sturm vorüber war und sie sich wieder sicher auf der Grosvenor wähnten, gewaltsam gegen mich und den Bootsmann vorgehen würden. Wahrscheinlich würden sie uns dasselbe Schicksal bereiten wie Coxon und Duckling, als Rache für den Tod von Stevens und den anderen Anführern der Meuterei und um sich davor zu schützen, nach England zurückgebracht und dort als Mörder den Behörden übergeben zu werden.
Inzwischen wurde das Wetterleuchten immer intensiver, und zum ersten Mal hörte ich das dumpfe Grollen des Donners.
„Das heißt,“ meinte der Bootsmann, „dass es noch ein Stück weit weg ist. Und wenn der Steward da vorn sich ein bisschen beeilt, können wir noch was essen und trinken, bevor es losgeht.“
Doch kaum hatte er ausgesprochen, kam der Steward nach achtern und brachte eine große Kanne Kaffee. Er stellte sie auf das Deckshaus, holte aus der Speisekammer eingelegtes Fleisch, Zwieback und Butter, und wir machten uns mit großem Appetit über das Mahl her.
Da ich als Erster fertig war, übernahm ich das Steuer, während Cornish aß. Dann schickte ich den Steward los, um frischen Kaffee aufzusetzen und ihn warm in der Kombüse zu halten, sowie ein gutes Frühstück für die Robertsons vorzubereiten, damit es servierbereit war, sobald die junge Dame ihre Kabine verließ.
„Bootsmann,“ sagte ich, als er langsam auf mich zukam und seine Pfeife stopfte, „mir gefällt das Großsegel nicht. Das reißt uns noch auseinander und gibt ein höllisches Spektakel. Ihr beide solltet besser aufentern und es mit etwas zusätzlicher Leine sichern.“
„Das ist schnell erledigt,“ antwortete er munter. Cornish ließ sein Frühstück stehen, und gemeinsam gingen sie in die Wanten.
Während ich am Steuer stand, musste ich wiederholt gähnen, und meine Augen brannten vor Müdigkeit. Doch der Anblick dieser ungeheuren, sich bedrohlich aufbauenden Wolkenwand querab, die eine düstere, unheilvolle Dunkelheit über die halbe See warf und in raschen Stößen blaues Feuer aus ihrem Schlund speite, während der Donner in tiefen, feierlichen Rollen erklang, war beängstigend genug, um mich wach zu halten.
Es wurde mit jeder Minute dunkler. Bereits waren die Sonnenstrahlen verblasst, doch an der Kante der Wolkenbank, dort, wo sie der Sonne am nächsten lag, glühte noch ein flammender Rand.
Eine völlige Flaute hatte eingesetzt, und das Schiff lag unbeweglich auf dem Wasser.
Die beiden Männer blieben eine Weile auf der Rah und kehrten dann zurück, nachdem sie das Segel sicher befestigt hatten. Cornish beendete sein Frühstück, während der Bootsmann zu mir trat.
„Sehen Sie das Langboot noch, Sir?“
„Nein,“ antwortete ich. „Es ist dort hinten im Regen verschwunden. Bei Gott, jetzt kommt es wirklich herunter!“
Ich übertrieb nicht. Der Horizont war ein einziger grauer Vorhang aus Regen, der aussah wie Dampf, der von einem kochenden Meer aufstieg.
„Die werden alle Hände voll mit Lenzen zu tun haben,“ meinte der Bootsmann.
„Halten Sie hier die Stellung,“ rief ich, „ich hole meine Ölzeugjacke!“
Ein paar Augenblicke später war ich zurück, und er machte sich auf den Weg, um sich für das Unwetter zu wappnen und Cornish dasselbe zu raten.
Ich ließ das Steuer für ein paar Sekunden los, um eines der Decksfenster zu schließen. In diesem Moment schien ein Blitz das ganze Schiff in Flammen zu setzen, und unmittelbar darauf folgte ein ohrenbetäubender Donnerschlag.
Ich glaube, Donner klingt auf See noch furchterregender als an Land, es sei denn, man befindet sich inmitten von Bergen. Hier entfaltet er seine volle Wucht, sein gewaltiges Grollen schlägt auf die glatte Wasseroberfläche, die den Schall weiterträgt und ihn meilenweit ungehindert ausrollen lässt.
Ich eilte, um zu prüfen, ob der Blitzableiter frei ins Wasser führte. Doch das Ende des Drahts hatte sich in den Backbord-Wanten verfangen. Ich warf das Ende ins Meer und kehrte zurück an das Steuer.
Nun, da die gewaltige Wolkenmasse fast über uns stand, erkannte ich, dass ihre Front eine nahezu perfekte Halbkugel bildete, deren Enden sich an beiden Horizontpunkten wie Hörner nach vorne wölbten. Zwischen diesen ‚Hörnern‘ lag noch ein klarer Streifen stahlgrauen Himmels. Dort war das Meer noch hell, doch nach Steuerbord hin wurde es schwarz, und der unheilvolle Schatten raste in erschreckender Geschwindigkeit auf das Schiff zu.
Zischend zuckte ein Blitz herab und verwandelte Deck, Rahen und Tauwerk in ein gespenstisches Netz aus blauem Feuer. Der folgende Donner war keine allmählich rollende Eruption, sondern eine einzige, abrupte Detonation. Ein dumpfer, tödlicher Schlag, als wäre ein gigantischer Himmelskörper aus höchster Höhe auf das Firmament gestürzt und hätte es zersplittert.
Dann hörte ich den Regen.
Ich weiß nicht, was furchteinflößender war, das Tosen des Donners oder das Schauspiel des Regens.
Es war ein Sturzbach, der aus ungeheurer Höhe niederging. Eine dichte, undurchdringliche Wasserwand, die jedes Sichtfeld auf Meer und Himmel auslöschte. Die Wassertropfen peitschten auf die Oberfläche und zerrissen sie in schäumende Gischt.
Und dann – wumm! – prasselte er auf uns herab.
Ich klammerte mich am Steuer fest, während der Bootsmann sich unter dem Rost der Gangway verkroch. Es war nicht nur Regen, es war Hagel, so groß wie Eier, und die Regentropfen standen ihnen in ihrer Größe kaum nach.
Es war kein Hauch von Wind zu spüren. Diese entfesselte Wasserflut stürzte in vollkommen senkrechten Bahnen herab. Wenn die Blitze durch sie zuckten, tauchten sie die Szenerie in eine geisterhafte Helligkeit, als wäre der Ozean von einem einzigen, unheimlichen Licht überzogen.
Die Dunkelheit war so dicht, dass ich die Kompassrose im Kompasshaus nicht mehr erkennen konnte. Das Wasser rauschte über das Deck hinweg, als hätten wir eine gewaltige Welle übernommen.
Zwanzig Minuten lang stand ich wie betäubt da – taub, blind, umgeben von einem höllischen Konzert aus krachendem Donner und prasselndem Regen. Die Finsternis wurde durch die gleißenden Blitze nur noch gespenstischer.
Dann war es plötzlich vorbei.
Der Sturm hinterließ eine gespenstische Windstille, und wir standen da, durchnässt, verstört, reglos.
Am Horizont wurde es heller, und ich spürte einen schwachen Luftzug auf meinem nassen Gesicht. Noch heller wurde es, während der Sturm im Lee weiter tobte und in finsterem Grollen davonrollte, wie eine Höllennacht, die über das Meer wanderte.
Ich wischte mir das Wasser aus den Augen und sah, wie der Wind über das Wasser auf uns zuraste, während der Himmel über uns zu einer einzigen, bleigrauen Fläche wurde.
„Jetzt, Bootsmann!“ brüllte ich. „Bereithalten!“
Er kroch unter dem Rost hervor und packte die Reling.
„Da kommt er!“ rief er – und dann, mit einem Aufschrei: „Heiliger Donner, das Langboot ist genau dahinter!“
Ich warf nur einen kurzen Blick in die Richtung, die er meinte, und tatsächlich, dort kam das Langboot auf einer tosenden Schaumfläche direkt auf uns zugeflogen.
Im nächsten Augenblick erwischte die Bö das Schiff, und es krängte heftig zur Seite, das Backbord-Schanzkleid tauchte tief ins Wasser, doch dann stabilisierte es sich.
„Hätten wir die Toppsegel oben gehabt,“ rief ich, „dann wäre es unser Ende gewesen!“
Ich zögerte einen Moment, ob ich das Ruder herumlegen und vor dem Sturm laufen sollte. Wenn das schon das Schlimmste war, konnte das Schiff vielleicht standhalten.
Doch in diesem kurzen Moment schoss das Langboot mit voller Wucht unter unserem Heck vorbei.
Zweimal, bevor es uns erreichte, sah ich, wie die Männer versuchten, es so zu drehen, dass sie längsseits kommen konnten. Jedes Mal hielt ich den Atem an – denn ich wusste: Sobald sie es quer zum Wind brachten, würde es kentern.
Gott bewahre mich davor, jemals wieder einen solchen Anblick ertragen zu müssen!