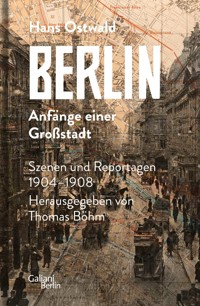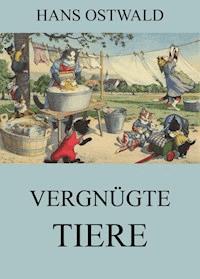Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Heinrich Zille war Grafiker, Maler und Fotograf. In seiner Kunst bevorzugte der "Pinselheinrich" genannte Zille Themen aus dem Berliner Volksleben, das er ebenso lokalpatriotisch wie sozialkritisch darstellte. Doch hinter dem "Pinselheinrich" versteckte sich noch ein anderer, introvertierter Zille, den nur seine intimsten Freunde kannten und zu schätzen wussten. Jenseits aller Komik und allen Gelächters schirmte er diese Privatsphäre vor neugierigen Blicken ab. In dieser privaten Welt entstanden die unbekannt gebliebenen Zeichnungen und Radierungen, die nie in Zille-Bände Einzug hielten: regungslos wartende, auf Brosamen hoffende Hausiererpaare, auf deren Schultern das ganze Unrecht der Gesellschaft zu lasten scheint; alte Reisigsammlerinnen, die gebückt und von Gram gebeugt noch eine andere Last als die ihrer Kiepen mit sich schleppen; dann gibt es zahlreiche Aktstudien von Arbeiterinnen aus der Zeit nach der Jahrhundertwende, in denen nichts von Zartheit zu finden ist, sondern robuste Leiblichkeit. Das vorliegende Zillebuch vom Erzähler und Historiker Hans Ostwald ist mit 223 S/W-Abbildungen illustriert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Ostwald/Heinrich Zille
Das Zille-Buch
Mit 223 meist erstmalig veröffentlichten Bildern
Das Zille-Buch
Hans Ostwald/Heinrich Zille
Mit 223 meist erstmalig veröffentlichten Bildern
Impressum
Texte: © Copyright by Hans Ostwald
Umschlag:© Copyright by Walter Brendel
Illustrator: © Copyright by Heinrich Zille
Verlag:Das historische Buch, 2021
Mail: [email protected]
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Inhalt
Einleitung
Zille als Künstler
Zille in der Liebe des Volkes
Wenn man berühmt ist ...
Zille-Feste
Zille und seine Modelle
Zille-Studien und -Akte
Zille-Mächens.
Die Männer der Mächens.
»Milljöh.«
Zille-Kneipen.
Zille-Fräuleins.
Zille-Kinder
Die Jugendlichen
Kleinbürger und Proletarier
Der fünfte Stand
Zille als Sozialkritiker
Aus Zilles Kindheit
Aus Zilles Lehrzeit
Aus der Gesellenzeit Heinrich Zilles
Heinrich Zille und die Soldaten
Zilles Lehrer und Kollegen
Zille-Witze
Zille-Weisheiten
Heinrich Zille
Einleitung
Motto: Am Tage: Arbeit, ernster Wille,
Abends: einen Schluck in der Destille.
Dazu ein bisken Kille-kille,
Das hält munter –
Heinrich Zille.
Das Zillebuch –
Es ist selbstverständlich, dass sich dies Zillebuch nicht mit kunstwissenschaftlichen oder kunsttechnischen Betrachtungen abgibt, sondern vor allem der Persönlichkeit des Künstlers gerecht zu werden versucht.
Seine Bedeutung in der Kunst steht fest. Sie ist offiziell von seinen Kollegen durch seine Berufung in die Akademie der Künste anerkannt worden.
Auch in diesem Buch wird hier und da auf einige wichtige Seiten seines Schaffens eingegangen werden. Es soll eine Darstellung seines Gesamtwerkes werden. Das Wesentliche aber ist der Mensch, der aus seinen Werken und aus seinem Wirken zu uns spricht.
Zille ist immer ein ganzer Mensch gewesen. Als seine ersten Zeichnungen aus dem Volke in den humoristischen Zeitschriften auftauchten, um 1900 herum, empfanden alle Leser, dass hier eine durchaus besondere und bedeutende Persönlichkeit sich äußerte. Eine eigenartige, persönliche Auffassung sprach aus dem kräftigen Strich der Darstellung, die eine ebenso geschulte wie eigenwillige Hand erkennen ließ. Das Dargestellte aber selbst: Volk, elendes, gedrücktes Volk, das sich trotz allem den Humor nicht nehmen ließ, das mit Lachen gegen den Druck und gegen seine kümmerliche Lebenshaltung aufbegehrte.
Zille wurde ein Programm.
Was andere in langen Reden und dicken Büchern sagten, wozu andere jahrelange Untersuchungen brauchten, das teilte er durch seinen Zeichenstift mit wenigen Linien mit. Er übermittelte aber mit seinen humorvollen Darstellungen nicht nur Elendsmenschen und Elendswinkel. Mit voller Liebe und mit vollem Bewusstsein berichtete er auch von der Kraft des Volkes.
Seine Gestalten sind durchaus nicht immer Elendsgestalten. Ja, auf den meisten Blättern sind Kinder und Frauen recht wohlgenährt und die Männer robust und kräftig.
Er glaubte ja auch an das Volk. Er glaubt auch heute noch an das Volk.
1. Pfefferkuchen nach einem Zillebild.
Mitmenschen!
Ja – ich erinnere mich; als ich zum ersten Mal, auf Drängen meiner Freunde, in der ersten Schwarz-Weiß-Ausstellung der Sezession, so um 1901 herum, in der Kantstraße neben dem Theater des Westens, meine Zeichnungen hingegeben hatte – Zeichnungen, die viel besser, wahrer waren als die, die ich später zum Broterwerb geleckter, frisierter bringen
musste, die das herbe Leben der Armen zeigten –, da standen vor den Bildern viele Menschen; und ich hörte, als ich mal lauschte, wie ein älterer Herr, wie es schien, Militär in Zivil oder Hauptmann an der Majorsecke, zu seiner Dame sagte: »Der Kerl nimmt einem ja die ganze Lebensfreude« – da schämte ich mich, so verstanden zu sein!
Ja, und wie es mir passierte, dass ein reicher Kunstjünger, der »Armut« malen wollte und sich dachte, wenn er meine Modelle, die vom Wedding, hätte – dass er sich dann in das »Milljöh« könnte hineinarbeiten, oder dass ihm die Sache dann besser liege –, der aber auszusetzen hatte, der Mutter der Kinder gegenüber: »Det se doch so wenig sauber und so sehr dreckig wären« und dass die Mutter ihm entrüstet erwiderte: »Ja – und for Zillen ken'n se jarnich dreckig jenuch sind –« Soll man sich da eigentlich nicht schämen?
Da hab' ich mich, als ich das später erfuhr, doch etwas geschämt. – Und als mein lieber Freund Karl Arnold, der Zeichner im »Simplicissimus«, ein Bild brachte, das mich zeigt, wie ich vor zwei »wohlhabenden« Männern »untertänigst« stehe und der wohlhabendste mich mit den Worten anspricht: »Nehm' Se sich noch ne frische Habana, Meister Zille, Sie ham uns mit Ihren Nutten un arme Leute imma so ville Freude jemacht!«
... Da schämte ich mich, dass das so wahr war.
Z.
Wenn Zille auch hinterher in seinem Alter manchmal sich kränkt, dass seine Schilderungen nur als Humoristika aufgenommen werden, so liegt doch in seinem Wesen und seiner Kunst so viel Humor, dass er selbstverständlich nicht nur als Elendsmaler gelten kann. Er selbst steckt so voller Eulenspiegeleien, dass er sogar in seiner Krankheit und unter den Erscheinungen des Alters seinen Humor immer wieder explodieren lassen muss. Näheres darüber findet der Leser in den letzten Abschnitten dieses Buches.
2. Pennbruder. Studie nach der Wirklichkeit.
Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.
Zille ist aber ganz gewiss der moderne Eulenspiegel. Er löckt mit tolldreisten Streichen und Aussprüchen wider bösartige Erscheinungen aller Art an. Seine humoristische, allerdings manchmal mit einem »Bittern« durchwürzte Lebensauffassung hat zweifellos unsere Weltanschauung und die allgemeine Einstellung zum Volke und zum Leben überhaupt beeinflusst.
Zille selbst blieb allerdings durchaus in seinen Schichten, in seiner Lebensführung sowohl wie in seiner Anschauung. Er blieb im Volksviertel wohnen. Er blieb in seiner Empfindung und seiner Überzeugung kampflustiger Proletarier, der immer auf eine Besserung dieser »besten aller Welten« hindrängt. – Dies aber, dass er sich immer als »Knecht des Kapitals« fühlt, ist seine künstlerische Stärke. Dies befähigt ihn, aus innerstem Erlebnis heraus zu schaffen, jede Linie seiner Gestalten mit ihrem Empfindungsgehalt zu füllen.
Er ist eben aufgewachsen in einer Zeit, als auf der einen Seite das Bürgertum nach außen hin fromm tat, als es aber in Wirklichkeit, verführt durch den Milliardensegen der siebziger Jahre, in übermütigem Genuss viele Ideale verlor. Das einfache Volk fühlte nur die Last der Anforderungen, den harten Druck der Verwaltung und eine quälende Verlassenheit. Die Berufenen, Kirchendiener und Staatsangestellte, fanden nicht den Ton und die Tat, um dem Volke Liebe und reine Lebensfreude zu geben. Zille weiß aus jener Zeit genug volkliche Derbheiten zu berichten und zu schildern. In Wort und Bild.
Gründlich verfehlt wäre es jedoch, nach manchen Zille-Gestalten zu schließen: Zille habe nur die fragwürdigen Elemente des Berlinertums und der Hauptstadt schildern wollen oder er habe nur solche Gestalten als »Volk« gesehen. Nein, er hat alle Schichten des Volkes mit gleicher Liebe geschildert. Das Kleinbürgertum, das arbeitende und werktätige Volk sind in seinem Werk mit gleicher Liebe behandelt worden wie die Außenseiter der Gesellschaft. Ja, wer sein Werk mit Gründlichkeit betrachtet, wird finden, dass er mit besonderer Liebe das sich ehrlich ernährende Volk dargestellt hat. Allerdings ist er an den Außenseitern, an den Entgleisten und Verkommenen nicht lieblos vorbeigegangen.
3. »Wenn man so in de Kintöppe sieht, wie se sich haben – die Lotte Werkmeister, die Cläre Waldoff, die Söneland – der lange Westermeier und der schlacksige Lambert Paulsen – un' wie die Prominenten alle heißen, dann denkt man, det se woll alle in de Kaschemme sind uffgewachsen – aber keene Spur von Klammergast – de janzen Fisimatenten ham se sich von hinten rum abjekiekt und sich so quasi weggestohlen – Kunststück!!«
Nach dem Original.
Er nahm sie als Ergebnis sozialer Bindungen und Vorgänge und erhob durch ihre Schilderung ebenso eine laute Anklage gegen die Verantwortlichen wie in den Darstellungen, in denen er die tausendfachen Nöte und die Duldungsfähigkeit der Werktätigen, besonders aber auch der Kinder und Frauen des Volkes allen jenen Menschen vor Augen führte, die nicht selbst in diesen erbärmlichen Höfen, Hinterhäusern und Mietskasernen leben brauchen. Auch im Bild 3 äußert er das in seiner humoristischen Weise. Über das Mittel der humoristischen Zeitschriften und Bücher führte er die Kenntnis und die Anteilnahme an dem »fünften« Stand auch in die eleganten und in die gutbürgerlichen Wohnungen und Landhäuser der besseren Wohngegenden ein ...
So ist denn Zille selbst auch durchaus nicht begeistert darüber, dass sich der »Hofball bei Zille« ebenso wie die sich daraus entwickelnden Zille-Bälle im riesenhaften Sportpalast zu einem Stelldichein aller nachgemachten Kaschemmenmiezen, unechten Pennbrüder, Schieber und falschen Apachen auswuchsen. Er sagte selbst darüber:
»Das sind alles bloß nebensächliche Sachen. Das ist jerade wie der Zille-Ball, was auch bloß een abjelöster Apachenschwoof is, als wenn es nischt wie blaue Oogen, Schiebermützen und Salonluden uff de Welt jäbe. Das war jarnicht das, was ich zeichnen wollte.«
Und doch ist Zille nicht nur der soziale Kämpfer. Er ist und bleibt in seinem innersten Wesen eine vollblütige Eulenspiegelnatur, eine immer muntere und ermunternde Eulenspiegelseele. Darum werden ihn alle lieben – selbst jene, die seine Überzeugung nicht teilen. Denn ursprünglicher Humor ist immer willkommen.
Und weil in diesem Buch das Wesentliche von seinen Scherzen und Schnurren und viel mehr Bedeutsames und Belustigendes, das noch nirgends veröffentlicht war, gesammelt ist und seinen Freunden und Verehrern dargebracht wird, hoffe ich, dass alle sich gern dem kräftigen und ermunternden Humor Heinrich Zilles hingeben werden.
1929. Hans Ostwald.
Manche Abschnitte hat Heinrich Zille selbst geschrieben, die anderen schrieb ich nach den ganz persönlichen und sehr anschaulichen Erzählungen Zilles.
4. Mutter aus dem Volke.
Nach dem Original.
Zille als Künstler1
Zille sprach von den Anfängen seiner Kunst: »Als ich anfing, war es ein großes Risiko, arme Leute zu malen. Damals koofte sowat keen Hammel – nicht einmal der Magistrat.«
Er lächelte verschmitzt über diesen Witz und erzählte aus seiner Jugend:
»Mit neun Jahren kam ich aus Sachsen nach Berlin, so um 1867. Am Anhalter Bahnhof kletterten wir aus dem Zug. Da hätten wir nun in der Gegend wohnen bleiben sollen. Denn die Leute siedelten sich damals in den Stadtteilen an, wo sie mit der Bahn ankamen. Die Pommern blieben am Stettiner Bahnhof, am Schlesischen Bahnhof wohnten die Ostpreußen und die Pollacken und am Görlitzer Bahnhof die Schlesier. Wir zogen aber in die Gegend am Schlesischen Bahnhof mit ihren engen, alten Häusern. Was ich da sah, habe ich schon in der Geschichte vom Kellner-Fränze und von Frau Clara mitgeteilt. Jugendeindrücke – die haften! – Na, und denn,, was man so als Lehrling und als Geselle erlebte. Da gibt's 'ne ganze Menge Geschichten ...«
*
»Das Sehen und Erleben in der Kinderzeit und in der Jugend half mir wohl später manche Bilder gestalten. Oft ist's umgekehrt. Arme Kunstjünger malen Reichtum und dicke Schinkenbrote. Und die reichen Jünglinge quälen sich, die Armut in Wort und Bild darzustellen.
Ich bin bei meinem ›Milljöh‹ geblieben. –
Ich wollte ja von meinem Milljöh aus der Jugendzeit erzählen ... Die Bewohner im Hause lernte ich alle gut kennen. Aus'm Vorderhaus, aus'm Seitenflügel und aus'm Quergebäude. Die hatten immer wat für mich zu tun. Da war der Kellner-Fränze, der meist in seiner Kneipe schlief, die Nachtbetrieb hatte. Seine Frau Clara ging schon in der Dämmerung auf die Straße – die Brüste hochgeschnürt, den kleinen Hut ins Gesicht gedrückt, um die Hüfte eine hohe Tournüre; unter dem Hut trug sie hoch aufgetürmte Locken, die am Tage im Tischkasten lagen, zwischen Kontrollbuch, Wurstenden, Schrippen, Schminke, Kämmen, Bindfaden, Gabeln, Löffeln, Mutterpflaster und allerlei anderm Kram. Ich musste ihr schwachsinniges Kind bewachen – bei einem Teller dampfender Bratkartoffeln und einem Haufen gelbgehefteter Schundromane: ›Die Bauernfänger von Berlin.‹
5. Küchentisch bei Frau Clara. Studienblatt nach einem Winkel in einem Schusterkeller.
Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.
Und wenn Frau Clara kein Geld hatte, wenn's regnete und nichts zu verdienen war auf der Straße – dann musste ich zu ihrem Mann nach Geld laufen. Oft hatte er selbst nichts und gab mir seinen Frack zum Versetzen. Den nannte er im Kreise seiner Sauf- und Spielkumpane sein ›Feigenblatt‹.
Und auch vom versoffenen Kommodentischler im Vorderkeller und von der blinden Rohrstuhlflechterin, vier Treppen hoch im Hinterhaus, wurde ich der Vertraute – und verdiente mir den Taler, den ich monatlich für die paar Zeichenstunden in der Woche an den alten Zeichenlehrer Spanner in der ärmlichen Dachstube in Berlin O, Blumenstraße, zahlen musste.«
*
»Das ist komisch, wie man manchmal zu seinem Beruf kommt!« meinte Zille, zugleich sinnend und lächelnd. »Das Zeichnen machte mir ja schon in der Schule Spaß. Es ging mir eben leichter von der Hand als den andern Schülern. Und als nu die Zeit ran kam, wo man an einen Beruf denken musste, sagte mein alter Zeichenlehrer zu mir:
›Das beste is, du lernst Lithograph. Zeichen kannste – und da sitzt du in 'ner warmen Stube – immer fein mit Schlips und Kragen. Brauchst nich schwitzen und kriegst keene dreckigen Kleider. Wirst mit ›Sie‹ angeredet – un vor allem – du sitzt in de warme Stube! Wat willste noch mehr?‹
Das gefiel mir – un so bin ich eben ›Zille‹ geworden.«
*
In einer Skizze: »Mein Lebenslauf« schildert Zille seine weitere Entwicklung:
»1873 lernte ich Lithograph und ging die Woche zweimal abends in den Unterricht zum alten guten Professor Hosemann in die Kunstschule, die damals in der Akademie war, ebenso zweimal die Woche zum Professor Domschke, Anatomie, der sehr grob war – und die vollste Klasse hatte. ›Wenn Se noch nich mehr kenn', dann setzen Sie sich mit Ihr Brett uff die Treppe un' nehmen nich hier die hoffnungsvollen Jünglinge, die bald nach Italien wollen, den Platz weg!‹ – aber die Klasse war übervoll, die jungen Leute freuten sich über den alten Herrn, der so wie der olle Schadow sprechen sollte – nach ihm hat's P. Meyerheim verstanden, das ›Berlinern‹ weiter auszubilden. Der alte Hosemann ließ mich in seiner Wohnung, Louisenstraße, am Neuen Tor, ganz gern seine Skizzen und Zeichnungen ansehen und auch abmalen, sagte aber: ›Gehen Sie lieber auf die Straße 'raus, ins Freie, beobachten Sie selbst, das ist besser als nachmachen. Was Sie auch werden – im Leben können Sie es immer gebrauchen; ohne zeichnen zu können, sollte kein denkender Mensch sein.‹ Es ist ein nicht grade heiteres, von wenig Sonne erhelltes Feld, das ich wählte: der fünfte Stand, die Vergessenen! Ich bewunderte Hans Baluscheck, den ich so hoch verehre und nie erreichen werde! ...«
Z.
*
In seiner Lehrzeit erlebte er dann auch manches »Milljöh-Stück«. Das findet der Leser in dem Kapitel, in dem jene Lehrjahre beschrieben werden. Hier sei auf seine künstlerische Ausbildung eingegangen:
»Bei diesem Lithographen wurden die deutschen Heerführer und Fürsten dutzendweise in allen Größen fabriziert, ebenfalls nach Photographien verstümmelte und geheilte Soldaten für medizinische Werke auf Stein gezeichnet, Heiligenbilder, Madonnen mit blutenden Herzen, der Gekreuzigte usw., die dann in den Wohnungen der armen Leute, rechts und links neben den Regulatoren hingen. Darunter baumelten die Kriegsgedenkblätter und Kriegsmedaillen der gefallenen oder verstümmelten Väter und Söhne. Wir hatten damals ein merkwürdiges Kunstgewerbe, der Triumph in der Möbelarchitektur war der Muschelaufsatz. All das frühere Gute ist seit jener Zeit aus den Wohnungen der kleinen Leute verschwunden, das Kunstgewerbe ging an die Arbeit. – War auch die Arbeit am Tage nicht so erfreuend, umso mehr waren es die Abende in der Kunstschule und später im Abendaktsaal. Sonntag ging's ins Freie, um Landschaften zu versuchen. Die noch bleibende Zeit mühte ich mich, das auf der Straße Gesehene aus der Erinnerung zu zeichnen. Der Lehre folgte die Gehilfenzeit; ich kam in gute Werkstätten, arbeitete mit R. Friese und Frenzel, den späteren Tiermalern, und vielen tüchtigen Lithographen zusammen und erlernte den Buntdruck. Nach der Militärzeit ging ich zum graphischen Gewerbe, wie Lichtdruck, Zinkographie, Photogravüre usw., da hat mir das Etwas zeichnen können geholfen, gute Arbeit zu machen. Mancher Beitrag für Zeitungen war entstanden, die Zeichnungen und Skizzen sammelten sich an, so dass ich auf Zureden von Freunden mich zaghaft traute, in der ersten Schwarz-Weiß-Ausstellung der Berliner Sezession 1901 auszustellen. Man war entrüstet über die Verunglimpfung Berlins und seiner Bewohner.
Nach und nach lernten die Leute sehen, urteilen und mich verstehen. Im Osten und Norden Berlins verstanden sie mich gleich, als meine Gestalten im Simplicissimus und der Jugend, den ersten Zeitschriften, die mir gnädig waren, auftauchten. Seit 1907 bin ich nicht mehr im graphischen Gewerbe und konnte mich mit dem, was mir am Herzen lag, nun ganz und gar befassen ...«
Zille erklärte, dass nicht nur die Kindheitseindrücke auf ihn so stark gewirkt hätten:
»Nie werde ich vergessen, was ich am Dönhoffplatz erlebte. Ich hatte 'ne kleine Privatarbeit und ging so früh in die Werkstatt, dass ich schon vor Arbeitsbeginn ein paar Stunden für mich arbeiten konnte. Es handelte sich um eine Technik, die nicht in der Werkstatt geübt wurde, in der ich mich aber selbst üben wollte. Und da war nu am Dönhoffplatz zweimal Wochenmarkt. Lauter Obdachlose kamen hin, die als Helfer wat verdienen wollten. Und damit sie nich die Zeit verpassten – denn die Bauern aus der nächsten Umgebung, aus Schöneberg und Templow fuhren ziemlich früh an – kamen die armen Markthelfer schon am Abend vorher und pennten da – vor den Haustüren. Wie die Heringe lagen sie in den Hauseingängen.
6. Rücken-Akt. Aus der Zeit, als Zille noch nicht selbständiger Künstler war. Diese Radierung, eine der neben seinem Broterwerb entstandenen Arbeiten, zeigt ihn schon abseits aller akademischen Süßigkeit.
Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.
Die Schwächsten und die, die am meisten froren, ließen sie hinten liegen, wo't wärmer war. Die vorne, das waren die Stärksten.
Manchmal aber kamen die Schutzleute. Die zogen die armen Kerle an die Schläfenhaare hoch. Und das tut verflucht weh. –
Über diese Reihen von Ärmsten musste ich wegsteigen, wenn ich meine Früharbeit anfing. Solche Eindrücke vergisst man nicht.
Und wenn ich mal spät Unter den Linden lang ging – ich hatte doch Abendunterricht in der alten Akademie und daran schloss sich manchmal noch 'n kleiner Bummel – da saßen auf manchen Bänken die Obdachlosen. Schlafen sollten sie nicht. Und weil die Schutzleute kontrollieren kamen, stellten die Obdachlosen Wachen aus. Die mussten ›Polente!‹ rufen, wenn Schutzleute kamen. Erwischten die Schutzleute aber doch einen Schläfer, dann fassten sie ihn an den Füßen an und kippten ihn über seinen Kopp weg uff de andre Seite. Im Hotel de Rome und in den andern Hotelsdrüben neben den Palais aber war's noch hell und da ging's hoch her. Die Equipagen und die Droschkenkutscher warteten und verstauten die Angeheiterten und fuhren sie nach Hause. Und hier wurde den Armen die letzte Ruhe genommen ...«
»Ja, wenn ich meine eigene Arbeit für mich nicht gehabt hätte – dann hätte ich es wohl kaum ausgehalten – jahrzehntelang in der Tretmühle. Aber wenn ich morgens so 'n bisschen nach der Natur gezeichnet hatte, dann hatte ich Ruhe für die Brotarbeit. Ich musste erst ein Bild für mich gemacht haben, ehe ich an die Arbeit ging.
Und abends? Ja, da konnte es wohl vorkommen, dass ich bis vier in der Nacht arbeitete – bis der Hahn krähte. Früher gab's ja noch Hühner – in Rummelsburg, später in Karlshorst und auch hier in Charlottenburg in unserer Nachbarschaft. Als ich damals hierher zog – die Photographische Gesellschaft verlegte doch ihre Werkstatt vom Dönhoffplatz hier 'raus – da war's noch ländlicher. Am Kaiserdamm war große Heide.
7. Zerzauste Kiefer in der Nähe von Rummelsburg. Eine der Studien Arbeiten, die Zille vor oder nach seinen Broterwerbsstunden »für sich« machte.
Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.
Da saßen die Weiber mit ihren Kindern – hielten sie ungeniert an die Brust – oder hielten sie ab: da konnte man sie belauschen ... Und überall waren freie Plätze, wo die Menschen sich noch auf die Erde setzen konnten.
Na – und immer habe ich auch nicht bloß gezeichnet. Manchmal wurde es auch so spät über ein Buch: Dickens – – und Zola: Germinal, Nana, Fruchtbarkeit – und was ich sonst alles bekam.
Aber auch später, als ich nicht mehr in die Werkstatt ging, saß ich morgens oft bis vier auf, am Reißbrett mit dem Stift oder stand vor der Staffelei. Na ja – wenn man was schaffen will! – Und ich rühmte mich zu Gaul:
›Du, jetzt geht's schon bis um viere‹!«
Über Zilles wirklich ernste und gewissenhafte Einstellung zur Kunst mögen seine folgenden Äußerungen unterrichten und aufklären:
»Es gab so viele, die sich vor eine Sache hinstellten oder hinsetzten und sie mühselig abmalten. Das Volk lässt sich das nicht immer gefallen. Und dann wechselt doch auch das Bild rasch. Auf der Straße – und auch sonst: Licht und Farbe.
Ich machte mir bloß Notizen. Und sagte: ›Das müsst ihr euch ins Auge klemmen – und denn zu Hause verarbeiten! ...‹
Wer das nicht kann, der kommt nicht zu einer fertigen Sache.«
*
»Wie das so ist: erst hat man keine richtige Kritik für seine eigenen Sachen. Und so machte ich denn die Körper immer zu lang und die Köpfe zu klein. Bis mir eines schönen Tages der Bildhauer Krauß sagte:
›Mensch, Ihre Figuren haben ja alle zu viel Kopflängen!‹ Und das stimmte!
8. Zille vor seiner Staffelei. Hinter der Staffelei Senta Söneland.
Nach einer Photographie.
Da sah ich mich vor. Und was kam nu!?
Als Hyan mal meine Zeichnungen sah, meinte er:
›Na, Ihre Puppen haben wohl alle eens uff'n Kopp gekriegt!‹
Und das stimmte auch!
Na – nun suchte ich eben das Richtige.«
*
»Liebermann fragte mich mal, warum ich keine Selbstbildnisse male.
Ich antwortete ihm:
›Wenn ich mich früh im Spiegel gesehen habe, wenn ich mich gekämmt habe, habe ich genug von meinem Gesicht!‹ –«
*
»Liebermann fragte mich auch mal: ›Vakoofen Sie? Sie müssen doch mächtig Jeld machen!!‹
›Nich wie Sie bei de Reichen‹, antwortete ich ihm. ›Ich verkoofe bloß an kleene Leute. Die können nich Dausende zahlen: Denen muss ick die Freude schon billiger machen!‹
›Zille, det is schön von Ihnen!‹
Ich schwieg ein Weilchen, überlegte und sagte: ›Ach, Herr Professor, die Leinwand und die Ölfarbe achte ich viel zu hoch. Und denn: es malen schon zu viel Leute in Öl. Ich kritzle lieber auf Papier!‹
›Na, denn kleben Se doch Ihre Zeichnungen uff Pappe und schmieren Lack drüber. Dann kriegen Se mehr Jeld vor!‹ riet mir der berühmte Maler.
›Ich bleibe aber lieber bei meinem Kritzeln!‹ schloss Zille.«
*
»Das ist alles nur mit Gewalt gemacht!« behauptet Zille von seinen Werken. »Nur mit Gewalt!
Weil ich es gewollt habe. Weil ich mich immerzu gezwungen, immerzu geübt habe! Weil ich jedes kleine Ding beobachtete und abzeichnete. Jeden alten Latschen. Jeden krumm getretenen Stiebel. Jede alte Gosse. Jede Küchenecke. Jeden Straßenwinkel.«2 Und wenn man ihm erwidert: Aber auch die Küchenecke, der Stiebel und die Gosse sind doch von Ihnen so gezeichnet, wie es eben nur ein Meister kann!
Dann sagt er, mit einem nach innen flimmernden Zwinkern seiner hellen Augen, halb bescheiden, halb ängstlich sich belauschend, wie wenn er sich vor einer geheimnisvollen Kraft in seinem Innern fürchte:
»Nee, nee – das ist mit Gewalt gemacht! ...
Das habe ich alles nur mit Gewalt erzielt. Nur mit Fleiß! Und immer wieder Gewalt!
Sonst schafft man das nicht!
Das ist nicht Begabung.
Das ist nur Wollen.
Ich wollte eben auch was für mich machen.
Ich wollte nicht immer in der Werkstatt bloß an einer Sache ein bisschen rum arbeiten. Wie etwa so'n Arbeiter, der bloß sein ganzes Leben lang Türklinken macht – vielleicht bloß die Gussnaht abkratzen – oder den Gusskopp abkneifen.
Nee –
Da fragten mich die Herren von der Photographischen Gesellschaft, warum ich denn jeden Morgen schon zeichne – so 'n bisschen nach der Natur – und abends auch noch oft bis in die Nacht. Das hätte ich doch nicht nötig. Ich hätte doch mein Brot.
Ja, ich wollte doch auch was für mich machen.
Was Ganzes wollte ich machen.
Ich wollte was machen, aus mir heraus.
So, wie ich die Welt und die Menschen sah.
Ich sah sie doch ganz anders, als die andern.
Und das musste ich eben machen ...«
*
»Alle möglichen und unmöglichen Kunstjünger – und solche, die sich dafür halten, schicken einem Proben oder rücken einem sogar selbst auf die Bude. Oder die lieben Eltern oder Onkels kommen und bringen Proben.
Ja, was soll man dazu sagen?
Soll man die Verantwortung auf sich laden, dass da wieder so 'n Kunstproletarier erzogen wird? Ich sage meist:
›Werdet Schofför; die leben wenigstens nicht lange – die haben aber Brot‹ ...
Weiß man, wie solch Mensch sich entwickelt?
Manch einer macht als Kind so viel Versprechungen – macht die schönsten Bilder. Überhaupt, wenn Vater selbst Künstler ist oder in der Familie allerlei Liebhaberei getrieben wird. Dazu kommt dann solche kindliche Ursprünglichkeit – und das Genie ist fertig.
›Unser Peter braucht doch kaum was zu lernen – ach, der braucht gar nicht mehr zu lernen. Sehen Sie nur, was der kann!‹
9. Die Jungfernbrücke im Schnee zeichnete Zille, nachdem er, nachts aus einer Kaschemme heimkehrend, sie im frischen Schnee gesehen. Er benutzte diese Skizze zu einem Rodelbild, und zu der Zeichnung, auf der die noch »immer frisch vom Lande« gekommene Dirne die Männer anspricht.–
Und es ist auch manchmal überraschend, was so'n Junge kann. Ja – und dann, wenn die Pubertät vorbei ist – dann soll er selber Charakter haben – und Fleiß – und Erfindung –
Und denn ist er ein hohles Ei. Ausgepustet ....
Nee – ich nehme die Verantwortung nicht auf mich.
Ich sage immer:
›Gehn Sie man auf die Hochschule und holen Sie sich da Bescheid. Die Leute da sind angestellt und werden dafür bezahlt‹ ...«
*
In seinen früheren Jahren ist Zille von manchen Geschäftsleuten rücksichtslos ausgebeutet worden. Seine Zeichnungen wurden, ohne dass er gefragt oder dafür bezahlt wurde, in Massen zum Nachdruck verkauft. Auch erschienen viele Abbildungen von ihm, zu deren Reproduktion er keine Genehmigung erteilt hatte, die von den Verlegern gegen seinen Willen veröffentlicht worden waren. Zuerst hat er wohl manches ruhig geschehen lassen: »Man verliert sonst seine Beziehungen.« Dann hat er gemeinsam mit Kollegen Nachdruckskontrolle geübt, seine Zeit im Dienste der Kollegen geopfert. Jetzt steht er auf dem Standpunkt, von dem er erzählt:
»Der Kunsthändler .... bot mir so recht niedliche Preise für meine Zeichnungen. Am liebsten hätte er den ganzen Schwung so auf Ramsch gekauft. Da sagte ich zu ihm:
›Gewiss doch – ich werde meine Zeichnungen pfundweise verkaufen!‹
Da merkte er denn, was los war und ging. –«
*
Selbstbewusst erzählt er, wie Liebermann immer für ihn eintrat, wie er ihn in die Akademie brachte (siehe Kapitel: »Wenn man berühmt ist«) und wie er auch bei andern Gelegenheiten Zilles Können anerkannte undbewertete: Ein großer Verlag stiftete einen Preis für den besten Illustrationszeichner. Selbstverständlich wollte er – schon um der Reklame wegen – seinen Hauszeichner ausgezeichnet sehen. Aber Liebermann, der neben andern als Schiedsrichter gebeten war, bestimmte Zille als Preisträger. Das gab dann einen langen Streit und Verhandlungen zwischen Liebermann und dem Verlag.
Schließlich einigten sie sich auf Zille und den Hauszeichner.
Der Verlag stiftete eben zwei Preise ....
*
Zu einer berühmten Sängerin sagte Zille nach Schluss des Konzertes:
»Wie glücklich sind Siel Wenn Ihre Arbeit vorbei is, denn is se wech . . . Unsa Dreck bleibt immer!«
*
Einen bekannten, modernen Maler, der alles nach dem Modell zeichnet und malt, belehrte Zille:
»Sie müssen das ins Auge klemm'n un denn nachher zu Hause ausschütten. Wenn Sie das nich können, denn is 'ne Photographie besser.«
Überhaupt steht Zille der jüngsten Kunst – sehr kritisch gegenüber. So sagte er öfter:
»Die soll'n man erst so'n Stiebel malen, wie'n der Anton (Werner) jemalt hat!«
Diese Äußerung ist bezeichnend für seine Kunstauffassung. Ihm ist kein Gegenstand zu geringwertig. Er muss nur künstlerisch durchgearbeitet sein.
Er bleibt dabei, dass »Kunst« von »Können« kommt.
*
Auch von andern Eindrücken sprach Zille, von solchen aus der Kunst früherer Zeit. Er ließ manchen gelten, der eine Zeitlang übersehen worden war. Sprach achtungsvoll von Paul Meyerheim, vergaß nie Hosemann und erläuterte mit der Eindringlichkeit des Schaffenden die Unterschiede zwischen dem Pessimismus von Wilhelm Busch und seiner eigenen, aufbegehrenden, auf Besserung dringenden Weltanschauung.
Und wenn er gefragt wurde, ob das Volk ihm denn für das liebevolle Hinweisen auf seine Leiden und Nöte gedankt habe, fragte er mutwillig:
»Soll es mir verhauen? ... Nee – dazu is't nich gekommen. Aber so'n bißken Liebe merkt man doch, wenn man sich ums Volk kümmert –«
*
Mit gutem Humor sieht er auf sein früheres Leben zurück und lacht über Erlebnisse und Angriffe mannigfacher Art:
»Meine erste eigene Wohnung war im Osten Berlins im Keller; nun sitze ich schon im Berliner Westen, vier Treppen hoch, bin also auch ›gestiegen‹. Einige Radierungen sind ins Kupferstichkabinett gelangt und eine Anzahl Zeichnungen und Skizzen in die Nationalgalerie. Jetzt, 1924, bin ich sogar Mitglied der Akademie geworden. Dazu schreibe ich das, was das völkische Blatt, der ›Fridericus‹ sagt: ›Der Berliner Abort- und Schwangerschaftszeichner Heinrich Zille ist zum Mitglied der Akademie der Künste gewählt und als solchervom Minister bestätigt worden. – Verhülle, o Muse, dein Haupt.«
Z.
*
Wenn er auch nicht mehr ganz so handelt, wie er im Motto seines Lebens und Schaffens angegeben hat – wenn er auch längst den Schluck in der Destille und das Kille-Kille abgeschworen hat: mit dem Ergebnis seiner frohen Arbeit kann er gewiss zufrieden sein.
Zwar zweifelt er manchmal und meint:
»Das kommt ja doch alles in den großen Müllkasten der Zeit!«
10. Verhülle, o Muse, dein Haupt!
Skizzenblatt, zum 1. Mal veröffentlicht.
Aber er hat auf seine Zeit gewirkt, hat beste Zeitkunst geschaffen, hat Augen und Herzen geöffnet. Und da er das mit wahrhaft klassischem Können und mit ernstestem Willen tat, wird er nicht im Müllkasten der Zeit verschwinden, sondern Zille, der Künstler unseres Volkes bleiben.
Zille in der Liebe des Volkes
Kein heutiger Künstler kann sich rühmen, so wie Zille vom Volke geliebt und gekannt zu sein. Das Volk hat, trotzdem er es in den humoristischen Zeichnungen für die Zeitschriften oft ein wenig komisch und von oben herab darstellen musste, immer seine große Liebe hindurch empfunden – und hat sie ihm auch reichlich vergolten. Er selbst konnte denn auch auf die Frage eines Schriftstellers erwidern:
»Ach ja – man merkt schon, dass man immer fürs Volk gearbeitet hat – so'n bißken Liebe merkt man schon. –«
Im weitesten und gemütvollsten Sinne des Wortes war Heinrich Zille eben ein Heimatskünstler. Nicht zum geringsten schmeichelte er sich in die Liebe des Volkes ein durch das Mitgefühl für die Kümmernisse und für die Freuden, das aus allen seinen Blättern sprach. Nicht zum wenigsten machte ihn beliebt die Darstellung der Berliner Kinder. (Siehe Kapitel: »Zille-Kinder« und die Kinderstudien im Abschnitt: »Studien und Akte«.) Wer Kinder sowie Zille ablauschen und durch seinen Zeichenstift festhalten kann, wird immer beim Volke die allerwärmste Gegenliebe erleben.
Er ging immer mit dem Zeichenstift in der Hand den Weg des Volkes. Nicht nur in die Kaschemmen und auf die Rummelplätze. Als um 1905 die sommerliche Auswanderung der Berliner in die Freibäder an den Spree- und Havelufern eine Wendung in der ganzen Lebensart der Hauptstädter brachte, ward Zille der Maler des Freibads. Aus einer Unzahl von Zeichnungen und Skizzen, in denen er die Lust der Berliner an Luft und Sonne betonte, sei hier wenigstens sein Blatt »Zurück zur Natur«, Bild 13, wiedergegeben. Auch in einigen andern Kapiteln (»Zille-Fräuleins« und »Zille-Witze«) sind mehrere Freibadbilder zu finden.
Heinrich Zille fand auch den richtigen Weg, dem Volk die großen Kriegserlebnisse mit Humor zu würzen.
Seine Bilderreihe »Vadding in Frankreich – Vadding im Osten« brachte fast zweihundert heitere Erlebnisse eines Landsturmmannes und seines Freundes »Korl« während des Weltkriegs. Nie kamen auf diesen Blättern blutige Ereignisse vor. Zille wusste sie stets zu umgehen und dem in allen Lebenslagen, selbst im Granattrichter noch aufleuchtenden Humor des Volkes gerecht zu werden.
11. Een kleener Berliner Dickkopp.
Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.
Den schönsten Grund zur Liebe, mit der ihn das Volk umgibt, legte er aber durch die Schilderungen des Volkslebens und durch die Darstellung der Stadtgegenden und der Häuser und Winkel, in denen das Volk wohnte und wohnt. Er brachte naturgetreue Wiedergaben aus dem Scheunenviertel, aus dem baufälligen »Alt-Berlin«, aus Hinterhäusern und Höfen, wie sie in Neukölln wie am Wedding, in Moabit wie in Schöneberg, eben in allen Volksgegenden sich finden. (Siehe »Studien« und »Milljöh«.)
Er brachte gewissermaßen die Landschaft, in der das Volk lebt.
Das Volk fand sich und seine Umgebung durch die Arbeit eines überaus gutherzigen Künstlers auf den Blättern von Heinrich Zille wieder. Und das vergalt es dem Künstler.
Kaum eine Ausstellung wurde so besucht, wie die Zille-Ausstellung zu seinem siebzigsten Geburtstag im Märkischen Museum. Der Bau an der Waisenbrücke, sonst kaum beachtet, hatte seine großen Tage. Des gewaltigen Andranges wegen musste er oft geschlossen werden. Monatelang konnte man vor dem Eingang die Besucher in langen Schlangen anstehen finden – als gäbe es dort wichtige Lebensmittel. In vielen Familien sind Zeichnungen gesammelt oder wenigstens einzeln an die Wand genagelt worden. Und bei fast allen Gewerbetreibenden und in unzähligen Arbeiter- und Angestellten-Haushaltungen wird irgendein Zille-buch wie ein kleines Heiligtum aufbewahrt und von Zeit zu Zeit vorgeholt, um die Herzen zu erquicken und zu erfrischen.
Wie er selbst zum Volke steht, drückte er einmal in einer kurzen, sehr treffenden Zeitungsplauderei aus:
»Immer hab' ich mit den kleinen Leuten gelebt, mit denen ich aufgewachsen, die für mich die Großen waren: – Volk – die Armen. Die den Besitz und die Wohlhabenheit weniger müssen erhalten, vermehren und sich selbst mit Brosamen sollen abfinden. Ich versuchte mit Bild und Wort die Vergessenen zu bannen, so nach und nach kam ich in die Zeitungen, illustrierten Zeitschriften, in die Witzblätter und wurde so der ›Arme-Leute-Maler‹ – leider Witzblätter – es tut weh, wenn man den Ernst als Witz verkaufen muss.
Der Verschönerungsrat, der Barbier, der mich betreute, hielt vielen Zeitschriften zur Unterhaltung seiner Kunden, aber auch zu seiner eigenen Belehrung. Er legte mir schmunzelnd immer die neuesten Journale mit Zille-Bildern vor und sagte: ›Großartig!‹ Er kannte mich aber nicht.
Ich fragte mal, wie sich das Publikum, seine Kunden, über die Bilder aussprechen. ›Großartig! Sie könn' jarnich erwarten, jeder will die Zeitung oder das neue Buch haben – aber es sin ooch Jegner dabei, die da sagen: Berlin würde dadurch beleidigt, verschandelt! Da hab' ick ihn' jesagt: ›Meine Herren – det verstehn Se wohl nicht – det is eben Zille sein Milljöh – und aus sein Milljöh kann er eben nich mehr raus!‹ –
Und ich sagte: ›Er will es auch nicht.‹«
Z.
*
12. »Det is mein Auto janz alleene!«
Nach dem Original zum 1. Mal veröffentlicht.
Zur Vollendung seines siebzigsten Lebensjahres wurde eine große Übersicht über seine Werke von der Stadt Berlin im Märkischen Museum veranstaltet. Große Eröffnungsfeier. Der Oberbürgermeister – Stadträte – Stadtväter – mancherlei wichtige Personen aus der Staats- und Stadtverwaltung.
Der Oberbürgermeister hält eine gründliche Rede auf Zille und sein Werk. Würdigt sein Wirken. Durch seine Arbeit sei das Berliner Volk in allen seinen Nöten und in seinem humorvollen Wesen erst so richtig in die Kunst eingeführt worden. Ihm sei es zu verdanken, wenn das Berliner Volk nun auch ebenbürtig sei in der großen Kunst. Durch sein Medium habe er es verklärt und habe auch seine scheinbaren Schattenseiten überwunden und auch die Elendesten dem Herzen der andern Schichten näher gebracht. Zille aber, der sich nicht wohl fühlte, dachte:
»Die Brust schmerzt, als wenn sie mich sprengen wollte.«
Und als auch der Direktor des Museums ihm bei anderer Gelegenheit Ähnliches sagte, da bedankte sich Heinrich Zille und wies mit einer Geste auf die Zeichnungen hin, auf denen das Berliner Volk in seiner ganzen ungeschminkten Art erscheint:
»Das gilt ja nur dem Volk. Sie wollen in mir nur das Volk streicheln. ...«
Die Feiern machte er vielleicht nicht ganz ungern mit. Aber bei allem Wohlgefühl, das er über seine Popularität empfand, war es ihm oft im Kreise der ihn umringenden Gratulanten und Standespersonen höchst ungemütlich. Ja, bei der öffentlichen Feier seines Geburtstages, inmitten von mehr als hundert hohen Beamten und andern Prominenten, plagte ihn sein Alter und sein Altersleiden, die Zuckerkrankheit. Und bei den langen Reden dachte er: Wenn's doch zu Ende wäre!
*
Am schlimmsten wurde Zille von seinen Verehrern bedrängt, als er durch die Feier seines siebzigsten Geburtstags in der Öffentlichkeit, in allen Zeitungen, in vielen Reden und bei allen möglichen Gelegenheiten genannt wurde. Er nahm alle die ihm überreich gespendeten Gaben gern an. Sein langer Arbeitstisch war mit Feinkostkörben und Blumentöpfen und Sträußen gefüllt. Nur über die Blumen war er nicht ganz begeistert. Am wenigsten über die weißen, großblumigen Chrysanthemen, von denen ihm mehrere gebracht worden waren. Er sah sie über seine Brillengläser hinweglugend an und meinte leise abwehrend:
13. Zurück zur Natur.
Aus: »Rund ums Freibad«, Verlag Dr. Selle-Eysler A.-G. Bilder aus den Freibädern.
»Die haben was Totes an sich, wie weißes Papier. Ohne Farbe ... Das ist ja, wie wenn sie mich schon beerdigen wollen!«
*
Und eine junge Dame, die gar zu gern doch ein Zille-Autogramm haben wollte und mit einem großen eingehüllten Blumentopf sich durch die Tür hineingezwängt hatte in Zilles Arbeitszimmer, reichte schüchtern und wortlos dem Meister ihren Blumentopfgruß hin, den er schon mit stillem Grausen in die Hände nahm:
Richtig – wieder eine weiße Chrysantheme!
Er stellte sie zu den übrigen – sah mit gerunzelter Stirn zu der angstvoll Harrenden hin – und ging dann doch auf sie zu, ihre Hand zwischen seine Hände nehmend:
»Na – Kindchen – Sie wollen gewiss auch meine Unterschrift haben? ... Und schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ...«
*
Aber er erlebte nicht nur die Schattenseiten des Berühmtseins. Er weiß auch von den heiteren Erlebnissen zu berichten, die ihm begegneten:
»Einmal habe ich mich doch gefreut. Da kam es raus, wie bekannt ich bin. Ich bekam eine Postkarte, auf der nichts als ein Kahn3 auf der Adressenseite gezeichnet war.
*
Der Postbote gab sie mir:
›Det können Sie doch bloß sein!‹
*
14. Vadding in Frankreich. Weihnacht 1914.
»Wenn ick man blot wüßt, wat ›Stille Nacht, heilige Nacht‹ uf französisch heet! Ick möcht de Lütt mal een dütsches Wihnachtslied vorsingen.«
Ulk 1914.
»Neulich musste ich mir'n Auto nehmen, um nach Hause zu fahren. Und als ich nun meine Straße und Hausnummer sagte, nickte der Schofför und sah mir so komisch prüfend an, dass mir ordentlich bange wurde. Und als wir dann durch den Tiergarten kamen, da stoppte er'n bisschen.
Nanu, denke ich, was soll das werden?
Da dreht er sich um und fragt lächelnd:
›Sie sind doch Zille, der Maler Zille?‹
Ich musste nun ›Ja‹ sagen.
›Na, ick habe Sie doch jleich erkannt – nach den Bildern in der Zeitung. Haben Sie't eilig?‹
›Das gerade nicht‹, antwortete ich. ›Aber ich muss fahren, weil meine Beine mich nicht mehr so weit tragen.‹