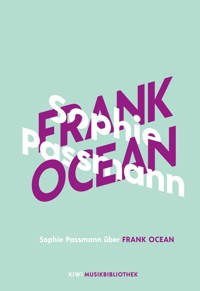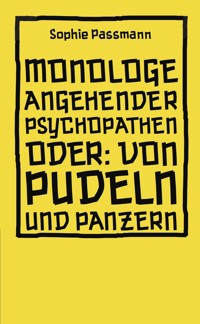9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sophie Passmann hat mit »Pick me girls« nicht nur ihr persönlichstes Buch geschrieben, sondern auch eine kluge Auseinandersetzung mit dem männlichen Blick. Ihr Memoir zeichnet ein stellvertretendes Frauenleben nach und wirft die Frage auf: Welche Version von ihr selbst hätte Sophie Passmann sein können, wenn das Patriarchat nicht existieren würde? »Ich bin nicht so wie andere Frauen«, ist der typische Satz eines pick me girls. Wahrscheinlich haben die meisten Frauen diesen Satz mal gedacht, nicht nur in der unbewusst-misogynen Abgrenzung zu einem ganzen Geschlecht, sondern als Herabwürdigung des eigenen Selbst – man ist nicht so dünn und hat keine so gute Haut wie alle anderen Frauen. Wenn man als Frau geboren wird, kommen die Selbstzweifel ab Werk. Spätestens in der Pubertät wird man mit der goldenen Regel konfrontiert, die zwar nirgendwo geschrieben steht, aber als allgemeingültig gilt: Der männliche Blick, das Begehrtwerden ist die höchste Währung. Warum wir alle pick me girls sind und welche Unmöglichkeiten Sophie Passmann und höchstwahrscheinlich auch jede andere Frau im Laufe ihres Lebens ertragen muss, das seziert Sophie Passmann so scharf und klug wie keine andere.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sophie Passmann
Pick me Girls
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Sophie Passmann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Sophie Passmann
Sophie Passmann, 1994 geboren, ist Autorin, Satirikerin und Moderatorin. Ihr Buch »Alte weiße Männer« stand wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, »Komplett Gänsehaut« stieg sofort auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste ein. Auf ZDFneo ist sie mit Tommi Schmitt in der Talkshow »Neo Ragazzi« zu sehen. Zusammen mit Joko Winterscheidt moderiert sie den wöchentlichen Podcast »Sunset Club«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Ich bin nicht so wie andere Frauen«, ist der typische Satz eines pick me girls. Wahrscheinlich haben die meisten Frauen diesen Satz mal gedacht, nicht nur in der unbewusst-misogynen Abgrenzung zu einem ganzen Geschlecht, sondern als Herabwürdigung des eigenen Selbst – man ist nicht so dünn und hat keine so gute Haut wie alle anderen Frauen. Wenn man als Frau geboren wird, kommen die Selbstzweifel ab Werk. Spätestens in der Pubertät wird man mit der goldenen Regel konfrontiert, die zwar nirgendwo geschrieben steht, aber als allgemeingültig gilt: Der männliche Blick ist die höchste Währung.
Warum wir alle pick me girls sind und welche Unmöglichkeiten Frauen im Laufe ihres Lebens ertragen müssen, das seziert Sophie Passmann so scharf und klug wie keine andere.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2023, 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Christian Werner
ISBN978-3-462-31128-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
Einleitung
Alternative Einleitung für Männer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Danksagung
»When I was younger, I thought the first person confessional essay was going to save us.«
Lena Dunham
Für Hannah, für Frida.
Einleitung
Ich denke oft an die Frau, die ich eigentlich wäre. Es ist die Version von mir, die existieren würde, wenn ich in meiner Jugend nicht schon gelernt hätte, so zu sein, wie ich dachte, wie Frauen zu sein haben. Die Wahrheit ist, dass ich den Überblick verloren habe darüber, was mein echter Charakter ist und was nur das Resultat dessen, dass man als junges Mädchen irgendwann durch Elternhäuser und Lehrer beigebracht bekommen hat, dass die Anerkennung von Jungs die wichtigste Währung ist, die im zwischenmenschlichen Miteinander existiert. Ich weiß, dass ich die Frau, die ich eigentlich hätte sein können, nicht mehr werde. Ich wäre eigentlich weicher und wärmer und langweiliger. Ich würde andere Musik hören, lauter und seltener. Ich hätte in meinem Leben weniger Sex gehabt und bessere Pornos geguckt. Ich würde tiefere Ausschnitte tragen und mit Taxifahrern flirten. Ich hätte keine Angst, im Fitnessstudio kurze Shorts zu tragen. Ich hätte nicht für jedes Fehlverhalten eines jeden Mannes in meinem Leben mindestens ein Dutzend Tage lang ein Dutzend Ausreden gefunden. Ich hätte nicht eine Sekunde meines Lebens meinen Körper gehasst. Ich würde nicht so oft gefragt werden, ob es eigentlich jemandem in meinem Leben gebe, so, als sei mein Leben alleine nicht schon überbordend genug. Ich hätte niemals Hermann Hesse gelesen. Ich hätte die Männer, die ich zu wenig geliebt habe, mehr geliebt und auf die Männer, die ich zu viel geliebt habe, nicht gewartet. Ich hätte kurze Haare und lange Nägel. Die Frau, die ich eigentlich wäre, ist weniger erfolgreich und hat öfter recht. Es ist eine Frau, die nur in der Theorie existiert.
Ich befürchte mittlerweile, dass es sich nicht lohnt, die Frau zu werden, die man eigentlich sein könnte, nicht in dieser Welt, nicht in diesem System. Ich glaube sogar, dass ich ein besseres Leben habe, seit ich mich damit abgefunden habe, dass ich sie niemals sein werde. Ich habe jahrelang versucht, eine Frau zu werden, die feministisch und moralisch makellos lebt, jeden ihrer Schritte, jede ihrer Lebensentscheidungen im Vorhinein dahin gehend überprüft, ob es mich zu einer besseren Frau macht, zu einer Frau, die mehr Vorbild ist, mehr Feministin, weniger Fantasie oder Projektion für Männer. Ich habe mich damit abgefunden, dass mein Leben als Frau ein ständiges Ausprobieren und Scheitern bleiben wird, ein Korrigieren und Entschuldigen. Es gibt nicht die perfekte Frau, es gibt die Frau, die ich eigentlich wäre, nicht. Was es gibt, ist ein ständiges Dazwischen.
Die Frau, die ich heute bin, schämt sich für die Momente, in denen sie über Witze von Männern in Meetings etwas zu laut lacht, weil sie weiß, dass es ihr Leben einfacher macht. Die Frau, die ich heute bin, hat immer bei ersten Dates bezahlt und den Mann insgeheim dafür verachtet, dass er sie nicht daran gehindert hat. Sie ist neidisch auf den Erfolg anderer Frauen, nicht, weil sie es ihnen nicht gönnt, sondern weil sie weiß, dass die Öffentlichkeit nur eine bestimmte Menge erfolgreicher Frauen ertragen will, dass die Ressourcen also begrenzt sind. Auch wenn es feministischer und besser und wärmer und reifer klingt, das Gegenteil zu behaupten, sind diese erfolgreichen Frauen dann eben Konkurrenz.
Auf der einen Seite glaube ich, dass ich wirklich genug tue und getan habe, dass ich genug nachdenke und reflektiere, dass ich auf genug verzichte und für genug kämpfe. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass es da eine theoretische Version von mir gibt, die ich eigentlich sein sollte. Vielleicht gibt es diese Version sogar von annähernd jeder Frau.
Ich wurde in eine Popkultur hineingeboren, die eine fast obszöne Faszination aufbringt für Frauen, die anders sind als andere Frauen. Diese Frauen sind die Hauptrollen in romantischen Komödien, sie sind Popstars und Topmodels. Diese Frauen sind eine Fantasie, ein Produkt der Idee, dass Frauen an sich eher unangenehm und anstrengend sind, aber ein paar Ausnahmen muss es doch geben, denn immerhin will ein großer Teil der Männer auf diesem Planeten Sex mit Frauen haben. Die Erzählung ist, dass diese Frauen seltene Kostbarkeiten sind, die sich abheben aus dem Einheitsmüll von Weiblichkeit, der sonst so existiert. Diese Frauen kehren jedes weibliche Klischee um, sie sind tiefsinnig und humorvoll, uneitel und ohne jede Art von emotionalem Ballast, sie sind unabhängig und zufälligerweise ausnahmslos wunderschön. Diese Frauen sind die Antiheldinnen zu einem sexistischen Klischee, das manifestiert, was andere, normale Frauen angeblich alles sein sollen. Es ist leicht für Männer, diesen Frauen Anerkennung zu schenken, weil sie diese Frauen hochhalten können, während sie gleichzeitig die meisten anderen Frauen weiterhin herabwürdigen.
Ich wollte den Großteil meines Lebens anders sein als andere Frauen. Ich hielt es für den einzigen Ausweg aus meiner mir sehr offensichtlich erscheinenden Misere, dass ich nicht schön, nicht charmant, nicht weiblich genug war, um eine von diesen Frauen zu sein, die männliche Anerkennung nur durch Repräsentation ihres Geschlechtes erhalten konnte. Ich dachte, ich müsste, wenn ich es meiner Umwelt schon zumutete, so zu sein, wie ich war, wenigstens einen charakterlichen Mehrwert mitbringen. Ich müsste dann wenigstens die lustige Frau sein, die verständnisvolle Frau, die Frau, der Männer alles erzählen könnten, ganz egal, wie abstrus, verdreht oder offensichtlich grenzüberschreitend es wäre. Ich habe mich jedoch nie wirklich bewusst entschieden, anders sein zu wollen als andere Frauen. Die Welt hatte mich nur sehr schnell davon überzeugt, dass ich das, was bei anderen Frauen ausreichend vorhanden war, nicht zu bieten hatte und ich der Welt, die Frauen ja immer irgendeine Gegenleistung für ihre Existenz abverlangte, halt etwas anderes bieten müsste.
Ich kam nicht auf die Idee, dass ich auch einfach hätte sein können.
Als ich das erste Mal davon hörte, dass das Internet für diese Frauen, die jahrzehntelang in den Augen der Öffentlichkeit anders als andere Frauen sein wollten, den Begriff pick me girls gefunden hatte, war ich auf eine Art verärgert, die mich selbst verwunderte. Ich empfand es als wahnsinnig ungerecht, dass so getan wurde, als wären die Frauen aus reinem Hass auf andere Frauen so geworden, immerhin wusste ich ja, dass es zumindest bei mir nur der Versuch war, den Weg raus aus unendlich vielen Komplexen zu finden. Es ist doch ein Spiel, das wir alle seit Jahrzehnten ohnehin meistens verlieren, dachte ich. Wieso fingen Frauen ohne Not an, jetzt auch noch einen Wettbewerb daraus zu machen, wer am besten darin war, eine Frau zu sein?
Gleichzeitig hatte ich eine unendliche Faszination für pick me girls und alles, was dazu gehörte. Zum einen wusste ich, dass ich selbst eines war und dass sich meine Scham deswegen sehr aktiv in Grenzen hielt. Zum anderen wusste ich, dass hinter dem Begriff pick me girls etwas steckt, was mit viel diffuseren Kategorien zu tun hat als mit sexueller Orientierung, Klasse, Hautfarbe oder Religion. Die Diskussion um pick me girls ist eine, die nach schwammigeren Identitäten fragt, danach, wie die ersten Männer im Leben einen behandelt haben, wie der eigene Körper aussah, als man aufwuchs, oder wie man zumindest glaubte, wie er aussah. Danach, wie intensiv das Umfeld, in dem man zur Frau wurde, einem vermittelt hat, dass man ausreicht, so, wie man ist. Danach nämlich, wie intensiv die Leidenschaften, die man als Teenagerin entwickelte, belohnt, ignoriert oder sogar herabgewürdigt wurden.
Mein Frauwerden war dadurch geprägt, dass ich ein weißes Cis-Mädchen war. Aber die Tatsache, dass ich ein pick me girl war, hatte auch damit zu tun, dass ich ein unglückliches Mädchen war. Ein psychisch krankes Mädchen. Ein hochintelligentes Mädchen. Ein dickes Mädchen. Ich sage nicht, dass jeder sich ab jetzt seine eigenen Kategorien bauen sollte, um nicht mehr an den Privilegien, die mit der eigenen Herkunft einhergehen, gemessen werden zu müssen. Aber die Tatsache, dass das gesamte feministische Internet innerhalb von wenigen Monaten den Ausdruck pick me girls in sein Repertoire übernommen hat, zeigt, dass es wohl den Wunsch danach gibt, nicht mehr nur über das Frausein, sondern auch über das Frauwerden zu sprechen.
Ich bin davon überzeugt, dass es bei pick me girls viel um Scham geht, um Selbsthass und um das ständige Gefühl, dass mit einem selbst etwas grundlegend falscher, hässlicher oder unangenehmer ist als mit anderen Mädchen. Es geht in diesem Buch um all das, um all die Momente in meinem Leben, in denen sich diese Gefühle ausgebreitet haben. Ich schreibe dieses Buch, weil mir die Zeit davonrennt. Ich bin fast 30 Jahre alt – bald hören sich junge Mädchen nicht mehr freiwillig an, was ich übers Frausein zu sagen habe. Bald bin ich nicht mehr im besten Fall die coole Tante, bald bin ich höchstens die unangenehme Stiefmutter. Ich schreibe dieses Buch jetzt, weil ich glaube, dass ich jungen Frauen mit ein paar Dingen in diesem Buch das Leben leichter machen kann. Das hier ist kein Teenager-Selbsthilfebuch. Es ist auch kein feministisches Kampfwerk und erst recht, um Gottes willen, keine Autobiografie. Das ist das Buch, das ich mit 14 Jahren gebraucht hätte. Genau wie ich jeden Tag versuche, die Frau zu sein, die ich mit 14 Jahren gebraucht hätte.
Alternative Einleitung für Männer
Bevor ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, wollte ich etwas schreiben, was Männer ebenso lesen wollen wie Frauen. Wenig irritiert mich an meinem Job mehr, als die Tatsache, dass Frauen vor allem für Frauen schreiben und Männer für alle schreiben dürfen. Ich schreibe viel über Sexismus, das sollte doch dazu führen, dass vor allem Männer meine Texte lesen, so, wie es bei Themen wie Rassismus oder Antisemitismus schon lange zum guten Ton gehört, dass gerade diejenigen, die nicht davon betroffen sind, sondern die Schuld an den Strukturen haben, versuchen, sich durch Bücher weiterzubilden. Selbst die wachesten, herzlichsten Männer, selbst die, die mit mir gemeinsam in Milieus leben, in denen der basalste Anflug von Feminismus irritierend deutlich belohnt wird, lesen wenig bis keine feministische Literatur. Ich wollte ein Buch schreiben, das es schafft, Männern genauso wie Frauen zu suggerieren, dass sie es lesen sollten, nicht aus moralischen Gründen, sondern weil sie es schlicht und ergreifend lesen wollen.
Dieses Buch handelt im Grunde von nichts anderem als der Autoaggression, mit der Frauen sich selbst in ihrer Weiblichkeit abwerten, um Männern besser zu gefallen. Dieses Vorwort sagt deswegen das Gegenteil von dem, was es ursprünglich sollte: Männer, lest dieses Buch meinetwegen nicht. Lest meinetwegen dieses Vorwort zu Ende und legt es danach wieder weg.
Dieses Buch hat eine Einleitung extra für Männer, weil ich glaube, dass wir in einer kulturellen Zwischenphase sind, in der viele Männer vieles bereits deutlich besser machen wollen, als sie es früher gemacht haben, und dennoch vieles so tun, wie sie es immer getan haben. Es ist mühelos möglich, mir zu unterstellen, ich hätte einen zu pessimistischen Blick auf Männer und ihre Interessen. Aber ich weiß, von wem meine Lesungen besucht werden, ich weiß auch, von wem Konzerte von weiblichen Popstars besucht werden. Ich weiß, wie ungebrochen groß mein Interesse schon immer war an Literatur von Männern und Frauen – mein Bücherregal sieht aus wie eine große, glückliche, gemischtgeschlechtliche Familie –, ich weiß aber auch, dass Männer dann doch oft auf die Bücher ihrer Männerhelden von früher warten, ehe sie das Buch einer weiblichen Autorin kaufen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die allerwenigsten das bewusst tun. Es ist ein Reflex, eine kulturelle Prägung, die viel mit den unfreiwillig auf uns allen abgeladenen Behauptungen darüber zu tun hat, dass Männer ein wenig allgemeingültiger über die Welt schreiben könnten als eben Frauen. Die Wahrheit ist, dass die große Popliteratur, der große Gonzo-Journalismus, die Beatniks, all die postmodernen Helden aus den Staaten eben auch vor allem darüber geschrieben haben, wie es ist, ein Mann zu sein. Sie haben es aber meist mit der Behauptung getan, sie würden darüber schreiben, wie es ist, ein Mensch zu sein.
Das meiste, was ich über Männer weiß, habe ich aus genau diesen Büchern gelernt. Es kam mir nie wie überflüssiges Wissen vor, nur, weil ich selbst kein Mann bin. Ganz im Gegenteil. Ich behaupte nicht, dass ich über alle Menschen schreibe. Ich schreibe über Frauen, ich werde es weiterhin tun, selbst wenn das bedeutet, dass kaum Männer lesen, was ich schreibe.
Man kann Frauen nicht vollständig und aufrichtig respektieren, wenn man ihre Kultur nicht konsumiert, wenn man ihre Musik nicht hört, ihre Bücher nicht liest, wenn man nicht wissen will, wie ihre Geschichten ausgehen. Männer, die Männer lesen und Männern zuhören und wissen wollen, was Männer über die Welt denken, und all das mit der Ausrede präparieren, das sei eben kulturelle Prägung, das sei Jugend, das sei Nostalgie, sind offenbar nicht daran interessiert, Frauen nur wegen ihrer Gedanken in ihre Leben zu lassen. Kultur von Frauen zu konsumieren bedeutet, Frauen zu ertragen, auch wenn sie keine Funktion erfüllen, wenn sie weder Mutter oder Hure noch Jungfrau sind – mehr noch –, wenn sie sogar vor allem das tun, was man mit Kunst in der Regel tut: irritieren, nerven, ärgern.
Wenn mir das Schreiben dieses Buches eines beigebracht hat, dann, dass wenig unnachhaltiger, erschöpfender und erfolgloser ist, als als Frau so zu leben, wie es vermeintlich Männern gefällt. Ich war immer dann am uninteressantesten, wenn ich besonders beliebt bei besonders vielen Männern war. Und ich habe erst dann angefangen, wirklich großartige Männer kennenzulernen, als ich aufgehört habe zu versuchen, es ihnen bei der ersten Begegnung möglichst einfach zu machen. Ich habe beschlossen, das so beizubehalten. In einer coolen Welt würden Männer Bücher von Frauen lesen. Ich finde mich damit ab, dass nur die großartigen Männer Bücher von Frauen lesen.
*
Ich erinnere mich sehr genau an meine Kindheit. Ich weiß, wie warm es an dem Tag war, an dem ich Fahrradfahren gelernt habe, und ich weiß, wie der Baumarkt roch, in dem ich mir die Tapete für mein Kinderzimmer aussuchen durfte. Auf der Tapete waren kleine freundliche Hubschrauber mit lachenden Gesichtern auf blauem Hintergrund und der Baumarkt roch ehrlich gesagt wie jeder andere Baumarkt auf der Welt, nach Silikon, Schnittholz und Schweiß.
Ich erinnere mich nur bruchstückartig an meine Jugend. Ich weiß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass ich einen ersten Kuss und einen ersten Vollrausch hatte, aber ich könnte beim besten Willen nicht sagen, wie alt ich war, als beides stattfand, wie ich mich gefühlt habe und wann das Gefühl wieder aufgehört hat. Ich weiß nicht, wie genau ich die Zeit nach dem Abitur verbracht habe und was ich an Nachmittagen nach der Schule gemacht habe. Ich erinnere mich punktuell an schlechte Frisuren und an Jungs, in die ich aus der Ferne unglücklich verliebt war. Ich erinnere mich an Episoden. An die großen Themen, die es in meiner Jugend gab, an die Schicksalsschläge und die Krisen, die ich so schnell wie möglich zu Ende fühlen wollte.
Ich war in der Theater-AG und im Sportverein, ich ging manchmal sogar zu Partys. Ich erinnere mich an die brennende Scham, die man empfand, wenn aus einem Gespräch in einer Gruppe hervorging, dass man zu irgendeinem Geburtstag irgendeines Klassenkameraden nicht eingeladen war und man die Enttäuschung über diese Einsicht verstecken wollte, während die anderen diskutierten, welche Geschenke sie kaufen würden und welche Mütter welche Kinder wann zur Party fahren könnten. Ich hatte gute und ich hatte schlechte Phasen, man könnte sagen, ich war körperlich anwesend während meiner Pubertät. Der Rest ist eine große Verunsicherung. Eines Tages saß ich in meinem Kinderzimmer und die Tapete mit den Hubschraubern war weiß überstrichen. Ich erinnere mich nicht ansatzweise daran, wie es dazu kam.
Ich bin aber irgendwann eine Frau geworden.
Als ich eine Frau wurde, begann ich, mich für mein Aussehen zu schämen und für meine Lautstärke, ich verstand die schwer dechiffrierbaren Vorgaben nicht, nach denen man sich plötzlich um Jungs herum bewegen sollte, ich verstand nicht, dass man sich gegenseitig Kopfbedeckungen vom Kopf zu reißen und dann kreischend wegzulaufen hatte, in der Hoffnung, dass man kurz Flirt-Fangen spielen könnte. Ich verstand nicht, wieso alles so schwierig wurde und niemand von den Erwachsenen versuchte, es einem etwas leichter zu machen. Regeln änderten sich plötzlich und niemand machte sich die Mühe, einem zu erklären, wieso das so war. Man fand es nicht mehr schlimm, wenn die eigenen Eltern rauchten, sondern klaute ihnen Zigaretten aus der Schachtel. Niemand wollte die beste Note in der Klassenarbeit schreiben und niemand wollte ausgeschlafen zur Schule kommen. Wir alle gaben uns auf eine seltsam offensichtliche Art auf einmal Mühe dabei, so auszusehen, als würde uns das Leben keinerlei Kraft kosten. Ich fand alles an meiner Jugend mindestens verwirrend, meistens angsteinflößend. Es überstieg meine Vorstellungskraft, dass es allen um mich herum so gehen sollte. Ich begann, die Schuld bei mir zu suchen. Irgendetwas an mir musste kaputter, falscher, alberner sein als an allen anderen um mich herum. Alle anderen schienen ihre Jugend ja viel besser hinzukriegen. Die ersten Lieben meiner Freundinnen wirkten erträglich schmerzhaft und ausreichend kurz, die anderen Mädchen um mich herum hatten in meinen Augen keinen Grund, sich für ihr Aussehen zu schämen, ihre Haare waren seidig und ihre Beine waren gerade. Es lag an mir, entschied ich. An mir waren irgendwelche Dinge so grundfalsch, dass ich viel mehr unter allem litt. Die anderen Mädchen waren besser als ich, sie sahen besser aus und sie waren besser angezogen, sie waren liebenswürdiger und deswegen auch beliebter. Ich war wahrscheinlich nicht einmal 15 Jahre alt und entschied mich aus Hilflosigkeit für die Erzählung, unter der Frauen bis heute leiden. Ich dachte, ich sei anders als andere Frauen. Ich wollte mich nicht abgrenzen, ich hatte das Gefühl, es war bereits passiert.
Ich bewunderte andere Frauen. Ich staunte über die Leichtigkeit, die ich ihnen unterstellte, ich verstand das Leben nicht, das sie sich bauten. Sie gingen aus und schienen nicht zu weinen. Ich dachte, ich sei anders als andere Frauen, weil diese Erzählung meiner Jugend erträglicher war als das, was in Wirklichkeit um mich herum passierte. Ich hatte die Wahl, ich konnte mich selbst zum Freak ernennen, um meine Traurigkeit, die Scham, mit der ich jeden Tag durchs Leben rennen musste, wenigstens zu einer Ausnahme zu machen. Oder ich hätte den Gedanken zulassen müssen, dass die meisten jungen Frauen um mich herum sich so fühlten wie ich es tat.
Oft möchte ich mir einen rostigen Nagel durch die Hirnrinde rammen, wenn ich 20 Minuten ohne jeden Anflug von Esprit durch die Startseite meiner Instagram-App scrolle. Der Algorithmus, von dem man mittlerweile redet, als wüsste man auch nur ansatzweise, was sich dahinter verbirgt, soll den sogenannten content angeblich für mich kuratiert haben, damit alles genau meinen Interessen entspricht. Das meiste davon fühlt sich allerdings wie ein wirrer Fiebertraum an, um den kein Teil von mir jemals freiwillig gebeten haben kann. Ich scrolle natürlich trotzdem. Und schaue mir an, wie sich ganze Humorgenres innerhalb der sozialen Netzwerke entwickeln, einfach, weil sie gut funktionieren bei den Leuten. Es gibt Videos, die absichtlich wirr und unlogisch sind, es gibt Videos mit streitbaren Pointen und Videos, in denen moralische Dilemmata gezeigt werden, alles mit dem Ziel, möglichst viele Leute dazu zu bewegen, empört, irritiert oder wütend unter dem Video zu kommentieren. Jede Art von Reaktion ist eine gute Reaktion, wenn man content createt. Eines der größten und reichweitenstärksten Genres ist das, was man unter so relatable zusammenfassen könnte. Das sind Videos, in denen eine Erinnerung aus der Jugend, eine Anekdote aus einer Familiendynamik oder ein Gefühl, das man in einem bestimmten Moment seines Lebens hat, nachgestellt werden. Diese Videos versuchen etwas zu zeigen, mit dem sich eine möglichst große Gruppe von Menschen im Internet gemein machen kann. Es sind nicht die Videos, die am witzigsten, klügsten oder interessantesten sind. Aber es sind die Videos, die die meisten Leute dazu bewegen, auf sie zu reagieren und sie zu teilen. So-relatable-Humor ist ein Genre, das es ohne das Internet nie geben würde. Uns etwas zu zeigen, was wir selbst erlebt haben, funktioniert noch besser als eine Katze, die einen Laserpointer jagt und dabei gegen eine Wand rennt. Auch wenn die Entstehungsgeschichte dieser Humorsparte spätkapitalistisch trübsinnig ist, ist das, was eher versehentlich durch sie passiert, interessant. Menschen auf der ganzen Welt suchen den größten gemeinsamen Nenner, den sie einer Generation unterstellen können. Milieus und identitätspolitische Gruppen sortieren sich auf der Suche nach dem nächsten Viralvideo in ihre Vorlieben und Eigenheiten selbst ein. Wenn in fünf Jahren der erste Soziologe TikTok runterlädt, wird er schnell merken, dass er und sein gesamtes Forschungsfeld von Teenagern mit Ringlicht obsolet gemacht wurden.
Es gibt Videos von Erwachsenen, die immer wiederkehrende Verhaltensweisen von ihren Eltern parodieren: Mütter, die samstagmorgens passiv-aggressiv mit dem Staubsauger gegen die Kinderzimmertür stoßen, um die Kinder aufzuwecken, obwohl sie nicht genau begründen können, wieso sie etwas dagegen haben, dass ihr Teenager-Kind länger schläft. Väter, die kistenweise Grapefruits nach Hause schleppen, nachdem ihre Tochter einmal eine Grapefruit gegessen hat. Aus einer vermeintlich individuellen Familiendynamik wird ein schwer erklärbarer Kohorten-Spleen, sobald sich in sozialen Netzwerken Menschen auf der ganzen Welt über ein und dieselbe Verhaltensweise ihrer Eltern amüsieren. Es gibt diese Videos für jede noch so spezielle Gruppe von Menschen. Musical-Darsteller am Broadway machen Videos, die vermutlich vor allem für andere Musical-Darsteller am Broadway relatable sind. Weiße konservativ erzogene Frauen aus den US-amerikanischen Küstenstaaten machen Witze über ihre Ugg-Boot- und Kirchenchor-Jugend, die für mich zwar nachvollziehbar, aber nicht besonders unterhaltsam sind. Je kleiner die Grundgesamtheit der potenziellen Zielgruppe, desto seltsamer und nischiger sind die Videos. Und je größer die gewählte Grundgesamtheit ist, desto beklemmender ist die Einsicht, dass gewisse Erlebnisse offenbar nicht nur für Tänzer in New York oder Hausfrauen in Maine gelten, sondern für einen Großteil einer Generation, egal, ob man in den Staaten oder in irgendeinem Land Europas groß geworden ist. Es gibt unzählige dieser Videos von Frauen in meinem Alter, die die gemeinsamen Wirklichkeiten von Frauen in meinem Alter suchen. Es sind Videos über Mütter, die Streite mit der selbstmitleidigen Feststellung beenden, dass sie wohl einfach schlechte Mütter seien. Es sind Videos über den Moment des Unwohlseins, den man als Frau spürt, wenn der Uber-Fahrer einen über den Innenspiegel etwas zu lange anschaut. Es sind Videos von Frauen, die ihre Teenager-Zeit mit brutalen Tagträumen darüber verbringen, welche Körperteile oder Fettschichten sie sich gerne mit der Küchenschere abschneiden wollen. Es sind Videos von Frauen, die darüber sprechen, wie sie Jahre später durch Zufall in einem Gespräch bemerken, dass dieses unangenehme Date damals, an das sie nicht so gerne zurückdenken, technisch und juristisch gesehen in einer Vergewaltigung endete. Es sind Videos, die nicht auf ausnahmslos alle Frauen in meinem Alter anwendbar sind, aber zum Teil hunderttausendmal kommentiert und geteilt wurden. Es sind allgemeingültige Erlebnisse, die sich Frauen im Internet nacherzählen.
Als diese Videos populär wurden, war das der Beginn meiner Einsicht, dass vermutlich rein gar nichts an meiner Jugend außergewöhnlich war.
Der Beweis dafür, dass ich so anders nicht war, wurde mit jedem neuen Video, das in meiner Timeline auftauchte, weiter angetreten. Als Teenagerin überstieg es meine Vorstellungskraft, dass vielleicht nicht jede, aber die meisten Frauen um mich herum Selbstzweifel hatten, Selbsthass, Scham, unangenehme Aufeinandertreffen mit Männern, die deutlich älter waren als man selbst. Ich denke viel darüber nach, wie meine Jugend wohl ausgesehen hätte, wenn ich mit einem Grundverständnis dafür durch die Gegend geirrt wäre, dass ich nicht alleine bin. Denn um nichts anderes geht es bei dieser omnipräsenten und mittlerweile zur Parodie gewordenen Behauptung, man sei anders als andere Frauen. Es geht um Einsamkeit und Vereinzelung, auch wenn dieses Beharren auf die eigene Außergewöhnlichkeit wie Selbsterhöhung oder Arroganz wirken kann. Ich habe nicht einen Tag meines Lebens gedacht, ich sei anders als andere Frauen, weil ich mich besser fand als andere Frauen. Ich dachte, ich sei anders als andere Frauen, weil mein kleines Gehirn den Gedanken, dass noch mehr Frauen genauso sein könnten wie ich, zu brutal fand.
Ich schaute also ins Internet und stellte fest, dass ich vielleicht gar nicht außergewöhnlich war, nur, weil ich mich außergewöhnlich fühlte, und hatte den Eindruck, ich wäre Batman, der als Erwachsener erfährt, dass seine Eltern gar nicht tot sind, sondern nur nach dem Wocheneinkauf einen Parkplatz suchen.
Plötzlich fehlte mir meine Origin-Story.
*
Als ich zum ersten Mal den Begriff pick me girls hörte, hoffte ich, er hätte mit Grey’s Anatomy zu tun. In der zweiten Staffel der Serie gibt es diesen tränentreibenden Monolog der Hauptfigur Meredith Grey, die gerade eine eher strapaziöse Affäre mit ihrem Chef Derek eingegangen ist, bevor der die Gelegenheit hatte, ihr zu sagen, dass er verheiratet ist (upsi!). Sie ringt sich in Staffel zwei dazu durch, ihm ihre Gefühle in einer pathetischen Ansprache zu gestehen. Derek, der vor der Entscheidung steht, ob er Meredith oder seine Ehefrau will, steht im OP-Saal. Meredith schaut ihn voller Liebe und Sehnsucht an und sagt: »Pick me. Choose me. Love me.«
Sie sprach damit diese eine Sache aus, die ja im Grunde der Subtext von jedem Flirt jemals und von etwa zwei Dritteln aller »Geht’s dir gut??«-Sprachnachrichten ist, die ich in meinem Leben an Männer so versendet habe. Bitte entscheide dich für mich.
Bekannt wurde der Begriff pick me girls 2020 via TikTok, als die ersten Userinnen anfingen, Videos aufzunehmen, in denen sie ebendiese Spezies persiflierten, nämlich Frauen, die für andere Frauen offensichtlich recht durchschaubar auf männliche Anerkennung aus waren, zum Beispiel, indem sie möglichst oft darauf hinwiesen, dass sie vor allem mit Jungs befreundet seien, weil andere Frauen so viel Drama machten; dass sie sich eher für Sport interessierten als für Schminke; dass sie Bier tranken und Fast Food aßen, statt wie die anderen Frauen Kalorien zu zählen. Die einzige Charaktereigenschaft des pick me girls ist die Tatsache, dass sie versucht, anders als andere Frauen zu sein. Andere Frauen werden dabei immer über weibliche Klischees definiert: oberflächlich, leicht hysterisch, unentspannt, essgestört, Spielverderberinnen, die ihre Partner von entspannten Abenden mit den Jungs weglockten, um sich bei ihnen darüber auszuheulen, dass sie drei Kilo zugenommen hatten. Anders als andere TikTok-Trends, die ohne größeren Einfluss auf das popkulturelle Gedächtnis irgendwann wieder verschwinden, wurde pick me girls