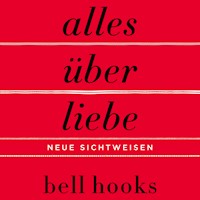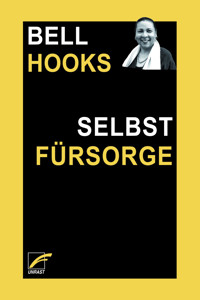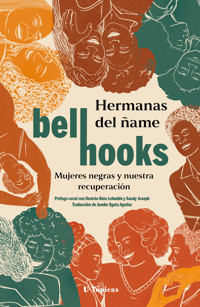13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zugehörigkeit und Verbundenheit sind Herzensangelegenheiten für bell hooks und von diesen handelt ihr sehr persönliches Buch "Dazugehören. Über eine Kultur der Verortung". hooks reflektiert darin ihre Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart, die sie von Ort zu Ort führte, aus der Arbeiterklasse an die Universität, vom Land in die Stadt und wieder zurück, nur um dort zu enden, wo sie begann: in ihrer Heimat Kentucky. In der schlichten und zugleich tiefgründigen Erzählung skizziert sie eine ›Geografie des Herzens‹, in der das Glück des einfachen Landlebens, die Suche nach Trost in der Natur, Ökologie und Nachhaltigkeit, lokales und globales Umweltbewusstsein, Kunst, Familie und Zusammenleben einen Platz finden. Sie reflektiert die kulturelle und soziale Verortung des Individuums und die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Umwelt. hooks erinnert an vergangene und gegenwärtige Erfahrungen von Afroamerikaner*innen im ländlichen Süden der USA, die seit jeher eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft und der ökologisch orientierten Selbstversorgung spielen. Ehrlich, klug und mit träumerischem Mut entwickelt bell hooks in "Dazugehören" eine antirassistische und ökologische Vision einer Welt, in der alle Menschen – wo auch immer sie zu Hause sind – ein gutes und erfülltes Leben führen können: eine Welt, zu der wirklich alle dazugehören
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
bell hooks, am 25. September 1952 als Gloria Watkins in Hopkinsville, Kentucky geboren und Ende 2021 verstorben, war eine afroamerikanische Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin. Schon als junge Studentin schloss sie sich der feministischen Bewegung an und machte sich 1981 gleich mit ihrem ersten Buch Ain’t I a Woman: Black Women and Feminism einen Namen. In den nachfolgenden Jahrzehnten hat sie zahlreiche Werke veröffentlicht, in denen sie sich mit Rassismus, Sexismus und Klassismus beschäftigt, und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden.
bell hooks
Dazugehören
Über eine Kultur der Verortung
Aus dem amerikanischen Englisch von Helene Albers
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
bell hooks: Dazugehören:
1. Auflage, Oktober 2022
eBook UNRAST Verlag, Februar 2023
ISBN 978-3-95405-139-7
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Titel der Originalausgabe:
Belonging. A Culture of Place, 2nd Edition
Erstveröffentlichung Routledge, 2009
Copyright © 2019 Taylor & Francis
Alle Rechte vorbehalten
Autorisierte Übersetzung der englischsprachigen Ausgabe, herausgegeben
von Routledge, einem Mitglied der Taylor & Francis Group LLC
Umschlag: Unrast Verlag, Münster
Satz: Unrast Verlag, Münster
Inhalt
Vorwort: Wissen, wohin ich gehe
1 Kentucky ist mein Schicksal
2 Von Bergen berührt
3 Die Erde berühren
4 Das Erbe zurückfordern – Versöhnung zulassen
5 Ganz sein und heilig
6 Noch einmal: Die Segregation muss aufhören
7 Der Schwarze Blick auf das Weißsein
8 Durch Tabakfelder fahren
9 Erdverbundenheit: Festen Boden unter den Füßen haben
10 Fremd und widerständig: Eine Ästhetik des Schwarzseins
11 Eigensinnig und faszinierend
12 Ein Ort, an dem die Seele Ruhe finden kann
13 Ästhetische Vermächtnisse: Geschichte handgefertigt
14 Alle Teile zusammenfügen
15 Über das Leben als Schriftstellerin in Kentucky
16 Die Rückkehr zur Wunde
17 Ein heilendes Gespräch
18 Lebt eure Träume – Verändert die Gegenwart
19 Herzensangelegenheiten
20 Eine Gemeinschaft der Fürsorge
Anmerkungen
Vorwort: Wissen, wohin ich gehe
Die Idee von einem Ort, wo wir hingehören, ist für viele von uns ein wichtiges Thema. Wir alle möchten wissen, wie es möglich ist, in Frieden auf dieser Erde zu leben, wie es möglich ist, das Leben zu unterstützen. Können wir ein Ethos der Nachhaltigkeit schaffen, bei dem es nicht nur um den angemessenen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, sondern auch um die Gestaltung eines sinnhaften, lebenswerten Lebens geht? Tracy Chapman verleiht dieser Sehnsucht in ihren Liedtexten Ausdruck, wenn sie singt: »I wanna wake up and know where I’m going.« (»Ich möchte aufwachen und wissen, wohin ich gehe«). Auf meinen Reisen bin ich immer wieder verblüfft, wie viele Bürger:innen unseres Landes sich verloren und orientierungslos fühlen, das Gefühl haben, dass sie nicht sehen können, wohin unsere Reisen uns führen, dass sie nicht wissen, wohin sie gehen. Viele Menschen haben kein Gefühl für ihren Ort. Was sie kennen, was sie haben, ist ein Gefühl der Krise, des drohenden Untergangs. Sogar die Älteren, deren Leben schon viele Jahrzehnte währt, sagen, dass das Leben in diesen Zeiten anders sei, »sehr seltsam«, dass unsere heutige Welt eine Welt des »Zuviel« sei – dass dieses Zuviel eine Verwirrung des Geistes bewirke, eine alltägliche Angst hervorrufe, die die Lebensgewohnheiten der Verlorenen, Umherziehenden und Suchenden bestimmt.
Mamas Mama Baba (Sarah Oldham) würde sagen, »eine Welt mit zu vielen Wünschen und zu viel Verschwendung«. Sie lebte ein einfaches Leben im Einklang mit den Jahreszeiten: Der Frühling bedeutete Hoffnung und Aussaat, der Sommer war da, um zu sehen, wie alles wächst, um spazieren zu gehen und auf der Veranda zu sitzen. Der Herbst war die Zeit zu ernten und Vorräte anzulegen, der tiefe Winter die Zeit für Stille, Zeit um zu nähen und sich auszuruhen. Während meiner gesamten Kindheit und auch anfangs noch, als ich erwachsen wurde und nicht mehr bei meiner Familie wohnte, lebte Baba sicher in ihrem zweistöckigen Holzhaus, das ihre Zuflucht auf dieser Erde, ihr Zuhause war. Sie fuhr kein Auto. Es gibt keine Notwendigkeit Auto zu fahren, wenn man möchte, dass der Platz auf der Erde, wo man hingehört, zu Fuß umrundet werden kann. Es gab mehrere dieser Leute in der Welt meiner Kindheit, Menschen, die lieber mit beiden Beinen fest auf dieser Erde herumspazierten als hinter dem Lenkrad eines Autos zu sitzen. Als Kinder waren wir fasziniert von diesen Leuten, die beim Gehen ihre Arme schwangen und große Schritte machten, um sich rasch fortzubewegen. Sie legten mehrere Meilen am Tag zurück, aber immer nur auf bekanntem Terrain, weggehend, aber immer wieder in die vertraute Umgebung zurückkehrend, unterwegs mit einer klaren Absicht – dem Willen, im heimischen Grund verwurzelt zu bleiben, und in der Gewissheit, ihren Platz zu kennen.
Wie viele Menschen heutzutage sehne ich mich danach, meinen Platz in dieser Welt zu finden, das Gefühl zu haben, nach Hause zurückzukehren, mit einem Ort verheiratet zu sein. Auf der Suche nach einem Ort, wo ich hingehöre, mache ich eine Liste der Dinge, die ich brauche, um mir festen Boden unter den Füßen zu verschaffen. Ganz oben auf der Liste steht: »Ich muss irgendwo leben, wo ich gehen kann. Ich muss in der Lage sein, zu Fuß zur Arbeit zu gehen, zum Einkaufen, an einen Ort, wo ich sitzen kann, Tee trinken und Gemeinschaft erfahren kann. Indem ich gehe, werde ich ganz im Hier und Jetzt präsent sein, als eine Person, die die Erde beansprucht und ein Gefühl des Dazugehörens, eine Kultur der Verortung schafft.« Ich machte auch eine Liste von Orten, an denen ich vielleicht gerne wohnen würde: Seattle, San Francisco, Tucson, Charleston, Santa Fe – das waren nur einige der Städte auf meiner Liste. Ich reise an diese Orte auf der Suche nach einem Gefühl der Zugehörigkeit, der Ahnung davon, dass man hier zuhause sein könnte. Ironischerweise stand mein Heimatstaat Kentucky nicht auf dieser Liste. Und damals wäre es mir nie in den Sinn gekommen, nicht im Entferntesten, zu überlegen, an meinen Geburtsort zurückzukehren. Dennoch war es letztlich Kentucky, wo die Suche nach einem Ort für mich endete.
Dieses Buch Dazugehören stellt gewissermaßen eine Chronik meines Nachdenkens über Themen wie Verortung, Zugehörigkeit und Verbundenheit dar. Vergangenheit und Gegenwart sind hier miteinander verschmolzen, um die Stationen meiner Rundreise nachzuzeichnen – sich wiederholend, rundherum im Kreis, von einem Ort zum anderen, nur um wieder dort zu enden, wo ich gestartet bin, in meiner alten Heimat in Kentucky. Wiederholung macht mir Angst. Sie scheint etwas Statisches an sich zu haben, so als ob man feststeckte. Sie erinnert mich an die langsamen, trägen, heißen Sommertage meiner Kindheit, an denen sich dieselben Lebensmuster immerzu wiederholten. Es gibt viele Wiederholungen in diesem Buch, das mein ganzes Leben umfasst. Und es erinnert mich daran, wie die Älteren in meiner Familie mir dieselben Geschichten wieder und wieder erzählten. Dieselbe Geschichte immer aufs Neue zu hören, macht es unmöglich zu vergessen, und so erzähle ich hier meine Geschichte wieder und wieder und wieder. Fakten und Ideen wiederholen sich, denn jeder Essay in diesem Band wurde als Einzelstück geschrieben und stellt jeweils eine ganz spezielle Momentaufnahme dar.
Viele der hier versammelten Essays fokussieren auf das Themenfeld Land und Landbesitz. Ausgehend von der Tatsache, dass neunzig Prozent aller Schwarzen im agrarischen Süden der USA lebten, bevor zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Massenmigration in die Städte des Nordens einsetzte, schreibe ich über afroamerikanische Farmer:innen der Vergangenheit wie auch der Gegenwart, die sich um die lokale Produktion natürlicher, unverfälschter Nahrungsmittel kümmerten und die in der Natur Trost fanden. Natürlich wäre es undenkbar, diese Themen zu behandeln, ohne über race[1] und Klasse zu sprechen. Es wäre unmöglich, über die Vergangenheit Kentuckys zu schreiben, ohne die düstere Geschichte der Sklaverei in diesem Staat zu beleuchten und aufzuzeigen, wie stark das Leben der Schwarzen in Kentucky gegenwärtig immer noch durch eine rassistische Politik bestimmt wird. Ich denke darüber nach, wie der fortwährende Rassismus sich in der Welt von Grund und Boden niederschlägt und schreibe über die Segregation des Wohnens, über ökonomisch rassifizierte Zonen. So beginnen diese Essays zwar mit Kentucky als Ausgangspunkt, aber die Perspektive wird erweitert auf die politische Praxis des Rassismus und Klassismus in unserem gesamten Land.
Ähnliches gilt für die Essays über Umweltschutz und Nachhaltigkeit, deren Bedeutung weit über Kentucky hinausreicht. Sie zeigen Wege auf, wie wir dafür kämpfen können, die Balance des Planeten wiederherzustellen, indem wir unsere Beziehung zur Natur und den natürlichen Ressourcen ändern. Ich lote die Verbindungen zwischen Schwarzer[2] Traumabewältigung und Ökologie aus. Wenn ich anspreche, dass für die Kohlegewinnung ganze Bergkuppen abgetragen werden, schreibe ich über die Notwendigkeit der Schaffung eines sozialen und ethischen Kontextes, in dem die Sorgen der Menschen in den Appalachen als wichtige Belange aller amerikanischen Bürger:innen erachtet werden. Darüber hinaus schreibe ich hier über Familie und entwerfe dabei eine Art Poesiealbum mit Erinnerungen an die Menschen, die mich aufgezogen und meinen Geist genährt haben.
Seit ich nach Hause zurückgekehrt bin, denke ich über Fragen geografischer bzw. regionaler Verortung nach und reflektiere mein Verständnis davon, was es heißt, eine Schriftstellerin aus Kentucky zu sein. Aus diesem Grund wird die Aufsatzsammlung abgerundet durch mein Gespräch mit dem visionären Schriftsteller, Dichter, Essayisten und Kulturkritiker Wendell Berry aus Kentucky. Als ich aus Kentucky fortgezogen war, in meinem ersten Jahr am College, entdeckte ich erstmals Wendells Schriften. Was mich am meisten an ihm faszinierte, war seine unbedingte Vorliebe für die Poesie (zu dieser Zeit war Lyrik der zentrale Schwerpunkt meines eigenen Schreibens). Nichtsdestotrotz setzte er sich in seinen Essays mit einer breiten Palette von Themen auseinander, die von Grund auf radikal und sehr vielschichtig waren. In Wendells Fußstapfen zu treten, war von Anfang an ein Weg, der mich zurück an meinen Heimatort Kentucky führen würde. Das erste Seminar, das ich am Berea College abhielt, handelte von Berrys Diskussion der rassistischen Politik in The Hidden Wound. In unserem Dialog reflektieren wir über sein Leben und Werk – und über meines – sowie darüber, wie unsere Wege sich ungeachtet unserer altersmäßigen und ›ethnischen‹[3] Differenzen kreuzen.
Auf dem Weg zu Wendells Farm in Port Royal, Kentucky, sah ich viele schöne Scheunen, gefüllt mit frisch geerntetem Tabak. Diese Bilder waren der Auslöser für die ebenfalls in diese Sammlung aufgenommene kurze Abhandlung über die Tabakpflanze.
Loyal Jones hebt in seinem Werk Appalachian Values als einer der seines Erachtens zentralen Eigenschaften Kentuckys die Bedeutung der Familie hervor und kommentiert: »Wir denken in Kategorien von Personen, wir erinnern uns an Leute, die uns vertraut sind und wir sind wenig interessiert an Abstraktionen und Menschen, von denen wir nur gehört haben.« Daher beginnen viele Essays in diesem Band – besonders die über Kreativität, Ästhetik und den künstlerischen Prozess – mit Familienmitgliedern und Verwandten, die mir am vertrautesten sind. Über die Vergangenheit zu schreiben, birgt nicht selten das Risiko, in Nostalgie zu schwelgen und das Leben damals zu idealisieren. Raum für Echtheit und Aufrichtigkeit zu schaffen, wenn ich mich an Vergangenes erinnere und dies mit Idealvorstellungen und Sehnsüchten der Gegenwart zu verbinden, war von großer Wichtigkeit in meinem Schreibprozess. Indem ich die Vergangenheit als Rohmaterial benutze, das mich dazu zwingt, kritisch über meinen Geburtsort, über Ökologie und Nachhaltigkeit nachzudenken, kehre ich wieder und wieder zu den Erinnerungen an meine Familie zurück. Während der Niederschrift dieser Essays begann Rosa Bell, meine Mutter, ihre Erinnerung zu verlieren und sich rasch fortzubewegen an einen Ort des Vergessens, von dem es keine Wiederkehr gibt. Dadurch, dass ich ihre tiefe und andauernde Trauer über diesen Verlust miterlebe, erfahre ich wieder und wieder, wie kostbar das Erinnern ist.
Wir werden geboren und leben unser Leben an einem Ort der Erinnerung. Unser Dasein ist geprägt von allem, woran wir uns erinnern, vom banalsten Moment bis hin zum majestätischsten. Durch die Kunst und den Akt des Erinnerns erkennen wir uns selbst. Zudem bieten Erinnerungen uns eine Welt, in der es keinen Tod gibt, in der alles durch Rituale der Wertschätzung und des Gedenkens weiterlebt. In Dazugehören begegne ich der Vergangenheit mit Respekt, denn sie ist eine Ressource, die uns als Basis dienen kann, um unser Engagement für die Gegenwart zu hinterfragen und zu erneuern. So können wir die Welt zu einem Ort machen, an dem alle Menschen ein gutes und erfülltes Leben leben und sich zugehörig fühlen können.
1Kentucky ist meinSchicksal
Wenn man sich entschieden hat, achtsam zu leben, dann ist es nicht nur wichtig, sich genau zu überlegen, wo und wie man leben will, sondern auch den Platz zum Sterben mit Bedacht auszuwählen. Seit der Entscheidung, aufs Land und in die Landschaft meiner Kindheit, nach Kentucky, zurückzukehren, tröstet mich der Gedanke, dass ich hier, wo ich aufgewachsen bin, auch sterben könnte. So stelle ich mir ›mein Ende‹ vor: Ich schließe meine Augen und sehe Hände, die eine Urne halten, eine Person den Kentucky-Hügel, den ich mein eigen nenne, hinaufsteigend, meine sterblichen Überreste verstreuend, als ob es Samen wären und keine Asche, eine verbrannte Gabe für den festen Grund, der Wind und Regen ausgesetzt ist – alles, was von meinem Körper übrig ist: dahin. Meine Existenz ist verwandelt; ich bin dahingeschieden und bewege mich fort in die Ewigkeit. Diese Abschiedsszene stelle ich mir vor und finde Trost darin.
Die Hügel Kentuckys waren der Ort, wo mein Leben begann. Sie stehen für Verheißung und Möglichkeit und sind zugleich der Ort all meiner Ängste, der bösen Geister, die mich bis in meine Träume verfolgen. Ich durchstreife die Hügel meiner Kindheit und fühle mich frei, laufe vor Schlangen und sonstigen verbotenen Schrecken der Natur davon – sowohl vor den realen als auch den imaginierten. Dabei lerne ich, mich sicher zu fühlen, in dem Wissen, dass ich immer in Sicherheit sein werde, wenn ich mich nur meiner Angst stelle und sie überwinde. Dieses Wissen gibt mir ein unerschütterliches Vertrauen in die Kraft der Natur, die verführerisch und aufregend, freudvoll und tröstlich ist.
Für mich war die Natur immer ein echtes Refugium, ein heiliger und heilender Ort. Dem Ruf folgend, eins mit der Natur zu sein, kehrte ich in den einzigen Staat zurück, in dem ich eine Kultur der Zugehörigkeit erfahren hatte. Meine Kindheit in Kentucky ist durch Demarkationslinien geteilt, die ein Davor und Danach sauber voneinander abgrenzen: Das Davor war das isolierte Leben, das wir als Familie in den Hügeln Kentuckys führten, ein Leben, in dem die Trennlinien von race, Klasse und Gender keine Rolle spielten. Was eine Rolle spielte, war die Grenzlinie zwischen Stadt und Land – die Natur war entscheidend. Mein Leben in der Natur war dieses Davor, und das Danach war das Leben in der Stadt, wo Geld und Status alles bestimmten. Auf dem Land war unsere Klassenzugehörigkeit ohne jede Bedeutung. In unserem Zuhause waren wir von Hügeln umgeben. Nur die vorderen Fenster unseres Hauses schauten auf die einsame Landstraße, gebaut für die Männer, die nach Öl suchten; alle anderen Fenster waren den Hügeln zugewandt. In unserer Kindheit war die selten befahrene Straße uninteressant. Die Hügel hinter unserem Haus waren der Ort der Magie und der Möglichkeiten, ein üppig grünes, verwunschenes Grenzland, wo nichts Menschengemachtes uns etwas anhaben konnte, wo wir frei waren und stets bereit für das nächste Abenteuer.
Als wir die Berge verließen, um uns in der Kleinstadt niederzulassen, wo angeblich die Schulen besser sein sollten, wo wir in die große, bedeutende Kirche, die Virginia Street Baptist, gehen konnten (alles Dinge, von denen man uns sagte, sie würden uns besser machen und uns helfen, jemand Wichtiges zu sein), erlebte ich meinen ersten schrecklichen Verlust, meine erste tiefe Trauer. Ich wollte in der Abgeschiedenheit jener Hügel bleiben. Ich sehnte mich nach Freiheit. Diese Sehnsucht war dort in den Hügeln in mein Bewusstsein eingebrannt worden und schien zu behaupten, dass alles Gute im Leben zu uns käme, wenn wir nur nach Freiheit strebten. Die Menschen in Kentucky schätzten Unabhängigkeit und Selbstbestimmung mehr als alles andere.
Waren meine frühen Vorstellungen von Identität zwar vom anarchischen Leben in den Hügeln geprägt, so habe ich mich doch nie mit Kentucky identifiziert. Die rassistische Segregation, die Ausbeutung und Unterdrückung von Schwarzen durch Weiße waren so weit verbreitet, dass dies mein ohnehin bereits gebrochenes Herz noch mehr leiden ließ. Allein die Natur war der Ort, wo man der Welt der menschengemachten Konstruktionen von race und Identität entkommen konnte. In unserem isolierten Leben in den Bergen hatten wir sehr wenig Kontakt mit der Welt der weißen Dominanzkultur. Außerhalb der Berge hingegen waren wir der Vorherrschaft der Weißen und ihrer Macht über unser Leben ohne Unterlass ausgesetzt. Damals wussten alle Schwarzen, dass der Staat mit all seiner Macht Weiße privilegierte, während er sich um das Wohlergehen der Schwarzen nicht kümmerte. Was wir in den Bergen gelernt hatten, war, für uns selbst zu sorgen, indem wir Nahrungsmittel anbauten, Tiere hielten und tief mit der Erde verwurzelt lebten. Wir hatten in den Bergen gelernt, selbstbestimmt zu leben. Die Natur war die Basis für unsere anti-hegemoniale Schwarze Subkultur, der Ort des Sieges. In der natürlichen Umwelt hatte alles seinen Platz, Menschen eingeschlossen, und alles war scheinbar durch die Gegenwart des Mystischen beeinflusst. Hier konnte das System des imperialistischen kapitalistischen Patriarchats weißer Vorherrschaft keine absolute Macht ausüben, denn in dieser Welt war die Natur mächtiger. Nichts und niemand konnte sie ganz unter seine Kontrolle bringen. In meiner Kindheit erlebte ich die Verbindung zwischen einer heilen natürlichen Welt und der menschlichen Sehnsucht nach Freiheit.
Die in den Hügeln lebenden Menschen strebten nach einem Leben in Freiheit. Die Hillbillys[4] entschieden sich, jenseits des Gesetzes zu leben und glaubten an das Recht jedes und jeder Einzelnen, das eigene Leben selbst zu bestimmen. Bei den Menschen in den Bergen Kentuckys erfuhr ich zum ersten Mal, was es heißt, in einer auf Anarchie basierenden Kultur zu leben. Die Leute dort waren davon überzeugt, dass Selbstbestimmung Freiheit bedeutete. Sie mussten vielleicht mit wenig auskommen, womöglich in einer selbstgezimmerten Hütte leben, dennoch fühlten sie sich ermächtigt, weil sie die Lebensgewohnheiten, die den Alltag ausmachten, entsprechend eigener Werte und Vorstellungen gestalten konnten. So hatten die Menschen in den Hügeln das Gefühl, dass sie selbst die Kontrolle über ihr Leben hatten. Sie machten ihre eigenen Regeln.
Jenseits dieses abgeschiedenen ländlichen Raumes, in der Stadt, wurden die Regeln von anderen, von Unbekannten gemacht; sie wurden den Menschen aufgezwungen und durchgesetzt. In den Bergen meiner Kindheit hatten Weiße und Schwarze oft zusammengelebt; es gab hier keine Segregation, eher Grenzen, die dadurch bestimmt waren, welches Territorium man für sich beanspruchte. Die Vorstellung von ›Privateigentum‹ war den Leuten fremd; die Berge gehörten allen, so schien es mir wenigstens in meiner Kindheit. Denn in den Bergen gab es keinen Ort, an dem ich nicht umherstreifen konnte oder den ich nicht betreten durfte.
Als ich in der Stadt lebte, lernte ich, wie tiefgreifend die Unterdrückung der Schwarzen durch Weiße war. Wir wurden zwar nicht in Reservate gesteckt, aber Schwarze wurden gezwungen, innerhalb bestimmter städtischer Grenzen zu leben, die zwar nicht formal abgesteckt waren, aber durch weiße Gewalt gegen Schwarze Menschen markiert wurden, sobald man es wagte, sie zu übertreten. Unsere segregierten Schwarzen Wohngegenden waren von den anderen abgeschottet. Nur manchmal grenzten sie an die Wohnviertel armer und mittelloser Weißer. Jedoch lebten weder Schwarze noch weiße Arme in der Nähe der wirklich mächtigen und privilegierten weißen Eliten, die unser Leben regierten.
In der städtischen Schule wurde uns beigebracht, dass Kentucky im Amerikanischen Bürgerkrieg zu den sogenannten border states zählte. Damit war gemeint, dass es ein Bundesstaat war, der keine eindeutige Stellung zu den rassistischen Vorstellungen von der Überlegenheit der Weißen, zur Sklaverei und der fortwährenden Herrschaft mächtiger Weißer über die Schwarze Bevölkerung bezog. In der Schule lehrte man uns, zu glauben, dass Kentucky nicht so sei wie der tiefe Süden. Dabei war es offenbar egal, dass die mit Gewalt durchgesetzte rassistische Segregation diese Institutionen des Lernens prägte, dass die Schulausflüge die Kinder regelmäßig zum Jefferson-Davis-Denkmal führten, oder an andere Orte, wo die Konföderation und die Flagge der Konföderierten geehrt wurden. Den Schwarzen kam es seltsam vor, dass mächtige Weiße in Kentucky so tun konnten, als ob die extreme weiße Vorherrschaft in ›ihrem‹ Staat nicht existierte. Wir sahen kaum einen Unterschied zwischen der Ausbeutung und Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung in Kentucky und anderen Südstaaten wie Alabama, Mississippi und Georgia. Bis ich die Highschool abgeschlossen hatte, war meine Sehnsucht, Kentucky zu verlassen, immer stärker geworden. Ich wollte die gnadenlose, das Leben der Schwarzen so beeinträchtigende rassistische Segregation hinter mir lassen. Ich wollte einen Ort der Freiheit finden.
Und doch war es meine Flucht aus Kentucky, meine weite Reise an die Westküste, nach Kalifornien, die mir offenbarte, wie sehr mein Denken und Fühlen von geografischen Kategorien geprägt war. In dem Jahr, als ich mein Grundstudium an der Stanford University begann, gab es dort nur wenige Studierende aus Kentucky. Ich war mit Sicherheit die einzige Schwarze Studentin aus Kentucky, und entsprechend den vorherrschenden gesellschaftlichen Sitten und Gebräuchen des Rassismus suchten weiße Studierende aus Kentucky meine Gesellschaft nicht. Es war auch bereits in diesem ersten Jahr, dass mir die gängigen Stereotypen und Vorurteile über Kentucky begegneten. Nur wenige wussten in Stanford etwas über das Leben in Kentucky. Für gewöhnlich erntete ich Gelächter, wenn ich gefragt wurde, woher ich stammte, und darauf Kentucky als meinen Heimatstaat nannte. – Oder man reagierte mit der Frage: »Kentucky – wo ist das denn?«
Hin und wieder traf ich während meines Grundstudiums auf Kommiliton:innen, die wirklich ernsthaft etwas über das Leben in Kentucky erfahren wollten, und dann erzählte ich von der Natur dort, von der Üppigkeit unserer Landschaft, dem Wasserfall am Blue Lake, wo ich als Kind spielte. Ich sprach über die von den zwangsumgesiedelten Cherokee verlassenen Höhlen und ihren Pfaden. Ich erzählte von den Appalachen, die weiß und Schwarz waren, von den Schatten aus Kohlestaub auf den Körpern der Schwarzen Männer, wenn sie von der Arbeit in den Minen nach Hause zurückkehrten. Auch sprach ich über Tabakfelder und Pferde, die das blau schimmernde Gras in Kentucky in eine Märchenlandschaft verwandelten. Stolz erzählte ich von den Schwarzen Jockeys, die bei den Pferderennen im Mittelpunkt standen, bevor der imperialistische Kapitalismus weißer Vorherrschaft strenge Regeln der Segregation aufstellte und auf diese Weise Schwarze aus der öffentlichen Sphäre des Pferdesports in Kentucky verbannte.
Die Verdrängung von Afroamerikaner:innen, insbesondere Schwarzer Jockeys, aus der Arena des Pferdesports ging Hand in Hand mit der immer stärkeren Verbreitung rassistischer Vorstellungen von der Überlegenheit der Weißen.
Für uns hieß das, in einer Kultur der Angst zu leben, in der wir das Land, die Tiere zu fürchten lernten, in der wir Angst vor den feuchten, kauenden Mäulern der Pferde bekamen, die Schwarze Jockeys nur noch selten reiten durften. Diese Trennung von der Natur und die damit eingehende Furcht, die Angst vor der Natur und vor dem Weißsein wurde zum alles bestimmenden Trauma im Leben Schwarzer Menschen.
In unserer Psychohistorie, d. h. in der Kultur der Schwarzen Südstaatler:innen, die die Ära der brutalen, legal sanktionierten rassistischen Apartheid miterleben mussten, wird das Gesicht des Terrors immer weiß sein, und die Symbole dieses Weißseins werden immer Angst hervorrufen. So wird z. B. für Schwarze die Flagge der Konföderierten niemals für kulturelles Erbe stehen. Vielmehr weckt sie in den Köpfen älterer Schwarzer immer noch Ängste, denn für sie signalisiert die Flagge die Befürwortung des weißen rassistischen Angriffs auf das Schwarzsein.
Weiße, die ihre Leugnung der weißen Vorherrschaft verschleiern, indem sie Slogans wie »heritage not hate« (»Erbe statt Hass«) im Munde führen, um ihre fortgesetzte Treue zu dieser Flagge zu unterstreichen, wollen nicht einsehen, dass ihre Weigerung anzuerkennen, was dieses »Erbe« für Schwarze bedeutet, selbst ein Ausdruck weißer rassistischer Macht und Privilegien ist. Denn die Flagge der Konföderierten ist nicht nur für das »Erbe« ein Symbol, sondern auch für den »Hass«.
Die Geschichte der Konföderation wird immer die Erinnerung an die Unterdrückung der Schwarzen durch die Weißen wachrufen: Rebellenflaggen, Gewehre, Feuer und der Galgenstrick – alles Symbole des Hasses.
Selbst wenn viele arme und entrechtete Weiße in Kentucky, die sich durch das Minenfeld der kapitalistischen weißen Herrschaft kämpfen, an den historischen Traditionen der kolonialen Herrschaft festhalten wollen und diese Geschichte für sich beanspruchen, so können sie doch niemals wirklich an der Macht und dem Privileg des kapitalistischen Weißseins teilhaben. Sie mögen sich dieses Symbol aneignen, um sich mit eben jener Welt und Vergangenheit zu verbinden, die auch sie entmenschlichen, aber es wird niemals etwas an der Realität ändern, dass sie von eben diesen Kräften der weißen Hegemonie beherrscht werden.
In dieser Kultur Kentuckys, in der die rassistische Vergangenheit der Konföderierten verherrlicht wurde, wuchs ich auf, in einer Welt, die bestrebt war, die Geschichte der Schwarzen in Kentucky zu verschleiern und auszulöschen. Für mich konnte ich keinen Platz in diesem historischen Erbe finden, auch wenn ich jetzt im Nachhinein erkennen kann, dass es immer zwei konkurrierende Kulturen in Kentucky gab: eine kulturell dominierende Welt weißer kapitalistischer Macht und die Welt der trotzigen Anarchie, die Freiheit für alle wollte. Und die Tatsache, dass diese Kultur der Anarchie ausgeprägte antirassistische Dimensionen hatte, zeugt von der einzigartigen Kultur der Schwarzen in den Appalachen, die nur selten anerkannt wird. Es ist diese Kultur, über die Loyal Jones in Appalachian Values schreibt:
»Ein großer Teil der Bevölkerung in den Bergen, sogar bis tief in den Süden nach Alabama und Georgia hinein, war gegen die Sklaverei eingestellt und kämpfte im Bürgerkrieg für die Union, und obwohl die Regierungen der ›Rekonstruction‹ ›Anti-Schwarze‹-Gesetze erließen und uns so zur Segregation anhielten, waren die meisten Menschen in den Appalachen nicht mit den gleichen Vorurteilen gegenüber Schwarzen behaftet wie in anderen Südstaaten.«
Also verbrachte ich meine frühe Kindheit in der Nähe einer sich nicht offen rassistisch äußernden weißen Bergbevölkerung, und diese Welt der Integration in den Hügeln von Kentucky prägte meine Erziehung. Unser Umzug in die Welt des Mainstreams und seiner Werte jedoch bedeutete, dass jetzt die weiße Vorherrschaft unser Leben bestimmte. Es war dieses Erbe der rassistischen Bedrohung und des Hasses, das in mir den Wunsch auslöste, Kentucky zu verlassen und nie wieder zurückzukehren.
Als ich Kentucky verließ, glaubte ich, ich könne so den Terror des Weißseins hinter mir lassen, aber die Angst verfolgte mich. Weit weg von meinem Geburtsort lernte ich die unzähligen Gesichter des Rassismus, der rassistischen Vorurteile und des Hasses, die tausend Facetten der weißen Dominanz kennen. Während meines ersten Jahres an der Stanford University fühlte ich zum ersten Mal, wie Bürger:innen ein und desselben Landes durch unterschiedliche geografische Herkunft getrennt sein konnten. Ich empfand keine Zugehörigkeit zu der Universität, vielmehr fühlte ich mich ständig wie eine nicht willkommene Außenseiterin. Genau wie ich in Kentucky Trost in der Natur gefunden hatte, war mir die natürliche Umwelt in Palo Alto, Kalifornien, mit all ihren Bäumen, dem Gras, den Pflanzen und dem Himmel ein Ort des Trostes. Ich grub meine Hände in die kalifornische Erde, die so anders war als die feuchte, rot-braune Erde in Kentucky – und empfand Ehrfurcht. Von Staunen erfüllt sinnierte ich darüber nach, dass ich tausende Meilen gereist war und nun sogar der Boden unter meinen Füßen ein anderer war. Und es war mir unbegreiflich, wie in diesem seltsamen Land die Erde meine Zeugin sein konnte, wenn sie doch kein Spiegel der Welt meiner Vorfahr:innen, der Landschaften meiner Träume war. Wie konnte dieses neue Land mich aufrecht halten, mir die Sicherheit bieten, dass mein Dasein einen festen Grund hatte?
Auf der Suche nach einem intellektuellen Leben in der akademischen Welt wechselte ich in eine auf Prinzipien der Unsicherheit basierende Umgebung, eine opportunistische Welt, in der sich alles verändert und endet. Ich sehnte mich nach meinem Heimatort zurück, wo man sich strikt weigerte, Veränderungen zu akzeptieren. Kentucky ist einer der Staaten unseres Landes, die für ihre starrsinnige Weigerung, den Wandel willkommen zu heißen, bekannt sind. Früher wollten die Menschen in Kentucky, dass alles unverändert von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde. Diese Ablehnung von Veränderungen war am offensichtlichsten in Bezug auf die rassistischen Verhältnisse. Denn in Kentucky hielten die Weißen noch an der Segregation fest, als andere Staaten bereits deutliche Fortschritte in Richtung Bürgerrechte gemacht hatten.
Weiße Konservative in Kentucky redeten sich ein: »Die Schwarzen wollen gar keine Veränderungen – sie finden es gut, so wie es ist.« Nachdem die rassistischen Weißen die Schwarzen in einen Zustand traumatischer Machtlosigkeit versetzt hatten, war es für sie kein Problem, uns mit ihrem glühenden, sattsam bekannten Rassismus zu terrorisieren, im festen Glauben, dass sie die Einstellungen und Gefühle der Schwarzen kannten, dass sie unsere Wünsche bestimmen könnten. Die Bestrebungen seitens der konservativen Weißen in Kentucky, Schwarze auszubeuten und zu unterdrücken, gingen Hand in Hand mit dem Bemühen, die rebellische Grundeinstellung der weißen Menschen in den Bergen zu brechen und auszulöschen. Der anarchische Geist, der die Kultur der weißen Hillbillys prägte, war genauso bedrohlich für den imperialistischen weißen kapitalistischen Staat wie jede Art von ‚ethnischer‘ Gleichheit und Integration. Deshalb musste diese Kultur ebenso wie die besondere Lebensart der Schwarzen Agrarbevölkerung unterminiert und letztlich zerstört werden.
Als ich Kentucky verließ, wollte ich der Psychohistorie einer traumatischen Machtlosigkeit entfliehen. Was ich mitnahm von den Subkulturen meines Heimatstaates, von den Hillbillys in den Appalachen, war ein positives Verständnis davon, was es bedeutet, eine Kultur des Dazugehörens zu kennen, wie sie meine Vorfahr:innen lebten und als Vermächtnis an mich weitergegeben hatten. In ihrem Buch Rebalancing the World definiert Carol Lee Flinders die Kultur des Dazugehörens als »innige Verbindung mit dem Land, zu dem man gehört, empathische Beziehung zu den Tieren, Selbstbeherrschung, bewahrender Konservativismus, überlegtes Handeln, Balance, Klarheit, Ehrlichkeit, Großzügigkeit, Egalitarismus, Gegenseitigkeit, Affinität zu alternativen Denkweisen, Verspieltheit, Inklusion, gewaltfreie Konfliktlösung und eine Offenheit des Geistes«. All diese Arten von Zugehörigkeit wurden mir in meiner frühen Kindheit beigebracht, aber diese Prägungen wurden durch die Dominanzkultur mit ihrer einseitigen Schulbildung überdeckt. Dennoch war es dieses unterdrückte Wissen, das meinen Radikalismus als Erwachsene befeuerte.
Als ich fern von meinem Geburtsort lebte, wurde ich mir meiner Herkunft aus Kentucky stärker bewusst als zu der Zeit, als ich noch dort wohnte. Das ist es, was die Erfahrung des Exils bewirken kann, nämlich einen Bewusstseinswandel, eine völlige Veränderung der eigenen Wahrnehmung der Heimat. Die geografischen Unterschiede prägten meine Psyche und meine Lebensgewohnheiten nun deutlicher als zu Hause. In Kentucky hatte niemand gedacht, ich hätte einen Kentucky-Akzent; in Kalifornien hingegen machte mich das Sprechen in der weichen Schwarzen Südstaatenmundart, die unsere Alltagssprache war, zum Objekt unerwünschter Aufmerksamkeit. Innerhalb kürzester Zeit lernte ich mein Sprechen zu verändern, die Klänge und die Kadenz von Kentucky geheim zu halten, sie zu einer intimen Stimme werden zu lassen, die nur von Menschen gehört werden sollte, die sie verstehen konnten. Nicht in der Sprache meiner Vorfahr:innen zu sprechen, half mir dabei, Spott über Kentucky zum Verstummen zu bringen. Es war ein Weg, zu vermeiden, durch die allgegenwärtigen geografischen Hierarchien klein gemacht zu werden, die meinen Herkunftsort als ländlich-rückständigen und aus der Zeit gefallenen Ort betrachteten. Während meines Studiums, als ich das Porträt der mir so vertrauten Landschaft mit der stereotypen Außensicht auf Kentucky abgleichen musste, lernte ich mehr denn je über meinen Herkunftsstaat.
Meine wohl größte Entfremdung in diesem neuen liberalen Collegeumfeld resultierte aus der völligen Abwesenheit jeglichen offen ausgedrückten Glaubens an Gott und das Christentum seitens der Lehrenden und Studierenden. Tatsächlich war es damals viel cooler zu sagen, man sei Agnostiker:in oder Atheist:in, als über den Glauben an Gott zu sprechen. Ich kam aus einer bibeltreuen, bibelfesten Welt, in der die Heilige Schrift in Alltagsgesprächen ständig zitiert wurde, weshalb mir psychologisch die Ressourcen und das Know-how fehlten, in einer Welt, in der Spiritualität mit ebensolcher Geringschätzung beäugt wurde wie die Herkunft aus den Südstaaten, normal zu funktionieren. In meinem Wohnheim war der einzige Student, der offen in der Bibel las, ein stiller, weißer Mormone, der eher für sich blieb und isoliert war. Wir redeten miteinander und versuchten uns dadurch weniger wie Fremde in einem fremden Land zu fühlen. Wir sprachen über die Bibel, aber das war nicht stark genug, um die durch den Rassismus geschaffenen Barrieren zu überwinden, die uns lehrten, Differenz mit Argwohn zu betrachten. Darüber hinaus gab es an der Universität zwar organisierte christliche Gruppen, aber sie sprachen nicht die religiöse Sprache, die ich zu hören gewohnt war.
Gegen Ende meines zweiten Collegejahres begann ich den religiösen Glauben meiner Familie, die Art von Religion, die mir zuhause beigebracht worden war, zu hinterfragen. In dem spirituellen Umfeld des New Age in Kalifornien entwickelte ich eine Spiritualität, die für meinen Verstand und mein Herz Sinn machte. Meine religiöse Praxis stand in Einklang mit dem göttlichen Geist, wie ich ihn in meiner Kindheit in den Hügeln Kentuckys kennengelernt hatte. Als Kind war ich immer hin und hergerissen gewesen zwischen dem frommen Diktat des religiösen Fundamentalismus und den Doktrinen der organisierten Kirche einerseits und der naturverehrenden, ekstatisch-mystischen Spiritualität der Hillbillys andererseits. Meine gesamte Collegezeit hindurch, sogar in den Zeiten, in denen meine Seele von Zweifeln geplagt war, hielt ich im Kern daran fest, an die Macht des göttlichen Geistes zu glauben.
Während meiner Collegejahre fing ich an, mich zerrissen zu fühlen, und diese Gefühle bestimmten mein Leben, wohin ich auch zog: nach Kalifornien, Wisconsin, Connecticut, Ohio, New York. In meinem Herzen blieb ich ein Mädchen vom Lande, ein exzentrisches Produkt des Fühlens und Denkens der Hillbillys von Kentucky, auch wenn in dem Leben, das ich nun lebte, andere Werte, Moralvorstellungen und Glaubenssätze galten. Fernab von Kentucky war mein Leben voller Widersprüche. So passten etwa Themen wie Ehrlichkeit und Integrität, die das Leben während meiner Kindheit klar und einfach gemacht hatten, nicht mehr so recht in die akademische und literarische Welt, die ich mir jetzt erwählt hatte. Mit der Zeit begann ich die Zerrissenheit, die meine Psyche so sehr bestimmte, besser zu verstehen. Je erfolgreicher ich als Intellektuelle und Autorin wurde, desto stärker hatte ich das Gefühl, mich ständig anstrengen zu müssen, damit meine Kernwahrheiten gehört wurden – in einer Welt, in der die Werte und Vorstellungen, auf denen ich mein Leben gründen wollte, keine Bedeutung hatten. Trotz alledem hatte ich nicht das Gefühl, dass ich nach Hause zurückkehren konnte. Denn das Selbst, das ich in diesen anderen Welten erfunden hatte, schien zu unkonventionell für Kentucky zu sein, zu kosmopolitisch.
Wie bei vielen anderen Autor:innen, speziell aus den Südstaaten, die ihrer Heimat den Rücken kehrten und in einer Art mentalem Exil lebten, wirkte sich das Zerrissenheitsgefühl zerstörerisch aus und führte bei mir zu einem seelischen Zusammenbruch. Heilung zu finden hieß für mich, mich auf mein Selbst zu besinnen, die Puzzleteile meines Lebens in die Hand zu nehmen und wieder zusammenzufügen. Indem ich mich an meine Kindheit erinnerte und über mein früheres Leben schrieb, machte ich eine Bestandsaufnahme, entdeckte mich selbst und fand mein Zuhause. – Deutlich erkannte ich jetzt, dass Kentucky mein Schicksal war.
Es war mir nicht gelungen, die intensive suizidale Melancholie, die mich als Kind so gequält hatte und zum Teil eine Reaktion darauf gewesen war, dass ich die Hügel und die dortige Welt der Freiheit hatte verlassen müssen, abzustreifen. Sie verfolgte mich, egal, wohin ich ging. Und der allzu vertraute Schmerz, der mich nachts wachhielt, weinend und voller Sehnsucht, war immer präsent, wohin ich auch ging, und hinterließ die Erfahrung einer traumatischen Machtlosigkeit. Die Schrecken meiner Nächte in Kentucky, die wilden Pferde, die durch meine Träume galoppierten, mich verwirrt und schlaflos zurückließen, verfolgten mich. Die Schlaflosigkeit, die mich als Kind plagte, wurde sogar noch schlimmer, je weiter ich mich vom Zuhause meiner Kindheit entfernte. Viele Male lag ich, fernab von Kentucky, schlaflos in völlig dunklen Zimmern und überlegte, wie ich mir ein Zuhause schaffen könnte. Jedoch endeten all meine Versuche, neu zu beginnen, immer darin, mich in die Vergangenheit zurückzubringen, und ich ließ zu, dass sie die Grundlage für meine Gegenwart wurde.
Immer wenn ich Zweifel über die Richtung hatte, die mein Leben nehmen sollte, stellte ich mir vor, ich sei eine Filmemacherin, die einen autobiografischen Film mit dem Titel Kentucky ist mein Schicksal drehte. Die ersten Einstellungen dieses Films wären alle Aufnahmen von der Natur, von Tabakfeldern, -farmen und -scheunen. Ich trete in dieser Filmerzählung als Zeugin auf: Baba, die Mutter meiner Mama, bindet Tabakblätter zusammen und bereitet sie zum Aufhängen in Schränken und Truhen vor, um Motten und anderes Ungeziefer fernzuhalten. Ein Großteil dieses imaginären Films dreht sich um die Älteren, deren Präsenz meine Kindheit bestimmte.
Als ich meinen Geburtsortsort zum ersten Mal verließ, nahm ich zwei Dinge von Zuhause mit, die der Inbegriff meiner frühen Jahre waren: geflochtene Tabakblätter und die Patchwork-Decke, die meine Großmutter Baba mir als junges Mädchen geschenkt hatte. Diese zwei Totems sollten mich immer daran erinnern, woher ich komme und wer ich im tiefsten Inneren bin, und so stehen sie zwischen mir und dem herzzerreißenden Wahnsinn des Exils. Sie sind gegenwärtig in meinem neuen Leben, um mich vor dem Tod zu beschützen und mich daran zu erinnern, dass ich jederzeit nach Hause zurückkehren kann. Einmal im Jahr bin ich immer zu Besuch nach Hause gefahren, und dies war jedes Mal ein Übergangsritual, mit dem ich mich vergewisserte, dass ich immer noch dort hingehörte, dass ich mich nicht so sehr verändert hatte, dass ich gar nicht mehr nach Hause zurückkehren könnte. Meine Besuche zu Hause hinterließen in mir fast immer ein Gefühl der Zerrissenheit: Ich wollte bleiben, aber ich musste weg, auf ewig von Zuhause davonlaufen.
Der Wahnsinn wurde fern von Zuhause leichter akzeptiert. An den überwiegend weißen Colleges, die ich besuchte, war es nichts Ungewöhnliches, dass Studierende sich durch die Trennung von ihrer gewohnten Umgebung überwältigt fühlten, dass wir uns vielleicht entfremdet fühlten, dass wir sogar tatsächlich verrückt wurden. Ich lernte, dass Therapie der beste Weg war, um mich meinen psychischen Verletzungen zu stellen, der beste Weg zur Heilung. Eine meiner jüngeren Schwestern fragte mich neulich: »Wie konntest du wissen, dass du Hilfe brauchtest?« Ich antwortete: »Ich wusste, dass ich nicht normal bin. Ich wusste, dass es nicht normal war, sich umbringen zu wollen.« Intensive, traurige Selbstmordgedanken brachten mich zur Therapie, aber in jenen frühen Jahren half sie nicht. Ich konnte keine Therapie finden, die die Macht der geografischen Herkunft, der Prägungen durch die Vorfahr:innen, der rassifizierten Identität anerkannt hätte. Wie die meisten Leute bezogen offenbar auch die Therapeut:innen ihre Vorstellungen über die Kentucky-Hillbillys aus der Comedy-Serie Beverly Hillbillies. Und auf jeden Fall mangelte es mir in meinen frühen Collegejahren an einer angemessenen Sprache, um all das zu benennen, was mich geprägt und geformt hat.
Obwohl ich den Eindruck hatte, die Therapie würde nicht helfen, verlor ich nie den Glauben daran, dass ich gesund werden könnte, dass Heilung möglich war, wenn ich die Vergangenheit verstand und sie mit der Gegenwart verbinden konnte. Baba, meine Großmutter mütterlicherseits, fragte mich oft: »Wie kannst du nur so weit weg von deinen Leuten leben?« Wenn sie diese Frage stellte, hatte ich immer das Gefühl, dass da ein wenig Tadel mitschwang, ein leises Beharren darauf, dass ich illoyal sei, das Vermächtnis meiner Vorfahr:innen verraten hätte, als ich von Zuhause fortging. Die Frage, die ich mir stellte, war: »Wenn Kentucky dir so viel bedeutet, warum kannst du dann nicht einfach nach Hause gehen und dort bleiben?«
Als ich Anfang zwanzig war, begann ich die Vergangenheit narrativ zu kartieren, indem ich die meiner Auffassung nach prägenden Kindheitserfahrungen niederschrieb. Ich begann damit, Listen anzulegen – währenddessen ich über die Geschichten nachdachte, die ich einer Person erzählen würde, die ich gerade kennengelernt hätte und mit der ich mich Schritt für Schritt ganz vertraut machen wollte. Es war mir klar, dass ich dieselben Geschichten, die ich für bedeutsam hielt, wieder und wieder erzählte. Ich war mir sicher, dass, wenn ich diese Erinnerungen nur zu Papier bringen und sortieren könnte, es mir helfen würde, Ordnung in mein Leben zu bringen. Ich war davon überzeugt, dass ich, wenn ich einen klaren, detaillierten Bericht über das erstellte, was mein Selbst ausmachte, einen Schritt zurücktreten und mich in einem neuen Licht sehen könnte, nicht länger fragmentiert, sondern ganz und vollkommen.
Meine Kindheitserinnerungen aufzuschreiben, half. Es gab mir wieder Boden unter den Füßen. Ich sammelte diese Erinnerungen und veröffentlichte sie in meinen Memoiren Bone Black. Poetisch in Stil und Ton, sogar abstrakt sind sie, und während ich diesen Kindheitsbericht lese, kommt es mir vor, als sei die, die hier spricht, in Trance, entfernt und doch nahe. Einen Großteil meines Lebens außerhalb von Kentucky verbrachte ich in einem Trancezustand, als ob ich da und zugleich nicht da wäre. Deshalb stellte die Arbeit an meiner Heilung, an meinem Ganzwerden einen Prozess des Erwachens dar, des Übergangs von der Trance in die Realität, des Erlernens völliger Präsenz in der Gegenwart. Mein Zuhause zu verlassen, löste extreme Gefühle von Verlassenheit und Verlust aus. Es war wie sterben. Die Erinnerungen an Zuhause zu retten und die Puzzleteile zusammenzufügen war eine Rückwärtsbewegung, die es mir ermöglichte, mich vorwärtszubewegen. Alle meine Trancezustände waren ein Schutz gegen die Schrecken meiner Kindheit. Als ich mein Zuhause verließ, nahm ich ungelöste Traumata mit. Dadurch, dass ich die Stimmen meiner Vorfahr:innen an jeden Ort, den ich später mein Zuhause nannte, mit mir trug, hatte ich den erinnerten Schmerz fortwährend im Gepäck und ließ zu, dass er mich immer wieder mit sich fortriss. Dieses Gefühl, weggefegt zu werden, war wie ein Karussell, das nicht aufhörte, sich zu drehen.
Erst als dieses Gefühlskarussell, in dem ich mich befand, seit ich von Kentucky fortgezogen war, aufhörte, konnte ich klar sehen und geheilt werden. Dennoch hat mich diese Klarheit nicht direkt zur Rückkehr nach Kentucky bewogen. In der Tat befürchtete ich, dass ich, wenn ich nach Kentucky zurückkehrte, zerschmettert werden würde, dass Gefühle aufkämen, die mich aus dem Gleichgewicht bringen und zerbrechen würden. Am sichersten schien es mir, eine Frau aus Kentucky zu sein, wenn ich nicht in Kentucky war. Da mein Heimatort tatsächlich Ort und Ursprung der ernsten Störung war, die meinen Geist beeinträchtigt hatte, glaubte ich nicht, dass ich dort sicher sein könnte. Denn immerhin konnte ich den Zusammenhang zwischen der privaten familiären Dysfunktion und der politischen, vom Staat Kentucky verschuldeten Dysfunktion erkennen. Wayne Kritsberg bietet eine brauchbare Definition von Dysfunktion in seinem Buch Healing Together, in dem er erklärt:
»Eine dysfunktionale Familie ist eine Familie, die dauerhaft nicht in der Lage ist, ein sicheres, nährendes Umfeld zu bieten. Durch ihre maladaptiven Verhaltensweisen entwickelt die Familie eine Reihe von Einschränkungen, die das soziale und emotionale Wachstum ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, hemmt. Die gesunde Familie hingegen bietet ihren Mitgliedern Sicherheit und Fürsorge und unterstützt sie in ihrer Entwicklung, indem sie feste, aber vernünftige Grenzen setzt, anstatt starre Zwänge aufzuerlegen.«
Die fundamentalistisch-christliche, patriarchale Macht, die in meinem Heimatort die Sphäre der Öffentlichkeit und des Staates bestimmte, spiegelte sich in der Struktur meiner Ursprungsfamilie und ihrer Werte wider. Gleichzeitig prägte die weiße Vorherrschaft die Psyche von Schwarzen und Weißen in einer einschränkenden und deformierenden Weise.
Die Verbindung zwischen geografischen Lagen und psychologischen Seinszuständen herzustellen war hilfreich. Es ermächtigte mich, die schlimmen dysfunktionalen Aspekte der Südstaatenwelt, in der ich aufwuchs, zu erkennen, die Art wie der internalisierte Rassismus unsere emotionale Intelligenz, unser Gefühlsleben beeinträchtigte. Trotzdem konnte ich auch die positiven Aspekte meiner Kindheit und Jugend, die lebenserhaltenden Widerstandsstrategien erkennen. Auf jeden Fall ermächtigte die rassistische Segregation bzw. der Widerstand gegen Rassismus und weiße Vorherrschaft nonkonforme Schwarze, eine auf oppositionellen Werten basierende Subkultur zu schaffen. Jene oppositionellen Werte, die meiner Psyche während der frühen Kindheit eingeprägt wurden, befähigten mich, einen überlebenswichtigen Widerstandswillen zu entwickeln, der mir sowohl bei meinen Besuchen zu Hause, als auch in der geistigen Wildnis, in der ich mich fern von zu Hause aufhielt, zu Gute kam. Oppositionelle Lebensgewohnheiten, die ich in meiner Kindheit erlernt hatte, schufen eine Bindung an meinen Heimatort, die nicht gelöst werden konnte.
Dort, wo ich aufwuchs, gab es viele abtrünnige Schwarze und Weiße, die die abgelegenen Wälder, die natürliche Umgebung als einen Raum abseits der von Menschenhand geschaffenen Konstruktionen und der herrschenden Kultur wahrnahmen. Hier waren sie in der Lage, einzigartige Denk- und Lebensgewohnheiten zu entwickeln, die sich dem Status quo entgegenstellten.
Dieser Widerstandsgeist prägte einen Großteil der frühen Geschichte Kentuckys. Für die weißen Kolonisator:innen stellte das Land zu Beginn eine unberührte, wahrhaft wilde Wildnis dar, die sich der Zähmung durch die Kräfte des imperialistischen patriarchalen Kapitalismus weißer Vorherrschaft widersetzen würde. Obwohl diese Kräfte das Land letztlich doch ihren räuberischen Interessen unterordnen konnte, schufen sie kein geschlossenes System. So gelang es einzelnen Weißen und Schwarzen in Kentucky immer noch, Subkulturen zu schaffen – meist in Senken, auf Hügeln und Bergen –, in denen Überzeugungen und Werte herrschten, die denen der Mainstream-Kultur widersprachen.
Das freie Denken und das unangepasste Verhalten, das durch die Abgelegenheit gefördert wurde, war eine Bedrohung für das imperialistische kapitalistische Patriarchat weißer Vorherrschaft, und deshalb musste es untergraben werden. Deshalb wurde die Vorstellung verbreitet, dass die Menschen, die diese Räume bewohnten, Inzucht betrieben, ignorant, dumm, und unregierbar seien. Der hinterwäldlerische, anarchische Geist, der die Armen ermächtigte, einen anderen Lebensstil zu wählen als im Rest des Staates und der sogenannten zivilisierten Gesellschaft wurde als menschenunwürdig hingestellt und dadurch kaputt gemacht. Wenn er auch nicht ganz vernichtet werden konnte, so galt er fortan doch zumindest als kriminell oder suspekt.
Dieser Geist des Widerstands und der Revolution wurde in mir genährt durch Generationen von Schwarzen aus Kentucky, die sich für Eigenständigkeit und Selbstbestimmung statt für die Abhängigkeit von einer Regierung entschieden hatten, und er wurde zum Katalysator für meinen persönlichen Kampf um Selbstbestimmung. Der Kern dieser widerständigen, oppositionellen Kultur bestand im Beharren darauf, dass jede:r von uns ein Mensch mit Wert und Würde ist. Den eigenen Wert anzuerkennen, bedeutete, dass man sich entscheiden musste, ein aufrechter Mensch zu sein, zu seinem Wort zu stehen. In meiner Kindheit lehrten mich meine älteren Verwandten, von denen viele keine formale Bildung genossen hatten und denen es an grundlegenden Kenntnissen im Lesen und Schreiben mangelte, dass man als anständige Person immer die Wahrheit sagen und die Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen musste. Insbesondere meine Großmutter mütterlicherseits, Baba, lehrte mich, dass diese Werte die Grundlage meines Wesens sein sollten, egal wo und in welchem Land ich lebte. Sie brachte mir bei, dass ich, um diese Werte zu leben, lernen musste, mutig zu sein, den Mut aufzubringen, zu meinen Überzeugungen zu stehen, Fehler einzugestehen und wiedergutzumachen, Stellung zu beziehen.
Mich immer der Wahrheit verpflichtet zu fühlen, eine Frau zu sein, die zu ihrem Wort steht, eine Frau von Integrität, das war es, worauf meine Großmutter beharrte. Im Nachhinein habe ich mich oft gefragt, ob ich mir ihre Lektionen so sehr zu Herzen genommen hatte, dass es mir schließlich unmöglich war, mich so weit fort von meinem Geburtsort und meinen Leuten zu Hause zu fühlen. Denn nach Integrität zu streben, machte es schwer, Freude an einem Leben fernab von den Leuten und der Landschaft meiner Kindheit zu empfinden. Und als die Alten, die so großzügig ihre Geschichten, ihre Weisheit und ihr Leben teilten, damit ich und Menschen wie ich ein gutes, reicheres Leben führen konnten, zu sterben begannen, war es nur eine Frage der Zeit, dass ich mich berufen fühlte, ihrer zu gedenken und ihr metaphysisches Vermächtnis in die Gegenwart zu tragen. Unter hinterwäldlerischen Analphabet:innen wurden mir Werte und Normen vermittelt, nach denen ich mein Leben führen sollte. Diese ethischen Standards hatten wenig Bedeutung in der Welt jenseits der kleinen Schwarzen Gemeinschaften in Kentucky, die ich mein Leben lang gekannt hatte.
Das Aufwachsen in einer extrem dysfunktionalen Herkunftsfamilie hatte mich zwar ›verrückt‹ gemacht, aber ich überlebte und schuf mir fern meiner Heimat ein neues Zuhause. Ich konnte schließlich auf die positiven Fertigkeiten zurückzugreifen, die ich während meiner Kindheit und Jugend erlernt hatte. Kentucky war der einzige Ort, an dem ich gelebt hatte, wo es Ältere gab, die den Jüngeren Werte vermittelten und zugleich deren Eigensinn akzeptierten. Durch ihr Beispiel ließen sie mich wissen, dass vollkommene Selbstverwirklichung der einzige Weg zu wahrer Heilung war und sie offenbarten mir, dass die Schätze, die ich suchte, bereits mein eigen waren. Die Erfüllung all meiner Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach einem Ort, an dem ich mich heimisch fühlen konnte, das Ziel all meines Suchens, von Stadt zu Stadt, nach Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, wartete auf mich in Kentucky, wartete darauf, dass ich mich erinnerte und mein Erbe zurückforderte. Außerhalb meines Heimatstaates fand ich mich oft unter Leuten wieder, die meinten, ich hinge altmodischen Werten an, die mich bemitleideten, weil ich nicht wusste, wie man opportunistisch sein oder die Spiele mitspielen konnte, die mir geholfen hätten, voran zu kommen.
Ich werde an diese spannungsgeladene Dualität des Begehrens erinnert, wenn ich Lorraine Hansberrys Stück A Raisin in the Sun lese. In dem Stück dramatisiert sie die Konflikte, die entstehen, wenn die Werte der Zugehörigkeit, die alten Denkweisen, mit den Werten des Unternehmertums und des beruflichen Opportunismus kollidieren. Traurig darüber, dass ihr Sohn die Versicherungssumme, die sie nach dem Tod ihres Mannes erhalten haben, für sich nehmen will, sagt Mama, früher sei es die Freiheit gewesen, die Leben bedeutete. Sie fragt ihren Sohn: »Seit wann bedeutet Geld Leben?« Walter Lee antwortet: »Es war immer Leben, Mama. Wir haben es nur nicht gewusst.« Zweifellos lebten die Massen von Schwarzen, die aus dem agrarisch geprägten Süden vor rassistischer Ausbeutung und Unterdrückung flüchteten, von der sie glaubten, sie würde ihnen im industrialisierten Norden nicht widerfahren, in einem ständigen Wertekonflikt. Ihre ländliche Vergangenheit hinter sich zu lassen, bedeutete, Kulturen der Zugehörigkeit und Gemeinschaft, in der die Ressourcen geteilt wurden, zugunsten einer Kultur des liberalen Individualismus aufzugeben. Bislang wurden nur wenige Studien veröffentlicht, die die seelischen Turbulenzen behandeln, mit denen Schwarze durch diese Migration und die damit verbundenen neuen psychischen Anforderungen konfrontiert waren.