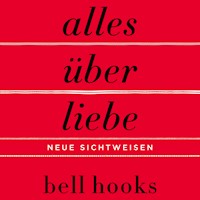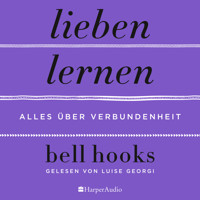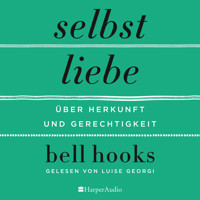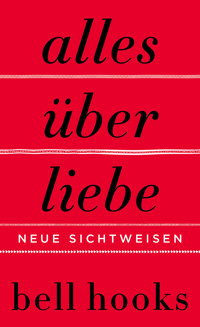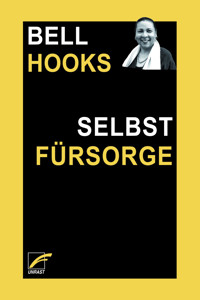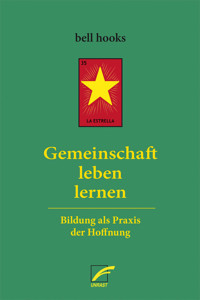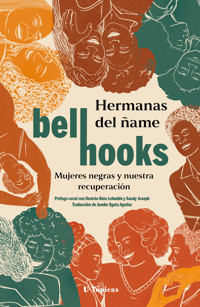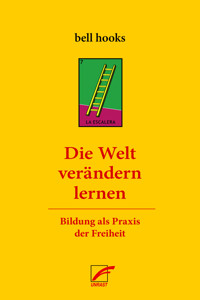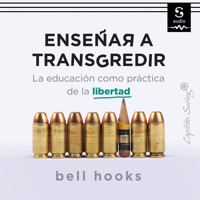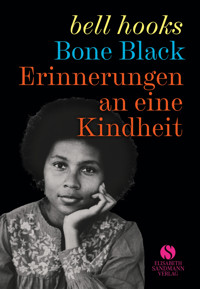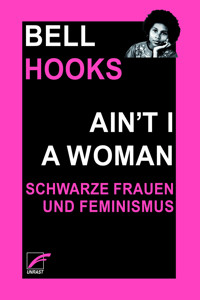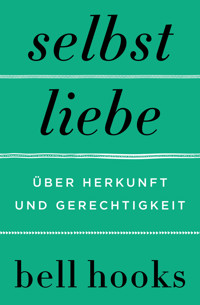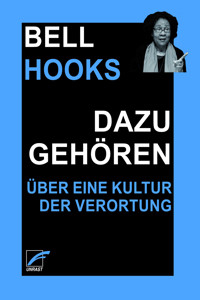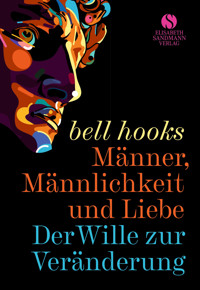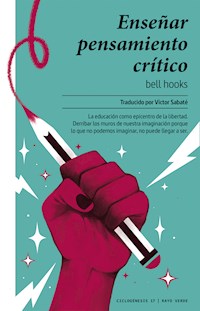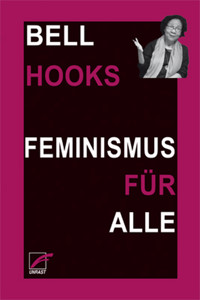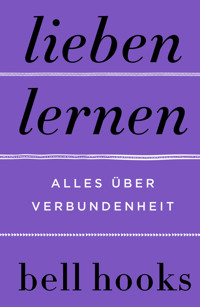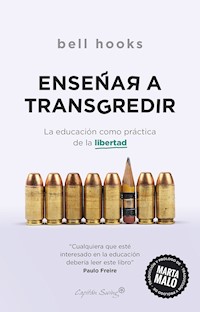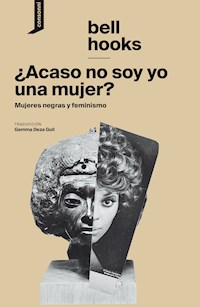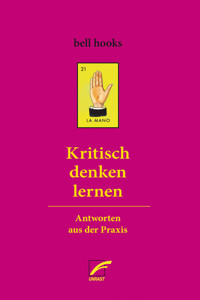
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Kritisch denken lernen" ist eine gleichermaßen provokante wie vergnügliche intellektuelle Auseinandersetzung mit den alltäglichen Herausforderungen des Lehrens und Lernens in Schule und Universität. In 32 kurzen und leicht verständlich geschriebenen Essays antwortet die renommierte Kulturkritikerin und Pädagogin bell hooks auf konkrete Fragen, die sie nach der Veröffentlichung ihrer Bestseller "Die Welt verändern lernen" und "Gemeinschaft leben lernen" erreicht haben. Die Themen sind vielfältig und breit gefächert: Ist vernünftiger Unterricht auch in großen Lerngruppen möglich? Was können Schüler*innen und Studierende gegen einen langweiligen Unterricht tun? Wie können Schwarze weibliche Lehrende eine positive Autorität im Hörsaal aufrechterhalten, ohne durch die Brille negativer rassistischer und sexistischer Stereotypen gesehen zu werden? Kann Humor beim Lernen dienlich sein? Und wie soll eine Lehrperson mit Tränen im Klassenzimmer umgehen? Die Antworten, die bell hooks auf diese und viele weitere Fragen gibt, sind erfrischend praxisnah. In den hier versammelten Essays feiert die Autorin, die aus vielfältigen und langjährigen Erfahrungen als Professorin an Colleges und Universitäten schöpfen kann, die weltverändernde Kraft der Fantasie und des Geschichtenerzählens im Unterricht als eine zuverlässige Möglichkeit, sich gegen Rassismus, Sexismus und Klassismus zu wehren und kritisches Denken zu fördern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
bell hooks, am 25. September 1952 als Gloria Watkins in Hopkinsville, Kentucky geboren und Ende 2021 verstorben, war eine afroamerikanische Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin. Schon als junge Studentin schloss sie sich der feministischen Bewegung an und machte sich 1981 gleich mit ihrem ersten Buch Ain’t I a Woman? einen Namen weit über wissenschaftliche Kreise hinaus. In den nachfolgenden Jahrzehnten hat sie zahlreiche Werke veröffentlicht, in denen sie sich mit Rassismus, Sexismus und Klassismus beschäftigt, und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden.
bell hooks
Kritisch denken lernen
Antworten aus der Praxis
Aus dem amerikanischen Englisch von Helene Albers
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
bell hooks: Kritisch denken lernen
1. Auflage, Oktober 2024
eBook UNRAST Verlag, Januar 2025
ISBN 978-3-95405-210-3
© UNRAST Verlag, Münster 2024
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Titel der Originalausgabe:
Teaching Critical Thinking. Practical Wisdom, New York 2010
Copyright © 2010 Taylor & Francis
Alle Rechte vorbehalten
Autorisierte Übersetzung der englischsprachigen Ausgabe,
herausgegeben von Routledge, einem Mitglied der Taylor & Francis Group LLC
Umschlag: UNRAST Verlag, Münster
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
Einleitung
1 Kritisches Denken
2 Demokratische Bildung
3 Engagierte Pädagogik
4 Dekolonisierung
5 Integrität
6 Die Sinnfrage
7 Zusammenarbeit (geschrieben mit Ron Scapp)
8 Das Gespräch
9 Die Geschichte erzählen
10 Die Geschichte teilen
11 Fantasie
12 Dozieren oder nicht
13 Humor im Unterricht
14 Zeit für Tränen
15 Konflikt
16 Feministische Revolution
17 Schwarz, weiblich, Akademikerin
18 Lernen über den Hass hinaus
19 Anerkennung für Lehrende
20 Wenn Lehrende dem Lernen im Weg stehen
21 Selbstwertgefühl
22 Die Freude am Lesen
23 Intellektuelles Leben
24 Kinderbücher schreiben
25 Spiritualität
26 Berührung
27 Wieder zu lieben
28 Feministischer Wandel
29 Jenseits von Race und Gender
30 Über Sexualität sprechen
31 Lehren als prophetische Berufung
32 Praktische Weisheit
Anmerkungen
»Die menschliche Existenz ist durch das Stellen von Fragen entstanden, und deshalb ist sie der Ursprung des Wandels in der Welt. Es gibt ein radikales Element der Existenz, und dies ist der radikale Akt des Fragens. (...) Im Kern hat die menschliche Existenz mit Überraschung, Infragestellung und Risiko zu tun. Und deswegen auch mit Handeln und Veränderung.«
Paulo Freire
(Learning to Question. A Pedagogy of Liberation, Geneva, NY, 1989)
Vorbemerkung des Verlags zum Sprachgebrauch:
Sprache als Kulturgut unterliegt beständigem Wandel, ebenso wie fortschreitende sozialwissenschaftliche Diskurse, in denen Standpunkte auch über sich verändernde Sprache vertreten werden. Dies ist in einer modernen Übersetzung eines 2009 geschriebenen Textes nicht immer unproblematisch und soll deshalb an dieser Stelle kurz erklärt werden.
In diesem Buch benutzen wir
• gendersensible Sprache, die mit dem eingefügten Doppelpunkt möglichst barrierearm alle biologischen und sozialen Geschlechter ansprechen soll. Begriffe, die im Kontext der 1990er- bis 2000er-Jahre ausschließlich cis Frauen (und Lesben) bezeichnen, werden hier im generischen Femininum belassen und nicht gegendert.
• ›Schwarz‹ als identitätsstiftenden und selbstgewählten Begriff von Menschen und Communitys in Großschreibweise, weil er nicht als adjektivische Zuschreibung zu verstehen ist – und schon gar nicht als Farbe.
• den englischen Begriff race unübersetzt. Im Gegensatz zum deutschen Wort ›Rasse‹, das biologistisch und auch historisch äußerst problematisch konnotiert ist, wird Race heute auch im deutschen Sprachraum zunehmend als emanzipatorischer Begriff verwendet.
Einleitung
Meine Schullaufbahn begann ich in den fünfziger Jahren in den segregierten Schwarzen Schulen von Kentucky. Ich hatte das Glück, von afroamerikanischen Menschen unterrichtet zu werden, denen es ein echtes Anliegen war, dass ich, wie alle anderen auch, eine ›gute Schulbildung‹ erhielt. Unter einer ›guten Schulbildung‹ verstanden sie nicht nur Wissensvermittlung und Berufsvorbereitung, sondern auch, dass wir zu kontinuierlichem Engagement für soziale Gerechtigkeit, insbesondere für den Kampf gegen Rassismus ermutigt wurden. Dabei waren sie der festen Überzeugung, dass eine Lehrperson immer auch menschlich sein muss. Für mich verkörperten sie sowohl einen überlegenen Intellekt als auch moralische Integrität und prägten so meine Vorstellung von der Schule als einem Ort, an dem die Sehnsucht nach Wissen gestillt werden und wachsen kann. Die Lehrenden[1] in unseren segregierten Schulen erwarteten von uns, dass wir das College besuchen. Denn sie waren vom Geist eines W. E. B. Du Bois durchdrungen, der 1933 in einer Schrift über höhere Bildung für Schwarze schrieb:
»Wir halten die mögliche Zukunft in unseren Händen, aber nicht durch Wunsch und Willen, sondern nur durch Denken, Planen, Wissen und Organisation. Wenn das College dem kommenden Zeitalter amerikanische Schwarze bescheren kann, die sich selbst und ihre Notlage kennen und wissen, wie sie sich schützen und rassistische Vorurteile bekämpfen können, dann wird die Welt unserer Träume kommen – und nur dann.«
Entsprechend wurde uns beigebracht, dass Bildung der sicherste Weg zur Freiheit ist. Die Lehrpersonen waren dazu da, uns anzuleiten und uns den Weg in die Freiheit zu zeigen.
Als ich aufs College kam, war ich wirklich erstaunt, dort Lehrende vorzufinden, die ihr Hauptvergnügen im Unterricht darin zu finden schienen, ihre autoritäre Macht über die Studierenden auszuüben, uns zu entmutigen und uns geistig wie körperlich nicht als Menschen zu behandeln. Ich hatte mich für die Stanford University und damit für ein überwiegend weißes College entschieden, vor allem, weil die finanziellen Hilfen dort besser waren als an Schwarzen Hochschulen, aber ich hatte nie darüber nachgedacht, wie es sein würde, von rassistischen Lehrkräften unterrichtet zu werden. Auch wenn ich bereits eine Highschool mit offen rassistischen Lehrer:innen besucht hatte, die uns verachteten und unfreundlich waren, so hatte ich doch eine romantisch verklärte Vorstellung vom College. Ich glaubte, es wäre ein Paradies des Lernens, wo wir alle so sehr mit Studieren beschäftigt wären, dass wir keine Zeit für die belanglosen Dinge dieser Welt hätten, insbesondere nicht für Rassismus.
Wir brauchen mehr autobiografische Zeugnisse über die erste Generation Schwarzer, die überwiegend weiße Schulen, Colleges und Universitäten besuchten. Denn stellt euch vor, wie es ist, von einer Lehrperson unterrichtet zu werden, die glaubt, dass ihr keine vollwertigen Menschen seid. Stellt euch vor, wie es ist, von Leuten unterrichtet zu werden, die sich für überlegen halten, nur weil sie weiß sind und die der Meinung sind, dass sie sich nicht selbst erniedrigen sollten, indem sie Personen unterrichten, von denen sie wirklich glauben, dass sie unfähig seien zu lernen.
Normalerweise wussten wir, welche weißen Professor:innen uns offen hassten, und wir blieben ihren Kursen fern, es sei denn, es war unbedingt erforderlich. Da die meisten von uns im Zuge des starken antirassistischen Bürgerrechtskampfes an die Universitäten kamen, wussten wir, dass wir dort Verbündete im Kampf finden würden, und das taten wir auch. Im Übrigen war es doch etwas überraschend, dass der unverhohlene Sexismus meiner männlichen Dozenten im Grundstudium noch schlimmer war als ihr unterschwelliger Rassismus.
In diesem seltsamen neuen Klima des sozialen Umbruchs zur Schule und anschließend aufs College zu gehen, war sowohl aufregend als auch beängstigend. Damals feierten fast alle den Beginn eines neuen Zeitalters der Gleichheit und der demokratischen Bildung, aber in Wirklichkeit sind die alten Hierarchien von Race, Klasse und Gender intakt geblieben. Und neu entwickelte Rituale sorgten dafür, dass sie nicht angetastet wurden. Der Versuch, diese beiden Welten zu vereinbaren – die eine, in der wir wie alle anderen lernen und studieren konnten, und die andere, in der uns ständig vor Augen geführt wurde, dass wir nicht wie alle anderen waren –, machte mich ein wenig schizophren. Ich wollte lernen und hatte Spaß daran, aber ich fürchtete mich vor den meisten meiner Lehrenden.
Ich habe studiert, um Lehrerin zu werden. Doch ich hatte gar keine Lust zu unterrichten. Ich wollte Schriftstellerin werden. Ich lernte bald, dass schlecht bezahlte Jobs mit langen Arbeitszeiten mich nicht zu einer Schriftstellerin machten, und ich akzeptierte, dass Unterrichten der beste Beruf war, den eine Autorin ausüben konnte. Als ich mein Studium beendete, hatte ich schon alle Arten von Lehrenden kennengelernt. Auch wenn progressive Lehrpersonen, die für die Praxis der Freiheit ausbildeten, die Ausnahme waren, inspirierte mich ihre Anwesenheit. Ich wusste, dass ich ihrem Beispiel folgen und eine Lehrerin werden wollte, die junge Menschen dazu anregt, selbstbestimmt zu lernen. Und genau diese Art Lehrerin wurde ich, beeinflusst von den progressiven Frauen und Männern (Schwarze und weiße), die mir von der Grundschule bis zum College immer wieder die Macht des Wissens vor Augen geführt hatten. Diese Lehrenden haben mir gezeigt, dass wir uns bewusst dafür entscheiden können, für die Praxis der Freiheit zu unterrichten.
Indem ich die Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentfaltung der Lernenden förderte, lernte ich bald, das Unterrichten zu lieben. Ich liebte die Studierenden. Ich liebte den Unterricht. Doch ich fand es auch zutiefst beunruhigend, dass der Machtmissbrauch, den ich während meiner Ausbildung erlebt hatte, häufig noch an der Tagesordnung war, und ich wollte darüber schreiben. Als ich meinem langjährigen Lektor bei Routledge, Bill Germano, zum ersten Mal erzählte, dass ich ein Buch mit Aufsätzen über das Unterrichten schreiben wollte, äußerte er Bedenken. Er sagte damals, dass es vielleicht kein Publikum für ein solches Buch gäbe, und wies mich darauf hin, dass ich keine Professorin für Pädagogik sei; vielmehr hätten sich meine bisherigen Veröffentlichungen auf feministische Theorie und Kulturkritik konzentriert. Ich erklärte dass ich in diesem neuen Buch die Verbindungen zwischen engagierter Pädagogik und Fragen von Race, Gender und Klasse untersuchen sowie den Einfluss der Arbeit von Paulo Freire auf mein Denken erklären wollte. Als er mir zuhörte, was er eigentlich immer tat, war Germano überzeugt. Und Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom wurde 1994 mit großem Erfolg veröffentlicht.[2]
Zehn Jahre später veröffentlichte ich Teaching Community. A Pedagogy of Hope,[3] gewissermaßen die Fortsetzung von Teaching to Transgress, die sich mit weiterführenden Fragen der engagierten Pädagogik beschäftigte. Im Vorwort mit dem Titel »Hoffnung lehren und leben« spreche ich über die Tatsache, dass das erste Buch über das Lehren ein erstaunlich breites Publikum erreichte und dass es mir die Möglichkeit gab, mit Lehrenden und Studierenden in eine Diskussion über Bildung einzutreten. Ich habe dort folgendes ausgeführt:
»In den vergangenen zehn Jahren habe ich mehr Zeit damit verbracht, Professor:innen und Studierenden etwas über das Unterrichten beizubringen, als in den regulären Lehrveranstaltungen des Fachbereichs Englisch, der Feminist Studies oder der African American Studies. Es war nicht nur die große Resonanz auf mein Buch Die Welt verändern lernen, die mir diese neuen Räume für den Diskurs eröffnete. Hinzu kam etwas anderes: Als ich in die Öffentlichkeit trat, um als Dozentin zu arbeiten, war ich von Anfang an bestrebt, Leidenschaft, Kompetenz und Würde in die Kunst des Unterrichtens einzubringen. Daher war meinem Publikum klar, dass ich das praktizierte, was ich predigte. Diese Verbindung von Theorie und Praxis war ein lebendiges Beispiel für alle Lehrpersonen, die auf der Suche nach praxisorientierter Erkenntnis sind.«
In den mehr als zwanzig Jahren, die seither vergangen sind, wurde ich immer wieder gebeten, auch solche Themen anzusprechen, die in den ersten beiden pädagogischen Büchern nicht ausdrücklich behandelt wurden. Ich wurde auch von einzelnen Lehrpersonen gebeten, Fragen zu beantworten, die ihnen als besonders dringlich erschienen.
In diesem hier vorliegenden letzten Buch meiner pädagogischen Trilogie, Kritisch Denken lernen. Antworten aus der Praxis,[4] bin ich nicht dem Muster der beiden vorangegangenen Bücher gefolgt und habe keine Sammlung von Aufsätzen verfasst. Stattdessen habe ich in diesem Buch Themen und Anliegen aufgegriffen, die von Lehrenden und Lernenden direkt an mich herangetragen wurden, und auf jede Frage mit einem kurzen Kommentar geantwortet. Die zweiunddreißig ›Antworten‹ behandeln eine breite Palette von Themen, einige einfach, andere komplex. Immer werden dabei Fragen von Race, Gender und Klasse aus verschiedenen Blickwinkeln behandelt. Ich habe mich sehr gefreut, diese kurzen Kommentare zu schreiben, denn es gibt so viele lohnende Themen rund um die Lehre, die es wert sind, betrachtet zu werden, auch wenn sie nicht unbedingt einen längeren Aufsatz erfordern. Eine Schwarze Professorin wollte, dass ich mich mit der Frage beschäftige, wie sie ihre Autorität im Unterricht aufrechterhalten kann, ohne durch die Linse rassistischer, sexistischer Stereotypen als »wütende Schwarze Frau« betrachtet zu werden. Eine Lehrperson wünschte sich, dass ich etwas über Tränen im Unterricht sage, während eine andere mich bat, etwas über Humor in der Lehre zu sagen. Eine sehr spezielle und provokative Frage war die, ob wir von Wissenschaftler:innen und Schriftsteller:innen lernen können, die rassistisch und sexistisch sind. Die Macht der Erzählung, die wichtige Rolle des Gesprächs im Lernprozess und der Stellenwert der Fantasie im Unterricht sind nur einige weitere Themen, die in dieser Textsammlung behandelt werden.
Alle in diesem Buch behandelten Themen sind aus meinen Gesprächen mit Lehrenden und Lernenden hervorgegangen. Auch wenn sie nicht durch eine gemeinsame Leitidee oder Fragestellung verbunden sind, entspringen die Themen doch alle unserem gemeinsamen Wunsch, zu verstehen, wie wir den Unterricht zu einem Ort leidenschaftlichen Engagements und intensiven Lernens machen können.
1
Kritisches Denken
Auf dem Umschlag meiner Memoiren Bone Black[5] ist ein Schnappschuss von mir zu sehen, als ich drei oder vier Jahre alt war. Darauf halte ich ein Spielzeug aus der Ferienbibelschule in der Hand, ein Buch in Form einer Taube. Ich scherze oft, dass man dieses Bild als »Porträt einer Intellektuellen als junges Mädchen« bezeichnen könnte – meine Version von »Der Denker«.[6] Das Mädchen auf dem Schnappschuss blickt intensiv auf das Objekt in ihren Händen; ihre Augenbrauen zeigen höchste Konzentration. Wenn ich dieses Bild betrachte, kann ich sie denken sehen. Ich kann ihren Geist arbeiten sehen.
Denken ist eine Handlung. Für alle, die Intellektuelle sein wollen, sind die Gedanken das Labor, in dem sich Fragen stellen und Antworten finden lassen und der Ort, an dem die Visionen von Theorie und Praxis zusammenkommen. Der Hauptantrieb des kritischen Denkens ist die Sehnsucht nach Wissen – um zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Kinder besitzen eine natürliche Neigung zum kritischen Denken. Über die Grenzen von Race, Klasse, Geschlecht und Lebensumstände hinweg kommen Kinder in eine Welt voller Wunder und einer ganz eigenen Welt der Sprache, erfüllt von dem Wunsch nach Wissen. Manchmal sind sie so begierig nach Wissen, dass sie zu unerbittlich Fragenden werden – sie wollen wissen, wer, was, wann, wo und warum das Leben ist. Auf ihrer Suche nach Antworten lernen sie fast instinktiv, wie man denkt.
Leider endet die Leidenschaft der Kinder für das Denken oft, wenn sie auf eine Welt treffen, die sie nur zu Konformität und Gehorsam erziehen will. Den meisten Kindern wird schon früh beigebracht, dass Denken gefährlich ist. Traurigerweise hören sie auf, den Prozess des Denkens zu genießen und beginnen, den denkenden Verstand zu fürchten. Ob in Elternhäusern, in denen sie durch eine Mischung aus Disziplinierung und Bestrafung lernen, dass es besser ist, Gehorsam über Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung zu stellen, oder in Schulen, in denen unabhängiges Denken kein akzeptables Verhalten ist, die meisten Kinder in unserem Land lernen, die Erinnerung an das Denken als eine leidenschaftliche, vergnügliche Tätigkeit zu verdrängen.
Wenn sie dann als Studierende in die Hochschulen kommen, haben die meisten von ihnen bereits verinnerlicht, sich vor dem Denken fürchten. Diejenigen, die keine Angst vor dem Denken haben, kommen oft mit der Annahme in die Lehrveranstaltungen, dass Denken nicht notwendig sein wird, dass alles, was sie tun müssen, darin besteht, Informationen zu konsumieren und sie in den richtigen Momenten wiederzukäuen. In der traditionellen Hochschulbildung finden sich die Studierenden in einer Welt wieder, in der unabhängiges Denken nicht gefördert wird. Zum Glück gibt es immer einige Lehrveranstaltungen, in denen einzelne Lehrende sich bemühen, Bildung als Praxis der Freiheit zu vermitteln. In solch einem Umfeld geht es um das Denken, und vor allem kritisches Denken ist das, worauf es dort ankommt.
Studierende werden nicht über Nacht zu kritisch denkenden Menschen. Zunächst müssen sie lernen, Freude am Denken zu entwickeln und die Kraft des Denkens zu schätzen. Engagierte Pädagogik ist eine Lehrstrategie, die darauf abzielt, in den Lernenden den Willen zum Denken und zur Selbstentfaltung wiederzubeleben. Insbesondere um die Befähigung zum kritischen Denken geht es der engagierten Pädagogik. In seinem Aufsatz »Critical Thinking. Why is it so difficult to teach?« sagt Daniel Willingham, dass kritisches Denken darin besteht, »beide Seiten einer Sache zu sehen, offen für neue Erkenntnisse zu sein, die alte Ideen widerlegen, nüchtern zu argumentieren, zu verlangen, dass Behauptungen durch Belege gestützt werden, Schlussfolgerungen aus verfügbaren Informationen zu ziehen, Probleme zu lösen usw.«
Einfacher ausgedrückt bedeutet kritisches Denken, zunächst das Wer, Was, Wann, Wo und Wie der Dinge herauszufinden – die Antworten auf die ewigen Fragen des wissbegierigen Kindes zu finden – und dann dieses Wissen so zu nutzen, dass man entscheiden kann, was am wichtigsten ist. Der Pädagoge Dennis Rader, Autor des Buches Teaching Redefined, hält die Fähigkeit, zu bestimmen, ›was wichtig ist‹, für einen zentralen Bestandteil des kritischen Denkens. In ihrem Buch The Miniature Guide to Critical Thinking. Concepts and Tools definieren Richard Paul und Linda Elder kritisches Denken als »die Kunst, das Denken zu analysieren und zu evaluieren, um es zu verbessern«. Weiter definieren sie kritisches Denken als »selbstgesteuert, selbstdiszipliniert, selbstkontrollierend und selbstkorrigierend«. Das Nachdenken über das Denken oder das gründliche Reflektieren über Ideen sind weitere notwendige Bestandteile des kritischen Denkens. Paul und Elder erinnern uns daran:
»Kritisch denkende Menschen sind sich über den Sinn und Zweck der Frage, um die es geht, im Klaren. Sie hinterfragen Informationen, Schlussfolgerungen und Standpunkte. Sie bemühen sich, klar und präzise zu sein und relevante Themen zu adressieren. Sie versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen, logisch und fair zu sein. All diese Fähigkeiten wenden sie auf ihr Lesen und Schreiben an, ebenso wie auf ihr Sprechen und Zuhören.«
Kritisches Denken ist ein interaktiver Prozess, der die Beteiligung von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen erfordert. Alle Definitionen beinhalten die Einsicht, dass kritisches Denken Urteilsvermögen erfordert. Es ist eine Art der Annäherung an Ideen, die darauf abzielt, den Kern, die zugrundeliegenden Wahrheiten zu verstehen, und nicht nur die oberflächliche Wahrheit, die vielleicht am offensichtlichsten ist. Einer der Gründe, warum die Dekonstruktion in Wissenschaftskreisen so populär wurde, ist, dass sie die Menschen dazu aufforderte, lange, intensiv und kritisch zu denken, die Dinge zu entschlüsseln, ihnen auf den Grund zu gehen und nach Erkenntnis zu streben. Zwar finden viele kritisch Denkende in dieser Arbeit intellektuelle oder akademische Erfüllung, doch bedeutet das noch lange nicht, dass auch alle Studierenden das Erlernen kritischen Denkens uneingeschränkt zu schätzen wissen.
Tatsächlich sträuben sich die meisten Studierenden gegen den Prozess des kritischen Denkens; sie fühlen sich wohler, wenn sie beim Lernen passiv bleiben können. Kritisches Denken erfordert, dass alle am Lernprozess Beteiligten sich engagiert in den Unterricht einbringen. Wenn Studierende sich dem verweigern, fühlen sich Lehrende, die unermüdlich daran arbeiten, kritisches Denken zu fördern, oft entmutigt. Erlernen Studierende jedoch die Fähigkeit des kritischen Denkens, was in der Regel leider nur wenigen gelingt, ist das eine wirklich lohnende Erfahrung für beide Seiten. Mit der Erziehung zu kritischem Denken verbinde ich die Hoffnung, dass ich meinen Studierenden durch mein Beispiel die Freude an der Arbeit mit Ideen, am Denken als aktiver Tätigkeit vermitteln kann.
Unvoreingenommenheit ist eine wesentliche Voraussetzung für kritisches Denken. Ich spreche oft von radikaler Offenheit, weil mir nach Jahren im akademischen Umfeld klar wurde, dass es allzu leicht ist, am eigenen Standpunkt festzuhalten, ihn zu verteidigen und andere Perspektiven auszuschließen. So vieles in der akademischen Ausbildung bestärkt Lehrende in dem Glauben, dass sie immer ›Recht haben‹ müssen. Ich schlage stattdessen vor, dass wir als Lehrende immer offen sein müssen, und bereit dazu, uns einzugestehen, wenn wir etwas nicht wissen. Das radikale Bekenntnis zur Offenheit ist es, was die Integrität des Prozesses des kritischen Denkens und seine zentrale Rolle in der Bildung gewährleistet. Dieses Engagement erfordert viel Mut und Vorstellungskraft. In ihrem Buch From Critical Thinking to Argument betonen die Autoren Sylvan Barnet und Hugo Bedau: »Kritisches Denken verlangt von uns, dass wir unsere Vorstellungskraft nutzen, die Dinge aus anderen Perspektiven sehen und uns die wahrscheinlichen Konsequenzen unserer Position vorstellen.« Kritisches Denken stellt daher nicht nur Anforderungen an die Lernenden, sondern auch an die Lehrenden. Sie müssen durch ihr Beispiel zeigen, dass Lernen in der Praxis bedeutet, dass nicht alle von uns immer Recht haben können und dass sich die Form des Wissens ständig ändert.
Der aufregendste Aspekt des kritischen Denkens im Unterricht ist, dass es von allen Initiative verlangt und alle aktiv dazu auffordert, leidenschaftlich zu denken und ihre Ideen leidenschaftlich und offen zu teilen. Wenn alle im Unterricht, Lehrende wie Lernende, erkennen, dass sie gemeinsam dafür verantwortlich sind, eine Lerngemeinschaft zu schaffen, dann erst wird Lernen wirklich relevant und nutzbringend. In einer solchen Lerngemeinschaft gibt es kein Scheitern. Alle beteiligen sich und teilen die Ressourcen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils benötigt werden. So ist sichergestellt, dass wir den Unterricht mit dem Wissen verlassen, dass kritisches Denken uns empowert.
2
Demokratische Bildung
Als ich in den fünfziger Jahren aufwuchs, zu einer Zeit, als die Schulen noch rassistisch segregiert waren, doch im Stillen die Saat des Bürgerrechtskampfes bereits aufgegangen war, wurde allenthalben über die Bedeutung und den Wert der Demokratie gesprochen. Es war sowohl ein öffentlicher Diskurs als auch ein privates Gesprächsthema. Schwarze Männer wie mein Vater, die in der Schwarzen Infanterie im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten, kamen nach Hause, desillusioniert von einem Land, das sie zum Kämpfen und Sterben geschickt hatte, um »die Demokratie auf der Welt zu schützen«, ihnen selbst aber gleichzeitig die Bürgerrechte verweigerte. Diese Desillusionierung brachte sie jedoch nicht zur Verzweiflung, sondern diente ihnen zuhause als Katalysator im Kampf für eine wahrhaft demokratische Gesellschaft. Während meiner gesamten Highschool-Zeit nahm ich an den Aufsatzwettbewerben von »Voice of Democracy« teil, die im Rahmen ihres Stipendienprogramms ausgeschrieben wurden. In meinen Aufsätzen vertrat ich leidenschaftlich meine Meinung, dass unser Land eine großartige Nation sei, die großartigste Nation der Welt, weil die Vereinigten Staaten sich der Demokratie verpflichtet hätten. Ich schrieb, dass alle Menschen in unserem Land Verantwortung für den Schutz und die Erhaltung der Demokratie übernehmen müssten. Wie vielen Schwarzen Kindern wurde auch mir beigebracht, dass einer der wichtigsten Aspekte unserer Demokratie darin bestand, dass sie das Recht auf Bildung für alle, unabhängig von Race, Gender oder Klasse garantiert.
Gegenwärtig gibt es unter den Lernenden kaum noch einen öffentlichen Diskurs über das Wesen der Demokratie. Heutzutage gehen die meisten von ihnen einfach davon aus, dass das Leben in einer demokratischen Gesellschaft ihr Geburtsrecht sei; sie aber nichts für die Aufrechterhaltung der Demokratie tun müssen. Möglicherweise verbinden sie Demokratie nicht einmal mehr mit dem Ideal der Gleichheit. In ihren Köpfen geht die Feindschaft gegen die Demokratie immer und ausschließlich von irgendwelchen fremden ›Anderen‹ aus, die nur darauf warten, das demokratische Leben anzugreifen und zu zerstören. Sie haben noch nie die amerikanischen Vordenker:innen der Vergangenheit und Gegenwart gelesen, die uns die Bedeutung der Demokratie erklären. Sie haben John Dewey nicht gelesen. Sie kennen seine eindringliche Botschaft nicht, dass »Demokratie in jeder Generation neu geboren werden muss«, und dass »die Bildung ihre Hebamme« ist. In ihrem Buch Democratic Schools beziehen sich James Beane und Michael Apple auf John Dewey, wenn sie die Notwendigkeit betonen, die Schulbildung an demokratischen Werten auszurichten. Sie erklären: »Wenn die Menschen eine demokratische Lebensweise sichern und aufrechterhalten wollen, müssen sie die Möglichkeit haben, zu lernen, was diese Lebensweise bedeutet und wie sie konkret gelebt werden kann.« Als entrechtete Gruppen amerikanischer Bürger:innen zusammen mit ihren Verbündeten dafür kämpften, die Bildungseinrichtungen so zu verändern, dass alle Menschen – auch Schwarze, People of Color und weiße Frauen – den gleichen Zugang erhalten, entstand ein dynamischer nationaler Diskurs über demokratische Werte. Im Einklang mit diesem Diskurs wurde Lehrenden eine entscheidende Rolle in der Vermittlung demokratischer Ideale zugesprochen. Ein nachhaltiges, kontinuierliches Engagement für soziale Gerechtigkeit bildete den Kern dieser Ideale.
Viele der Verbündeten im Kampf waren weiße Männer. Aufgrund der allgemeinen Verhältnisse und ihrer besonderen Privilegien standen sie an der Spitze der Bemühungen, das Bildungswesen zu einem Ort zu machen, an dem demokratische Ideale von Grund auf verwirklicht werden sollten. Doch vielfach waren diese die demokratischen Werte verfechtenden Männer innerlich gespalten. In der Theorie vertraten sie zwar die Ansicht, dass alle Menschen ein Recht auf Bildung haben, doch in der Praxis unterstützten sie die Aufrechterhaltung der Hierarchien in den Bildungseinrichtungen, in denen privilegierte Gruppen begünstigt wurden. Wie Thomas Jefferson, der viel zum Aufstieg der Demokratie beigetragen hat, waren sie voller Widersprüche. Auch wenn Jefferson forderte, dass »die Masse des Volkes gebildet und informiert« sein müsse, kam in vielen seiner Werke seine Zwiespältigkeit zum Vorschein. Einerseits konnte er wortreich darüber sprechen und schreiben, wie notwendig es sei, den Geist der Demokratie und der Gleichheit hochzuhalten, und andererseits konnte er Versklavte besitzen und Schwarzen die grundlegenden Menschenrechte verweigern. Trotz dieser Widersprüche ließ Jefferson nicht von seiner Überzeugung ab, dass es für den »Fortschritt des menschlichen Geistes« entscheidend ist, dem Wandel gegenüber aufgeschlossen zu sein. Er schrieb: »In dem Maße, in dem sich alles weiterentwickelt, aufgeklärter wird, in dem Maße, in dem neue Entdeckungen gemacht, neue Wahrheiten entdeckt werden, die Sitten und Meinungen sich ändern, mit dem Wandel der Umstände, müssen sich auch die Institutionen weiterentwickeln, um mit der Zeit Schritt zu halten.«
Sicherlich wurden Schule und Bildung tiefgreifenden und radikalen Veränderungen unterzogen, als die Kritik an den imperialistischen, weiß-suprematistischen, kapitalistischen, patriarchalen Normen an Fahrt aufnahm. Die konservative Dominanzkultur reagierte auf diese Veränderungen jedoch mit Angriffen auf politische Fördermaßnahmen, insbesondere auf die Politik der »Affirmative Action«, die den Institutionen der höheren Bildung die Möglichkeit gab, entrechtete Gruppen stärker einzubeziehen. Die Folge war, dass die Türen der Bildung, die sich gerade erst geöffnet hatten und den Entrechteten den Zugang ermöglichten, wieder verschlossen wurden. Denn der anschließende Aufstieg der Privatschulen untergrub das öffentliche Schulwesen, während das bloße Lernen auf Prüfungen hin die Diskriminierung und Ausgrenzung verstärkte, sodass die rassistische und klassistische Segregation im Bildungswesen rasch zur allgemein akzeptierten Norm wurde. An allen Fronten wurden die Mittel für Bildung gekürzt. Progressive Professor:innen, die sich einst für einen radikalen Wandel eingesetzt hatten, wurden schlichtweg gekauft. Hoher Status und hohe Gehälter haben sie dazu gebracht, sich dem System anzupassen, das sie einst so vehement bekämpft hatten.
In den 1990er-Jahren wurden die Black Studies, die Women’s Studies und die Cultural Studies so umgestaltet, dass sie nicht mehr als progressive Orte innerhalb des Bildungssystems fungierten, von denen aus ein öffentlicher Diskurs über Freiheit und Demokratie geführt werden konnte. Sie wurden größtenteils entradikalisiert. Und dort, wo dies nicht stattfand, wurden sie ghettoisiert und galten bloß noch als Spielwiese für Studierende, die sich eine radikale Identität zulegen wollten. Heute werden Lehrende, die sich diesem Prozess verweigern, oft ausgegrenzt oder sogar gedrängt, die akademische Welt zu verlassen. Diejenigen von uns, die bleiben und sich weiterhin für Bildung als Erziehung zur Freiheit einsetzen, erleben hautnah, wie die demokratische Bildung unterminiert wird, da die Interessen des Großkapitals und die Macht der Konzerne die Studierenden geradezu dazu verleiten, Bildung ausschließlich als Mittel für materiellen Erfolg zu betrachten. Ein solches Denken stellt den Erwerb von Informationen über die Gewinnung von Erkenntnis oder das Erlernen kritischen Denkens.
Der Grundsatz der Gleichheit, der den Kern der demokratischen Werte bildet, hat in einer Welt, in der eine globale Oligarchie die Macht übernimmt, nur noch wenig Bedeutung. Unter dem Vorwand der Bedrohung durch terroristische Angriffe wird den Bürger:innen eingeredet, dass freie Meinungsäußerung und Protest unser Land in Gefahr bringen. Und Regierungen auf der ganzen Welt übernehmen faschistische Politikstrategien, die die Demokratie an allen Fronten unterminieren. Dass »der Kapitalismus keine Demokratie mehr braucht«, erklärt Hervé Kempf in seiner kraftvollen Polemik How the Rich Are Destroying the Earth. Er stellt fest:
»So ist die Demokratie für die Ziele der Oligarchie kontraproduktiv geworden: Die Demokratie begünstigt den Widerstand gegen ungerechtfertigte Privilegien; sie nährt Zweifel an illegitimen Machtbefugnissen; sie drängt auf eine rationale Prüfung von Entscheidungen. Sie ist daher in einer Zeit, in der die schädlichen Tendenzen des Kapitalismus immer offensichtlicher werden, zunehmend gefährlich.«
Mehr als je zuvor in unserem Land brauchen wir Pädagog:innen, um Schulen zu Orten zu machen, an denen die Bedingungen für die Entwicklung und Förderung eines demokratischen Bewusstseins geschaffen werden. Das Bildungssystem ist der wichtigste Ort in unserem Land, an dem freie Meinungsäußerung, Dissens und pluralistische Positionen in Theorie und Praxis geschätzt werden. In ihrer nachdenklichen Betrachtung dieses Themas, Wrestling with the Angel of Democracy. On Being an American Citizen erinnert uns Susan Griffin daran, dass »der Geist der Demokratie nur durch eine ständige Revolution am Leben erhalten werden kann«. In ihren tiefgründigen Betrachtungen über Demokratie in ihrem Buch The Healing of America hebt Marianne Williamson hervor, dass das demokratische Prinzip der Einheit in der Vielfalt als Grundlage der demokratischen Werte erhalten bleiben muss:
»Es gibt Menschen in Amerika, die unsere Einheit überbetonen, aber die Bedeutung unserer Vielfalt nicht zu schätzen wissen, genauso wie es Menschen gibt, die unsere Vielfalt betonen, aber die Bedeutung unserer Einheit nicht zu schätzen wissen. Es ist unerlässlich, dass wir beides würdigen. Es geht um unsere Einheit und unsere Vielfalt, denn ihr Verhältnis zueinander ist Ausdruck einer philosophischen und politischen Wahrheit, außerhalb derer wir nicht gedeihen können.«
Griffin bekräftigt diese Einschätzung: »In einer Demokratie werden viele verschiedene Standpunkte zu allen möglichen Themen geäußert, und fast alle davon müssen toleriert werden. Dies ist ein Grund, warum demokratische Gesellschaften in der Regel pluralistisch sind.« Die Zukunft unserer demokratischen Bildung wird davon abhängen, inwieweit demokratische Werte über den Geist der Oligarchie triumphieren können, der versucht, die Vielfalt der Stimmen zum Schweigen zu bringen, die freie Meinungsäußerung zu unterbinden und den Bürger:innen den Zugang zu Bildung zu verwehren.
Wir als progressive Pädagog:innen halten weiterhin an einer Bildung als Praxis der Freiheit fest, weil wir verstehen, dass Demokratie nur in einem Umfeld gedeiht, in dem das Lernen geschätzt wird und die Fähigkeit zu denken das Kennzeichen mündiger Bürger:innen ist; freie Meinungsäußerung und die Bereitschaft zum Dissens werden in solch einem Umfeld akzeptiert und gefördert. Griffin meint:
»Diejenigen, die zum demokratischen Bewusstsein beitragen, überschreiten die Grenzen des Vorurteils. Ihre Einstellung steht im Einklang mit dem tiefen Wunsch nach Rede- und Gedankenfreiheit, und zwar nicht nur als Mittel in den ewigen Kämpfen um politische Macht, die in jeder Epoche stattfinden, sondern aus einem viel grundlegenderen demokratischen Impuls heraus, dem Wunsch nach Bewusstseinserweiterung.«
Demokratische Bildung basiert auf der Annahme, dass Demokratie funktioniert, dass sie die Grundlage für jedes echte Lehren und Lernen ist.