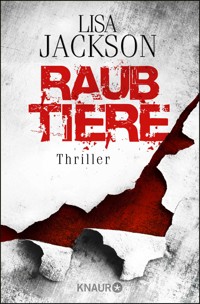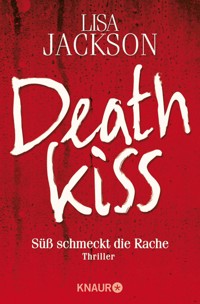
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein West-Coast-Thriller
- Sprache: Deutsch
Bald schon, bald … Mit jedem Mord kommt er ihr näher. Niemand wird ihn hindern, seinen Rachedurst zu stillen … Shannon Flannery hat das quälende Gefühl, beobachtet und verfolgt zu werden – aber niemand glaubt ihr. Allein Special Agent Travis Settler scheint sie ernst zu nehmen, doch in Wahrheit misstraut auch er der attraktiven Frau. Denn Settler sucht verzweifelt nach seiner Tochter und vermutet Verbindungen zwischen Shannons dunkler Vergangenheit und dem Verschwinden seines Kindes. Erst nach und nach erkennt Travis, dass auch Shannon Opfer ist – und in akuter Lebensgefahr schwebt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Lisa Jackson
Deathkiss
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Wenn ein Mörder mit [...]
Prolog
Spätsommer Der Wald bei Santa Lucia, Kalifornien
1.Kapitel
Drei Jahre später
2.Kapitel
3.Kapitel
4.Kapitel
5.Kapitel
6.Kapitel
7.Kapitel
8.Kapitel
9.Kapitel
10.Kapitel
11.Kapitel
12.Kapitel
13.Kapitel
14.Kapitel
15.Kapitel
16.Kapitel
17.Kapitel
18.Kapitel
19.Kapitel
20.Kapitel
21.Kapitel
22.Kapitel
23.Kapitel
24.Kapitel
25.Kapitel
26.Kapitel
27.Kapitel
28.Kapitel
29.Kapitel
30.Kapitel
31.Kapitel
32.Kapitel
33.Kapitel
Epilog
Heiligabend
Danksagung
Wenn ein Mörder mit dem Feuer spielt, wird sich jemand die Finger verbrennen …
Prolog
Spätsommer Der Wald bei Santa Lucia, Kalifornien
Er hatte sich verspätet.
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr, deren Digitalanzeige im stockdunklen Wald gespenstisch glomm.
Drei Minuten vor Mitternacht.
Verdammt!
Er würde es nicht mehr rechtzeitig schaffen, und er würde Aufmerksamkeit auf sich ziehen, etwas, was er unbedingt vermeiden wollte.
Er beschleunigte seine Schritte, trabte bergab über das unebene Gelände, bewaldetes Hügelland fern abseits jeglicher Zivilisation.
Eine einsame Gegend, in der ihn niemand entdecken würde.
Die Nachtgeräusche stahlen sich in sein Bewusstsein: das Rascheln von Herbstlaub im heißen Wind, das Knacken eines trockenen Zweiges unter seinen Füßen und das heftige Pochen seines eigenen Herzens, das Adrenalin durch seine Adern strömen ließ.
Er sah noch einmal auf die Uhr, die jetzt Mitternacht anzeigte, und biss die Zähne zusammen. Der Schweiß brach ihm aus allen Poren, seine Nerven waren aufs äußerste angespannt.
Langsam! Verrate dich nicht, indem du wie ein angeschossener Hirsch durchs Unterholz brichst! Besser, du kommst ein paar Minuten zu spät, als dass du durch den Lärm alles zunichte machst.
Er blieb stehen, holte ein paarmal tief Luft und nahm den Geruch des zundertrockenen Waldes wahr. Er schwitzte unter seiner dunklen Kleidung. Vor Hitze. Vor Anstrengung. Vor gespannter Erwartung. Und vor Angst.
Er wischte sich die Augen trocken und atmete zur Beruhigung tief durch. Konzentrier dich. Sei bei der Sache. Erlaube dir keinen Fehler. Nicht heute Nacht.
Irgendwo in der Nähe schrie leise eine Eule. Er wertete es als Omen, als gutes Omen. Na schön, er kam zu spät. Damit wurde er fertig.
Hoffentlich.
Als sich sein Puls beruhigt hatte, holte er aus der Tasche seiner enganliegenden Jacke die Skimaske hervor, zog sie hastig über den Kopf und rückte die Öffnungen für Augen und Nase zurecht.
Unter sich sah er das erste Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Gleich darauf ein weiteres.
Taschenlampen.
Sie versammelten sich.
Ihm blieb beinahe das Herz stehen.
Aber es gab kein Zurück, jetzt nicht mehr. Er hatte sich festgelegt. Wie die anderen auch. Es bestand die Möglichkeit, dass er erwischt wurde, dass sie alle erwischt wurden, aber dieses Risiko gingen sie ein.
Er setzte seinen Abstieg fort.
Während der Vollmond höher stieg, legte er die letzte Viertelmeile unter Lebensbäumen und Tannen im Laufschritt zurück. Er zwang sich zur Ruhe, trat um die letzte Wegbiegung auf die Lichtung hinaus, wo die anderen vier warteten.
Alle waren schwarz gekleidet wie er, die Gesichter hinter dunklen Skimasken verborgen. Sie hatten sich mit etwa einem Meter Abstand voneinander in einem Kreis aufgestellt, in dem für ihn eine Lücke blieb. Ihre Blicke ruhten auf ihm, als er seinen Platz einnahm.
»Du kommst zu spät«, flüsterte eine rauhe Stimme. Der Größte der Gruppe starrte ihn an. Der Anführer.
Seine Muskeln verkrampften sich, und er nickte stumm. Es wäre sinnlos gewesen, Entschuldigungen vorzubringen.
»Fehler dürfen nicht passieren. Keine Verzögerungen!«
Mit geneigtem Kopf nahm er die Zurechtweisung hin.
»Mach das nicht noch einmal!«
Die anderen sahen ihn an, ihn, den Übeltäter.
Schließlich richtete die Gruppe ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Anführer. Er war nicht nur größer als die Übrigen, sondern hatte auch eine Aura der Macht an sich, etwas Unbarmherziges – etwas, das Respekt einflößte … und Angst.
»Wir fangen an«, fuhr dieser fort, zumindest für den Augenblick beschwichtigt.
Nach einem letzten Blick in die Runde bückte er sich, ließ sein Feuerzeug aufschnappen und hielt die Flamme an ein Häufchen Zweige, die knisternd Feuer fingen. Kleine Flammen züngelten blitzschnell den vorbestimmten Weg entlang. Der Wind trug den Geruch von brennendem Kerosin mit sich. Ein scharfer Zacken aus feurigem Licht bildete sich heraus, dann ein weiterer, und schließlich war das Symbol, ein brennender Stern auf der Lichtung, vollständig.
»Heute Nacht geht es zu Ende.« Der Anführer richtete sich wieder auf und nahm seinen Platz an einer Spitze des Sterns ein. Die anderen verteilten sich auf die übrigen Zacken, wobei ihre Stiefel dem Feuer gefährlich nahe kamen.
»Schluss!«
»Ist alles vorbereitet?«, fragte die Person zu seiner Rechten zischelnd.
»Ja.« Der Anführer sah auf die Uhr. Obwohl er nur flüsterte, war Befriedigung aus seiner Stimme herauszuhören, sogar Stolz. »Ihr alle wisst, was ihr zu tun habt. Heute Nacht bezahlt Ryan Carlyle für seine Taten. Heute Nacht muss er sterben.«
Das Herz des zu spät Gekommenen setzte einen Schlag aus.
»Moment! Nein! Das ist ein Fehler«, wandte ein anderer aus der Gruppe ein und schüttelte den Kopf, als kämpfte er mit moralischen Skrupeln. »Wir dürfen das nicht tun. Es wäre Mord. Vorsätzlicher Mord.«
»Es ist beschlossene Sache.« Der Anführer blieb fest.
»Aber es muss doch eine bessere Lösung geben.«
»Die Ausführung des Plans hat bereits begonnen. Niemand wird je davon erfahren.«
»Aber …«
»Ich sagte doch bereits, es ist beschlossene Sache.« In dem schneidenden Flüstern lag eine Warnung, keine weiteren Einwände zu erheben.
Aller Augen waren auf denjenigen gerichtet, der den Mut aufgebracht hatte, zu protestieren. Er hielt noch einen Sekundenbruchteil stand, dann ließ er resigniert die Schultern hängen und schwieg.
»Gut. Dann sind wir uns also einig.« Der Anführer warf dem Aufsässigen einen letzten Blick zu, bevor er begann, den einfachen, aber wirkungsvollen Plan zu umreißen, mit dem Ryan Carlyles Leben ein Ende gesetzt werden sollte.
Niemand stellte Fragen.
Sie hatten verstanden.
»Sind wir uns einig?«, vergewisserte sich der Anführer. Alle außer dem Aufsässigen nickten. »Sind wir uns einig?«, fragte der Anführer noch einmal barsch. Nun gab auch der Letzte seinen Widerstand auf und senkte stumm den Kopf.
Der Anführer schnaubte zufrieden, blickte dann der Reihe nach die anderen drei an, die noch immer auf ihren Plätzen an den Zacken des Sterns standen. Dabei ließ er den Blick besonders lange auf dem Verspäteten ruhen.
Weil er ein paar Minuten nach dem vereinbarten Zeitpunkt eingetroffen war? Oder aufgrund eines tiefen, animalischen Misstrauens? Er spürte den Blick des großen Mannes auf sich lasten und erwiderte ihn fest.
»Ihr alle kennt eure Aufgaben. Ich verlange einwandfreie Arbeit.« Niemand erwiderte etwas. »Geht jetzt«, befahl der Anführer. »Jeder einzeln auf dem Weg, auf dem er hergekommen ist. Und sprecht mit niemandem über diese Angelegenheit.«
Inzwischen war das Kerosin verbrannt, und die Flammen des Sterns begannen um sich zu greifen. Die fünf Verschwörer wandten sich vom Feuer ab und verschwanden im Wald.
Auch er folgte dem Befehl. Mit rasend klopfendem Herzen, alle Sinne aufs äußerste geschärft, lief er bergauf, wobei er sich hin und wieder umsah. So angestrengt er auch lauschte, er hörte nichts als seinen eigenen keuchenden Atem und das Seufzen des Windes in den Bäumen.
Er war allein.
Niemand folgte ihm.
Niemand würde je erfahren, was er geplant hatte.
Tief unten auf der Lichtung breitete sich das Feuer inzwischen weiter aus, kroch rasend schnell durch das sommertrockene Gras auf die Bäume zu.
Ihm blieb nicht viel Zeit. Trotzdem wartete er noch, suchte mit Blicken den dunklen Hügel ab. Die Sekunden verstrichen, bis er endlich hörte, wie weit entfernt ein Motor angelassen wurde. Dann, kaum eine Minute später, erwachte noch ein Auto oder Pick-up dröhnend zum Leben.
Los, los, dachte er, sah auf die Uhr und biss sich auf die Unterlippe. Schließlich ertönte das Geräusch eines dritten Motors, kaum hörbar, und verhallte in der Ferne. Gut.
Er wartete darauf, dass auch das vierte Fahrzeug gestartet wurde.
Eine Minute verging.
Er schob seine Skimaske hoch, wischte sich das Gesicht ab und zog sie dann wieder zurecht. Nur für alle Fälle.
Eine weitere Minute verstrich.
Was zum Teufel war da los?
Ein Schauder der Angst kroch ihm über den Rücken.
Keine Panik. Warte ab.
Aber so lange durfte es doch nicht dauern. Sie mussten es doch alle eilig haben, zu fliehen. Zwischen den Bäumen hindurch sah er die höher schlagenden Flammen. Bald würde jemand den Brand entdecken und ihn melden.
Verdammt!
Womöglich hatte der Anführer Argwohn gegen ihn geschöpft. Vielleicht war sein Zuspätkommen ein bedeutend schlimmerer Fehler gewesen, als er gedacht hatte, und jetzt spionierte der Anführer des geheimen Bundes ihm nach.
Mit geballten Fäusten starrte er wachsam in die Dunkelheit.
Bleib ruhig. Noch ist Zeit.
Erneut warf er einen Blick auf die Uhr. Kurz vor halb eins. Und das Feuer dort unten griff um sich, fraß sich prasselnd durchs Unterholz.
Den Brandgeruch in der Nase, lauschte er … Hörte er da ein Motorengeräusch?
Fünf weitere Minuten lang stand er schwitzend da, alle Muskeln angespannt, bereit zur Flucht.
Immer noch nichts.
Scheiße!
Er durfte keine weitere Minute mehr vergeuden, und so entschied er sich, es zu riskieren. Geschmeidig rannte er bergauf in Richtung der kaum noch benutzten Holzfällerstraße hoch oben, doch an einer Weggabelung bog er scharf nach rechts ab und lief quer zum Hang weiter. Allmählich begannen seine Muskeln zu schmerzen. Dann sah er endlich den Abgrund vor sich, eine tiefe Schlucht, die in der Berglandschaft klaffte.
Jetzt war es gar nicht mehr weit. Er konnte es noch schaffen.
Auf Anhieb fand er den großen Baum, der ihm schon früher als Brücke gedient hatte, balancierte vorsichtig über die rauhe Borke und zwischen geknickten Zweigen hindurch zum anderen Rand der Schlucht. Tief unten breitete das Feuer sich immer weiter aus, der Rauch stieg in dichten Wolken in den dunklen Nachthimmel.
Schnell!
An der Baumwurzel angelangt, sprang er ab und folgte unbeirrt einem Weg, der zu einem mannshohen Felsbrocken führte. Fünf Schritte oberhalb davon fand er einen vom Blitz gespaltenen und geschwärzten Baum, der aussah, als hätte Gott selbst ihn entzweigeschlagen.
Und am Stamm dieses Baumes stand sein Opfer.
An Händen und Füßen gefesselt, an die eine Hälfte des gespaltenen Baumstamms gebunden, den Mund zugeklebt, so wartete sein Gefangener auf ihn.
Er knipste die Taschenlampe an, sah, dass sich der Mann bei dem Versuch, sich zu befreien, die Handgelenke an den Fesseln blutig gescheuert hatte.
Vergebens.
»Die Information war richtig«, sagte er zu seinem Opfer, das die Augen weit aufriss. Schweiß lief dem Mann übers Gesicht. Er blickte wild um sich, als hoffte er auf Rettung. »Sie wollen Blut sehen.«
Der Gefesselte stieß unverständliche Laute aus.
»Dein Blut.«
Der Gefangene bäumte sich auf, zerrte an seinen Fesseln. Sein Peiniger empfand einen Anflug von Mitleid. Die Laute wurden schriller, als wollte der Gefesselte um sein erbärmliches Leben feilschen. Seine Augen traten hervor, und er schüttelte wild den Kopf. Nein! Nein! Nein! Als sei all das ein entsetzlicher Irrtum.
Doch was geschehen sollte, war ein Akt der Gerechtigkeit. Die Aussicht darauf wärmte ihm das Blut, jagte ihm Adrenalin in die Adern. Langsam zog er eine Zigarettenschachtel aus der Hosentasche. Er klopfte eine Filterzigarette heraus und steckte sie lässig zwischen die Lippen, während der armselige an den Baum Gefesselte voller Grauen zusah.
»O ja, sie wollen Ryan Carlyle noch heute Nacht tot sehen«, sagte er und zündete sich die Marlboro an, wobei er die Flamme mit der hohlen Hand vor dem Wind schützte. Papier und Tabak flammten kurz auf. Er atmete den Rauch tief ein, schmeckte ihn und spürte ihn in der Lunge.
Der Gefangene wand sich, trat mit weit aufgerissenen Augen und unter erstickten Angstlauten um sich. Blut rann von seinen Handgelenken.
»Und weißt du was? Ich will ihn auch tot sehen. Aber auf meine eigene Weise.« Der Gedanke an Ryan Carlyles Ableben und dessen Auswirkungen erfüllte ihn mit einem beinahe friedvollen Gefühl.
Sein Opfer wand und krümmte sich wie von Sinnen. Die Laute, die es ausstieß, klangen jetzt nicht mehr flehentlich oder verängstigt, sondern wütend. Und noch immer zerrte der Mann an den Fesseln, als glaubte er, sich retten zu können.
Zu spät.
Die Entscheidung war gefallen.
Sein Peiniger griff erneut in seine Tasche und zückte eine Spritze. Die Zigarette zwischen den Lippen, drückte er leicht den Kolben, so dass ein wenig klare Flüssigkeit aus der Hohlnadel austrat.
Der Gefangene war so fest an den Baumstamm gefesselt, dass es kein Problem war, ihm die Nadel in den bloßen Arm zu stechen. Anschließend trat er zurück und wartete darauf, dass die Droge Wirkung zeigte. Er sah zu, wie die Augen seines Opfers glasig und seine Bewegungen matter wurden. Schließlich hörte der Gefangene auf, sich gegen seine Fesseln zu wehren, und sah seinen Peiniger nur noch mit grenzenlosem Hass an.
Es war an der Zeit.
»Adios«, sagte er leise und ließ die brennende Zigarette auf den ausgetrockneten Waldboden fallen. Sofort glommen die Tannennadeln auf, und im nächsten Moment brannten das trockene Laub und die dürren Zweige leuchtend rot. Die Flammen folgten einer sorgfältig gelegten Spur rund um den Baumstamm.
Knack!
Ein kleiner Ast fing Feuer.
Zisch!
Ein Büschel Moos ging in Flammen auf.
Träge stieg der Rauch zum Himmel, während die Flammenspur den Baum umrundete. Er trat weiter zurück. Der Kopf des Gefangenen fiel schlaff zur Seite.
»Tut mir leid, Carlyle«, sagte er und schüttelte den Kopf, als der Mann wie in Zeitlupe ein letztes Mal versuchte, seine Fesseln zu zerreißen, Seile aus Naturfaser, die zu Asche zerfallen und der Polizei keinen Anhaltspunkt bieten würden, da sie aus dem gleichen Material bestanden wie die Kleidung des Opfers. Nichts würde darauf hindeuten, dass der Mann gefesselt und an den Baum gebunden worden war, und selbst die Droge würde schon bald nicht mehr nachweisbar sein.
Er trat noch ein paar Schritte zurück, um sein Opfer durch die höher werdende Wand knisternder, gieriger Flammen hindurch zu betrachten. »Das war’s«, sagte er mit tiefer Befriedigung. »Du bist ein toter Mann.«
1.Kapitel
Drei Jahre später
Hilfe!«, schrie sie, doch ihre Stimme versagte.
Von Angst getrieben, rannte sie mit bleischweren Beinen durch den Rauch und die Hitze. Rings umher tobte der Waldbrand. Sengende Höllenflammen loderten zum Himmel auf. Der Rauch war so dicht, dass er ihr fast den Atem verschlug, und der Brandgeruch stach in ihrer Nase. Ihre Lunge brannte. Ihre Augen tränten, die Haut warf Blasen.
Überall um sie herum stürzten verkohlte Äste zu Boden, splitterten krachend, während sie weiterlief. Funkenregen prasselte nieder und versengte ihre Haut.
»O Gott!«
Ihr war, als sei sie in den Höllenschlund gestürzt.
»Hilfe«, versuchte sie noch einmal zu schreien, doch kein Laut kam über ihre Lippen. »Bitte, hilf mir doch jemand!«
Aber sie war allein.
Dieses Mal war niemand in der Nähe, um ihr zu helfen.
Auch ihre Brüder, die sonst immer schnell zur Stelle waren, konnten sie jetzt nicht retten.
Oh, lieber Gott.
Lauf, verdammt noch mal! Beweg dich! Raus hier, Shannon! Schnell!
Sie stürzte vorwärts, stolperte, wäre beinahe gefallen, das Feuer eine tobende Bestie mit heißem, stinkendem Atem, die mit knisternden Armen nach ihr griff, sie umfing, ihre Haut verbrannte.
Als sie schon glaubte, sie müsste in den Flammen sterben, wich das Feuer unvermittelt mit einem letzten Fauchen zurück und verschwand. Der schwarze Rauch verwandelte sich in dichten, weißen Nebel, und plötzlich lief sie über Felder voller glühender Asche. In der Luft lag der stechende Geruch von verbranntem Fleisch. Der Boden war eine endlose, ausgedörrte Wüste.
Und überall lagen Knochen.
Aufgetürmte Haufen angekohlter, ausgebleichter Knochen.
Zahllose Gerippe, alle mit Asche bedeckt.
Katzen. Hunde. Pferde. Menschen.
In ihrer Vorstellung nahmen die Skelette die Gestalt ihrer Verwandten an, die Schädel schienen Gesichter zu bekommen. Ihre Mutter. Ihr Vater. Ihr Kind.
Bei dem Gedanken an ihr Kind durchfuhr sie ein heftiger Schmerz.
Nein! Nein! Nein!
Es waren doch nur Skelette.
Niemand, den sie kannte.
Das konnte nicht sein.
Der Geruch nach Tod und dem ausbrennenden Feuer stach ihr in der Nase.
Sie wollte sich abwenden, flüchten, doch sie konnte keinen Schritt tun, ohne über die verstreuten Knochen zu stolpern. Sie stürzte, und unter ihrem Gewicht zerbrachen die Skelette. In Panik, wild um sich schlagend, versuchte sie, sich aufzurappeln, den schaurig knackenden Gerippen zu entkommen.
Rrrring.
Eine Sirene schrillte. Wie aus weiter Ferne.
Ihr Herz machte einen Satz. Da kam jemand!
Sie drehte sich um und sah, wie sich eines der Skelette bewegte, den grotesken, halbverbrannten Kopf wandte, um sie anzusehen.
Fetzen von verkohltem Fleisch hingen von den Wangenknochen, der Großteil des schwarzen Haares war verbrannt, die Augen waren tief in die Höhlen gesunken, doch es waren Augen, die sie erkannte, Augen, denen sie vertraut hatte, Augen, die sie einmal geliebt hatte. Und sie starrten sie an, blinzelten und bezichtigten sie stumm unaussprechlicher Verbrechen.
Nein, dachte sie panisch. Nein, nein, nein!
Wie konnte etwas so Grässliches lebendig sein?
Sie schrie, doch wieder versagte ihre Stimme.
»Ssshannon …«, zischte die Stimme ihres Mannes boshaft. Trotz der Hitze überlief sie eine Gänsehaut. »Ssshannon.« Es war, als würde sein Gesicht Form annehmen, das verkohlte Fleisch sich glätten, sich über die Knochen legen, als würden Nasenknorpel sich bilden, und die eingesunkenen Augen sahen sie starr an.
Sie versuchte noch einmal zu schreien.
Rrrring! Die Sirene. Nein – ein Telefon.Ihr Telefon.
Shannon fuhr hoch. Schweißgebadet und mit wild klopfendem Herzen saß sie aufrecht im Bett. Es war dunkel, sie befand sich in ihrem Zimmer unter dem Dach ihres kleinen Hauses. Überwältigt von Erleichterung schluchzte sie auf. Es war ein Traum. Nur ein Traum. Nein, ein böser, perverser Albtraum.
Neben ihr auf dem Boden gab der Hund mürrisch Laut.
Wieder schrillte das Telefon.
»Jesus, Maria und Josef«, flüsterte sie – der Schreckensruf ihrer Mutter, den sie selbst nur selten benutzte. »Was ist nur los mit mir?« Sie strich sich das wirre Haar aus den Augen und atmete zitternd aus. Es war heiß im Zimmer, nicht der Hauch einer frischen Brise bewegte die Sommerluft. Sie warf die verschwitzte Bettdecke von sich, keuchend, als hätte sie einen Marathonlauf hinter sich. »Ein Traum«, ermahnte sie sich selbst. Ein Druck hinter den Augen kündigte Kopfschmerzen an. »Nur wieder so ein verdammter Traum.«
Mit klopfenden Herzen nahm sie den Hörer ab. »Hallo?«
Keine Antwort.
Nur Stille … und dann doch etwas … leise Atemgeräusche?
Sie warf einen Blick auf den Wecker auf ihrem Nachttisch: 0:07 stand da in rot leuchtenden Digitalziffern, groß genug, dass sie sie ohne Kontaktlinsen erkennen konnte. »Hallo!«
Sie war plötzlich hellwach.
Hastig schaltete sie die Nachttischlampe an. Wer rief sie so spät nachts an? Was hatte ihre Mutter immer gesagt? Nach Mitternacht passiert nichts Gutes. Ihr Herz raste. Sie dachte an ihre alten, gebrechlichen Eltern. Sollte ihnen etwas zugestoßen sein? War jemand aus ihrer Familie verletzt? Verschwunden? Oder Schlimmeres?
»Hallo?«, rief sie noch einmal lauter. Dann wurde ihr klar: Wenn etwas passiert wäre und die Polizei oder einer ihrer Brüder sie anriefe, hätte derjenige sich gleich gemeldet. »Wer ist da?«, fragte sie energisch und überlegte, ob ihr vielleicht jemand einen üblen Streich spielte.
»Hören Sie, wenn Sie sich nicht endlich melden, lege ich auf.« Immer noch hörte sie leise rasselndes, schweres Atmen. »Schön! Wie Sie wollen.« Sie knallte den Hörer auf die Gabel. »Blödmann«, knurrte sie leise und konnte sich nicht einmal damit trösten, dass der unbekannte Anrufer sie aus ihrem schrecklichen Albtraum erlöst hatte.
Verdammt, er war so lebensecht gewesen. So greifbar. So beunruhigend. Immer noch schwitzte sie, hatte Gänsehaut, glaubte den Rauch noch zu riechen. Sie fuhr sich mit der Hand über die Augen, atmete tief durch und schob die Bilder energisch von sich. Es war ein Traum, nichts weiter. Sie griff wieder nach dem Telefon und ließ sich die Rufnummern der letzten Anrufer anzeigen. Die Nummer des allerletzten, um 0:07 Uhr, war unterdrückt. Kein Name, keine Nummer.
»Natürlich«, brummte sie und versuchte das Unbehagen abzuschütteln. Es waren nur gelangweilte Kids, die wahllos irgendwelche Nummern anriefen. Oder? Stirnrunzelnd starrte sie den Hörer an. Wer sonst hätte es sein können?
Ihr Hund Khan, eine Promenadenmischung mit einem sichtbaren Anteil von Australischem Schäferhund in seinem gescheckten Fell und den unterschiedlichen Augen, bellte noch einmal leise. Er blickte von seinem Platz auf dem Bettvorleger hoffnungsvoll zu ihr empor und klopfte mit dem Schwanz auf den Holzfußboden, als erwartete er, dass sie ihn zu sich ins Bett ließ.
»Bist du verrückt?« Sie wälzte sich herum und kraulte ihn hinter einem Ohr. »Es ist Mitternacht, und du und ich, wir brauchen beide unseren Schlaf. Also komm nicht auf die Idee, aufs Bett zu springen, okay? Ich muss mir nur noch etwas gegen diese Kopfschmerzen holen.« Sie stand auf und ging barfuß ins Bad.
Als sie den engen Raum betrat, hörte sie, wie Khan mit einem dumpfen Aufprall aufs Bett sprang. »Runter!«, befahl sie und schaltete das Licht ein. Sie hörte, wie der Hund wieder auf dem Boden landete. »Untersteh dich, Khan.«
Du bist eine schöne Hundetrainerin, dachte sie, strich sich das Haar aus dem Gesicht und fasste eine Handvoll ihrer Locken. Du bringst Such- und Rettungshunde in Katastrophengebiete, brennende Gebäude und sogar ins Wasser, aber diesen Köter kannst du nicht mal von deinem Bett fernhalten.
Sie beugte sich über das Waschbecken, drehte mit der freien Hand das Wasser auf und trank direkt aus dem Hahn. Das Wasser spritzte in ihr erhitztes Gesicht, während die Reste des Albtraums immer noch in einem Winkel ihres Bewusstseins rumorten.
Nur nicht mehr daran denken!
Ryan war seit drei Jahren tot, und in dieser Zeit war sie des Mordes an ihm beschuldigt und freigesprochen worden. »Zeit, darüber hinwegzukommen«, ermahnte sie sich, nahm ein Handtuch von der Stange und trocknete sich Gesicht und Dekolleté ab. Ihr Therapeut hatte versichert, dass die Albträume allmählich nachlassen würden.
Bisher hatte sich das nicht bestätigt. Sie blickte in den Spiegel des Medizinschranks über dem Waschbecken und zuckte zusammen. Dunkle Schatten umgaben ihre geröteten Augen. Das kastanienbraune Haar war zerzaust und wirr vom unruhigen Schlaf. Feuchte Locken klebten an ihrer Haut, um Lippen und Augenwinkel zeichneten sich feine Sorgenfältchen ab.
»Das Gesicht eines Engels mit dem Mundwerk des Teufels«, hatte ihr Bruder Neville einmal nach einem besonders heftigen Streit gesagt, als sie etwa vierzehn war.
Aber nicht heute Nacht, dachte sie säuerlich, nahm einen Waschlappen aus einem offenen Regal, hielt ihn unter den Wasserstrahl und tupfte sich das Gesicht damit ab.
Neville. Er fehlte ihr immer noch entsetzlich, und wann immer sie an ihn dachte, krampfte sich ihr Herz schmerzlich zusammen. Da Neville sieben Minuten nach seinem Zwillingsbruder Oliver das Licht der Welt erblickt hatte, war er ihr, Shannon, genau genommen altersmäßig am nächsten, denn sie war als das letzte von Patrick und Maureen Flannerys sechs Kindern knapp zwei Jahre später geboren worden. Wenngleich Oliver und Neville als Zwillinge einander auf besondere Weise verbunden waren, hatte doch auch sie sich Neville so nahe gefühlt wie sonst keinem ihrer Geschwister.
Jetzt hätte sie Neville gern an ihrer Seite gehabt. Er hätte ihr das Haar gezaust, schief gelächelt und gesagt: »Du machst dir zu viele Sorgen, Shannon. Es war nur ein Traum.«
»Und ein Anruf«, hätte sie eingewandt. »Ein gruseliger Anruf.«
»Jemand hat sich verwählt.«
»Mitten in der Nacht?«
»Hey, irgendwo auf der Welt ist schon längst Morgen. Beruhige dich.«
»Klar«, murmelte sie leise. Als ob das so einfach wäre. Sie hielt den Waschlappen noch einmal unters Wasser, wrang ihn aus und legte ihn sich in den Nacken. Das Pochen in ihrem Hinterkopf wurde stärker. Im Medizinschrank fand sie ein Röhrchen Ibuprofen, schüttelte zwei Tabletten in ihre Handfläche und nahm sie mit einem weiteren großen Schluck Wasser aus dem Hahn ein. Ihr Blick fiel auf das Röhrchen mit den Schlaftabletten im Regal unter dem Spiegel, die Dr. Brennan ihr vor drei Jahren verschrieben hatte. Kurz erwog sie, ein paar zu schlucken. Aber morgen früh – nein, später an diesem Morgen – konnte sie es sich nicht leisten, benommen oder träge zu sein. Sie hatte Trainingsstunden mit mehreren neuen Hunden angesetzt und sollte außerdem den Kaufvertrag für ihr neues Haus unterschreiben, eine größere Ranch. Zwar würden bis zum Umzug noch Wochen vergehen, aber der Vertrag war bereits ausgehandelt.
Bei dem Gedanken an das Gut, das sie erwerben wollte, stiegen andere Sorgen in ihr auf. Erst letzte Woche, als sie die Grundstücksgrenze abschritt, hatte sie das Gefühl gehabt, dass sich jemand hinter den knorrigen Stämmen der schwarzen Eichen versteckte und sie beobachtete. Selbst Khan war ihr an diesem Tag gereizt erschienen. Nervös.
Hör auf damit, wies sie sich selbst zurecht. Im Gegensatz zu den meisten Hunden, die sie abrichtete, zeichnete sich Khan nicht unbedingt durch ein sicheres Gespür aus. Niemand war ihr gefolgt, niemand hatte sie beobachtet. Sie befand sich schließlich nicht in irgendeinem Horrorfilm, verflixt noch mal. Außer ihr war niemand dort gewesen.
Der Grund für ihre Nervosität war einfach, dass sie ihr gesamtes Erbe und all ihre Ersparnisse in die neue Ranch investierte. Wer wäre da nicht ein wenig angespannt gewesen? Ihre Brüder waren gegen den Plan und nahmen kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, sie auf das Ausmaß ihres Fehlers hinzuweisen.
»Das hätte Dad nicht gewollt«, hatte Shea ihr bei seinem letzten Besuch vorgehalten. Er stand auf der Veranda, rauchte eine Zigarette und sah sie an, als hätte sie den Verstand verloren. »Dad hat sein Leben lang gespart, jeden Cent dreimal umgedreht und klug investiert, und es würde ihm nicht gefallen, dass du deinen Anteil am Erbe für eine heruntergekommene, zugewucherte Farm vergeudest.«
»Du hast sie noch nicht einmal gesehen«, konterte Shannon unbeirrt. »Und komm mir nicht mit solchen Sentimentalitäten. Dad hatte immer Vertrauen in meine Entscheidungen.«
Shea bedachte sie mit einem düsteren, schwer zu deutenden Blick und sog heftig an seiner Zigarette. Er schien zu finden, dass sie ihren Vater überhaupt nicht gekannt hatte.
»Dad hat mir immer den Rücken gestärkt«, setzte sie hinzu, nun doch ein wenig verunsichert.
»Ich will’s dir ja nur sagen.« Er blies den Rauch aus und warf die Kippe in den staubigen Kies des Platzes, der das Haus von den Scheunen und den anderen Wirtschaftsgebäuden trennte. »Gib acht, Shannon, auf dein Geld und auf dich selbst.«
»Was soll das denn nun wieder heißen?«
Die Kippe glühte noch, ein dünner Rauchfaden stieg von ihr auf.
»Nur, dass du manchmal etwas ungestüm bist.« Er legte den Kopf schief und zwinkerte ihr zu. »Du weißt schon. Das gehört zum Fluch der Flannerys.«
»Hör auf damit. Das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Eben Moms Art, es Dad heimzuzahlen. Der Fluch der Flannerys – dass ich nicht lache.«
Er zog eine dunkle Augenbraue hoch. Eine Sekunde lang sah er aus wie eine dieser Teufelskarikaturen mit wissend-lüsternem Grinsen und hochgezogenen Brauen. »Ich meine ja nur.«
»Sag, was du willst, ich kaufe die Ranch und damit basta.«
Jetzt, eine Woche später, gingen ihr Sheas Worte erneut durch den Kopf. Sie hatten fast wie eine Warnung geklungen.
Und Shea war nicht der Einzige, der sie warnte. Ganz und gar nicht! Auch ihre anderen Brüder hatten sie im Lauf der letzten Wochen bedrängt, erwachsene Männer, die sich offenbar einbildeten, sie noch immer unter ihre Fittiche nehmen zu müssen. Sie schnaubte verächtlich. Robert hatte ihr geraten, ihr Geld lieber auf die Bank zu bringen, dabei würde es dort nur geringe Zinsen einbringen. Robert! Dem Mann rann sein Erbteil durch die Finger wie Wasser. Er hatte sich einen Sportwagen gekauft und steckte so tief in der Midlife-Crisis, dass er sogar Frau und Kinder verlassen wollte. Und Aaron, ihr ältester Bruder, hatte bereits einen Teil seines Geldes bei Spekulationen an der Börse verloren. Ganz zu schweigen von der Woche in Reno, wo er Gerüchten zufolge dreißigtausend Dollar am Black-Jack-Tisch gewonnen und wieder verspielt hatte. Sein anfängliches Glück hatte nicht angehalten, und Aaron reagierte seitdem empfindlich auf dieses Thema.
Dann war da noch Oliver, der sein gesamtes Geld Gott und der Kirche vermachte. Natürlich, dachte Shannon stirnrunzelnd und fragte sich, ob sein religiöser Fanatismus etwas mit ihr zu tun hatte. Das schlechte Gewissen nagte an ihr, als sie daran dachte, wie Oliver nach dem Unfall, als Ryan ums Leben gekommen und Neville kurz darauf verschwunden war, ultrareligiös wurde. Er hatte sogar die Priesterlaufbahn eingeschlagen und sollte bald die Weihe empfangen. Welche Rolle sie in seiner Bekehrung zum Glauben spielte, blieb unklar. Jedenfalls hatte die Tatsache, dass sie des Mordes an ihrem Mann bezichtigt wurde, dazu beigetragen.
Shannon schüttelte die Gedanken ab, wollte sich nicht auf dieses vertraute, aber bedrohliche Terrain begeben.
Sie vermutete, dass ihr Bruder Shea mit seinem Erbteil umsichtig wirtschaftete. Er war ja immer vorsichtig – in finanziellen Angelegenheiten ebenso wie überhaupt in seinem Leben. Shea war in sich gekehrt, nicht leicht aus der Reserve zu locken, aber immer bereit zurückzuschießen, und wenn nötig, kämpfte er mit harten Bandagen.
Wie kamen ihre Brüder dazu, ihr kluge Ratschläge geben zu wollen? Sie konnten ihre Pläne schlechtreden, so viel sie wollten, Shannon würde doch tun, was sie selbst für richtig hielt. Sie war mindestens so starrsinnig wie die vier.
Wahrscheinlich lag es an der negativen Einstellung ihrer Brüder, dass sie so nervös war, als sie sich das letzte Mal auf dem überwucherten Grundstück aufhielt.
Aber warum war sie nur plötzlich so besorgt? Konnte nicht schlafen, fürchtete sich vor ihrem eigenen Schatten, schreckte nachts aus grauenhaften Albträumen auf?
Sie verzog das Gesicht und ließ den Waschlappen ins Becken fallen. Vielleicht war es Zeit, mal wieder ihren Therapeuten aufzusuchen. Vor einem Jahr hatte sie sich so gefestigt gefühlt, dass sie die wöchentlichen Sitzungen, mit deren Hilfe sie Ordnung in ihr Leben gebracht hatte, beendete.
Auch wenn ihr die Vorstellung nicht behagte – vielleicht gehörte sie ja zu den Menschen, die nicht dauerhaft ohne therapeutische Unterstützung zurechtkamen.
»Toll«, murrte sie.
Himmel, es war heiß. Die ganze Woche über hatte die Temperatur sich um 38 Grad bewegt, und selbst nachts war sie selten unter 25 Grad gesunken. Das Tagesgespräch im Ort drehte sich um die bedrohliche Dürre und natürlich um die ständig wachsende Waldbrandgefahr.
Shannon vermied es, noch einmal in den Spiegel zu sehen. »Am Morgen siehst du besser aus«, redete sie sich zu, doch insgeheim fragte sie sich, ob sämtliches Make-up dieser Welt ausreichen würde, um ihr ein frisches Aussehen zu verleihen. Und wenn sie in wenigen Stunden die Kontaktlinsen einsetzen wollte, würde sie Unmengen Augentropfen benötigen.
Um den schalen Geschmack im Mund loszuwerden, massierte sie sich etwas Zahnpasta ins Zahnfleisch und spülte dann den Mund aus. Als sie mit Kraft den Hahn zudrehte, hörte sie die alten Leitungen unwillig ächzen. Immer noch hatte sie den stechenden Geruch von Feuer und Rauch in der Nase.
Sie trocknete sich den Mund ab und fragte sich, was sie gegen diesen Geruch tun sollte.
In diesem Augenblick hörte sie Khan knurren. Leise. Warnend.
Das Handtuch noch in der Hand, blickte sie durch die geöffnete Tür und erkannte den graubraunen Schatten des Hundes, der erneut aufs Bett sprang.
»Was zum Kuckuck …?« Shannon sah aus dem Fenster, und mit einem Schlag begriff sie: Der Rauchgeschmack in Nase und Rachen wollte nicht weichen, weil er mehr war als nur die Nachwirkung ihres Traums. Er war echt.
Ihr Herz drohte stehen zu bleiben. Sie rannte den Flur entlang. Khan hatte das Fell gesträubt und begann wild zu bellen.
Herrgott, was war da nur los?
Angst kroch ihr über den Rücken. Sie spähte durch das Insektenschutzgitter und sah nichts als dunkle Nacht. Eine schmale Mondsichel war über den Hügeln aufgegangen und erhellte die zwei Hektar jenseits der Grenze ihres Besitzes: eine Fläche dürrer, unkrautüberwucherter Wiesen, die als Bauland erschlossen werden sollten. Ein trockener Wind fegte plötzlich von Osten her durch das Tal, rüttelte an den Ästen der Bäume beim Haus und raschelte im verdorrten Laub.
Alles schien in Ordnung zu sein.
Bis auf den Geruch.
Shannons Angst wuchs.
Wieder knurrte Khan in Richtung des offenen Fensters. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass im Lampenlicht die Silhouette ihres Körpers zu sehen war. Sie schaltete das Licht aus und tastete in ihrer Nachttischschublade nach der Brille. Dabei suchte sie mit dem Blick die Umgebung ab. Nichts zu sehen … oder doch, dort bei der Südweide – war da nicht ein Glimmen? O Gott. Ihr Hals schnürte sich zu. Endlich fand sie die Brille, stieß in ihrer Hast, sie aus dem Etui zu nehmen, die Nachttischlampe um. Dann blickte sie wieder hinaus in die Dunkelheit.
Das Glimmen war verschwunden. Kein Lichtschein war zu sehen, nirgendwo Flammen … Aber der schwache Rauchgeruch blieb. Sie schmeckte ihn auf der Zunge.
Brannte es womöglich im Haus?
Aber warum schaute der Hund dann zum Fenster?
Sie griff zum Telefon, um Nate Santana anzurufen, der über der Garage wohnte. Doch dann fiel ihr ein, dass er für eine Woche verreist war, sein erster Urlaub seit Jahren. »Verdammt.« Sie biss die Zähne zusammen. Sonst fiel ihr niemand ein, den sie mitten in der Nacht hätte anrufen können. Nicht einmal ihre Brüder, die sie auch drei Jahre nach dem Vorfall immer noch für etwas wunderlich hielten.
Sie eilte über den Holzfußboden zu dem Erker auf der anderen Seite des Zimmers. Vorsichtig spähte sie aus dem Fenster, von wo aus sie den gekiesten Platz vor dem Haus und die Scheunen, Zwinger und Schuppen überblicken konnte. Im gespenstisch fahlen Licht der Sicherheitslampen sah sie nichts Ungewöhnliches, nichts, was erklärt hätte, warum der Hund knurrte.
Vielleicht hat Khan eine Eule oder eine Fledermaus gehört.
Oder ein Reh oder einen Waschbären draußen auf der Wiese gewittert.
Und du selbst bist einfach überreizt durch den bösen Traum und den merkwürdigen Anruf …
All das erklärte jedoch nicht den Rauchgeruch. »Komm«, sagte sie zu dem Hund. »Wir sehen mal nach.« Ohne Licht zu machen lief sie die Treppe hinunter. Plötzlich stürmte Khan an ihr vorbei, wobei er sie beinahe umriss, und lief zielstrebig zur Haustür. In dem kleinen Eingangsflur blieb er stehen und reckte die Nase witternd in Richtung der Tür, sämtliche Muskeln angespannt.
Aber Shannon ließ sich von ihm nicht mehr täuschen.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und lugte durch die kleine Glasscheibe in der Eichentäfelung der Haustür. Es war still draußen, der Wind hatte sich rasch wieder gelegt. Ihr Pick-up stand vor der Garage, dort, wo sie ihn abgestellt hatte, die Schuppen und Scheunen waren verschlossen, der Platz vor dem Haus leer. In den Fenstern von Nates Wohnung über der Garage brannte kein Licht.
Siehst du? Du hast dir mal wieder etwas eingebildet.
Khan stand regungslos bei der Tür und winselte. »Falscher Alarm«, sagte sie und schalt sich selbst im Stillen einen Feigling.
Aber seit wann war sie ein Feigling? Wann hatte sie ihre Abenteuerlust verloren? Sie, die mit so vielen älteren Brüdern aufgewachsen war, die sich nie hatte einschüchtern lassen, sondern alles mitgemacht hatte, was die Jungen unternahmen – wann war sie zum Angsthasen geworden?
Shannon war in dieser Gegend aufgewachsen. Als Kind war sie ein richtiger Wildfang gewesen. Angst war ihr nahezu unbekannt. Noch vor ihrem vierten Geburtstag konnte sie ohne Stützräder Fahrrad fahren, und als sie achtzehn war, fuhr sie auf der Harley ihres ältesten Bruders über den Highway 101 in Richtung Süden, die ganze wilde Küste Kaliforniens entlang. Als Kind war sie ohne Sattel geritten, hatte auf dem Rodeo sogar am Fasslaufen teilgenommen. Mit fünfzehn war sie heimlich mit zwei Freundinnen zu einem Open-Air-Konzert zum Red Rocks Amphitheater bei Denver getrampt. Später hatte sie am Steuer von Roberts neuem Mustang Cabrio einen Unfall überlebt. Der Wagen landete mit dem Kühler voran im Graben, ein Totalschaden. Sie selbst war mit einem gebrochenen Schlüsselbein, einem verstauchten Handgelenk, zwei blauen Augen und einem angeschlagenen Ego davongekommen und hegte den Verdacht, dass Robert ihr den Vorfall nie verziehen hatte.
Kein Wunder, dass es dann, als sie sich verliebte, ebenso stürmisch zuging. Sie war Feuer und Flamme gewesen und hatte keine Sekunde lang für möglich gehalten, dass aus dieser Liebe etwas anderes als reines Glück entstehen würde.
»Idiot«, murmelte sie bei dem Gedanken an Brendan Giles, ihre erste Liebe. Wie dumm und unbedacht sie gewesen war, und später dann am Boden zerstört, als das dicke Ende kam …
Um die düsteren Gedanken zu vertreiben, öffnete sie den Kühlschrank und kramte hinter einem Sechserpack Cola light eine Flasche Mineralwasser hervor.
Als sie die Tür schloss, war es wieder dunkel in der Küche. Sie lehnte sich an die Arbeitsplatte und drückte die kalte Flasche an ihre Stirn. Der Schweiß lief ihr den Rücken hinunter.
Eine Klimaanlage. Das war es, was sie brauchte. Eine Klimaanlage und eine Einrichtung, die verhinderte, dass irgendwelche Idioten sie mitten in der Nacht anriefen.
Khan gab endlich seinen Posten bei der Tür auf, trabte an Shannon vorbei und scharrte an der Hintertür. Sein Nackenfell war nicht mehr gesträubt. Er drehte sich mit flehentlichem Blick zu ihr um, als könne er es kaum noch erwarten, endlich hinausgelassen zu werden und am nächstbesten Gebüsch sein Bein zu heben.
»Klar, warum nicht?«, sagte Shannon. »Tob dich ruhig aus.« Die Flasche noch immer an die Stirn gedrückt, entriegelte sie die Hintertür. »Aber lass das bitte nicht zur Gewohnheit werden. Schließlich ist es nach Mitternacht.« Khan schlüpfte blitzschnell hinaus, und sie folgte ihm in der Hoffnung auf eine erfrischende Brise.
Doch die Nacht war heiß und still.
Atemlos.
Shannon trat auf die Veranda hinaus, da fiel ihr Blick auf etwas, was dort nicht hingehörte: ein Blatt Papier, an einen der Pfosten geheftet, die das Vordach stützten. Gänsehaut lief ihr über den Rücken. Aber vielleicht hatte es mit dem Zettel gar nichts weiter auf sich, vielleicht hatte ihr nur jemand eine Nachricht hinterlassen.
Mitten in der Nacht? Warum hat derjenige nicht stattdessen angerufen?
Das Blut drohte ihr in den Adern zu stocken. Vielleicht war der Anrufer von vorhin ja derjenige, der das Papier an den Pfosten geheftet hatte.
Sie trat zurück und tastete durch die Küchentür mit einer Hand nach dem Lichtschalter. Im nächsten Moment war die Veranda von zwei Glühbirnen hell erleuchtet.
Shannon blieb wie angewurzelt stehen und starrte auf das Blatt. Bei dem Anblick wurde ihr flau im Magen. Das Papier war angesengt, die Ränder schwarz und gewellt. Jemand hatte es mit einer grünen Reißzwecke an den Pfosten gepinnt.
Das Blut rauschte ihr in den Ohren. Als sie näher heranging, erkannte sie, dass es sich offenbar um eine Art Formular handelte. Sie rückte ihre Brille zurecht und las die teilweise vom Feuer unkenntlich gemachten Worte, die in der Mitte des Dokuments noch sichtbar waren.
Name der Mutter: Shannon Leah Flan…
Name des Vaters: Brendan Giles
Sie rang nach Luft.
Ihr Atem stockte.
Geburtsdatum:23.Septemb…
Uhrzeit:00.07 Uhr
»Nein!«, schrie sie, ließ die Wasserflasche fallen und hörte wie aus weiter Ferne, wie sie von der Veranda rollte. 23.September! Ihre Gedanken überschlugen sich. Morgen. Nein, es war ja bereits nach Mitternacht, also war heute der 23.September, und der Anruf … O Gott, der Anruf war um Punkt 0.07 Uhr gekommen. Ihre Knie drohten nachzugeben, sie lehnte sich gegen das Verandageländer und starrte in die Dunkelheit, als könne sie denjenigen sehen, der ihr das antat, der all den Schmerz wieder wachrufen wollte. »Du Mistkerl«, stieß sie mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Trotz der heißen Nacht fror sie bis ins Mark.
Vor dreizehn Jahren, am 23.September, um genau sieben Minuten nach Mitternacht hatte Shannon ein dreitausendzweihundert Gramm schweres Baby zur Welt gebracht.
Sie hatte das Kind danach niemals wiedergesehen.
2.Kapitel
Er stand am Feuer, spürte die Hitze und lauschte dem Prasseln der Flammen, die das zundertrockene Kleinholz verzehrten. Sämtliche Vorhänge waren geschlossen. Langsam knöpfte er sein Hemd auf. Moos fing Feuer, zischte, sprühte Funken, während das blütenweiße Hemd von seinen Schultern glitt.
Über dem Kaminsims war ein Spiegel angebracht. Darin sah er sich selbst beim Auskleiden zu, betrachtete seinen perfekt geformten Körper, dessen Muskeln sich geschmeidig unter seiner straffen Sportlerhaut abzeichneten.
Er blickte in seine Augen. Blau. Eisig. Eine Frau hatte sie als ›Schlafzimmeraugen‹ bezeichnet, eine andere als ›kalte Augen‹, wieder eine andere ahnungslose Frau hatte gesagt, es seien ›Augen, die zu viel gesehen haben‹.
Sie alle hatten recht, dachte er und lächelte. Ein ›mörderisches Lächeln‹, wie er einmal zu hören bekommen hatte.
Bingo.
All diese Frauen ahnten nicht, wie nahe sie der Wahrheit gekommen waren.
Er sah gut aus und war sich dessen bewusst. Nicht so gut, dass man sich auf der Straße nach ihm umdrehte, aber doch interessant genug, dass Frauen, die ihn einmal angesehen hatten, nicht leicht wieder wegschauen konnten.
Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte er die freie Auswahl gehabt und konnte fast jede Frau bekommen, die er wollte.
Er öffnete die Schnalle seines Ledergürtels und ließ ihn auf den Holzfußboden fallen. Die Hose glitt leicht über sein Gesäß und an den Beinen hinab und blieb um seine Fußknöchel liegen. Auf Boxershorts oder eine Unterhose hatte er verzichtet. Wozu auch? Es kam doch nur auf die äußere Erscheinung an.
Immer.
Sein Lächeln erstarb. Er trat näher an die Kamineinfassung heran und spürte wieder die Hitze, die die alten Steine abstrahlten. Auf dem glatten Holz des Simses standen gerahmte Fotos in Reih und Glied. Bilder, die er aufgenommen hatte, ohne dass die betreffenden Personen es bemerkten. Menschen, die bezahlen mussten. Die Kleine, die alte Dame, die Brüder. Alle ohne ihr Wissen auf Zelluloid gebannt.
Die Dummköpfe!
Hinter den Bildern lag sein Jagdmesser. Es hatte einen beinernen Griff und eine schmale Stahlklinge, die problemlos durch alles Lebendige schnitt. Fell, Haut, Muskelfleisch, Knochen, Sehnen – mit der nötigen Kraft ließ sich alles leicht durchtrennen.
Das Messer war seine zweitliebste Waffe.
Seine liebste Waffe bestand aus Benzin und einem Streichholz … Aber manchmal reichte das nicht.
Er testete die Schneide an seiner Handfläche, und tatsächlich, obwohl er die Haut kaum berührt hatte, zeigte sich eine dünne Blutspur, rote Tröpfchen, die parallel zu seiner Lebenslinie aus einem kaum sichtbaren Schnitt quollen.
Er erkannte darin eine gewisse Ironie. Ohne die anderen winzigen Narben in seiner Handfläche zu beachten – Spuren der Faszination, die das Messer auf ihn ausübte –, sah er zu, wie die rote Spur breiter wurde und zerlief. Als sich genug Blut gesammelt hatte, um einen dicken Tropfen zu bilden, hielt er die Hand übers Feuer. Er spürte die Hitze, die fast seine Haut versengte, und beobachtete, wie der Blutstropfen sich löste, fiel und in den gierigen Flammen zischend verdampfte.
»Heute Abend geht es los«, schwor er sich. Die erste Phase seines Plans hatte er bereits in die Tat umgesetzt: den Warnhinweis an sie. Binnen einer Stunde würde er die nächste Phase beginnen, indem er zügig nach Norden fuhr. Und bis zum folgenden Abend würde er den nächsten Schritt vollzogen haben. Er würde mit der alten Frau anfangen – wie nannte sie sich noch gleich? Ja, richtig: Blanche Johnson.
Er schnaubte verächtlich über ihren lächerlichen Versuch, ihre Vergangenheit zu vertuschen. Er wusste, wer sie in Wirklichkeit war, auch wenn sie sich, mit ihren Häkeltüchern behängt, als verschrobene alte Klavierlehrerin tarnte. Sie würde bezahlen, genau wie Shannon Flannery und die anderen bezahlen mussten.
Er wog das Messer in der Hand. Mit Blanche würde er anfangen, und dann, sobald er das Mädchen in die Falle gelockt hatte, war Shannon an der Reihe. Shannon und die Übrigen. Er ließ den Blick über die gerahmten Fotos wandern, bis er an einem etwas größeren Bild von Shannon hängen blieb. Mit zusammengebissenen Zähnen betrachtete er das hinreißend schöne Gesicht.
Unschuldig und sexy, süß und doch verführerisch.
Und sündig wie die Hölle.
Er zeichnete mit dem Finger ihren Haaransatz nach; in seinem Unterleib regte sich etwas, als er ihre grünen Augen sah, die Nase mit den zarten Sommersprossen, die dichten Locken widerspenstigen kastanienbraunen Haares. Ihre Haut war hell, der Blick lebhaft, das Lächeln schmal, als ob sie spürte, dass er sich im Schatten der Bäume verbarg und die Kamera auf ihr herzförmiges Gesicht gerichtet hatte.
Der Hund, dieser räudige Köter, war von der anderen Seite des Waldes her aufgetaucht und hatte, als er Shannon erreichte, die Nase in die Luft gereckt, gezittert, geknurrt und ihn dadurch beinahe verraten. Shannon hatte dem Köter einen knappen Befehl zugerufen und einen Blick hinüber zum Wald geworfen.
Doch inzwischen schlich er sich bereits davon. Schlüpfte geräuschlos zwischen Bäumen und Büschen hindurch, entfernte sich mit der Windrichtung von ihr. Er hatte seine Fotos. Mehr brauchte er nicht.
Vorerst nicht.
Weil der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen war.
Aber jetzt …
Das Feuer glühte hell, schien lebendig zu pulsieren und tauchte den kalten Raum in einen warmen, rosigen Schein. Noch einmal betrachtete er im Spiegel seinen perfekten Körper, dann drehte er sich um.
Er blickte über die Schulter und knirschte mit den makellos weißen Zähnen, denn der Spiegel zeigte ihm jetzt seinen Rücken. Ein grausiger Anblick: die Haut, vernarbt und glänzend, sah aus, als sei sie geschmolzen.
Er dachte an das Feuer.
An die Qualen, die er durchlitten hatte, als es ihm buchstäblich das Fleisch von den Knochen brannte.
Er würde es nie vergessen.
Nicht, solange er auf diesem gottverlassenen Planeten noch atmete.
Und diejenigen, die ihm das angetan hatten, würden bezahlen.
Aus den Augenwinkeln sah er noch einmal das Foto von Shannon. Schön und wachsam, als ob sie wüsste, dass ihr Leben sich grundlegend ändern würde.
Doch zunächst brauchte er den Köder.
Um sich die Frau gefügig zu machen.
Er lächelte vor sich hin. Was für ein Glück, dass die Tochter in Falls Crossing lebte, einer Kleinstadt in Oregon am Ufer des Columbia River.
Er kannte den Ort gut, war selbst dort gewesen. Er hatte gewartet. Beobachtet.
Es war Schicksal, dass die Tochter und die alte Frau, die sich Blanche nannte, einander kannten, dass sie am selben Ort lebten, dass er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte … oder vielmehr mit zwei Streichhölzern.
Die Flammen im Kamin knisterten und fauchten.
Wie dumm sie alle waren.
Das Mädchen.
Die alte Dame.
Und Shannon.
Alle fühlten sich sicher in ihrem Leben, mit ihren Geheimnissen, ihren Lügen.
Wussten sie denn nicht, dass kein Mensch sicher war? Niemals?
Wenn sie dumm genug waren, sich in Sicherheit zu wiegen, dann stand ihnen allen ein böses Erwachen bevor.
Voller unbändiger Vorfreude schob er das Messer in die Scheide. Er hatte lange auf diese Gelegenheit gewartet. Hatte gelitten. Doch jetzt war er am Zug. An diesem Abend hatte er den Stein ins Rollen gebracht.
Aber das war erst der Anfang.
Er musste noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, ehe er sich auf den Weg machte.
Nimm dich in acht, dachte er mit einem boshaften Lächeln, zückte noch einmal das Messer und sah zu, wie sich das Feuer auf der langen, scharfen Klinge spiegelte. Ich komme, Shannon, o ja, ich komme. Und dieses Mal bringe ich mehr als eine Kamera und eine alte Geburtsurkunde mit.
»Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht?« Aaron stieß mit dem Zeigefinger nach dem angekohlten Stück Papier auf Shannons Küchentisch.
Es lag zusammen mit der Heftzwecke in einem Klarsichtbeutel auf der zerkratzten Eichenplatte, neben der Zeitung und einem Salz- und Pfefferstreuerset in Form von Dalmatinerhunden.
Es war brütend heiß in der Küche, obwohl der Ventilator auf Hochtouren lief. Khan lag auf einem kleinen Läufer bei der Hintertür und ließ Shannon nicht aus den Augen, als erwartete er jeden Moment, dass sie einen Leckerbissen hervorzauberte.
Shannon schloss die Klappe des Geschirrspülers und drückte die Starttaste. Der Motor klickte, das Wasser begann zu rauschen. Endlich drehte sie sich zu ihrem Bruder um. »Was ich mir gedacht habe? Ich weiß es nicht. Ich musste mir wohl erst mal darüber klar werden, wie ich mit der Sache umgehe.«
»Drei verdammte Tage lang.«
»Ja, ganz recht. Drei Tage lang.«
Neulich nachts, nachdem sie die Urkunde gefunden hatte, war sie zunächst völlig schockiert gewesen. Als sie wieder einigermaßen klar denken konnte, hatte sie ein Paar Latexhandschuhe übergestreift, die sie immer anzog, wenn sie die Hundezwinger reinigte, die Urkunde von dem Pfosten gelöst und sie zusammen mit der Heftzwecke in einen Klarsichtbeutel gesteckt.
»Warum hast du mich nicht sofort angerufen, nachdem es passiert war?«
»Hör zu, Aaron, ich wusste einfach nicht, wie ich mich verhalten sollte, okay?« Sie wischte sich die Hände an einem fadenscheinigen Geschirrtuch ab. »Es … es war ein Schock.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Aaron fuhr sich mit einer Hand durch das dichte Haar, ging zum Kühlschrank und nahm ein Bier heraus. Als er sah, dass es sich um alkoholfreies handelte, verzog er das Gesicht, aber er riss die Dose trotzdem auf. Dann schwang er sich auf den Küchentresen, so dass seine langen Beine in der Khakihose vor dem laut summenden Geschirrspüler baumelten. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn und liefen an seinen Schläfen hinunter.
Shannons ältester Bruder war ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Das gleiche kantige Kinn, die gleichen stechenden blauen Augen, die gleiche gerade Nase, deren Flügel sich über dem gepflegten Schnurrbart blähten, wenn er gereizt war. Und genau die gleiche hitzige Wut, die jeden Moment aufflammen konnte. Seinem Jähzorn hatte Aaron es zu verdanken, dass er sowohl aus der Army als auch aus der Feuerwehr unehrenhaft entlassen worden war. Danach war er zu einem ortsansässigen Psychologen in Therapie gegangen, den er allerdings seit über einem Jahr nicht mehr aufgesucht hatte.
Momentan war er Single und betrieb eine eigene Detektei, ein in einen Sekretariats-Service eingebundener Ein-Mann-Betrieb.
Ohne den Blick auch nur eine Sekunde lang von seiner Schwester zu lösen, trank er ausgiebig aus der Dose und fragte dann: »Weiß sonst noch jemand davon?«
»Nur derjenige, der den Zettel hinterlassen hat.«
»Und du meinst, es war dieselbe Person, die dich in der Nacht angerufen hat.«
»Ja. Das muss alles genau geplant gewesen sein. Jemand wollte mir einen Mordsschrecken einjagen, und das ist ihm weiß Gott gelungen. Deswegen habe ich mich an dich gewandt …«
»Endlich mal.«
»Hör zu, ich hätte auch Shea anrufen könne, aber ich wollte die Polizei nicht hineinziehen, jedenfalls vorerst nicht, solange ich nicht weiß, was hier vorgeht. Oder ich hätte Robert benachrichtigen können, doch ich glaube nicht, dass sich die Feuerwehr für diese Sache interessiert. Schließlich wurde nichts beschädigt.«
»Nur dein Seelenfrieden.«
»Allerdings«, flüsterte sie und schüttelte den Kopf.
»Nach dem Ausschlussverfahren bist du dann also darauf gekommen, mich anzurufen.«
»Das erschien mir nur logisch.«
»Seit wann denkst du logisch?«, fragte er mit einem leichten Schmunzeln.
»Weiß nicht. Vielleicht seit ich beschlossen habe, endlich erwachsen zu werden.« Sie nahm ein Gummiband von der Fensterbank und band ihr Haar zu einem Pferdeschwanz. Dann sah sie aus dem Fenster. Sie hatte die Hunde gefüttert, sich vergewissert, dass sie sicher im Zwinger waren, und anschließend nach den Pferden gesehen, bevor sie ihren Bruder anrief. Jetzt stand die Sonne bereits tief und warf lange Schatten über den Parkplatz und die Wirtschaftsgebäude, doch die Temperatur wollte und wollte nicht sinken. »Du bist doch Privatdetektiv. Ich dachte, du könntest dich der Sache annehmen.«
Aaron trank noch einen Schluck Bier, dann blickte er über die Schulter ebenfalls nach draußen. Mit einer Kopfbewegung wies er auf die Garage und die dunklen Fenster von Nate Santanas Wohnung und fragte: »Santana ist nicht da?«
»Nein.«
»Irgendwie seltsam, wie?«
»Zufall.« Shannon ärgerte sich und fragte sich nicht zum ersten Mal, ob es nicht doch ein Fehler gewesen war, sich an Aaron zu wenden. Eigentlich hatte sie den Anruf hauptsächlich deswegen immer wieder hinausgeschoben: Sie wollte nicht, dass ihre Brüder sich in ihre Angelegenheiten einmischten, und die drei sollten keinesfalls glauben, sie könne nicht selbst mit ihren Problemen fertig werden. Also hatte sie gezögert, am Ende aber doch entschieden, dass sie Aarons Fähigkeiten brauchte. Jetzt zog sie diese Entscheidung natürlich schon wieder in Zweifel.
»Ich dachte, du glaubst nicht an Zufälle.«
»Allerdings nicht.«
»Findest du es dann nicht merkwürdig, dass so etwas ausgerechnet passiert, wenn Santana zum ersten Mal seit langem für ein paar Tage nicht da ist?« Aaron wies auf das in Folie verpackte Stück Papier auf dem Tisch neben den Keramikhunden. »Ich dachte, ihr zwei versteht euch gut.«
»Wir sind Geschäftspartner, weiter nichts.«
»Kommt er mit, wenn du umziehst?«
»Ich weiß nicht, aber er wird auf keinen Fall mit im Haus wohnen.« Sie seufzte und beschwor ihren Bruder mit dem Blick, das Thema endlich ruhen zu lassen. »Zwischen Nate und mir ist nichts. Nicht, dass dich das etwas anginge.«
»Jetzt geht es mich durchaus etwas an.«
»Na schön. Aber wir beide sind lediglich Geschäftspartner und nicht etwa ein Paar, falls du etwas in der Richtung andeuten wolltest. Was den Umzug betrifft: Ich weiß es nicht. Wir verhandeln noch.«
Aaron knurrte etwas Unverständliches, doch er sprach seinen Zweifel nicht aus. Gut. In nüchternem Ton fragte er: »Hast du jemals Kontakt zu deiner Kleinen aufgenommen?«
»Wie bitte?« Sie schrak auf.
»Das Kind, das du zur Adoption freigegeben hast, das gerade Geburtstag hatte. Hast du je Kontakt zu ihr aufgenommen?«
»Nein! Ich weiß noch nicht einmal, wo sie lebt.«
Bei dem Gedanken überwältigte sie der Schmerz, wie immer, wenn sie an ihr einziges Kind dachte, das sie nur einmal kurz im Krankenhaus gesehen hatte, unmittelbar nach der Geburt. Zu dem Schmerz kamen brennende Schuldgefühle, weil sie nicht stark genug gewesen war, ihr Kind allein aufzuziehen. Sie konnte sich noch so oft sagen, dass sie das Richtige getan hatte und dass ihre Tochter bei liebevollen Eltern, die sich sehnlichst ein Kind wünschten, besser aufgehoben war – die Zweifel schlichen sich doch in ihre Gedanken, in ihre Träume … Plötzlich schossen ihr heiße Tränen in die Augen.
Mit heiserer Stimme sprach sie weiter. »Ich habe daran gedacht. Himmel, ich wollte es so sehr. Aber, nein, ich habe es nie versucht, mich nie in so eine Liste im Internet eingetragen oder mich an Agenturen gewandt, die Adoptivkindern helfen, ihre leiblichen Eltern aufzuspüren.«
»Aber du hast mit dem Gedanken gespielt?«
Sie nickte.
»Hast du mit jemandem darüber gesprochen?«
»Nein.« Sie räusperte sich. »Ich dachte mir, vielleicht suche ich in ein paar Jahren nach ihr, wenn sie erwachsen ist.«
Aaron rieb sich das Kinn. »Was ist mit Giles?«
»Brendan?« Insgeheim hatte sie damit gerechnet, dass die Sprache auf ihren damaligen Freund, den Vater ihres Kindes, kommen würde.
»Ja. Hast du von ihm gehört?«
»Nein … Nie wieder.«
Aaron runzelte die Stirn, als glaubte er ihr nicht ganz. Der Hund, der begriffen hatte, dass mit einem Leckerbissen nicht mehr zu rechnen war, stand auf, streckte sich und gähnte, wobei er seine schwarzen Lefzen und die Zähne zeigte.
»Nie mehr«, wiederholte sie, und die alte Wunde riss schmerzhaft wieder auf. Sie entdeckte einen Wasserflecken auf dem Tresen, wischte ihn mit dem Finger fort.
»Er ist der Vater des Kindes.«
»Ich weiß, Aaron, aber vergiss nicht, er hat sich aus dem Staub gemacht, als er erfuhr, dass ich schwanger war. Ist über die Grenze gegangen.«
»Das glaubst du.« Er sprang geschmeidig vom Tresen auf das alte, rissige Linoleum.
»Ich weiß es. Die ganze Stadt weiß es.« Sie hob abwehrend beide Hände. »Wir sollten ihn aus dem Spiel lassen.«
»Ich würde gern mit ihm reden.«
Ich nicht, dachte Shannon. Sie wollte Brendan Giles nie im Leben wiedersehen. »Er ist ein Feigling und hat sich nicht im Geringsten für das Kind interessiert. Aber wenn du ihn findest, gut. Versuch es.« Sie musste an den letzten Streit mit ihm denken, nachdem sie ihm eröffnet hatte, dass sie schwanger war. Sie erinnerte sich, wie sein hübsches Gesicht sich zu einer hässlichen Fratze verzerrte, wie er höhnisch, beinahe angewidert den Mund verzog und ihr die Worte entgegenschleuderte, die sich in ihr Gedächtnis eingebrannt und ihr das Herz gebrochen hatten. »Weißt du«, gestand sie jetzt, »Brendan besaß die unglaubliche Frechheit zu sagen, das Kind wäre ja vielleicht gar nicht von ihm.«
»Das ist normal, so reagieren viele Männer.«
»Nein, normal ist es nicht. Es ist die Ausflucht eines Feiglings.«
»Du hättest auf einen Vaterschaftstest bestehen können.«
»Wozu? Um ihn zwingen zu können, etwas gegen seinen Willen zu tun? Damit er die Vaterschaft anerkannte? Seine Verpflichtung mir gegenüber erfüllte? Nein, Aaron, das kam nicht in Frage.«
»Wenigstens hast du ihn nicht geheiratet.«
Nachdem er die Worte ausgesprochen hatte, hingen sie schwer wie Blei in der heißen Küche. Sie beide mussten an Ryan Carlyle denken, den Mann, den sie geheiratet hatte. Und den sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft umgebracht haben sollte. Wohl eine noch schlechtere Wahl als Brendan Giles. Himmel, darin hatte sie ein sicheres Händchen. Kein Wunder, dass sie seit Ryans Tod jeder ernsthaften Beziehung aus dem Weg gegangen war.
Aaron sah auf die Uhr. »Kann ich das mitnehmen?«, fragte er und griff nach dem Klarsichtbeutel.
Als Shannon nickte, steckte er den Beutel mit dem angesengten Stück Papier ein. Dann bückte er sich und tätschelte Khans Kopf. »Wir sollten das alles zunächst für uns behalten«, schlug er vor. »Später weihen wir Shea ein, wenn es sein muss, aber vorher will ich mich etwas umhören und ein paar Nachforschungen anstellen.« Er trank sein Bier aus, zerdrückte die Dose und ließ sie auf dem Tresen stehen. Das bittere Lächeln, mit dem er Shannon ansah, erinnerte sie erneut an ihren Vater.
Aaron ging zur Tür, gefolgt von Khan. Die Hand am Türknauf, blieb er stehen und drehte sich noch einmal zu ihr um. Sein Lächeln erstarb. »Weißt du, Shannon, diese Sache gefällt mir nicht.«
»Mir auch nicht.«
»Wir sehen uns.«
Er nahm sie flüchtig in den Arm, tätschelte Khan noch einmal den Kopf und trat hinaus in den trockenen, heißen Abend. Es wurde jetzt rasch dunkler, die Sicherheitslampen hatten sich bereits eingeschaltet. Aaron ging zu seinem Wagen, stieg ein, drehte den Zündschlüssel und steckte sich gleichzeitig eine Zigarette an. Der Motor heulte auf, und er trat aufs Gas.
Shannon blickte dem Honda nach, bis die Rücklichter hinter den Bäumen verschwanden. Die Dunkelheit schien ihn zu verschlingen. Hastig schloss Shannon die Tür und prüfte das Schloss. Dann tastete sie automatisch nach Khans Halsband und hielt ihn dicht bei sich. In diesem Moment war sie froh, ihn zu haben. Es tat gut, nicht völlig allein zu sein.
3.Kapitel
Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt.« Oliver Flannery senkte den Kopf. Er kniete nackt auf dem Waldboden und stellte das Gelübde, das er bald ablegen sollte, in Frage. Er hatte so hart auf dieses Ziel hingearbeitet: Pfarrer einer eigenen Gemeinde zu werden, dem Ruf zu folgen, sein Leben Gott zu weihen.
Und er war so unwürdig.
So verdammt unwürdig.
Er spürte den heißen, zärtlichen Hauch der Nacht auf seinem Rücken wie den Atem eines Dämons aus der Hölle.
So viele Menschen hatte er belogen!
So viele göttliche und menschliche Gebote hatte er übertreten!
Er war hierher gekommen, in den Wald, wo er zum ersten Mal den Ruf Gottes vernommen hatte, nicht als mächtig dröhnende Stimme, sondern als etwas Leiseres, beinahe Mildes, das in ihm allmählich zu einem Rauschen anschwoll, gewaltig wie die Meeresbrandung.
Er war auf einen Felsvorsprung hoch oben auf einem Berg gestiegen und hatte mit dem Gedanken gespielt, sich in die Tiefe zu stürzen. Während er dort stand, nackt wie jetzt, und im Begriff war, seinem Leben ein Ende zu setzen, die Zehen um die schartige Kante des Abgrunds gekrallt, war die Stimme in ihm erwacht. Anfangs hatte sie ganz leise gesprochen, ihn beruhigt, das Rasen seines Herzschlags besänftigt.
Ergib dich mir, Oliver. Ich werde dich heilen, und im Gegenzug wirst du andere heilen. Vertrau mir. Glaube. Lass allen irdischen Besitz hinter dir. Folge mir, Oliver, und ich werde dir all deine Sünden vergeben.
»Alle?«, hatte er damals, vor so langer Zeit, geflüstert.
Vertrau auf mich.
Er hatte geschwankt, hatte mit geschlossenen Augen den Drang zu springen, den verführerischen Sog des ausgetrockneten Baches fünfzehn Meter unter sich gespürt. Doch als er bereits die Arme ausbreitete und sich auf den freien Fall gefasst machte, sprach Gott: Ich vergebe dir.
Oliver schlug die Augen auf und blickte hinab ins Tal. Schwindel erfasste ihn, und mit klopfendem Herzen trat er zurück. Schweiß rann ihm über Brust und Rücken. Hatte Gott tatsächlich zu ihm gesprochen? Oder wurde er verrückt, raubte das schlechte Gewissen, das seine Seele marterte, ihm schließlich auch den Verstand?
Vertrau mir, forderte die Stimme erneut. Ergib dich mir.
Oliver war auf die Knie gesunken. Tränen strömten über sein Gesicht, und er gelobte, von diesem Augenblick an Gottes ergebener Diener zu sein.
Doch er hatte versagt.
Alles, was er getan hatte, war eine einzige Lüge.
Und wieder einmal erwog er den einfacheren Weg, die rasche Lösung. Aber Selbstmord war feige. Und Sünde.
Noch eine Sünde.
Mit zusammengebissenen Zähnen ließ er sein erbärmliches Leben Revue passieren.
Er beugte sich tiefer hinab, bis er ausgestreckt in Gras und Laub lag, und flehte verzweifelt zu Gott, er möge seine Gebete erhören.
Er möge ihm vergeben.
Ihn leiten.
Doch in der Dunkelheit, in der eine schmale Mondsichel hinauf in den Sternenhimmel stieg, hörte er nur sein eigenes Herzklopfen und das Seufzen des heißen Windes, der im trockenen Laub und in den dürren Zweigen über ihm raschelte.