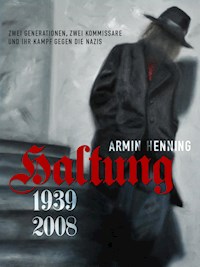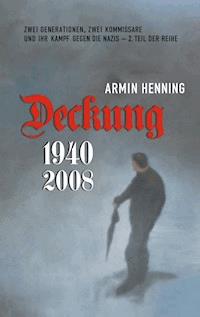
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zwei Generationen, zwei Kommissare und ihr Kampf gegen die Nazis
- Sprache: Deutsch
Der Krimi "Deckung" ist der Folgeroman des 2015 veröffentlichten Buches "Haltung" und spielt in zwei Handlungssträngen - im Dritten Reich und im Jahr 2008. Berlin 1940 - Die geheime Ermordung behinderter Menschen verändert auch das Leben der äußerst wohlhabenden Industriellenfamilie Winz. Der Verlobte ihrer Tochter Isolde, Helmut Rems, beteiligt sich heimlich daran, eine behinderte Verwandte der Familie in deren Sommerdomizil in Travemünde zu verstecken. Für Helmut, selbst Oberkommissar im Reichssicherheitshauptamt und Unterstützer des demokratischen Widerstands, ist dies nicht nur eine Tat aus Überzeugung. Für ihn stellen Mitwisserschaft und Mittäterschaft persönlich eine große Gefahr dar. Durch den Aufbau eines Netzwerkes an Informanten konstruiert er zur Ablenkung einen Skandal innerhalb der SS und Gestapo und erregt damit die Aufmerksamkeit des Reichsführers SS, Heinrich Himmler. Was als Lüge zur Tarnung beginnt, wird immer mehr zum einenden Projekt mit seinem Vorgesetzten, Oberführer Arthur Nebe. Als er selbst und das Widerstandsnetzwerk um den ehemaligen Reichstagsabgeordneten Julius Leber wenig später erneut aufzufliegen drohen und Helmut gerade im Begriff ist, das Problem zu lösen, ruft ihn niemand Geringeres als Adolf Hitler zum Rapport - weg von Berlin, auf den Obersalzberg. Helmut setzt alles auf eine Karte und entschließt sich zu seinem bisher kühnsten Plan ... Berlin 2008 - Die rechte Szene in Berlin hat einen neuen Star: Ewald Schaar. Ihm gelingt es immer mehr, die notorisch zerstrittenen rechten Gruppierungen zu einen und hinter sich zu versammeln. Achim Rems, Enkel des 2008 verstorbenen Oberkommissar Helmut Rems, soll den charismatischen Mann und dessen Bestrebungen im Auge behalten. Vernetzt sich Schaar jetzt sogar bundesweit? Gemeinsam mit seiner Kollegin Catherine Silber beobachtet er dessen Treffen und ein Verdacht keimt auf: Wird in einer Siedlung mit Gleichgesinnten etwa die alte Idee der Nationalsozialisten neu belebt? Ein Überfall auf eine Berliner Synagoge verändert das politische Klima in Berlin. Nina Silber, Schwester von Catherine und gleichzeitig Freundin von Achim, schleust sich in die Siedlung ein. Während einer Observation ergeben sich bald darauf überraschende Details über Schaars Privatleben, die es Achim ermöglichen, Schaar als V-Mann zu gewinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Conni
Inhalt
Prolog
Berlin, 22. April 2008
Berlin, 26. Januar 1940
KAPITEL EINS
Berlin, 24. April 2008
Travemünde, 27. Januar 1940
Lübeck, 28. Januar 1940
Berlin, 24. April 2008
Travemünde, 29. Januar 1940
Berlin, 30. April 2008
Travemünde, 30. Januar 1940
Berlin, 5. Mai 2008
Travemünde, 31. Januar 1940
Mecklenburg-Vorpommern, 5. Mai 2008
Travemünde, 31. Januar 1940
Travemünde, 1. Februar 1940
KAPITEL ZWEI
Berlin, 6. Mai 2008
Travemünde, 5. Februar 1940
Berlin, 7. Mai 2008
Berlin, 8. Mai 2008
Berlin, 6. Februar 1940
Berlin, 9. Mai 2008
Berlin, 13. Mai 2008
Lübeck, 8. Februar 1940
Berlin, 17. Mai 2008
Lübeck, 13. Februar 1940
Berlin, 19. Mai 2008
Berlin, 20. Mai 2008
21. Mai 2008
Travemünde, 14. Februar 1940
Berlin, 23. Mai 2008
Berlin, 16. Februar 1940
Mecklenburg-Vorpommern, 24. Mai 2008
Berlin, 18. Februar 1940
Berlin, 25. Mai 2008
Berlin, 22. Februar 1940
Berlin, 26. Mai 2008
Brandenburg an der Havel, 27. Februar 1940
Berlin, 28. Mai 2008
Berlin, 3. März 1940
KAPITEL DREI
Berlin, 30. Mai 2008
Travemünde, 6. März 1940
Travemünde, 8. März 1940
Warnemünde, 31. Mai 2008
Travemünde, 09. März 1940
Warnemünde, 31. Mai 2008
Berlin, 10. März 1940
Warnemünde, 1. Juni 2008
Berlin, 11. März 1940
Berlin, 02. Juni 2008
Berlin, 06. Juni 2008
Berlin, 09. April 1940
KAPITEL VIER
Berlin, 30. 04. 1940
Berlin, 16. Juni 2008
Berlin, 10. Mai 1940
Mecklenburg-Vorpommern, 17. Juni 2008
Berlin, 15. Mai 1940
Berlin, 22. Juni 2008
Berchtesgaden, 16. Mai 1940
Berchtesgaden, 17. Mai 1940
Berlin, 23. Juni 2008
Berchtesgaden, Fortsetzung 17. Mai 1940
Berlin, 18. Mai 1940
Prolog
Berlin, 22. April 2008
Der Wecker klingelt. Achim wird aus einem Traum gerissen und sofort mit den schweren Verfehlungen des sonntäglichen Vorabends konfrontiert. Mit wackeligen Beinen steht er auf und sieht auf dem Holzboden vor dem Bett den Grund seiner Leiden: Neben der alten Munitionskiste seines vor einigen Monaten verstorbenen Großvaters liegt deren Inhalt verstreut: Alte, in Wachstücher eingewickelte Tagebücher des alten Herrn, daneben eine leere Flasche Rotwein. Gestern Abend hatte er sich zum wiederholten Mal den Aufzeichnungen seines umtriebigen Vorfahren gewidmet. Sein Leben im Dritten Reich, seine Kontakte zum Widerstand, sein heimlicher Kampf gegen das Regime inmitten des Reichssicherheitshauptamtes. Seine Kontakte zu höchsten Nazis und seine Gefühle für Isolde, seine reiche Verlobte aus dem einflussreichen Hause des Industriellen Winz. Achim liest gerne in den Aufzeichnungen von Helmut Rems. Und wenn er dies tut, dann schaltet er seine Handys aus, genehmigt sich eine Flasche guten Rotweins und taucht für Stunden ab in die bewegte Vergangenheit seines Großvaters.
Mit fahrigen Bewegungen sucht Achim sich nun seine frischen Klamotten zusammen und hält noch einmal inne: Wenn er jetzt das dunkelbraune Hemd wählt, kann er wohl kaum seine neuen schwarzen Schuhe dazu anziehen. Also greift er zu einer hellen Jeans, schnappt sich den hellbraunen Gürtel und stolpert ins Bad.
Eine Stunde später steuert er seinen Mini in das Parkhaus des Landeskriminalamtes und eilt in das Gebäude. Ohne anzuklopfen, betritt er das Sekretariat und grüßt Marita Schulz, seine 60-jährige Sekretärin. Sie ist stets freundlich und nett. Aber das Feuer des Ehrgeizes ist schon lange erloschen: Sie reißt ihre letzten Jahre stur ab. Ihren nahenden Feierabend kommuniziert sie gerne dadurch, dass sie sich pünktlich ihren Lippenstift nachzieht und ein aufdringlich-süßliches Parfum auflegt und kurz und knapp ein „Tschüssi“ durch die Wände trällert. Heute jedoch kann Frau Schulz neben dem höflichen „Guten Morgen!“ noch mit einer echten Nachricht aufwarten: „Kollegin Silber lässt sich entschuldigen. Sie ist beim Chef.“
Irritiert bleibt Achim auf dem Weg in sein Dienstzimmer stehen, kratzt sich die Stirn und dreht sich zu Frau Schulz um: „Hat sie gesagt, was sie da will? Oder besser wohl soll?“
Frau Schulz erwidert ein freundliches Nein.
„Hmm“, brummt Achim, „da ist nicht zufällig noch gesagt worden, dass ich nachkommen soll?“
Seine Sekretärin schüttelt den Kopf.
Achim ärgert sich. Er hasst es, nicht zu wissen, was in seiner Arbeitseinheit vorgeht. Also drückt er sein Kreuz durch und brummt nur: „Sie soll sich umgehend melden, wenn sie wieder da ist.“ Mit diesen Worten setzt er den Weg in sein Zimmer fort. Kopfschmerzen, eine eigenmächtige Kollegin … Beschissener kann eine Woche nicht beginnen.
Berlin, 26. Januar 1940
Eiligst verließ Helmut sein Dienstzimmer und verabschiedete sich von seiner jungen und überaus hübschen Sekretärin Erna sowie von Rainer, dem Ersatzmitarbeiter für seinen in die ehemaligen polnischen Gebiete entschwundenen Mitarbeiter Bolle. Direkt vor dem Gebäude des Reichssicherheitshauptamtes in der Prinz-Albrecht-Straße stand sein privater DKW Front. Er öffnete die Fahrertür, stieg ein und fuhr mit Vollgas Richtung Winz-Villa im Westen Berlins. Die Stadt war in frisches Weiß getaucht, die Temperaturen ließen das ganze Reich frieren. Es war ein extremer Winter. Helmut hatte einige Mühe, den Wagen auf der Straße zu halten.
Nach gut 30 Minuten rollte er die großzügige, kiesbedeckte Auffahrt hinauf zur Villa und parkte seinen Wagen rechts vor dem Hauptportal zwischen einem Lastkraftwagen und dem großen Horch des Hausherrn. Isolde erwartete ihn bereits. Sie fiel ihm um den Hals und gab ihm unerhörterweise einen langen Kuss auf den Mund. „Hallo Liebling! Schön, dass du uns hilfst!“
Endlos lange hätte Helmut in ihre schönen, dunklen Augen gucken wollen, aber Johann Strang trug gemeinsam mit einem Hausangestellten eine Truhe durch das Vestibül in Richtung des LKW. Die Männer grüßten einander knapp, was angesichts der schweren Last von Johann aber auch nicht anders möglich war. Helmut kannte ihn schon seit einigen Jahren. Er war ein angesehener Professor, bis er bei den Nazis als Sozialdemokrat in Ungnade fiel. Durch die Vermittlung von Helmut erlangte er jedoch eine Anstellung bei der Familie Winz. Er war nun damit betraut, sich um Waltraut, die 50-jährige, geistig behinderte Schwester der Hausherrin, zu kümmern. Und der erste Schritt bestand nun darin, Waltraut in der Ferienvilla der Familie in Travemünde ein neues Zuhause zu geben und sie so vor dem anlaufenden Euthanasieprogramm zu verstecken.
Der Hausherr kam gerade die Treppe herunter, erblickte Helmut und breitete seine Arme aus. „Helmut! Schön, dich hier zu wissen! Waltraut ist schon ganz aufgeregt, die Sachen sind fast schon gepackt. Wir können in gut einer Stunde losfahren.“ Unten angekommen, hieb der wohlgenährte Mann Helmut mit seiner Rechten auf dessen Schulter. „Am besten, wir fahren mit deinem Wagen. Der Horch würde in Travemünde nur zu sehr auffallen.“ Dann legte Winz ein nachdenkliches Gesicht auf. „Es ist eine Schande, dass wir das in aller Heimlichkeit vollziehen müssen. Ein großer Irrtum des Führers ist das Ganze!“
Helmut nickte und hätte noch weitere „Irrtümer“ aufzählen können. Aber so weit ging das durchaus offene Verhältnis zu seinem künftigen Schwiegervater dann doch noch nicht.
Nach einer schnellen Mahlzeit im Salon machten sich Winz, Johann, Helmut und Waltraut auf nach Travemünde. Waltraut bestand darauf, neben Johann im LKW Platz zu nehmen. Winz gewährte ihr den Wunsch. Er wollte vermeiden, diese Fahrt – immerhin ein Abschied auf unabsehbare Zeit von ihrem gewohnten Umfeld – mit einer Szene zu beginnen.
Helmut gab Isolde einen schnellen Kuss und stieg in seinen Wagen, während Winz umständlich von der anderen Seite zustieg. Er war die Enge eines solchen Wagens seit Jahren nicht mehr gewohnt. Als er sich mit den Umständen arrangiert hatte, lächelte er ein wenig verlegen zu Helmut herüber. „Meine Leibesfülle ist der Preis meines Wohlstandes. Es sah wohl etwas albern aus, wie ich in deinen Wagen stieg?“
Helmut lachte. „Niemals!“, bestritt er gespielt entschieden. „Es sah nicht albern aus, eher bemerkenswert vorsichtig!“
Mit gespieltem Ernst erwiderte Winz: „Das will ich meinen. Im Gegensatz zu Frauen werden Männer nicht fett und unansehnlich, sondern schlicht stattlich!“
„Oha! Das lass mal deine Tochter nicht hören!“, tadelte Helmut seinen künftigen Schwiegervater und fuhr los. Die Kolonne aus LKW und dem DKW rollte vorsichtig vom Hof. Im Innenspiegel sah Helmut, wie Waltraut über beide Ohren grinste. Sie war sich wohl nicht ganz der Tatsache bewusst, dass dieser Abschied eventuell für immer sein könnte. Mit Abscheu dachte Helmut an seinen Besuch in der ehemaligen Heilanstalt Grafeneck bei Stuttgart. Dort wurde gerade eine der Anstalten eingerichtet, in denen behinderte Menschen gesammelt und dann ermordet werden sollten. Und dort stand auch schon einer der grauen Busse, mit denen die Menschen künftig abgeholt werden würden. Um auf andere Gedanken zu kommen, versuchte sich Helmut in Konversation. „Seit wann ist deine Frau bereits in Travemünde?“, fragte er in Richtung des alten Winz.
„Seit rund einer Woche. Sie richtet das kleine Anwesen ein wenig her. Das scheint sie aufzumuntern. Ich habe gestern mit ihr telefoniert.“ Bei der Antwort blickte er hinaus. Ihm schien das Thema nicht ganz zu behagen. Dann ergänzte er jedoch: „Wir sind seit fast 30 Jahren verheiratet. Wir führen eine durchaus solide Ehe. Gemeinsamer Aufstieg, gemeinsames Glück, gemeinsames Auseinanderleben, gemeinsame Entfremdung. Alles dabei. Aber ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen.“
Einige Fragen drängten sich Helmut auf, die er aber unmöglich stellen konnte. Ihre Beziehung war zwar recht offen, lebte jedoch eher von Andeutungen als vom offenen Wort. Winz gab aber von sich aus die Antwort auf die heikelste Frage.
„Und ohne ins Detail zu gehen – in Travemünde wohnt auch eine Frau, mit der ich seit einigen Jahren ein Verhältnis habe.“ Nun drehte er seinen Kopf um und sah Helmut unverwandt in die Augen. „Das ist meine Hypothek.“ Ohne Humor ergänzte er: „Solltest du so etwas meiner Tochter antun, erschieße ich dich selbstredend!“
Angst verspürte Helmut bisher eigentlich nur bei Gesprächen mit Arthur Nebe, seinem Chef im Amt V des Reichssicherheitshauptamtes. Oder beim Besuch des Arztes, wenn er Zahnschmerzen hatte. Nun stellte sich unvermittelt dieses Gefühl auch jetzt ein. Er erwiderte nur: „Das wird niemals passieren. Ich liebe Isolde. Wenn ich sie betrügen sollte, dann wäre es so, als würde ich mich selbst betrügen.“
Fortan schwiegen die Männer. Nach einer Stunde murmelte Winz unvermittelt eine Entschuldigung. Dann fuhr er fort: „Ich bin ein wenig unausgeglichen derzeit. Seit einigen Wochen laufen die Geschäfte hervorragend.“
„Das ist doch etwas Positives …“ Helmut überholte einen Traktor und beobachtete besorgt das schleppende Überholmanöver des LKW hinter sich.
„Wenn bei mir die Umsätze steigen, hebt sich meine Laune. Wenn die Umsätze Sprünge machen, gibt es Krieg.“ Winz trommelte mit den Fingern auf seinem Knie.
„Und was war dann das in Polen? Das war doch bereits Krieg. Ich sehe …“
Der stattliche Mann unterbrach Helmut unwirsch. „Ich rede nicht von einem Feldzug gegen das unterentwickelte Polen mit seinen lanzentragenden Reitern! Ich rede auch nicht von ein paar Panzern. Was ich meine, ist die Tatsache, dass auf breiter Front industrielle Kapazitäten genutzt werden, um ein Millionenheer mit Uniformen, Waffen, Nahrung in Konserven, Spritzen, Medizin und Munition auszurüsten. Herrgott!“, ereiferte er sich in ungewohnter Lautstärke. „Hitler macht erneut einen Fehler!“
„Hast du es gelesen?“, fragte Helmut, einer spontanen Eingebung folgend.
„Was soll ich gelesen haben?“, fragte Winz barsch.
„Mein Kampf.“ Wieder überholte Helmut einen Traktor.
„Nein. Ich kenne niemanden, der das gelesen hat …“
Jetzt war es an Helmut, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. „Wenn man ein Wirtschaftskapitän ist, sollte man das lesen, was diejenigen zu Papier gebracht haben, die unsere Geschicke in der Hand haben!“ Nach einer kurzen Pause verlieh Helmut seinen Worten mit einem Schlag auf das Lenkrad und einem „Verdammt noch eins!“ mehr Gewicht.
Winz zuckte merklich zusammen und sah, von Helmuts ungewohntem Zornesausbruch überrascht, zum Fahrersitz. Einen solchen Ton ihm gegenüber war er nicht gewohnt.
„Er will Krieg! Er will Sieg oder Untergang! Er will die Juden vernichten! Es ist einfach verhext. Bin ich der Einzige, der den Mist gelesen hat?“ Nun schaute er Winz direkt an, ohne auf den Verkehr zu achten. „Du solltest Hitler ernster nehmen und das lesen, was er angekündigt hat!“ Nun schrie er fast. „Konzentrationslager, Mord an Schwachsinnigen, Enteignung von Juden, der Polenfeldzug … Was muss noch geschehen, bis die Leute kapieren, was hier passiert?“
Winz schaute wieder aus dem Seitenfenster. Helmut konnte sehen, wie es in ihm arbeitete, aber seine Wut war noch längst nicht verraucht. Aufgebracht fuhr er fort: „Du bist klug, gut informiert, verkehrst in höchsten Kreisen! Du musst es doch wissen! Du bist doch kein einfacher Gimpel aus dem Wedding, der sein Wissen aus der Kneipe hat!“
„Halt an“, knurrte Winz. Als Helmut nicht reagierte, wiederholte er seinen Befehl. „Halt das Fuhrwerk verdammt nochmal an!“
Helmut steuerte den Wagen durch knirschenden Schnee auf einen abzweigenden Feldweg und ließ den Mitfahrer aussteigen. Er sah, wie Winz auf den Acker stapfte, nach rund 30 Metern stehen blieb und offensichtlich mit sich selbst in ein Zwiegespräch verfiel. Sein Atem dampfte zum Himmel auf. Helmut stieg aus und ging auf den LKW zu. Dort saßen der verunsicherte Johann und die immer noch selig dreinblickende Waltraut im Führerhäuschen des LKW und starrten Helmut an. „Er vertritt sich ein wenig die Beine. Er ist ja nicht mehr der Jüngste.“ Nach dem letzten Satz zwinkerte er Waltraut zu, die sich darüber amüsierte und ihm ihre lange, rissige Zunge entgegenstreckte.
Einige Minuten später kam Winz mit schweren Schritten auf den DKW zu und stieg wortlos ein. Helmut zuckte mit den Schultern, gab Johann das Signal für den Aufbruch und stieg ebenfalls in den Wagen.
Die weitere Fahrt nach Travemünde gestaltete sich ein wenig anstrengend, da Winz in tiefes Schweigen verfiel und grimmig die Landschaft betrachtete. Gegen Abend erreichten sie Travemünde. Hier brach Winz sein Schweigen, um Helmut in knappen Worten den Weg zum Anwesen zu weisen. Am Strandbahnhof vorbei, dann links in die Kaiserallee. Hier wurden die Häuser größer, luxuriöser.
Das Feriendomizil der Familie Winz war ein recht imposantes Haus im Jugendstil. Vom obersten Stockwerk hatte man bestimmt einen herrlichen Blick aufs Meer. Es hätte auch einen respektablen Erstwohnsitz so manch eines Industriellen abgeben können. Immer wieder fragte sich Helmut, wie groß wohl das Vermögen der Familie sein mochte.
Frau Winz erschien im Vestibül und wurde von Waltraut wild umarmt. Winz´ Gattin schien wie ausgewechselt zu sein. Im Gegensatz zu ihrem stets zurückhaltenden, fast an Arroganz grenzenden Gleichmut dem gesellschaftlichen Leben in Berlin gegenüber empfing sie Helmut und ihren Mann mit äußerster Herzlichkeit.
Auch Winz war von dem Temperament seiner Ehefrau positiv überrascht, ließ sich aber nicht von ihr anstecken, sondern brummte: „Helmut und ich gehen erst einmal etwas essen. Johann, bitte räume den Wagen aus.“ Mit einem Nicken bedeutete er Helmut, dass es nun Zeit war, das Haus zu verlassen. „Wir gehen zu Fuß.“
Rund zehn Minuten benötigten beide Männer, um entlang der winterlichen Strandpromenade zum Kursaal zu gelangen. „Früher war da ein Casino untergebracht. Heute kann man hier ganz gut essen oder Musik hören. Und es gibt anständigen Wein.“ Winz´ Stimmung schien sich allmählich aufzuhellen.
Sie betraten den Eingangsbereich, stampften ein paar Mal auf, um den Schnee von den Schuhen zu klopfen, und wurden von einem Angestellten höflich empfangen. „Herr Winz! Welch Glanz in unserem Hause! Sie wünschen Ihren Lieblingstisch?“ Dabei kam der geschniegelte Mann für Helmuts Geschmack ein wenig zu nah an Winz heran. Dann tuschelte er: „Ich habe da eine Flasche hervorragenden Rotwein aus Frankreich. Ich weiß ja, was Sie bevorzugen.“
„Sehr schön, Matthes, sehr schön. Darf ich Ihnen meinen künftigen Schwiegersohn vorstellen? Herr Rems aus dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin.“ Er ging einen Schritt zurück, um wieder eine statthaftere Entfernung zum leicht aufdringlichen Matthes herzustellen.
Helmut registrierte ein Flackern in den Augen von Matthes und nahm sich vor, den Mann in Berlin überprüfen zu lassen. Irgendetwas an ihm war unangenehm.
Ihnen wurde ein schöner Tisch mit Blick auf den alten Leuchtturm zugewiesen. Nachdem beide ihre Bestellung aufgegeben hatten, schlug Winz einen versöhnlichen Ton an. „Helmut, du musst mein Verhalten entschuldigen. Die Zeiten, in denen wir leben, sind nicht dazu angetan, das Leben auf die leichte Schulter zu nehmen.“ Er spielte nervös mit dem Zipfel der Stoffserviette. „Ich verstecke grade meine Schwägerin vor den Häschern des Staates, den ich nach Kräften unterstütze. Und du hast Recht! Ich lebe nicht schlecht unter der jetzigen Reichsführung. Aber ich bin weder blind noch skrupellos. Auch ich mache mir Sorgen.“
Helmut nickte und wollte seinerseits etwas erwidern, als der unterwürfige Matthes mit verschwörerischem Blick und einer Flasche Rotwein auf sie zu stolzierte. Er präsentierte das Etikett, woraufhin Winz anerkennend die Augenbrauen hochzog und sichtlich um Fassung bemüht war. „Verdammich, Matthes! Wo haben Sie den Tropfen her? Sie kollaborieren doch nicht heimlich mit dem Erzfeind?“
Sichtlich von Stolz erfüllt, beugte sich der Angesprochene – erneut reichlich distanzlos – zum linken Ohr von Winz herunter, sprach jedoch so laut, dass auch Helmut jedes Wort verstehen konnte. Winz selbst zuckte aufgrund der unerwarteten Lautstärke merklich zusammen. „Das bleibt mein Geheimnis, Herr Winz. Aber eines sei verraten: Ich pflege ausgezeichnete Kontakte zu einem Hotel in Bordeaux. Wir tauschen regelmäßig Kostbarkeiten aus.“
„Pah!“, raunzte Winz. „Was können wir denn schon den Franzmännern bieten, was sie verzückt? Eisbein vielleicht? Oder Kieler Sprotten? Oder den KdF-Wagen? Haben Sie schon mal einen gesehen?“
Nun musste auch Helmut grinsen.
Mit leicht beleidigtem Gesichtsausdruck erwiderte Matthes: „Sie würden sich wundern, was der Franzmann bereit ist auszugeben, um an Christstollen aus Dresden zu kommen. Und ein ordentlicher Schinken aus Italien nimmt manchmal auch wundersame Wege Richtung Frankreich.“
Winz winkte schmunzelnd ab: „Bitte keine Details. Ich fürchte, Sie sind ein ganz Schlimmer!“
Matthes entkorkte die Flasche und goss beiden Männern ein.
Während Winz den Wein probierte, fragte er Matthes beiläufig: „Ist denn schon was auf der Trabrennbahn auf dem Priwall los?“ An Helmut gewandt, erläuterte er: „Eine meiner Lieblingszerstreuungen hier auf der anderen Seite der Trave. Hier trainieren ganz passable Rennpferde.“
„Tut mir sehr leid, die Herren!“, flüsterte Matthes. „Aber ich fürchte, ich muss Ihnen eine schlechte Nachricht übermitteln: Der Priwall ist für Zivilisten gesperrt. Man munkelt, dass dort die Wehrmacht bauen lässt.“
Der alte Winz war entsetzt. „Auf dem Priwall? Was will man da schon bauen?“ Nachdenklicher fügte er hinzu: „Der Flughafen ist demnach auch für unsereiner gesperrt?“
Matthes nickte nur. „Die Schließung beider Einrichtungen bedeutet einen herben Rückschlag für die Besucherzahlen solventer Kunden, so viel darf ich verraten.“ Mit diesen Worten entschuldigte er sich.
Winz beugte sich zu Helmut hinüber: „Ein windiger Kerl, aber äußerst nützlich.“ Dann lehnte er sich wieder zurück, blickte aus dem Fenster und schloss mit dem Thema, jedoch wenig von seiner eigenen Aussage überzeugt: „Wir alle müssen Opfer bringen. Jede Medaille hat zwei Seiten.“
Das konnte sich Helmut sehr gut vorstellen. Gerade wollte er zum Glas greifen und mit seinem Schwiegervater in spe anstoßen, da setzte Winz erneut an, diesmal mit schelmischem Gesichtsausdruck: „Schon den neuesten Witz der Stadt über den KdF-Wagen gehört?“
Helmut schüttelte den Kopf. Er hatte den alten Mann noch nie dabei erlebt, wie dieser je einen humoristischen Gassenhauer zum Besten gegeben hätte.
Zumal ein Scherz zu diesem Thema heikel war. Der KdF-Wagen, der von Porsche konstruiert wurde und als Volkswagen die Massenmotorisierung breiter Bevölkerungsschichten ermöglichen sollte, war ein Prestige-Objekt der Nationalsozialisten. Nur litt der Anlauf der Serienproduktion unter der Aufrüstungspolitik der Reichsregierung.
„Die Männer an den Fließbändern dort sind schier verzweifelt. Was auch immer sie tun: Immer wenn sie versuchen, mit den Einzelteilen einen dieser Volkswagen zu montieren, es kommt eine Haubitze heraus!“ Dann fing Winz schallend an zu lachen, so dass alle Gäste zu ihnen schauten.
KAPITEL EINS
2008
Die rechte Szene in Berlin hat einen neuen Star: Ewald Schaar, dem Sohn eines ehemalig aufstrebenden Politikers, gelingt es immer mehr, die notorisch zerstrittenen Berliner Gruppierungen zu einen und hinter sich zu versammeln. Achim Rems, Kommissar beim Berliner Landeskriminalamt, soll den charismatischen Mann und dessen Bestrebungen im Auge behalten. Dies führt ihn auch über die Landesgrenze hinweg nach Mecklenburg-Vorpommern. Vernetzt Schaar die rechte Szene sogar bundesweit? Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Catherine Silber observiert er Schaar, und ein Verdacht keimt auf: Wird in einer Siedlung von rechten Sympathisanten etwa eine alte Idee der Nationalsozialisten neu belebt?
1940
Die unter Geheimhaltung gestellte, systematische Ermordung behinderter Menschen verändert auch das Leben der äußerst wohlhabenden Industriellenfamilie Winz. Der Verlobte von Tochter Isolde, Helmut Rems, beteiligt sich verdeckt daran, eine behinderte Verwandte der Familie in einem Sommerdomizil in Travemünde zu verstecken. Für Helmut Rems, Oberkommissar im Reichshauptsicherheitsamt und heimlicher Unterstützer des demokratischen Widerstands, ist dies nicht nur eine Tat aus Überzeugung – ihn bringen Mitwisserschaft und Mittäterschaft in große Gefahr. Trotzdem unterstützt er die Familie Winz nach Kräften und muss seine verstärkte Präsenz in Travemünde für seine Vorgesetzten begründen. Durch den Aufbau eines Netzwerkes an Informanten konstruiert er einen Skandal innerhalb SS und Gestapo und erregt damit die Aufmerksamkeit des Reichsführer SS, Heinrich Himmler. Was als Lüge zur Ablenkung seiner Vorgesetzten beginnt, wird immer mehr zum einenden Projekt mit seinem Vorgesetzten, Oberführer Arthur Nebe. Die Allianz dieser ungleichen Männer verfestigt sich.
Berlin, 24. April 2008
Achims Handy vibriert. Es ist Nina, seine neueste Affäre. „Ja bitte?“ Er weiß, dass sie es hasst, wenn jemand das Telefonat annimmt, ohne seinen Namen zu nennen. Und prompt stöhnt sie genervt auf. Leicht nervös fuchtelt er mit dem 30-cm-Lineal herum und legt das Stück Holz wieder auf seinen Schreibtisch in seinem Büro.
„Mit wem bin ich bitte schön verbunden?“, fragt sie genervt.
Das fängt ja schön an, denkt sich Achim und erwidert: „The Earl of Sex!“
„Witzig!“, antwortet sie schnippisch. „Warum bekomme ich davon nie etwas mit, sondern lass es nur vom elektrischen Zappelphilipp erledigen?“
„Was kann ich für dich tun, Gnädigste?“ Es ist offenbar dringend notwendig, das Thema zu wechseln.
„Wann sehen wir uns wieder? Ich fahre morgen nach Israel. Da habe ich einen wichtigen Auftrag ergattern können.“ In ihrer Stimme liegen Ungeduld, Lust, Aggression, Wut, das Bedürfnis nach Nähe. Alles in einem Satz, aus einem Mund. Dafür liebt er diese Frau.
„Wohl nach deinem Trip. Ich muss heute Abend jemanden beschatten.“ Achim ist klar, dass diese Antwort das Gesprächsklima weiter eintrüben wird.
„Aha!“, antwortet sie nur. Mit überraschend versöhnlichem Ton setzt sie fort: „Schade. Aber so wie ich mir meine Auftragnehmer nicht aussuchen kann, so hast du mit deinem Arbeits-Timing Pech. Aber wenn wir mal wieder Zeit füreinander haben, dann fahren wir bitte an die Ostsee. Einverstanden?“
„Ja, klar! Gerne doch! Du weißt: Ich liebe die See!“ Er freut sich über die plötzliche Wendung des Gesprächs. Eben noch stimmungstechnisch im Luv, plötzlich im Lee.
Damit war das Gespräch beendet. Seine Kollegin Catherine Silber stürmt plötzlich in sein Büro, stellt sich vor seinen Schreibtisch, stemmt ihre Hände in die Hüften und stellt den linken Fuß auf die Sitzfläche des Besucherstuhles. Ihr fehlen nur noch die lässig geschulterte Winchester und ein Grashalm im Mundwinkel. John Wayne hätte es nicht besser machen können. Dann verkündet sie: „Jesus macht wohl einen Ausflug nach Neubrandenburg.“
„Soso, Frau Kriminalkommissarin. Und woher haben wir diese Erkenntnis?“ Es macht ihm einfach Spaß, mit dieser unkonventionellen Frau zusammenzuarbeiten.
„Das LKA Mecklenburg-Vorpommern hat sich gemeldet. Die erwarten unseren Mann gegen 14 Uhr in einer Dorfschänke bei Neubrandenburg. Sie sind ganz aufgeregt. Da scheint sich etwas Großes zu entwickeln.“ Sie nimmt den Fuß vom Stuhl und massiert sich den Nacken, als sei sie die ganze Nacht auf dem Pferd durch die Prärie geritten.
„Und das wäre?“
„Das wissen sie nicht. Aber die Kollegen reden davon, dass sich die Creme de la Creme der Neonazi-Gesellschaft angesagt hat. Und das alleine ist schon der Hammer! Immerhin ist der Haufen eigentlich total zerstritten.“
„Hmmm …“, brummelt Achim. Ewald Schaar, ein smarter Mittdreißiger, wird als der neue rechte Jesus bezeichnet. Ein gutaussehender Mann, der sich anschickt, die rechten Kameraden zu einen und der Bewegung mit Hirn und Geschick zu dienen. Seinem Vater, dem ehemaligen Staatssekretär der Berliner Senatsverwaltung des Inneren, hat das Treiben seines Sohnes bereits geschadet. Seinen Job hat er verloren, als sich herausstellte, dass auch der Vater des Staatssekretärs ein untergetauchter Nationalsozialist war. Nun wird dem alten Herrn der Prozess gemacht. Und diesem Fall verdankt Achim seine Beförderung.
„Was machen wir jetzt, Chef?“ Catherine beendet ihre Massage und knackt mit den Fingergelenken. Achim hasst dieses Geräusch. Da sie das weiß, grinst sie unverschämt.
„Wir hängen uns dran. Sagen den Kollegen im Norden Bescheid, dass wir da rumturnen. Planen die denn selbst etwas Konkretes?“
„Nö, die wollen das alles nur beobachten.“
„Haben die da jemanden drin? Ich meine einen V-Mann?“ Achim steht auf und blickt aus dem Fenster. Er würde bei dem Treffen zu gerne Mäuschen spielen.
„Nein. Das Treffen ist sehr hochrangig besetzt. Aber lassen wir das Quatschen, Boss. Wir sollten langsam losfahren. Ach …“ Sie will sich gerade umdrehen, da fällt ihr noch etwas ein. „Unser Opel Vectra ist zur Inspektion in der Werkstatt. Der Wagen ist wohl einige Tage weg. Wir haben einen Ersatzwagen.“ Dann setzt sie ein böses Lächeln auf.
Achim ahnt Schlimmes: „Ja, und?“
„Wir sollten sofort losfahren. Immerhin fährt Schaar BMW. Und wir sollten doch ein wenig vor ihm ankommen.“ Ihr Grinsen wird noch unverschämter.
„Und worin genau liegt das Problem? Was ist das für ein Wagen?“ Langsam wird er sauer.
„Die Antwort wird dir nicht gefallen …“
Mit einem unguten Gefühl schnappt er sich seine Jacke und spurtet seiner Kollegin zum Innenhof mit dem Dienstwagenparkplatz hinterher.
Mit einem wölfischen Grinsen bleibt sie vor einem quietsch-gelben, gut 15 Jahre alten Renault Twingo mit rotem Faltdach stehen. „Ist der nicht süß?“
Blanke Wut schäumt in Achim hoch. „Was ist das bitte schön für eine Scheiße? Was sollen wir mit dieser Hippie-Kutsche? Sind die völlig verblödet?“ Mit Schmackes tritt er gegen die linke Tür. Ein ploppendes Geräusch kündet von dünnem Blech. „Scheiße auch! Was hat die Kiste? 50 PS? 60 PS?“
„75 PS, Baujahr 1998. Und es ist ein Sondermodell, also etwas ganz Exquisites. Und …“ Sie breitet die Arme aus. „Ein Rolldach!!! Wahnsinn, oder?“
Widerwillig öffnet er die Tür und lässt sich auf den Beifahrersitz fallen. Mit voller Wucht schlägt er auf das Armaturenbrett. „Scheiße echt! 1998? Da hat der dicke Kohl uns regiert und wir hatten noch die D-Mark in der Tasche“, belfert er. „Das Ding hat ja noch nicht einmal einen Tacho! Aus gutem Grund. Ist ja eh überflüssiger Schnickschnack in dieser Kiste!“ Dann steigt er ungehalten wieder aus. „Wir fahren mit meinem Wagen. Wie so ein Scheiß-Pizzataxi nutzen wir halt jetzt unsere Privatwagen!“
„Setz dich wieder hin und komm mal klar, Boss! Privatwagen ist tabu, das weißt du selbst.“ Sie steigt ein und Achim folgt zögerlich ihrer Anweisung. Catherine weist auf einen schmalen Schlitz in der Mitte des Armaturenbretts zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. „Das ist der Digitaltacho. Süß, oder? War total hip in den 90er Jahren.“
„Fahr!“, schnauzt er sie an. „Ich will sehen, dass das Ding da was Dreistelliges anzeigt!“ Achim zeigt auf den Tacho-Schlitz.
Die ersten einhundert Kilometer verbringen die beiden schweigend. Dann nimmt Achim sein Handy und lässt sich von seiner Sekretärin zur Verwaltungsstelle der Einsatzfahrzeuge verbinden. „Mit wem spreche ich? Herrn Polizeihauptmeister Schargel? Also, Kollege, ich glaube, es hakt! Ich bin hier in einem Renault Twingo aus den 90er Jahren unterwegs und … Nein, es ist KEINE Stadtfahrt, verdammte Axt! Es geht nach Mecklenburg-Vorpommern! Hiermit protestiere ich auf das Schärfste! Und es ist mir scheißegal, ob gerade alle anderen Wagen für einen Sondereinsatz vergriffen sind. Wir sind bei der Polizei in Berlin, nicht Mandys Nagelstudio.“
Catherine musste schon die ganze Zeit ein wenig über ihren Chef grinsen, nun lacht sie laut. Das wiederum irritiert Achim, ja macht ihn ausnehmend wütend. Er hält das Mikrofon des Handys zu und schnauzt sie an: „Halt die Klappe! So kann ich niemanden qualifiziert anscheißen!“
Daraufhin muss Catherine noch lauter lachen, was ihn zur Verzweiflung bringt. Ungehalten belfert er in das Handy: „Sie hören noch von mir, KOLLEGE!“ Damit beendet er das Gespräch, Catherine erlangt langsam wieder ihre Fassung, muss aber weiterhin über beide Backen grinsen. „Wenn du dich weiter so ereiferst über dieses unabwendbare, grauenvolle Schicksal, bekomme ich Muskelkater im Gesicht. Schon seit wir gestartet sind, leide ich unter Grinsezwang.“
„Witzig!“, raunzt Achim. „Wir riskieren immerhin unser Leben für die Wahrung der Demokratie. Da darf man wenigstens davon ausgehen, dass wir …“ Achim fasst ungläubig in das große, offene Fach direkt im Armaturenbrett vor sich und lässt sich wieder in den mickrigen Sitz fallen. „Na, wenigstens hast du einen Airbag! Versuche also vorausschauend und vorsichtig zu fahren. Mir bleibt nur der Gurt.“
Gegen Mittag erreichen beide die Polizeistation in Neubrandenburg. Catherine stellt den Renault vor dem heruntergekommenen Plattenbau ab und beide melden sich bei der Wache an. Über einen kargen Flur mit Linoleum-Fußboden und einigen deplatzierten Postern mit Südseemotiven werden beide in einen Sitzungsraum gebracht, in dem bereits drei uniformierte Kollegen und eine Zivilbeamtin sitzen. Man stellt sich gegenseitig vor. Oberkommissarin Schlenzer vom LKA sowie die drei Kollegen der hiesigen Polizei machen auf Achim einen aufgeschlossenen Eindruck. Wenn die wüssten, unter welch erniedrigenden Umständen ihre Berliner Kollegen die Anreise hatten antreten müssen … Aber glücklicherweise parkt der Renault außerhalb der Station, und somit sind sie vor Häme erst einmal geschützt. Dann fällt ihm siedend heiß ein, dass der peinliche Moment unweigerlich kommen wird, wenn sie später zu dieser Nazi-Pinte fahren. Derart in seine Gedanken versunken, merkt er zuerst nicht, wie die LKA-Frau ihn vergeblich versucht anzusprechen.
„Achim!“, stupst Catherine ihn an. „Dein Typ ist gefragt!“
„Oh!“, entfährt es Achim. „Wie belieben?“
Irritiert blicken ihn die uniformierten Kollegen an, Frau Schlenzer, eine recht attraktive rothaarige Frau Mitte vierzig, grinst.
„Du sollst etwas über unseren Jesus erzählen!“ Seine Kollegin blickt ihn schelmisch an. „Oder soll ich das machen? Nach der Horrorfahrt, die dir sicherlich noch in den Knochen steckt?“
„Oh, hatten Sie ein Problem auf der Anreise?“, erkundigt sich Schlenzer.
„Nein, nein!“, winkt Achim leicht genervt ab. „Alles gut.“ Dann schildert er die Erkenntnislage über Ewald Schaar samt den Implikationen des letzten Jahres.
„Liebe Berliner Kollegen, vielen Dank!“, erwidert Schlenzer nachdenklich. „Diese Männer und Frauen, die Schaar nun zu treffen gedenkt, sind die – wenn man so will – Leistungsträger der rechtsradikalen Szene in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt auch Hinweise darauf, dass einige der sogenannten Kameraden aus Brandenburg mit von der Partie sind. Und das ist unser Problem damit: Eigentlich sind sie derart zerstritten, dass es bislang als unmöglich galt, sie alle an einen Tisch zu bekommen.“
„Genau das macht die Brisanz der Personalie Schaar ja aus“, meldet sich Catherine zu Wort. „Schaar verfügt über herausragende soziale Kompetenzen. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, eine Neue Rechte unter seiner Führung zu formieren.“
„Und deshalb müssen wir das Treffen heute im Auge behalten.“ Frau Schlenzer lehnt sich in ihrem Stuhl zurück und schaut zur Decke. „Was haben die vor?“
„Ich nehme an“, nimmt Achim den Gesprächsfaden wieder auf, „wir verfügen über keinerlei akustische Überwachungsmittel?“
Einer der Polizisten schüttelt den Kopf. „Wir sind zu kurzfristig an den Hinweis dieser Zusammenkunft gekommen. Es war nicht möglich, das entsprechende Material, geschweige denn eine richterliche Genehmigung zu erwirken.“
Achim muss an seine Nina denken und wie sie mit ihren Wanzen in der Kleingartenkolonie ein Treffen mit Neonazis hatte abhorchen können. Aber Nina ist eben eine Privatdetektivin. Sie verstieß damit zwar gegen allerlei Gesetze, aber eben nicht gegen Dienstvorschriften. Und Letzteres ist für einen Polizisten heilig.
„Uns bleibt also nur übrig zu gucken, wer so alles tatsächlich kommt. Und immerhin wissen wir, dass sie was im Schilde führen.“ Catherine sieht jeden in der Runde mit großen Augen an.
„Sie haben eine begnadete Mitarbeiterin!“, gratuliert einer der uniformierten Polizisten Achim ironisch.
„Richtig!“ Frau Schlenzer ergreift wieder die Initiative. „Da wir in Zivilkleidung sind …“, und damit deutet sie einladend auf Achim und Catherine, „nehmen wir Tuchfühlung auf. Meine Herren …“, wendet sie sich an die Polizisten, „ich bedanke mich für die Gastfreundschaft und die Zusammenarbeit.“ Dann wendet sie sich Achim zu: „Fahren wir mit Ihrem oder mit meinem Wagen?“
„Mit Ihrem!“, antwortet Achim schnell.
Leicht mokant grinsend fragt die Schlenzer: „Aber Sie wissen doch nicht, mit was für einer Kalesche ich unterwegs bin?“
„Ihr Kennzeichen dürfte hier den Ausschlag geben. Wir fahren mit dem dicken B herum“, entgegnet Achim betont beiläufig.
Catherine klatscht sich übertrieben theatralisch mit der rechten Hand an die Stirn: „Ja, stimmt! Genau! Das Kennzeichen!“ Dann blickt sie Schlenzer an. „Mein Kollege hat recht: Ihr Wagen ist eindeutig geeigneter.“
Das ungleiche Trio schlendert nach der Verabschiedung von den drei Kollegen zum Innenhof der Polizeistation: Schlenzer steuert auf einen rund drei Jahre alten VW Jetta zu. „Jaja, ich weiß, was Sie denken. Aber bei uns im Lande ist der Glamour-Faktor im Fuhrpark eher nebensächlich.“
„Och, täuschen Sie sich da nur nicht, Frau Kollegin“, entgegnet Catherine und zwinkert Achim zu. Dieser befürchtet zunehmend eine rivalisierende Stimmung zwischen den beiden Damen und fragt sich, was der Grund dafür sein könnte. Er setzt sich nach hinten auf die Rückbank.
Gerade fährt der Jetta durch das Tor der Polizeistation, da bremst Schlenzer unvermittelt nach einigen Metern ab und deutet auf einen abseits geparkten Renault Twingo mit Berliner Kennzeichen. „Da! Sehen Sie! Genauso einen hatte ich auch einmal! Vor 15 Jahren war das mein erstes Auto! Dass es das Modell noch gibt …“ Sie grinst verschmitzt. „Aber ich hatte natürlich kein Berliner Kennzeichen. Ich hatte HRO.“ Dann schaut sie in den Rückspiegel zu Achim und fragt unschuldig: „Ist das etwa Ihrer?“ Ohne die Antwort abzuwarten, fährt sie wieder an und lacht lauthals. Catherine fällt in das Gelächter mit ein und bietet ihrer Kollegin die rechte Hand zum Einschlagen, was Schlenz nur zu gerne annimmt.
Achim verdreht die Augen. Von wegen Stutenbissigkeit zwischen den beiden. Die verstehen sich besser als vermutet, diese Biester.
Nach gut einer guten halben Stunde steuert Schlenzer den Wagen rechts an den Randstein. Achim schaut um sich: Sie befinden sich in einem der typischen sterbenden Dörfer, deren Zukunft vorbestimmt zu sein scheint. „Trostlos!“, entfährt es ihm. Dann entdeckt er die Kneipe, um die es geht. Er hätte sie nicht als solche erkannt, wenn nicht in diesem Augenblick die vergammelten Holzrollläden hochgezogen worden wären. „Siehe da, die Wüste lebt.“
Catherine schaut auf die Uhr. „Es sind noch 30 Minuten bis zum Beginn des Treffens. Sind wir nicht zu nah dran? So ein vergleichsweise neuer Wagen mit drei Menschen drin … Ich fürchte, wir fallen auf!“
Achim nickt. „Zudem erhöhen wir die Bevölkerungsdichte dieses Dorfes gerade um round about 20 Prozent.“
„Was ist Ihr Vorschlag?“ Wieder schaut Schlenzer in den Rückspiegel. Sollen Ihre Kollegin und ich uns etwa als lesbisches Pärchen da drin an einen Nebentisch setzen?“
Achim winkt gelangweilt ab. Er hat beschlossen, sich heute nicht mehr provozieren zu lassen. In diesem Moment rattern weitere Rollläden geräuschvoll hoch. Er öffnet seine Tür und murmelt: „Muss meine Beine vertreten.“ Durch die Windschutzscheibe sieht er, wie Schlenzer empört den Kopf schüttelt und irgendwie gestikuliert, woraufhin Catherine lacht und beschwichtigende Bewegungen macht. Achim geht den schlecht erhaltenen Bürgersteig entlang. Verstohlen betrachtet er die Klingelschilder und stellt fest, dass rund die Hälfte der Wohnungen dem Anschein nach zu urteilen unbewohnt ist. Nach rund 200 Metern macht er kehrt. Beim der Kneipe gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus drückt er aufs Geratewohl gegen die Eingangstür und hat Glück. Sie ist offen. Kurz entschlossen schlüpft er durch den Spalt und versucht, das Licht des Flures mit einem altertümlichen Bakelitschalter anzuschalten: Negativ. Das freut ihn. Er nimmt die drei Stufen, um sich die Tür zur rechten Erdgeschoßwohnung anzusehen. Wieder hat er Glück: Hier fehlt sogar der Schließzylinder. Also drückt er gegen das Türblatt, das sofort nachgibt. Schnell huscht er in die Wohnung. Sie ist komplett ausgeräumt, wenn auch nicht als ganz besenrein zu bezeichnen. Dann ruft er Catherine an.
„Was ist?“, meldet sie sich. „Wolltest du Bier holen, hast dich aber verlaufen?“
„Parkt den Wagen bitte weiter hinten und kommt schnell zum Haus gegenüber der Kneipe. Ich lass euch dann rein. In fünfzehn Minuten kommt die Polit-Prominenz dieses bezaubernden Örtchens – also yalla yalla! Von hier hat man einen Panoramablick auf die Kaschemme.“
Fünf Minuten später stehen beide Frauen in der Wohnung neben Achim. Grinsend hält Catherine ein Fernglas mit Restlichtverstärker in die Höhe: „Ich kenne doch meinen Chef! Wenn er sich aufmacht zu einer Landpartie, dann wird es immer irgendwie aufregend!“
Dann geht es los. Die drei Beamten notieren sich die Namen der Ankömmlinge, die sie identifizieren können. Zur eigenen Überraschung erkannten sie jeden der 24 Männer und zwei Frauen. Nachdem auch Schaar als Letzter aus dem Wagen gestiegen ist und sie den Eindruck haben, dass nun alle Teilnehmer der Versammlung zugegen sein müssten, steht Frau Schlenzer auf und klopft Catherine und Achim auf die Schulter: „Wir sind richtig gut, wenn wir richtig gut zusammenarbeiten, was?“ Dann geht sie zur Tür der Wohnung.
Catherine erhebt sich: „Was haben Sie vor? Dürfen wir das auch erfahren? Immerhin steht gegenseitiger Informationsaustausch ganz oben auf der Zutatenliste zum Erfolg!“
„Sie haben Recht. Zuerst einmal eine Anregung zur Geschäftsordnung …“ Sie streckt Catherine ihre rechte Hand entgegen. „Ich bin Kirsten.“
„Ich bin Catherine. Und das da, also mein Chef …“, sie deutet mit einem lässigen Kopfnicken nach hinten zum Fenster, „das ich Achim. Ich beschließe hiermit für uns beide, dass wir mit dem Duzen einverstanden sind.“
Achim hüstelt auffallend laut. „Diese Selbstermächtigung ist nachträglich hiermit durch mein Einverständnis autorisiert und damit ausdrücklich anerkannt.“
„Wunderbar!“, freut sich Kirsten Schlenzer. „Ich gehe jetzt mal raus und notiere mir die Kennzeichen. Ich habe mir nämlich auch gemerkt, wer aus welchem Wagen vorgefahren ist.“
„Moment!“ Mit einer auch für ihn selbst überraschend eleganten Bewegung steht Achim auf. „Nicht alleine. Der Fahrer von Schaar ist zwar gerade wohl zum Tanken weggefahren … Aber sollte trotzdem etwas dazwischenkommen, spiele ich sehr gerne Quarterback.“
„Ja, aber bitte nicht zu auffällig.“
„Wenn die bemerken, dass sie beobachtet werden, dann schadet das doch nicht. Die Brandenburger Linie ist jetzt auch nun die Berliner Linie.“
„Achim!“, säuselt Kirsten nun ironisch. „Selbst wenn es hier im Landesinneren so aussieht wie in Brandenburg oder meinetwegen auch wie Köpenick … Dies hier ist Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben unsere eigene Strategie.“
Travemünde, 27. Januar 1940
Ein komisches Geräusch riss Helmut aus seinem Schlaf. Er setzte sich auf und entzündete ein Streichholz, suchte auf dem Beistelltisch seine Taschenuhr und wurde fündig und klappte sie auf. Es war fünf Uhr früh. Er schüttelte das brennende Hölzchen aus und lauschte weiter in die Stille hinein. Da, schon wieder! Nun hörte er das Tapsen nackter Füße auf dem blanken Boden. Instinktiv nahm er aus der Schublade des Beistelltisches seinen Revolver und setzte seinen linken Fuß auf, als das elektrische Licht seines Raumes angeschaltet wurde. Mit verquollenen Augen stand Waltraut im Nachthemd in der Tür, jammerte etwas von „Ich kann nicht schlafen“ und bemerkte dann mit angstgeweiteten Augen ihren Irrtum. Nach einigen Schrecksekunden, noch bevor Helmut ein Wort an sie richten konnte, fing sie an zu schreien.
Keine zwei Minuten später standen das Ehepaar Winz und Johann in Helmuts Zimmer. Frau Winz begriff sofort und nahm ihre Schwester in die Arme. „Ist doch gut. Du hast dich in der Tür geirrt. Schau!“, sie zeigte auf Helmut. „Das ist Helmut, der dir bei deinem Umzug geholfen hat. Erinnerst du dich?“
Johann grinste das erste Mal, seit Helmut ihn kannte. Schnell korrigierte Helmut sich in seiner Beobachtung: Vor der Machtergreifung der Nazis hatte Johann auch gelacht. Aber eben seither nicht.
Die unverhofften Zimmergäste trollten sich. Doch anschließend war es Helmut nicht mehr möglich weiterzuschlafen. Er nahm sich vor, ein wenig zu lesen, und griff zu einem der belanglosen Romane, die die Goebbels’sche Zensur überlebt hatten. Kurz darauf übermannte ihn dann doch die Müdigkeit.
Gegen sechs Uhr wachte Helmut wieder auf. Diesmal gab es keinen besonderen Anlass. Er stand auf, zog sich seine wärmste Kleidung an und verließ das Anwesen. Zuerst stand er unschlüssig vor dem Haus und horchte, um festzustellen, wo das Meer lag. Dann ging er die Kaiserallee weiter in Richtung Norden. Dort bog er rechts ab und sah bereits das Wasser. Auf der Strandpromenade wanderte er nach Osten in Richtung der Mündung der Trave. Wenn er nicht irrte, lag dort auch das Kurhaus. Der Wind frischte auf, der Himmel war betörend klar und er wanderte mit sich und der Welt zufrieden auf den Leuchtturm zu, dessen wanderndes Licht eine für Helmut faszinierende, ja fast mystische Wirkung hatte. Einige Minuten später stand er an der Mündung der Trave in die Ostsee und betrachtete das andere Ufer, den seit einigen Monaten für Zivilisten gesperrten Priwall. Seine innere Uhr sagte ihm, dass er rund 45 Minuten unterwegs gewesen sein musste. Um 9.00 Uhr wurde im Hause Winz üblicherweise gefrühstückt. Also blieben ihm noch rund zwei Stunden. Kurz überdachte er seine Optionen und kam zu dem Ergebnis, seine Erkundungsrunde nachts fortzusetzen. Also schlenderte er zurück. Sein Weg führte ihn wieder am Kurhaus vorbei in die Kaiserallee, wo sich eine Person mit gravitätischen Schritten auf ihn zubewegte. Zwischen ihnen lagen noch gut 100 Meter. Doch der Abstand verkürzte sich schnell und ihm war, als erkenne er die Person wieder. Sicher: Es war dunkel, aber dieser Gang, diese Körperhaltung … Da wurde ihm klar: Es konnte sich nur um Waltraut handeln.
„Waltraut?“ Mit gedämpfter Stimme sprach Helmut sie an. Er wollte verhindern, dass sie sich erschrak. Wer wusste schon, in welcher gedanklichen Welt sie sich gerade befand. Fror sie etwa nicht?
Tatsächlich blieb Waltraut abrupt stehen und starrte ihn an.
„Ich bin es, Helmut. Der, der mit dir von Berlin hierhergefahren ist. Aber in dem anderen Auto.“ Langsam schritt er weiter auf sie zu. „Du brauchst keine Angst zu haben.“ Mit diesen Worten nahm er ihren rechten Arm. „Komm. Wir gehen nach Hause. Es gibt gleich Frühstück. Und zu Hause ist es schön warm.“
Schweigend ließ Waltraut es zu, dass Helmut sie zurück zum Ferienanwesen führte. Kaum waren die beiden Spaziergänger im Vestibül der Villa erschienen, da eilte ihnen Johann aufgeregt entgegen. „Herrje, wo kommt ihr denn her?“ Sichtlich aufgeregt nahm er das Kinn von Waltraut zwischen Zeigefinger und Daumen.
„Ich habe sie gerade auf der Kaiserallee getroffen. Dann sind wir direkt hierher zurück.“
„Komm, du Schlingel!“, neckte Johann seinen Schützling. „Du wäschst dich jetzt erst einmal, dann ziehst du dich ordentlich an und wir frühstücken. Ist das ein Angebot?“
Waltraut fing plötzlich an zu strahlen, fiel dem erschrockenen Johann um den Hals, gab ihm einen dicken Kuss auf die Wange und stieg eilig die Treppe hinauf.
Johann sah Helmut ein wenig verlegen an und wollte gerade gehen, da klopfte Helmut seinem alten Bekannten auf die Schulter. „Sie mag dich! Gratulation. Du scheinst einen besonderen Zugang zu Waltraut zu haben.“ Dann machte er eine kleine Pause und ergänzte mit ernster Miene: „Und es freut mich, dass es dir hier offensichtlich gefällt.“
Auf seine Schuhspitzen blickend murmelte Johann: „Helmut, du hast mich aus einer verzweifelten Lage befreit. In Berlin war ich ein schlecht bezahlter jüdischer Kellner, meine Frau ist weiterhin spurlos verschwunden. Nicht selten konnte ich mir monatelang kein ordentliches Essen leisten. Und dass ich nun hier bin mit einer ehrenwerten Aufgabe, unter dem Schutz des großen Namens Winz und dann alles das hier …“ Er deutete vielsagend auf den Überfluss des Anwesens. „Ich werde dir ewig dankbar sein. Aber wir müssen aufpassen!“ Er machte ein sehr ernstes Gesicht. „Waltraut ist sich selbst die größte Gefahr. Sie schlafwandelt. Ich werde sie nun abends entweder einschließen müssen oder mir etwas anderes einfallen lassen. Nicht auszudenken, wenn sie an den Falschen gerät. Die Gestapo in Lübeck hat einen reichsweiten Ruf und gilt als besonders rücksichtslos.“
„Hmm …“, grummelt Helmut nachdenklich. „Du hast sicherlich Recht.“ Dann lächelte er sein Gegenüber wieder an. „Es freut mich aufrichtig, dir zu helfen, Johann. Aber du hilfst auch der Familie Winz. Das alles hier ist keine Einbahnstraße und keinesfalls frei von Risiko für uns alle.“
Nach dem Frühstück, das fast schon in ausgelassener Stimmung verlaufen war, nahm Helmut Winz zur Seite, während Frau Winz mit Waltraut und Johann in den Garten ging.
„Heinz, ich bleibe ein paar Tage und fahre am Montag zur Gestapo-Zentrale in Lübeck. Mal sehen, was da für Kollegen herumlaufen und woran sie arbeiten. Ich werde versuchen herauszufinden, wie die Gestapo hier in Travemünde aufgestellt ist.“
„Danke, Helmut. Ich weiß, was du auf dich nimmst.“ Ein wenig verlegen schaute er Helmut an. „Und meine Frau ist sich dessen auch bewusst. Aber sie kann es nicht zeigen. Du kennst sie ja.“
„Schon gut. Wir müssen einige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, Heinz. Und dazu muss ich dir ein paar Fragen stellen. Können wir das im Salon erledigen?“
„Ja, gute Idee! Und dazu rauche ich eine gute Zigarre und wir genehmigen uns einen tüchtigen Schluck Whisky.“
Wenige Minuten später saßen beide Männer in großen Clubsesseln. Während Heinz Winz genüsslich seine Zigarre betrachtete, nahm Helmut seinen Tabak-Beutel und stopfte seine Lieblingspfeife. Vor ihnen auf dem Tisch standen zwei gut eingeschenkte Whisky-Gläser. Der Hausherr eröffnete das Gespräch. „Wir sollten die ernsten Dinge nun gewissenhaft besprechen, ohne den Genuss zu vergessen. Also: Du bist hier der Fachmann. Was gilt es abzusprechen?“
Helmut nahm genüsslich den ersten Zug seiner Pfeife. „Wie gesagt, ich sondiere in Lübeck, wie scharf die Behörden hier in Travemünde agieren. Meines Erachtens haben wir aber drei Punkte, die jetzt schon zu beachten sind. Erstens: Hast du hier Personal? Einen Gärtner? Eine Haushälterin?“
„Ich habe alle in andere Häuser hier in Travemünde vermittelt. Außer den jetzt Anwesenden hat hier niemand Zutritt.“ Winz nahm eines der beiden Gläser und hielt es in die Höhe.
Helmut erwiderte den Prost und nickte zufrieden. „Der Garten hinten sollte dichter bepflanzt werden. Und ein Sichtschutz muss her. Kennst du die Besitzer der beiden Nachbaranwesen?“
„Nein, beides ist in neuen Händen. Vorher wohnten dort Juden.“
Mit ernster Miene setzte sich Helmut aufrecht hin und beugte sich nach vorn. „Nun, das ist weniger ermutigend. Die arisierten Besitztümer wechselten nicht selten in regimetreue Hände.“ Nachdenklich tippte er mit dem Mundstück seiner Pfeife gegen die Tischkante. „Dann führt kein Weg an einem hohen Sichtschutz vorbei, der auch im Herbst und Winter funktioniert. Ich fürchte, es wäre nur eine Mauer geeignet.“
Winz schüttelte den Kopf. „Das wäre sicherlich viel zu auffällig. Es zöge Fragen nach sich.“
Helmut stand auf, ging zum großen Fenster mit Ausblick auf den Garten und drehte sich wieder zu Winz. „Ich glaube, ich habe schon einen Weg gefunden. Und damit bekommt der Besuch am Montag bei meinen Kollegen gleich einen offiziellen Anstrich.“ Grinsend setzte er sich wieder in den Sessel. „Und nun der dritte Punkt: Ich habe heute Morgen Waltraut bei meinem frühmorgendlichen Spaziergang bei einem heimlichen Ausflug erwischt. Sie scheint Schlafwandlerin zu sein. Ich fürchte, wir müssen sie nachts in ihrem Zimmer einschließen.“ Helmut ließ die Worte auf seinen künftigen Schwiegervater wirken.
„Recht hast du, auch wenn es mir überhaupt nicht gefällt.“ Winz rutschte nun seinerseits nach vorne. „Oder ich verstecke sie einfach woanders, kaufe etwas Neues … im Harz vielleicht, oder …“ Winz schüttelte ratlos seinen Kopf.
„Oder auf dem Obersalzberg? Gleich in der Nähe des Berghofes?“ Helmut lachte leise. „Im Auge des Hurrikans soll es ja windstill sein. Nein, lieber Heinz. Das hier ist gar nicht so schlecht. Du wirst überall die gleichen Probleme vorfinden. Und hier kann ich dafür sorgen, dass die Abschirmung des Gebäudes fast schon eine staatliche Maßnahme darstellt. Ich habe da ein Ass im Ärmel.“
Lübeck, 28. Januar 1940
Helmut fuhr mit seinem DKW über die Israelsdorfer Straße durch das Burgtor in die Lübecker Innenstadt hinein. In Gedanken war er in den Gebieten, die früher mal Polen waren. Mit Stalin war vereinbart worden, dass dort und in den baltischen Staaten lebende Deutsche dieser Tage ins Reichsgebiet umgesiedelt werden sollten. Es musste sich um mehrere 10.000 Menschen handeln. Ob die im Zweifel alle begeistert waren, ihre Heimat zu verlassen? Helmut lenkte seine Gedanken auf die nächsten Minuten. Lübeck war mit Sicherheit eine der schönsten Städte des Reiches. Einige bedeutende Personen kamen aus dieser Stadt. Aber es war heute nicht ungefährlich, dies so zu sehen. Thomas Mann war schließlich einer der geächteten liberalen Mitbürger. Aus einer einst reichen Patrizierstadt war eine rote Hochburg geworden, nun war sie braun. Aus seiner linken Manteltasche nestelte er einen Zettel mit der Adresse der Gestapo-Zentrale hervor. An der Parade 10 im Zeughaus. Die Adresse des Schreckens. In unmittelbarer Nähe des Lübecker Doms stellte er seinen Wagen ab und stapfte durch den tiefen Schnee. Es fing gerade wieder an zu schneien. Die Gestapo-Zentrale, das ehemalige Zeughaus, welches zwischenzeitlich zu einem Museum und zu einer Polizeistation umgewidmet worden war, lag friedlich eingereiht in schöne, alte Häuser. Der Geruch von Kohleöfen lag in der Luft. Entschlossenen Schrittes ging Helmut zum Hauptportal und klopfte. Ein SS-Mann öffnete: „Heil Hitler! Was wollen Sie?“
„Heil Hitler! Ich bin Kriminaloberkommissar Rems vom Reichssicherheitshauptamt. Ich wünsche mit dem Leiter der Gestapo hier zu sprechen. Es handelt sich um eine dringende dienstliche Angelegenheit, wie Sie sich denken können, Kamerad!“
Die Körperspannung des Wachmannes entwickelte sich in die von Helmut gewünschte Richtung. Sie nahm von einem durchaus ansprechenden Niveau noch erheblich zu. Der Mann überstreckte sein Kinn derart und seine Hacken klackten so laut, dass gesundheitliche Folgen nicht ganz auszuschließen waren. Helmut war es recht.
„Jawoll!“, schmetterte die SS-Wache. „Ich werde umgehend Meldung machen!“ Ohne eine entsprechende Vorahnung seitens Helmut wurde ihm die Tür unvermittelt vor der Nase wieder zugeschlagen. Gerade wollte sich Ärger in ihm entwickeln, da öffnete sich die Tür wieder und der SS-Mann flüsterte verlegen: „Entschuldigen Sie, Herr Obersturmbannführer, aber das ist Vorschrift!“ Wieder schloss sich die Tür, diesmal leiser. Helmut musste in sich hineinschmunzeln. Er murmelte leise: „Oberkommissar, ich bin Oberkommissar. Kein Nazi.“
Wenige Augenblicke später wurde die Tür erneut aufgerissen und der SS-Mann stand vor ihm mit einem Gesichtsausdruck, der erfreuliche Nachrichten verhieß: „Obersturmbannführer John freut sich, Sie empfangen zu dürfen! Er ist der kommissarische Leiter hier.“
„Ich Glückspilz!“, murmelte Helmut vor sich hin, nahm die letzte Stufe und stand im Vorraum.
„Wie belieben?“, fragte der Mann vor ihm, der nur das Genuschel des unverhofften Gastes aus Berlin vernommen hatte.
„Ich sagte, dass Sie es hier schön warm haben“, improvisierte Helmut.
Verlegen gestand der Soldat: „Ja, deshalb stehe ich auch hier drinnen Gewehr bei Fuß. Der Herr Obersturmbannführer hat es genehmigt. Er erwartet Sie im zweiten Obergeschoß rechts.“
Helmut nickte und stieg die Treppe hinauf. Alexander John war ein untersetzter Endfünfziger, vergleichsweise alt für einen SS- oder Gestapomann. Er erwartete seinen unverhofften Gast bereits. Ein sympathischer Kerl auf den ersten Blick, wenn nicht diese Uniform und die damit verbundene innere Haltung gewesen wären. „Heil Hitler! Herr Oberkommissar Rems, kommen Sie herein!“ Es ging an drei Büros vorbei, in denen eng an eng Männer und wenige Frauen an ihren Schreibtischen saßen und arbeiteten.
Am Ende des Ganges betraten beide ein recht kleines Büro und John wies Helmut den Besucherplatz am Schreibtisch zu. „Was kann ich für das Reichssicherheitshauptamt tun? Oder besser: Was tun Sie bereits in meinen Gefilden?“ Sein Ton und seine Mimik waren freundlich, die Augen hatten jedoch etwas Lauerndes.
„Herr Obersturmbannführer, ich bin hier in geheimer Mission. Um diese erfolgreich durchzuführen, müssen wir allerdings ein wenig kooperieren. Setzen Sie mich bitte erst einmal in kurzen Zügen über die innere politische Festigung in Lübeck ins Bild.“
John schilderte den Kampf gegen die immerwährende bolschewistische Gefahr, die unermüdlichen Bestrebungen, den deutschen Volkskörper von kranken Ideen zu befreien. Besonders häufig wies er auf die sehr beengten Verhältnisse hin, unter denen über 40 Männer und Frauen im viel zu kleinen Zeughaus ihren Aufgaben nachzugehen hatten. Es sei kein Zuckerschlecken hier.
Nach Selbstbeweihräucherung und Selbstmitleid legte John eine bedeutungsvolle Pause ein und wartete darauf, was sein Mitstreiter aus der Reichshauptstadt von ihm wollte.
Bevor Helmut ihm diesen Gefallen tat, hatte er eine Nachfrage. „Und was ist über Travemünde zu sagen?“
Nun beugte sich John misstrauisch vor und stützte sich mit beiden Ellenbogen auf die Schreibtischplatte. „Nichts Besonderes. Es ist ruhiger dort geworden, seit der Priwall kein Ort für bürgerliche Zerstreuung mehr ist, sondern ein Sperrgebiet.“
„Hmm“, brummte Helmut nur nachdenklich. „Nun komme ich zu meinem Anliegen. Aber lesen Sie erst einmal meine Vollmacht von Oberführer Arthur Nebe.“ Er überreichte ihm den Schrieb von Nebe, der besagte, dass Helmut Rems in dessen unmittelbarem Auftrag handele und alle polizeilichen Dienststellen angewiesen seien, seine Anweisungen uneingeschränkt zu befolgen. Diese Urkunde hatte Nebe ihm ausgestellt, um sich der Dienste von Helmut im eigenen Interesse auch außerhalb des Reichssicherheitshauptamtes sicher zu sein.
John war sichtlich beeindruckt, blieb aber weiterhin auf Distanz. „Und was kann ich für Sie tun?“
„Es gibt in Travemünde ein Anwesen, auf welchem wir einige Sicherungsmaßnahmen durchführen werden. Diese Maßnahmen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Fragen aufwerfen. Das Grundstück wird in Kürze stärker eingefriedet und ab sofort streng gesichert. Ich möchte, dass Sie bei entsprechenden Nachfragen darauf hinweisen, dass auf diese Fragen aus Gründen der strikten Geheimhaltung keine weiteren Antworten gegeben werden können.“
John lehnte sich wieder zurück. Das, was er zu hören bekam, konnte ihm sicherlich nicht gefallen. Ein Mann, dessen Aufgabe darin bestand, Geheimnissen auf den Grund zu gehen, ja diese sogar unter Gewaltanwendung zu erlangen, konnte nicht damit zufrieden sein, von einem Geheimnis nur oberflächliche Kenntnis zu haben. Und Helmut hatte ihm sogar unverblümt eröffnet, dass auch er künftig keine Details erfahren würde. „Und warum darf der hier höchste Vertreter der Geheimen Staatspolizei nicht wissen, was Sie dort so zu treiben gedenken? Wie stellen Sie sich das vor?“
„Ganz einfach …“, Helmut holte seinen Tabaksack hervor und begann, sich eine Pfeife zu stopfen. „Sie wissen, dass das Reichssicherheitshauptamt dort einem Geheimprojekt nachgeht. Und Sie wissen, dass es darüber hinaus nichts zu wissen gibt. Wer auch immer versucht, dem Projekt nachzugehen, dem droht unweigerlich Schutzhaft. Jedem.“
Abrupt stand John auf, blieb aber anschließend unschlüssig stehen. Dann hatte er sich wieder gefasst. „Sie drohen mir?“
Helmut schüttelte den Kopf. „Durchaus nicht. Ich kündige nur die Konsequenzen bei Zuwiderhandlung an.“ Er war mit der Pfeife fertig und nestelte nach seinen Streichhölzern. „Oder soll ich Oberführer Nebe von Ihren Bedenken Kenntnis geben? Oder besser noch von Ihrem Unverständnis über die Tatsache, dass die dem Reichsführer SS Himmler nachgeordneten Behörden auf höchster Ebene Geheimoperationen nachgehen?“ Damit zündete er seine Pfeife an und betrachtete die Glut im Kopf. „Wie soll ich nun verfahren? Nebe von Ihrer uneingeschränkten Kooperation berichten oder von Ihrem egoistischen Unbehagen über die Tatsache, außen vor zu sein?“
„Was bilden Sie sich ein!“, brüllte John vollends außer Rand und Band. „Soweit ich weiß, sind Sie weder Mitglied der Partei noch der SS! Oder gar der SA! Was erlauben Sie sich gegenüber einem Mann der ersten Stunde unserer Bewegung?“
Wortlos paffend wedelte Helmut nur mit der Vollmacht und versuchte einigermaßen erfolgreich einen Kringel aus Rauch in die Stubenluft abzusondern.
„Sie hochnäsiger Pimpf!“, schnarrte John.
Nun war es an Helmut, sich zu empören. „Was glauben Sie, wozu mich dieser Wisch ermächtigt? Soll ich etwa die Wache rufen und Sie in Schutzhaft nehmen? Auf diese Weise würde ich auch gleich Ihren legendär gemütlichen Keller und die darin befindlichen Zellen inspizieren können.“
Nun schrie John: „Ich scheiße auf Nebe! Er ist Ihr Vorgesetzter im Amt V des Reichssicherheitshauptamtes! Mein Vorgesetzter ist Heinrich Müller, Leiter des Amtes IV! Und damit wische ich mir meinen Arsch mit dem Persilschein Ihres Oberführers ab!“
„Ich nehme an“, antwortete Helmut in aufreizend ruhigem Ton, „dass dies zitierfähig ist? Und dass Sie folgerichtig die Kooperation mit mir ausschlagen? Ist das das Ergebnis dieser … dieser Unterredung?“
„Verdammt noch eins!“, schnarrte John und stampfte mit seinem rechten Stiefel auf wie ein trotziges Kind. „Natürlich nicht!“
„Nun denn“, erhob sich Helmut, nahm einen genussvollen Zug aus der Pfeife und ging ruhig zur Tür, „dann haben wir ja unsere Territorien abgesteckt. Sie scheißen auf das Amt V von Nebe auf Ihrem Gebiet und achten dafür die Zuständigkeit des Anwesens in Travemünde. Und dieses untersteht dem Amt V.“ Er zog einen Zettel mit seiner Dienstadresse aus dem Mantel und legte ihn auf den Schreibtisch. „Sollte ich eine Zuwiderhandlung feststellen oder Meldung darüber bekommen, dass Sie uns Steine in den Weg legen, so wird Nebe diesen Umstand nicht Ihrem Vorgesetzten melden, sondern direkt Reichsleiter Bouhler aus der Kanzlei des Führers.“ Er schritt zur Tür. „Ich darf mich empfehlen. Heil Hitler!“
Vorbei an den Zimmern mit den geschäftigen Gestapo-Mitarbeitern, die allesamt Zeuge des Gebrülls gewesen waren, eilte Helmut flüchtig zum Abschied nickend den Gang zurück, nahm die Treppe und passierte den Wachmann, der den Gast reichlich verunsichert verabschiedete.
Helmut brauchte dringend frische Luft. Auch wenn es nun wieder recht kalt war und dichter Schnee fiel, wollte er ein wenig zu Fuß durch Lübeck laufen und nachdenken. Mit einer solchen Eskalation hatte er selbst nicht gerechnet. Und diese Auseinandersetzung hatte alles Potential, irgendwann einmal Staub aufzuwirbeln – genau das Gegenteil dessen, was er zu beabsichtigen gedachte. Helmut überquerte den großen Bauhof und gelangte über die Hartengrube zur Obertrave. Dieser Straße am Wasser folgte er in Richtung Holstentor. Über die Holstenbrücke kam er zum berühmte Tor und dem neu arrangierten Adolf-Hitler-Platz. Dort machte er kehrt, schlug sich durch die zahlreichen „Gruben“ genannten Nebenstraßen über den Klingenberg durch die Straße, die passenderweise „Fegefeuer“ hieß. An der Gestapo-Zentrale vorbei gelangte er zurück zu seinem Wagen. Er wischte mit seinem rechten Ärmel den frischen Schnee von den Fenstern des DKW, räumte den Neuschnee vor den Reifen weg, stieg ein und fuhr los. Während der Fahrt wurde ihm klar, dass er dem Anwesen in Travemünde eine offizielle Deckung zukommen lassen musste. Die Idee, die Gestapo hier in Lübeck einfach zum Stillhalten zu bringen, hatte sich schlicht als zu naiv herausgestellt.
Nach gut 20 Kilometern bog er vorsichtig in die Kaiserallee in Travemünde ein und stellte den Wagen vor der Villa ab. Er sah auf seine Taschenuhr: Es war 14 Uhr. Johann öffnete die Tür und teilte ihm mit, dass sich die anderen im Salon versammelt hätten und jeder seinen eigenen Gedanken nachhänge. In der Tat spielten Heinz Winz und seine Gattin zusammen eine Partie Schach. In gewissen Kreisen war die Teilnahme von Frauen an diesem Strategiespiel noch immer ungewöhnlich, obgleich es bereits seit vielen Jahren sogar eigens für Frauen zugelassene Schachvereine gab. Aber Mann gegen Frau stellte noch immer eher die Ausnahme dar. Die Winzens waren jedoch schon immer besonders, das war Helmut nicht nur in seiner Beziehung zu Isolde klargeworden. Waltraut ging Näharbeiten nach und Johann nahm seine Rolle als vollwertiges Familienmitglied an, setzte sich in einen Ohrensessel und las eine Zeitschrift.
Heinz Winz bemerkte Helmut erst sehr spät, unterbrach die Partie und ging gut gelaunt auf Helmut zu. „Hallo mein Junge. Wie war es in Lübeck?“
Helmut zog es vor, ein ernstes Gesicht aufzulegen und nicht um den heißen Brei herumzureden. „Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten?“
Schlagartig zog auch in das Gesicht von Winz Ernsthaftigkeit ein. „Selbstverständlich. Lass uns in den Garten gehen.“ Dann sah er das Schneetreiben. „Nein. Wir gehen besser in die Bibliothek.“
Dort schilderte Helmut in knappen Worten seine Auseinandersetzung mit John.
„Und was folgt aus dieser vermaledeiten Situation?“ Winz wirkte sehr betroffen, zeigte aber keinerlei Anzeichen von Schuldzuweisungen in Helmuts Richtung.
„Wir geben vor, dass hier im Auftrag einer deiner Firmen, bei denen du Beteiligungen hast, die Euthanasie-Maßnahmen evaluiert werden.“ Helmut war sich der Güte seines Vorschlages selbst nicht ganz sicher, etwas anderes war ihm aber während der Fahrt nicht eingefallen.
Winz schüttelte heftig den Kopf. „Das ist gefährlich. Wer Auswertungen macht und Prozesse evaluiert, muss Potentiale aufweisen, Verbesserungen vorschlagen. Und ich will das nicht!“
In diesem Augenblick lief es Helmut heiß und kalt über den Rücken. Sein Vorschlag hatte noch eine weitere erhebliche Schwäche: Man könnte in die Situation geraten, zum Büttel des Systems zu werden. Er nickte niedergeschlagen. Dann kam ihm urplötzlich eine weitere Idee: „Heinz! Wie wäre es, wenn du im Auftrag einer deiner Firmen Statistiken anfertigst? Sagen wir mal über die Fallzahlen der Tötungen in den sogenannten Heilanstalten. Das hätte zwei Vorteile: Zum einen wäre das eine Aufgabe, ohne dass wir das System an sich unterstützen. Wir werten nur aus. Und mit diesen Zahlen hätten wir Material, um mit den Kirchen zu sprechen und ihnen das Ausmaß klarzumachen. Und das wäre der zweite Vorteil!“ Fast schon empfand Helmut eine gewisse Euphorie. Die Daten vom Staat verdeckt zu sammeln und so politisch zu nutzen – was für ein teuflischer Plan!