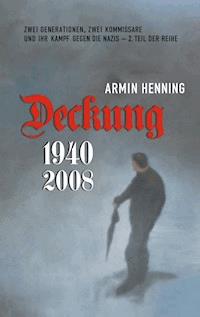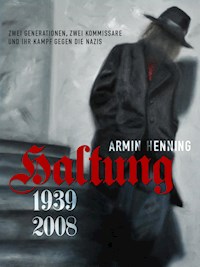
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Haltung - zwei Kommissare, zwei Generationen und ihr Kampf gegen die Nazis Berlin, 1939: Helmut Rems ist Oberkommissar im Reichssicherheitshauptamt und genießt das Vertrauen seines Vorgesetzen, SS-Oberführer Arthur Nebe, einem technokratisch-kühlen Nationalsozialisten. Doch Helmut führt ein Doppelleben: Als im Herzen überzeugter Demokrat nutzt er sein Wissen über das perfide Vorgehen und die grausamen Ziele des nationalsozialistischen Polizeiapparats, um seine demokratischen Gesinnungsgenossen im Untergrund zu schützen und das Herrschaftssystem der Nazis zu sabotieren. Auch seine Liebe zu Isolde, der Tochter eines einflussreichen Industriellen und Intimfreund der führenden Parteigarde, wird dabei auf eine harte Probe gestellt. Beruflich wie privat wird sein Leben für Helmut zu einem bedrohlichen Balanceakt - immer verfolgt von der stetigen Angst, entdeckt zu werden. Berlin, 2008: Ein neuer, charismatischer Anführer sorgt für Bewegung in der rechten Szene und für Unruhe bei den Behörden, als er beginnt, eine rechtsextremistische Zelle in Berlin zu professionalisieren. Achim Rems ist Beamter beim Berliner Landeskriminalamt, der im Kampf gegen die Neonazis eingesetzt wird. Als sein Großvater Helmut Rems im Sterben liegt, überlässt er seinem Enkel seine Tagebücher aus dem Dritten Reich. Durch deren Lektüre entdeckt Achim ein lange gut verborgenes Geheimnis. Und plötzlich droht ein mehr als sechzig Jahre untergetauchter Kriegsverbrecher, einen handfesten politischen Skandal in Berlin auszulösen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Teil 1
Bundesrepublik Deutschland im Frühjahr 2008
Das Dritte Reich im Herbst 1939
Teil 2
Die Bundesrepublik im Frühjahr 2008
Das Dritte Reich im Herbst 1939
Teil 3
Die Bundesrepublik im Frühsommer 2008
Das Dritte Reich im Herbst 1939
Teil 4
Die Bundesrepublik im Sommer 2008
Das Dritte Reich im Winter 1939
Prolog
Berlin, 26. September 1939
Helmut nahm den letzten Zug seiner Reemtsma R 6 und schnipste diese aus dem geöffneten Fenster seines privaten Automobils, einem grünen DKW Front. Zu dieser Stunde war er nicht, wie sonst so häufig, als Polizist unterwegs in den Straßen Berlins und observierte ein Haus. Er war privat hier. Aus sicherer Entfernung hatte er gesehen, wie vor wenigen Minuten drei gut gelaunte Männer des Sicherheitsdienstes (SD) das Haus in der Winsstraße verlassen hatten. Sie verließen ihren Folterkeller und gingen nun nach Hause zu ihren Frauen und Kindern. Nach getaner Arbeit, endlich einmal abschalten. Er legte die alte Zeitung weg, in der die Lebensmittelverordnung verkündet worden war. Also gab es bestimmte Nahrungsmittel wieder gegen Vorlage von Lebensmittelkarten. Er griff nach der Geneverflasche und zwei eingepackten Zigarettenstangen links neben sich und stieg aus dem Wagen. Im zweiten Hinterhof nahm er die Treppe zum Keller hinab und klopfte, wie verabredet, dreimal an die Kellertür. Helmut brauchte nicht lange zu warten. Die Tür ging auf und da stand er schon, der Hartmut. Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn. Kein Wunder bei der körperlichen Arbeit, die er offenkundig hatte verrichten müssen.
»Heil Hitler!«, brüllte er und bat seinen Gast in die gute Stube. »Hab meinen Kollegen gesagt, dass ich noch aufräume und sie damit nach Hause geschickt.« Er führte Helmut einen Kellergang entlang. Ihm wurde umgehend übel. Es roch zunehmend nach Blut, Erbrochenem, Urin und Angst, je weiter sie den Gang entlangschritten. Diese widerlichen Geruchseindrücke drängten selbst den typischen Kellermief erfolgreich zurück. Hartmut leitete Helmut einen Gang hindurch, bis sie einen größeren Kellerraum erreichten. »Finde ich ja toll, dass du mich mit dem Zeugs versorgst. Wie soll ich das wiedergutmachen?« Beiläufig zeigte er auf den Körper einer vermutlich jungen Frau. »Hat ganz schön gesungen. War am Anfang aber sehr zäh, die Schlampe!«
»Das mit der Gegenleistung fällt mir bestimmt bald ein. Lass dich überraschen.«
Zuerst stutzte er, dann grinste er wieder: »Was hast du denn Schönes in der Hand?«
Kumpelhaft schlug Helmut seinem Gastgeber auf die Schulter. »Was ganz Feines: echter Genever. Vorkriegsware!«
»Du Aufschneider! Wir sind erst ein paar Tage im Krieg! Den Polacken kommt das zwar anders vor, aber guck auf den Kalender! Selbst mein Bäcker handelt noch mit Vorkriegsware!«
Helmut riskierte einen kurzen Blick zum Bündel Mensch in der Ecke. »Und was hat sie gesungen?« Im Stillen litt er mit dem armen Geschöpf.
Mit gerunzelter Stirn betrachtete Hartmut seinen Gast. »Seit wann interessiert sich die Kriminalpolizei für das, was der SD macht?«
»Ab morgen sind wir eine Truppe. Denn wir beziehen die Räumlichkeiten des Reichssicherheitshauptamtes. Da ziehen die verschiedenen deutschen Polizei-Institutionen an einem Strang!« Kurze Pause. »Also: Was hat sie gesungen?«
»Sie hat sechs Namen einer kommunistischen Terrorzelle verraten. Ich muss den Durchschlag noch aufs Amt bringen. Übermorgen erfolgt dann der Zugriff und ab ins KZ Sachsenhausen in Schutzhaft. Weg mit dem Gesindel!«
Volltreffer! Helmut entdeckte auf dem Schreibtisch einen Stapel Papier.
»Warum erledigt ihr das denn in so einem Keller? Gehen dem SD die Folterkeller aus?« Er blickte dabei erneut beiläufig auf die Leiche. »Und hier ist die Flasche. Dir gehört der erste Schluck!«
»Tja, Ehre dem, dem Ehre gebührt!« Der Nazischlächter machte einen Schritt auf Helmut zu und nahm sich die Flasche, drehte den Schraubverschluss auf und setzte den Genever an. Voller Anerkennung nickend gab er die Flasche zurück und lachte. »Guter Stoff, was da so von den Franzosen kommt. Nun, die offiziellen Keller für solcherlei Arbeit des SD sind in der Tat sehr gut ausgelastet. Aber heute haben wir es hier erledigt, weil wir keine Zeit verlieren wollten. Der resolute Kampf gegen die Kommunisten wird sicher schwieriger in der nahen Zukunft. Habe gehört, dass wir verstärkt in Polen gefragt sein werden. Es tun sich leider neue Schwerpunkte auf.«
»Niederländisch. Oder Belgisch!«, raunte Helmut und schlug Hartmut plötzlich, wie aus dem Nichts, seine Faust auf den Nasenrücken. »Genever kommt nicht aus Frankreich.« Mit ungläubigem Blick stolperte der Geschlagene einige Meter zurück und fiel über die eigenen Füße. Mit dem Totschläger zog ihm Helmut noch eine über den Schädel. Mit schnellen Bewegungen stopfte er dem Schlächter mit einem auf dem Boden liegenden Lappen den Mund, fesselte ihn mit einer an der Decke umgelenkten Eisenkette an den Händen und zog ihn danach nach oben, so dass seine Zehenspitzen den Boden leicht berührten. Der SD-Mann kam wieder zu sich.
Mit scheinbarer Seelenruhe widmete sich Helmut dem Papierberg. Es handelte sich tatsächlich um das Verhörprotokoll. Flüchtig geschrieben und in schlechtem Deutsch. Auch Sekretärinnen wurden offenbar langsam knapp. Diese Truppe würde entsprechende Unterstützung benötigen, schmunzelte Helmut in sich hinein. Die Tote hatte alles verraten. Sechs Namen mit Adressen standen auf der Liste. Alle wohnten hier im Bezirk Prenzlauer Berg. Helmut ging zum Radiogerät und schaltete dieses ein. Sorgsam verschloss er alle Türen und Fenster, kehrte erneut zum Empfänger zurück und stellte ihn auf laut. Marschmusik ertönte. Er riss dem Nazi den Lappen aus dem Mund und schüttete ihm ein wenig Genever in den Mund. Hartmut prustete, konnte sich jedoch nicht wehren. Diese besondere Art der Zwangsernährung hatte sich Helmut bei seinen Kollegen abgeguckt. Es funktionierte wunderbar. Die Flasche war nun halb leer. »Weißt du eigentlich, was rädern ist?«
Der Nazi wand sich in den rasselnden Ketten, schrie, pisste sich in die Hose.
»Das ist, wenn man jemandem bei vollem Bewusstsein seine Glieder zerschmettert und dann auf ein Wagenrad flicht. Was habt ihr der Frau angetan? Erst vergewaltigt? Dann geschlagen? Oder habt ihr euch erst an sie herangewagt, als sie schon tot war?«
Nun strampelte Hartmut. Es wurde Zeit, ihn zu beruhigen. Helmut nahm eine Eisenstange, holte aus und zerschmetterte ihm nacheinander beide Knie. Es knackte fürchterlich. Nun hingen die Beine unterhalb der Kniescheiben lose herunter, die Oberschenkel nutzten ihre neue Bewegungsfreiheit und hatten ihr eigenes Leben. Ein absurdes Bild. Also holte er wieder aus und traf den hängenden Mann genau im Schritt. Der Nazi wurde ohnmächtig. Helmut kehrte zum Schreibtisch zurück und las sich das Protokoll erneut durch. Wieder aufgestanden und zum Schlächter zurückgekehrt, holte er diesen mit einem Schlag ins Gesicht wieder zurück ins Leben, zurück in den Keller, zurück in die Welt der Schmerzen, der Angst. Helmut stellte einen Stuhl hinter den baumelnden SD-Mann, ließ die Eisenkette ein wenig locker und ließ den geschundenen Kerl sich hinsetzen. Dann drückte er ihm Zettel und Stift in die Hände. »So, Meister, und nun schreib: Ich bin ein korruptes Nazischwein!«
Hartmut sah seinen Peiniger mit einer Mischung aus Angst, Schmerz, Überraschung und Hass an.
»Willst du schnell sterben oder langsam?« Helmut ging näher zum Todgeweihten und murmelte: »Du weißt genau, was dir blüht, wenn du nicht spurst. Ich werde dich rädern. Dann stirbst du einen Tag lang. Oder du spurst und wirst schnell erlöst.«
Also schrieb Hartmut. Danach machte er Anstalten, trotz des Lappens im Mund zu jammern und zu brüllen.
Schnell straffte Helmut die Kette erneut, der Nazi hing wieder an seinen Händen. »Du bist jetzt still, sonst zerschmettere ich dein Gesicht. Du hast die Wahl.« Der Geschundene wurde wieder ruhiger, aber seine Augen rollten panisch von links nach rechts.
»Mund auf! Betrunken wirst du nicht so sehr leiden.« Die zweite Hälfte vom Genever rann dem SD-Mann die Kehle hinunter. »Noch eine rauchen? Ich habe noch etwas Feines: Echte amerikanische Zigaretten! Camel! Ohne Filter!«
Der SD-Mann nickte, also entfernte Helmut das Stoffknäuel aus dem Mund, steckte dem Opfer seine letzte Zigarette hinein und entzündete diese. »Das ist doch was anderes als diese Propaganda-Glimmstängel Trommler oder Sturm der SA, was? Das holzige Zeugs.«
Nach ein paar Minuten hatte der SD-Mann die Zigarette zu Ende geraucht. Helmut nahm die beiden unversehrten Zigarettenstangen der Marke Camel und legte sie auf Hartmuts Jacke, die über die Lehne des Stuhles am Schreibtisch hing.
»So, und nun kommen wir zum Höhepunkt!«, murmelte Helmut. Mit einem gezielten Schlag auf den Kehlkopf tötete er den Mann.
Erschöpft fuhr er sich durchs Haar. Er hasste sein Tun, er hasste sich selbst in diesen Momenten. Damit war er keinen Deut besser als diese Nazis, dachte er sich stets in solchen Situationen. Unrecht mit Unrecht zu vergelten widersprach allen zivilisatorischen Grundregeln. Aber was sollte er machen? Die Demokratie war in Deutschland an die Wand gefahren worden, von Kommunisten und Nazis. Und dem passiven Bürgertum. Aber nun hatte sich Deutschland für die Gewalt der Massen entschieden. Entweder man ging mit oder schaute zu. Oder man wehrte sich. »Ich wehre mich!«, brüllte Helmut heraus. Einige Male entfuhr ihm der Satz, noch während er einen Stuhl zertrümmerte und dabei weitere Gegenstände im Keller beschädigte. Dann kam er wieder zu sich, schaltete den Volksempfänger aus, notierte sich die sechs Namen mitsamt den Adressen und verließ den Keller. Seinen Hut schob er tief ins Gesicht. Die Dämmerung hatte inzwischen eingesetzt. Ruhigen Schrittes ging er zu seinem DKW, überlegte es sich dann aber anders. Einer spontanen Eingebung folgend wollte er die sechs Wohnungen zu Fuß aufsuchen, dort Zettel mit einer Warnung vor dem »Besuch« der Polizei hinterlassen, zurück zum Wagen gehen und dann nach Hause fahren. Das war weniger auffällig, als mit seinem Wagen die betreffenden Adressen anzufahren. Er rettete nun Kommunisten, Gegner und Zerstörer der Demokratie. Ausgerechnet er!
30. März 2008
Es ist wieder Zeit für die ausführliche Lektüre der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung. Achim hat Glück und einen freien Tisch vor dem Café Kleinkram im Prenzlauer Berg gefunden. Er blinzelt in die Sonne und hofft dabei, dass auch am morgigen Sonntag, seinem letzten Urlaubstag, das Wetter ähnlich gut würde. Eine junge türkische Bedienung nimmt seine Bestellung auf. Sie scheint ein wenig im Stress zu sein, was nicht verwundert: Das Café ist sehr gut besucht. Knapp entgeht sie einem Zusammenstoß mit einem auf einem Lauffahrrad sitzenden Kind, bekommt mit ihrem Tablett gerade noch die Kurve. Letztendlich scheitert sie jedoch beim Versuch, einem von einem unachtsamen älteren Herrn gerade zurückgeschobenen Stuhl auszuweichen. Es scheppert, kracht, klirrt, das Kind kreischt hysterisch, die dazugehörige Mutter dreht sich erschrocken herum, die Bedienung flucht. Für den beschaulichen Prenzlauer Berg ist das schon eine veritable Störung des sozialen Friedens. Orte des Grauens und Terrors schießen durch seinen Kopf: Belfast! Die Townships! Ein von deutschen und englischen Pauschalurlaubern gemeinsam genutzter Hotelpool! Achim schmunzelt in sich hinein, schnell legt sich die Aufregung. Prenzlauer Berg regeneriert sich zügig von solcherlei Disharmonien. Ähnlich wie ein gestürztes Kind, das vor Schreck weint, das unbeschadete Knie betrachtet und sich dann totlacht. Schon wird die Straße wieder mit dem typischen Cafégeschwätz belegt. Menschen gehen am erkaltenden Tatort vorbei, sehen einen Bekannten dort sitzen und tauschen Freundlichkeiten aus. Wie geht’s? Ist das Wetter nicht schön? Ah, auf einen Wein hier?! Ein besonderes Auge hat Achim auf das Dreigespann direkt vor ihm. Zwei ältere Damen in Begleitung eines älteren Herrn. Er fragt die dicke, überschminkte Matruschka: »Und? Schmeckt es?« Sie kneift die Augen zusammen, beugt sich vor, ihr schwerer Busen lässt das Tischgebälk leicht quietschen, wackelt ein wenig mit ihrem ausladenden Hintern wie ein rückwärtsparkender LKW, guckt verschwörerisch zum Gegenüber und raunt paraerotisch: »Jaaa, ein Gedicht.« Ihr Mund verzieht sich bizarr zu einer überschminkten Futterluke.
Das Sozialleben von Menschen ähnelt dem Orientierungssinn der Fledermäuse. Sie senden stets Zeichen des Wohlbefindens aus. Mimisch, über Gesten, mit Worten. Damit tasten sie ihr soziales Umfeld ab und vergewissern sich: Ja, ich lebe, die anderen leben, mir geht es gut, den anderen geht es gut. Ich bin ein soziales Subjekt. Wie auf dem Dorf. Nur kürzer als ein Schwätzchen über den Zaun. Leider ist der schnell errungene Frieden vorbei – für Achim jedenfalls. Aus der Dunckerstraße biegt ein Mann in die Raumer Straße ein. Mitte 60, schwarz-leger gewandet, Sandalen, graues, volles Haar zum Pferdeschwanz gebunden. Und stets ein süffisantes, selbstgefälliges Lächeln auf den Lippen. Sein Vater. Achims Laune sinkt. Der Kater in ihm buckelt, das Pferd in ihm legt die Ohren an, der Mafiosi in ihm reinigt sich die Fingernägel mit einen Springmesser.
»Hallo, Sohn! Ist hier frei? Danke. Lange nicht voneinander stören lassen!« Schon sitzt er, ganz der Vater, wie Achim genervt feststellt.
»Ja, Tag, danke. Setz dich bitte. Ah, du sitzt schon. Landeerlaubnis nachträglich erteilt. Um es kurz zu machen: Passe dich dem Umfeld an und wähle Modus ‚Sozialen Frieden‘. Ich hoffe, es geht dir gut!« Mit einer scheinbar beiläufigen Geste schnipst Achim ein virtuelles Staubkorn von seinem Sakko. Sein Vater hasst diese Geste, wie ihm bewusst ist.
Dieser blickt mit einem mokanten Lächeln um sich und nickt scheinbar anerkennend: »Prenzlauer Berg. Alles schön hier. Das passt zu dir.«
»Danke, Paps. Ich beneide dich um deine Anpassungsfähigkeit. Gibt’s was Neues?«
»Ich denke schon. Ich brauche Geld.« Er ringt mit seinen Händen. Er ist nervös.
Da ist etwas im Busch. Innerlich verdreht Achim seine Augen. »Warum? Wofür? Ich habe keines. Für dich meine ich …«
»Ich habe eine neue Freundin. Mirka, 30 Jahre alt. Nun komm ich zum Problem: Sie ist schwanger …«
Achims Unterbewusstsein wählt den dümmsten Gesichtsausdruck. »Die Kurzversion bitte …«
Sein Vater hebt an: »Kurzversion: Ich habe vor drei Monaten Mirka geheiratet. Sie ist im dritten Monat schwanger. Also bin ich juristisch der Vater. Ich will für ein paar Wochen abtauchen, bis das Problem sich eventuell von alleine geregelt hat und …«
Nun richtet sich Achim auf und flucht in sich hinein: »Typisch mein Alter. Sich verpissen, wenn es eng wird.« Dann atmet er aber tief durch und entgegnet scharf: »So etwas regelt sich nicht von alleine, du Arschloch! Wenn du deinen Schwengel in die Dame gehalten hast, dann musst du verkommener Alt-68er verdammt nochmal dafür gradestehen! Offenbar kannst du das ja noch, Methusalix! Hast du den nicht begriffen, dass Sex zwischen Mann und Frau nichts mit Biene und Blume, sondern eher etwas mit Nitro und Glycerin zu tun hat? Und Geld, um eine Frau zu verarschen mit Kind, bekommst du von mir niemals! Das Gespräch ist beendet!«
Eine kleine Pause entsteht, Achim guckt sonst wohin. Wo ist meine Dienstwaffe?, fragt er sich.
»Ich bin nicht der Vater …«, stammelt Achims Vater. »Ich habe mich vor zehn Jahren sterilisieren lassen.«
Er scheint am Ende zu sein. Etwas Merkwürdiges, Widernatürliches keimt in Achim auf: Mitleid.
Umgehend trampelt sein Vater jedoch den sich entwickelnden Setzling des Mitgefühls mit seiner Selbstgerechtigkeit nieder. »Ihr seid doch eine verkommene Generation. Kein Pflichtgefühl! Nur Konsum im Kopf. Und Rapmusik, Latte Macchiato und Google! Ein Scheißland ist das geworden! Und …«
Mit diesem Geschwafel bringt er seinen Sohn auf die Palme. Mit Tabasco in den Augen erwidert er: »Halt einfach den Mund, Herr Vater! Ihr habt ja lange durchgehalten, ihr Kreuzberger Kommunenkiffer! Früher Gruppensex und die Doors, heute Gartenzaun und VW Passat. Mit ein paar gartenzwergähnlichen Alibi-Ikonen wie dich im Vorgarten der verbürgerlichten Erinnerungskultur. Ihr habt den Kampf der Systeme nicht gewonnen und nicht verloren. Schlimmer: Ihr Hippies habt aufgegeben. Zu null habt ihr gespielt. Die Ossis, die Überzeugten von damals, haben wenigstens Ernst gemacht. Jedenfalls die ersten 30 Jahre! Aber verloren haben sie. Und wie! Haben ja auch richtig was riskiert. Nämlich einen Staat, keine selbstgerechte Subkultur, die mal mimosenhaft aufblüht, sich mal wieder zurückzieht.«
»Das siehst du zu undifferenziert!«, erregt sich sein Gegenüber. »Unsere Gegner waren in Amt und Würden und Repräsentanten UNSERES Landes …«
Achim lässt ihm keine Chance. Nicht dass er seinen Beitrag nicht schon öfter geprobt hätte … »Jeder Vorwurf an meine Generation ist ein Vorwurf an deine eigene. Denn wer hat uns erzogen? Wer hat – aus deiner Sicht – bei der Vermittlung von Werten versagt? Wer ist wessen Geistes Kind? Aber von einem Mitglied einer melancholischen, zu Selbstkritik unfähigen Versagergeneration erwarte ich nichts … Ach übrigens, wie geht es Mutter? Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Also ich meine die Frau, mit der du mal verheiratet warst und mich gezeugt hast!«
Nun steht der alte Mann auf, will seinen von selbstgedrehten Zigaretten vergilbten Vollbart umwöllten Mund gerade öffnen, da setzt Achim zum finalen rhetorischen Faustschlag an: »Und zu guter Letzt: Von einer Generation, die in Plattenläden gegangen ist, um wochenlang Lieder wie ‚Das Lied der Schlümpfe‘, ‚Die Indianer vom Titikhaka-See‘ oder von Wum und Wendelin ‚Ich hätte gerne eine Mietzekatze‘ auf Nummer eins in den Hitlistencharts zu halten, lass ich mir nichts, aber auch gar nichts vorhalten!«
In dem Moment steht der Vater abrupt auf und geht – vielleicht für immer. Achim ist es im ersten Moment egal. Die Cafégäste, auch Passanten waren Zeuge dieser Auseinandersetzung. Die Welt bleibt für Achim für Sekunden stehen. »Das war gratis!«, sagt er mehr zu sich selbst, greift zur Zeitung und versucht, wieder runterzukommen. Egal welcher Teil der Zeitung es ist: Er braucht Beschäftigung, Ablenkung. Und siehe da: Es ist der Karriereteil.
Nach rund 20 Minuten legt er die Zeitung auf den Stuhl neben sich. Ab Montag muss er wieder zur Arbeit an den Tempelhofer Damm. Dort im Landeskriminalamt warten seine Kollegen bestimmt schon sehnsüchtig auf ihn. Sein Handy vibriert, seine Freundin Cordula versucht ihn zu erreichen. Achim geht nicht ran, sein Bedarf an Konversation ist gedeckt.
Teil 1
Bundesrepublik Deutschland im Frühjahr 2008
Achim Rems lebt zufrieden im aufstrebenden, aber doch manchmal widersprüchlich anmutenden vereinten Berlin. Einerseits erleben die Berliner einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Stadt ist angesagt. Während viele Menschen diese sich neu formierende Metropole besuchen oder gleich ganz dorthin ziehen und sich vom Mythos von der unangepassten, stets improvisierenden Art des Zusammenlebens berauschen lassen, kämpft die Verwaltung der Stadt mit einem scharfen Sparkurs sowie den mit den neuen Entwicklungen einhergehenden sozialen Problemen. Mit Herz und Seele ist Achim Polizist und widmet sich beruflich dem Kampf gegen Intoleranz und neonazistische Tendenzen.
Als sein Großvater im Sterben liegt, befasst er sich das erste Mal mit ihm und seiner Vergangenheit. Es ist der Beginn einer späten und kurzen, aber durchaus intensiven Verbindung.
Das Dritte Reich im Herbst 1939
Helmut Rems arrangiert sich mit dem nun seit sechs Jahren regierenden Regime im Dritten Reich. Im Land selbst herrscht während des erfolgreich verlaufenden Polenfeldzugs aufgrund der relativen Ordnung und des scheinbar anwachsenden Wohlstandes so etwas wie Zufriedenheit. Der Krieg in Polen beunruhigt die Menschen, es herrscht aber angesichts der Erfolgsmeldungen der Propaganda eine relative Ruhe. Aufgrund seiner kriminalistischen Fähigkeiten wird der ausgebildete Polizist Rems ohne NSDAP-Parteizugehörigkeit oder Mitgliedschaft in der SS in das neu geschaffene Reichssicherheitshauptamt (RSHA) versetzt. Hier werden die Kompetenzen der verschiedenen staatlichen Polizeiapparate sowie die bislang dazu konkurrierenden Sicherheitsorganisationen der NSDAP – die Schutzstaffel (SS) und der Sicherheitsdienst (SD) – organisatorisch gebündelt. Helmut Rems gewinnt das Vertrauen seines Amtsleiters Arthur Nebe, der seine Position innerhalb des neu aufgebauten, von Eifersüchteleien der neuen Abteilungen geprägten RSHA weiter stärken will.
Privat ist Helmut mit der Tochter eines wohlhabenden Industriellen sehr glücklich liiert, pflegt jedoch geheime Kontakte zum politischen Widerstand um Dr. Julius Leber, einem am 5. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichteten Sozialdemokraten und ehemaligen Reichstagsabgeordneten.
Berlin, 3. April 2008
Achim sitzt in seinem Dienstwagen, einem sieben Jahre alten blauen Opel Vectra, und knetet seinen Schaumstoffball. Er und dieser Opel – was für ein Gegensatz auf engstem Raum! Er, der gerne schicke Autos fährt, zurzeit einen neueren Mini Cooper. Er, der mit Anfang 40 in seinen besten Jahren ist und sich dessen auch bewusst ist und gerne gute Markenkleidung trägt. Nicht zu teuer, aber eben auch nicht vom Grabbeltisch eines Discounters. Er, der mit Cordula, einer schönen und gebildeten Frau, seit drei Jahren zusammen ist. Er, der gerne in Prenzlauer Berg wohnt und es sich weder durch Nachwenderomantiker noch von den urbanen Öko-Hybrid-Fair-Trade-Besserverdienern vermiesen lässt. Ja und er, der gerne Polizist ist und aus Überzeugung auf der Seite des Gesetzes steht. Besonders der Kampf gegen die Gegner der Demokratie, der Vielfalt, der Bürgerrechte hat es ihm angetan. Und das trotz der meist mühsamen Arbeit mit Dienstvorschriften, abgestumpften Kollegen und der chronischen Unterfinanzierung der Berliner Polizei – einschließlich der miesen Gehälter. Auch die Langeweile gehört zu den nervenden Begleitumständen des Berufes. Seit zwei Stunden sitzt er nun in diesem verranzten Wagen und hat eine Eckkneipe in Oberschöneweide im Blick. Oberschöneweide, ein ehemaliger Hotspot der Industrie der DDR und überhaupt der Geschichte dieser Stadt, ist nun für die Nazis das, was für das gehobene Bürgertum Prenzlauer Berg ist. Hier leben keine saturierten, liberalen und selbstbewussten Bürger in Markenkleidung, sondern Wendeverlierer, Arbeiter, Alteingesessene und eben die Nazis. Billigklamotten und 1-Euro-Läden prägen das Stadtbild. Wenn Markenkleidung getragen wird, dann die von den rechten Labels. Sicher – einiges ist auch hier im Wandel. Aber es dauert hier alles ein wenig länger.
Durch den Rückspiegel beobachtet er, wie sein Kollege Nils mit zwei Kaffeebechern herantrabt. Nils öffnet mit unbeholfenen Verrenkungen die Beifahrertür, reicht Achim beide Becher und lässt sich dann in den Sitz plumpsen. Der Opel wackelt, der Kaffee schwappt gefährlich in den Gefäßen. Achim rutscht ruckartig zur Seite, aus Angst, ein Schwall der heißen Brühe könne seine teure Jeans erwischen. Nun schweigen beide einander an, nippen an den Pappbechern. Achim, der immer noch keinen Frieden mit sich und diesem Tag gemacht hat, betrachtet den mit seinem Handy spielenden Kollegen aus den Augenwinkeln. Der Kollege, ein paar Jahre jünger als er selbst, ist derzeit Kriminalkommissar und steht damit hierarchisch unter ihm. Er ist ein prototypischer Zivilpolizist. Mittelmäßig bis schlecht gekleidet, am Dienstsport mehr aus Pflichtgefühl denn aus Begeisterung teilnehmend und stets dem Dienstweg verpflichtet. Nun kratzt er sich auch noch seinen Kopf. »Und? Irgendetwas passiert?«
»Ja, ich muss mal!« Achim starrt sehnsüchtig die Kneipentür an. »Und ich habe es satt, dass wir den Kaffee in dem Laden da kaufen und dann in irgendeine Ecke pinkeln.« Er nickt dabei nach hinten. »Es wird Zeit, dort zu pissen, wo es meiner Meinung nach hingehört.« Er nickt jetzt in die Richtung der Kneipe.
»Hör mal, das kannst du nicht machen. Das ist …«
»Ja?« Achim zieht die Augenbrauen hoch und verfällt in einen lauernden Unterton. »Gegen Vorschriften? Welche Vorschrift besagt, dass man nicht in Nazikneipen pinkeln darf?« Achim steigt entschlossen aus und steuert auf die Gaststätte zu. Doch auf halbem Wege kehrt er zum Opel zurück.
»Das machst du nicht! Ich wusste es.« Nils setzt ein leichtes, triumphierendes Lächeln auf.
»Doch, aber ohne Knarre.« Achim nimmt die Waffe aus dem Holster und legt sie auf den Fahrersitz. »Wenn ich in zehn Minuten nicht hier bin, holst du Verstärkung. Klar?« Er sieht in den Innenspiegel des Opels, ist mit dem Sitz seines Seitenscheitels zufrieden.
»Achim! Ohne Dienstwaffe? Das ist gegen die Vorschrift! Ich muss …«
»Nein!«, unterbricht er seinen Mitarbeiter. »ICH MUSS! Und ich gehe nun in die Kneipe. Und wo steht geschrieben, dass ein Beamter nur mit einer Waffe auf Toilette darf? Siehst du das Schild?« Er zeigt in Richtung Kneipe, an deren Tür ein Hinweisschild angetackert ist. »Es steht darauf, dass die Nutzung für Nichtgäste 50 Cent kostet. Also: Auch wenn es falsch ist, Geschäftsmodelle der Unterstützerszene zu fördern, so ziehe ich es vor, mich auf ein Qualitätsklo dieser Pimmelköppe zu setzen und so das Kioskklo unseres Kaffee- und Kaugummidemokraten einmal zu meiden.«
Die Opel-Tür fällt zu, Achim schlendert in Richtung der Höhle des Löwen. Er kratzt sich am Hintern. Das macht er immer dann, wenn er nervös wird. Alleine und unbewaffnet in eine Schlägerspelunke zu gehen ist auch für ihn eine Überwindung.
Die Holztür quietscht ihm entgegen, kaum will er nach dem Knauf fassen. Ein junger Mann tritt heraus, hält ihm freundlich die Tür auf. Mit einer solch einladenden Geste hatte er nicht gerechnet. Er nimmt die beiden Stufen auf einmal und steht in einem der typischen Schankräume altmodischer Eckkneipen. Die Holzvertäfelungen an den Wänden wurden angebracht, da träumte der Ossi noch von Ikea-Möbeln – falls sie wussten, was Ikea überhaupt ist. Der Schankraum ist fast leer. Hinter dem Tresen steht ein Mann Ende 50 mit vergilbtem Schnauzbart und konzentriert sich auf die Bedienung des Zapfhahnes.
»Für 50 Cent würde ich gerne einmal auf Klo. Ist das in Ordnung?« Achim stellt fest, dass in diesem Raum kein Gast sitzt, geht zum Tresen und legt eine Münze drauf. Der Wirt nickt in eine Richtung und murmelt: »Nach hinten«, ohne Achim eines Blickes zu würdigen. Während er sich der Doppelschwingtür nähert, hört er eine lauter werdende männliche Stimme. Offenbar redet sich da jemand in Rage. Entschlossen betritt er einen der Clubräume. In dem mit rund 20 Männern und genau zwei Frauen gut gefüllten und ebenso speckigen Gesellschaftsraum steht er einen Moment unschlüssig herum, während die Gäste ihn anstarren. Der Redner verstummt schlagartig und legt eine fragende, unterschwellig herausfordernde Miene auf. Der Mann, kaum 30 Jahre alt, hat zwar einen intelligenten Blick, seine Landser-Frisur und seine aggressive Körperhaltung machen jedoch sofort klar, wessen Geistes Kind er ist.
Achim macht ein unschuldiges Gesicht und sagt nur: »Klo?«
Der Redner verharrt schweigend und nickt lediglich in Richtung der Toiletten.
Achim ist nun doch ein wenig nervös. Die Tagungsgruppe unterbricht tatsächlich ihre Sitzung und wartet, bis der ungebetene Gast seine Notdurft verrichtet hat. Also beeilt er sich und will die Toilette gerade verlassen, da entdeckt er im Papierkorb ein Flugblatt mit einem Reichsadler – immerhin ohne Hakenkreuz. »Tag der offenen Tür des faschistischen Widerstandes Oberschöneweide. Kommt vorbei, informiert euch!« Das Datum ist von heute, die Adresse der Kneipe ist aufgeführt. Der weitere Text verrät, dass die Flugblätter offenkundig gezielt an Schulen verteilt wurden. Die Nazis machen heute also Nachwuchsarbeit. Achim putzt sich die Nase und betritt wieder den Clubraum. Mit einem raschen Blick in die Runde der Nazis stellt er fest, dass sich keiner unter 25 Jahren im Raum befindet. Zumindest hat sich noch kein Schüler hierher verirrt. Es gibt Hoffnung! Einen Gruß murmelnd verlässt er schließlich den Raum.
Im Auto schaufelt sich Nils eine Handvoll Smarties in den Mund und räkelt sich im Autositz. »Und? Hast du einen Blick auf die Jungs riskieren können?«
»Na ja«, Achim lässt sich auf den Fahrersitz fallen, »ganz schön düsterer Laden. Aber die betrinken sich dort nicht einfach, da hält jemand eine richtige Rede.« Als er gerade seinen Scheitel zurechtzieht, da sieht er vier junge Männer. Er schätzt alle auf 16 bis 18 Jahre. Sie kommen die Straße entlang, blicken sich verstohlen um. Nils stößt seinen Chef an und deutet in deren Richtung. »Ich wette, die Jungs bauen gleich Mist.«
In der Tat zeigen sich die Jungs recht nervös, bleiben rund zehn Meter vor der Kneipentür stehen und scheinen sich zu beratschlagen. Achim schiebt seinem Kollegen das zerknüllte Flugblatt herüber. »Heute ist Schülersprechstunde.«
Die Kneipentür wird geöffnet, ein großer junger Mann mit manierlichem Scheitel, teurer Jeans, akkurat gebügeltem Hemd, aber immerhin Springerstiefeln tritt auf die Straße. Als er seine vier potentiellen Opfer entdeckt, zündet er sich eine Zigarette an.
Achim setzt sich gebannt aufrecht hin, grübelt und trommelt mit seinen Fingern auf dem Lenkrad herum. Sein Kollege riecht den Braten und wird ein wenig nervös. »Was geht jetzt schon wieder in deinem rebellischen Beamtenkopp vor? Du hast doch wohl nicht vor …« Er kommt nicht weiter, denn schon ist sein Chef aus dem Opel gestiegen, steckt aber seine Nase nochmal zu Nils in den Wagen: »Na, komm mit!« Dann knallt er die Tür zu, ohne die Antwort abzuwarten.
Nils reißt die Beifahrertür auf und eilt seinem Chef hinterher. »Krass, krass, krass«, murmelt Nils halblaut vor sich hin. Achim registriert diesen typischen Ausspruch seines Mitarbeiters missbilligend und rollt genervt mit den Augen.
Der Nazi und die Jungs unterhalten sich bereits und scheinen die beiden sich nähernden Beamten nicht zu bemerken.
»Was hast du vor, verdammt nochmal?«, zischt Nils, der alle Mühe hat, seinem Vorgesetzten zu folgen. »Mach keinen Quatsch!«
Die Jungs und der Nazi verschwinden in der Gaststätte. Die Tür ist noch nicht zugefallen, da greift Achim zur Klinke und betritt den Schankraum. Nils hastet hinterher, bleibt am Türknauf mit der Jacke hängen, befreit sich umständlich und schafft es gerade noch, ohne großen Zeitverzug zu seinem Vorgesetzten aufzuschließen.
»Sie schon wieder! Haben Sie Dünnpfiff?« Der Wirt blickt beide Neuankömmlinge Bier zapfend misstrauisch an. »Bullen, was?«
Die Jugendlichen verschwinden mit dem Scheitelträger im Clubraum, ohne auf die Verfolger zu achten.
»Ist nicht gerade ein Clubhaus für Knaben eures Schlages. Was kann ich gegen Sie tun?« Der dicke Wirt freut sich über seinen kleinen Wortwitz und poliert mit einem Handtuch derweil ein Bierglas, lässt die ungebetenen Gäste aber nicht aus den Augen.
Noch bevor Achim zu einer Erwiderung ansetzen kann, drückt sich Nils an ihm vorbei, geht auf den Tresen zu und zeigt dem Hausherrn seinen Dienstausweis. »Wir haben gerade gesehen, wie Minderjährige sich in ihr Etablissement begeben haben.«
»Na und? Ist das verboten?«, pampt der Wirt zurück. »Macht euch lieber mal ’nen Kopp, was hier sonst so auf der Straße passiert. Hier treibt sich nämlich allerhand Gesindel herum!«
Nils deutet auf die Tür zur Straße. »In der Tat! Da sprechen Sie mir aus der Seele. Sie verbieten den Zutritt für Menschen unter 18 Jahren. Ist das hier eine Raucherkneipe?«
»Hey, Männer! Deswegen wollt ihr mich anschwärzen?« Der Wirt lacht, nimmt ein neues Glas und poliert es dann. »Die bekommen gleich ihre Cola und das war es dann! Wie wäre es mit einem alkoholfreien Bier? Geht auch aufs Haus, aber macht mir keinen Ärger!«
»Holen Sie die vier jungen Männer bitte sofort hier in diesen Schankraum. Wir wollen kurz mit ihnen sprechen.« Nils will sich gerade auf den Tresenhocker setzen, da stürmt Achim bereits los. Augen rollend folgt ihm sein Kollege hastig.
Effektvoll öffnet Achim die Schwingtüren in den Gesellschaftsraum und platzt in die Rede des Agitators. Schnurstracks geht er auf die sitzenden Schüler zu, dreht einen Stuhl mit der Lehne nach vorne um, setzt sich und guckt dem Größten der vieren unverwandt in die Augen. »Na dann mal her mit den Ausweisen.«
»Was ist da los? Wer sind Sie?«, herrscht der Typ hinter dem Pult die Ankömmlinge an. »Sie stören hier unsere Versammlung!« Alle Gäste schauen nun zum Katzentisch, einer der Jungs wird knallrot.
»Wir sprechen die jungen Herren nur kurz an und überprüfen die Einhaltung des Jugendschutzes«, proklamiert Nils und zeigt lässig seinen Ausweis hoch.
»Lassen Sie unsere Gäste bitte in Frieden. Hier bricht niemand das Gesetz.« Der Redner bedient sich nun eines leicht versöhnlichen Tones.
»Und eben das überprüfen wir gerade!«, entgegnet Nils, der in der Tür stehen geblieben ist.
»Männer!«, eröffnet Achim den perplex dreinblickenden Jungs. »Ihr zeigt mir nun hübsch eure Papiere. Wenn ihr unter 18 Jahre alt seid, dann verschwindet ihr wieder.«
Unschlüssig gucken sich die Angesprochenen an. Achim registriert, dass die Heranwachsenden wohl keinen Leithammel haben, sondern dass alle gleich unbedarft zu sein scheinen.
»Ihr wisst schon, dass ihr hier bei einer Veranstaltung von Nazis seid?« Achim fixiert nun den zweiten. »Ihr sollt nur eines wissen: Diese Herren da drüben«, er nickt zu den Nazis herüber, »stehen unter polizeilicher Beobachtung. Und wer sich bei denen aufhält, wird auch beobachtet. Also überlegt euch sehr gut, was ihr hier so macht.«
»Hey, sind Sie von der politischen Polizei oder was? Geht es Ihnen noch gut? Wir sind unbescholtene Bürger, die sich durch die Verfassung geschützt auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berufen und sich treffen.«
Unbeirrt hält Achim seine Hand nach den Papieren offen, kümmert sich nicht um den Redner, sondern sieht die Jugendlichen herausfordernd an. »Ausweise, aber schnell!«
Hastig kramen die drei Jungs ihre Dokumente hervor und legen diese auf den Tisch. Nur einer druckst herum: »Ich habe meinen nicht dabei.« Das war der Größte unter ihnen, den Achim bereits zu Beginn der Unterhaltung mit den Augen fixiert hatte.
»Wie heißen Sie und wie alt sind Sie?«
»Ich bin volljährig. Sebastian Richter, Siemensstraße 9.«
»Dann fahren wir nun dahin und begutachten Ihren Ausweis.« Achim steht auf und macht eine auffordernde Geste in Richtung Schankraum.
Der Redner eilt seinerseits zum Tisch mit den Jungs heran, stellt sich nun neben Nils und beobachtet das weitere Geschehen mit einem betont prüfenden Gesichtsausdruck.
»Muss das sein? Dann bekomme ich Stress mit meinen Eltern.« Zu der Nervosität in den Augen des Jungen gesellt sich ein wenig Angst.
»Ach was«, fragt Nils erstaunt in die Runde, »du bist volljährig und wohnst noch bei Mutti? Aber wenn du doch ein erwachsener Kerl bist, warum hast du Angst vor Ärger mit deinen Eltern?«
Unschlüssig guckt Sebastian Richter seine Kumpels an, erhält jedoch keinen Beistand.
Der Redner wechselt nun seinen Gesichtsausdruck von kritisch-prüfend auf Verantwortung tragend. »Mein Name ist August Scheuerle und ich bin hier der Versammlungsleiter. Wenn ihr Unterstützung braucht«, er schiebt eine Visitenkarte über den Tisch, »fragt mich. Ich bin Rechtsanwalt.«
»Ah, sehr aufmerksam!«, freut sich Nils mit gespielter Freude. »Vielen Dank!« Schnell schnappt er sich die Karte.
Achim steht ruckartig auf und stellt sich mit unterschwellig aggressiver Körperhaltung direkt vor den Anwalt, macht aber weiter nichts.
Nils betrachtet die drei Personalausweise, hebt seine Stimme im Beamtendeutsch an und stellt quasi amtlich fest: »Wir brechen dann mal alle auf. Herr Schraper, Herr Mühldinkel und Herr Schniedel … Herrje, Sie heißen wirklich Schniedel? … Wir verlassen nun diese Rauchergaststätte. Sie sind minderjährig. Wir prüfen, ob der Wirt mit einer Anzeige zu rechnen hat.« Er dreht sich um zu Sebastian Richter. »Und Sie bringen wir zwecks Personenüberprüfung nach Hause.«
»Sind das nun die neuen Methoden der Polizei?«, fragt August Scheuerle aufgebracht, was sein Publikum mit zustimmendem Getuschel quittiert, sonst aber ruhig sitzen bleibt. »Bitte geben Sie mir Ihre Dienstausweise, damit ich mir Ihre Namen notieren kann. Ich werde umgehend Beschwerde einreichen!«
Scheuerle scheint richtig sauer zu sein. Achim taxiert dessen 20-köpfige Anhängerschaft, registriert aber keine nennenswerten Gefahrenanzeichen. »Kollege, gib ihm mal unsere Visitenkarte.« Er wendet sich zum Nazianwalt um. »Weitere personenbezogene Daten erhalten Sie nicht von uns. Aber als Rechtsanwalt kennen Sie sicher die Vorschriften.«
Keine zehn Minuten später steht der bedauernswerte Sebastian Richter mit Achim und Nils vor dessen Eltern. »Was hast du wieder angestellt?« Herr Richter schnauzt seinen Zögling mit fauligem Atem an. »Was? Was nun schon wieder? Nichts als Sorgen mit dir!«
Achim kratzt sich am Hintern, dann nestelt er an seiner Frisur. Diese gespielte väterliche Entrüstung widert ihn an. Da steht nun der fette Kerl im Unterhemd und nachlässig gegürteter Cordhose vor seinem Sohn und greift in das gescheiterte pädagogische Konzept seiner Frau ein. Der arme Junge ist in derart klischeehaft schlechten Verhältnissen zu Hause, dass er Achim leidtut.
»Nun lass ihn doch mal …«, murmelt Frau Richter und zieht ihren Sohn an ihre Seite. Auch so eine Klischeegeste einer hartgeprüften Mutter, wie Achim beobachtet.
»Herr Richter, Frau Richter!«, Nils schlägt wieder zu seinem offiziellen Ton an, »wir haben Ihren Sohn in einer Raucherkneipe erwischt und …«
»Du rauchst?«, brüllt der alte Richter ungläubig. Sein Bauch wabbelt, als er zur Ohrfeige ausholt, aber dann doch nicht durchzieht. Offenbar hat er Hemmungen, sich in der Gegenwart der Staatsmacht der Körperverletzung schuldig zu machen. »Du weißt doch, woran Tante Käthe letztes Jahr gestorben ist. Feine Dame mit Zigarillos, und nun feine Dame unter der Erde!«
»Nein, Ihr Sohn hat nicht geraucht. Aber die Gaststätte ist nur für volljährige Gäste. Da er sich nicht hat ausweisen können, begleiten wir ihn nun.« Achim wendet sich an den jungen Mann: »Also: Können Sie sich ausweisen?«
Sebastian Richter verschwindet in einem der vom Flur abgehenden Räume.
Betretenes Schweigen herrscht nun zwischen den vier Erwachsenen. Nils bricht es auf. »Sie wissen, dass Ihr Sohn die Nähe zur rechten Szene sucht?«
»Na und?« Frau Richter scheint ihren Sohn auch unter schwierigsten Umständen zu schützen. »Besser, als wenn er klauen geht!«
Achim kratzt sich die Schädeldecke. »Was hat das eine mit dem anderen zu tun?«
»Ist ja gut, ist ja gut. Charlotte, geht doch mal die Kaffeemaschine anschmeißen!«, beauftragt der Alte in versöhnlichem Ton seine Frau.
Berlin, 26. September 1939
Der DKW passte vom Status her nicht ganz in die Reihe der Horch-Limousinen, Mercedes-Karossen und dem Audi-Sportwagen. Über 30 Fahrzeuge standen auf dem Hof der prächtigen Villa der Familie Winz im Grunewald. Einige Schutzpolizisten und SS-Männer lehnten an einer der Hauswände oder an den Fahrzeugen und nahmen schnell Haltung an, als sie merkten, dass der Hausbutler Winfried vor Helmut katzbuckelte. Der Besitzer des Mittelklassefahrzeuges war dann wohl doch einer der hohen Gäste des Hauses.
»Herr Rems, schön Sie zu sehen! Ich bin überzeugt, dass Fräulein Winz außer sich vor Freude sein wird, Sie hier zu wissen.« Die unterwürfige Körperhaltung passte nicht ganz zu der reichlich informellen Art der Kommunikation. Helmut schmunzelte, ließ sich den Hut abnehmen und betrat das Vestibül. Und schon war es wieder um ihn geschehen: Isolde stand mit einem Sektglas auf der Galerie und unterhielt sich fröhlich mit einem rund 40-jährigen Mann in modischem Zivil, bestehend aus einem lockeren Sakko und Hosen mit Kniebund. Die Berliner nannten diese Beinkleider »Überfallhosen«. Sie schaute ein wenig suchend nach unten und ihre Blicke trafen sich. »Helmut!«, rief sie, während ihr Sektglas in die linke Hand des verdutzt dreinblickenden Mannes wanderte und klatschte übermütig in die Hände. »Komm her, mein Schatz!«
Ja, sie ist nicht nur wunderschön, ihr Vater ist nicht nur reich und hat Einfluss, stellte Helmut gedanklich erneut fest, sie ist die Frau seines Lebens.
Immer wieder überrannte ihr direkter, unverstellter Charme seine beiden Persönlichkeiten. Den Demokraten einerseits, dem seine heimliche Gesinnung wichtig ist und der dafür sogar tötet. Eine Seite an ihm, die er selbst hasste. Sein zweites Ich liebte diese Frau, die das süße Leben in Reichtum und Zärtlichkeit mit sich brachte. Ein widerlich-schönes Arrangement mit den herrschenden Umständen. Warum darben, wenn es eh schon schlecht läuft in diesem Land?, beruhigte Helmut stets sein Gewissen. Warum nicht diese Frau lieben, ihre Kontakte nutzen und protzig leben? Er nickte zu ihr hoch. Winfried drückte ihm ein Glas Rotwein in die Hand mit den Worten: »Ein 1933er aus der Region um Bordeaux.«
»Na, Winfried, nichts Deutsches? Franzmann-Wein? Was ist denn mit Ihrem nationalen Feingefühl?«
Winfrieds Gesichtsmuskeln erschlafften vollends, er war wieder ganz Butler. »Bei Wein verstehen Sie doch keinen Spaß, Herr Rems! Und die Franzosen haben ein Händchen dafür. Man muss sie nicht mögen, kann aber ihren Wein trinken. Ich hoffe, meine Reaktion beruhigt unser beider Gewissen und eröffnet dem Genuss auch ideologisch Tür und Tor?«
Helmut nickte, murmelte ein »In der Tat!« und betrachtete weiterhin versonnen Isolde, wie sie ihren Gesprächspartner um den kleinen Finger wickelte. Ihr Opfer fühlte sich aber nicht mehr ganz so wohl, sondern guckte in regelmäßigen Abständen verstohlen auf Helmut. Isolde, das Biest, wusste das natürlich. Sie konnte diese Dritte-Reich-Karrieristen nicht ertragen und genoss nun dessen Unsicherheit. Noch wusste er wenig von seiner Geliebten, wie Helmut erneut feststellen musste, aber ihre Abneigung hinsichtlich dieses Männertyps war ihnen gemeinsam.
»Na, erlösen Sie ruhig diesen Paul Werner, diesen schwäbischen Schwätzer!«
Neben ihm stand unvermittelt Arthur Nebe. Aus den Augenwinkeln erkannte Helmut dessen riesige Nase.
»Badenser. Er kommt aus Baden, Oberführer Nebe!« Er nahm einen Schluck Wein, um seinen Hals für das zu betäuben, was nun zwingend folgen musste: »Heil Hitler!«
»Heil Hitler, Rems. Er ist nun Ihr Vorgesetzter, mein Stellvertreter. Wie Sie sehen, leiden wir beide.«
Helmut drehte sich zu seinem Gesprächspartner um. »Entschuldigen Sie, Oberführer. Aber ich kann es mir nicht erlauben, mein Urteil über Vorgesetzte in aller Öffentlichkeit zu äußern.«
»Wir sind unter uns.« Nebe setzte einen verschwörerischen Blick auf und nippte seinerseits an einem Glas Rotwein.
»Sie sind mein Chef und verlangen Loyalität gegenüber Partei und Staat. Und der Staat sind Sie. Und er. Und ich«, erwiderte Helmut.
»Nein«, Nebe schüttelte leicht den Kopf. »Wir sind nicht nur der Staat, wir sind auch die Partei, junger Mann. Der Staat ist Mittel zum Zweck, die Partei die Idee. Und es geht hier um die Idee!« Nebe holte zu einem wohldosierten Seitenhieb aus. »Auch wenn Sie kein Mitglied der NSDAP sind und auch sonst keinen Sinn für die Bewegung haben.«
Schnell schmierte Helmut seinen Hals erneut mit dem Wein, um sich zu sammeln. »Ich weiß!« Das ist alles, was er dazu sagen konnte.
Lachend tätschelte Nebe seinem Gesprächspartner auf die Schulter. »Wenn Sie etwas bedrückt, kommen Sie zu mir. Sie sind mir zwar ein Rätsel, aber sie sind ein brillanter Kriminalist. Und um gute Männer muss man sich kümmern. Und Sie sind mit der hübschen Frau dort oben liiert. Glückwunsch!«
Verschmitzt lächelnd nippte Helmut wieder an dem Glas. »Zu was genau gratulieren Sie mir, mein Oberführer?«
Sein Gegenüber war zuerst irritiert, sammelte sich aber umgehend. »Wir müssen bei Gelegenheit ungestört miteinander reden. Sie wundern sich, warum Sie nun mit in der Prinz-Albrecht-Straße residieren anstatt mit ihren anderen Kollegen von der Kriminalpolizei am Werderschen Markt? Ab jetzt ein Schreibtisch in der Höhle des Löwen, einem feindlichen Außenposten im Reich der SS und des SD gleich? So wie ich dort auch ein Büro bezogen habe?« Wieder führte Nebe das Glas an seine Lippen, trank einen kleinen Schluck und wartete effektvoll eine Sekunde, bevor er fortfuhr. »Sie sind ein Taktiker, Herr Rems. Ich gratuliere Ihnen zu einer wunderschönen Frau. Ich gratuliere zu Ihrem erworbenen Status in dieser reichen Familie. Und ich gratuliere Ihnen zur gewonnenen Freiheit, sich nicht ganz anpassen zu müssen. An Sie kommt keiner ran.« Er prostete Helmut zu. »Vorerst. Nicht, solange Sie im Hause Winz verkehren.« Er schlug schneidig die Hacken und schlenderte hinüber zum Reichsführer SS, Heinrich Himmler.
Den Wein im Glas kreisend stand Helmut einige Sekunden für sich alleine und betrachtete das Getränk. Noch bevor sie ihn ansprach, nahm er ihren typischen Geruch wahr. »Mein Liebster! Guck nicht so versonnen in den Wein. Blicke lieber verträumt in meine Augen!«
Eine Welle der Liebe und Erregung durchflutete seinen Körper. Diese Frau! Züchtig umarmte sie ihren Liebhaber und flüsterte: »Und weitere Blicke gewähre ich dir später! Das ist ein großer Tag für uns alle!«
Das Gemurmel verstummte schnell, als der Gastgeber mit einem Löffel und seinem Glas die gut 50 Gäste zum Verstummen brachte. Sichtlich mit sich und der Welt zufrieden erhob der Gastgeber seine Stimme: »Liebe Gäste! Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten?«
Seichtes, wohlwollendes Schmunzeln ging sofort in absolute Stille über. »Werte Gäste! Es gibt zwei Dinge zu feiern! Erstens: Morgen wird die Arbeit des Reichssicherheitshauptamtes aufgenommen. Endlich wird das zusammengeführt, was zusammengehört! Die besten Polizisten, die glühendsten Anhänger unserer Idee, die rücksichtslosesten Verfechter unserer Ziele! Obergruppenführer Reinhard Heydrich ist noch auf dem Weg zu uns. Aber es ist auch ein großer Moment für mich! Endlich darf ich darauf hoffen, dass SS und SD nun aus staatlichen Mitteln finanziert werden und nicht mehr alleine aus der Schatulle der Partei! Sollen meine Zuwendungen an die NSDAP nun in Flugblätter und Megaphone münden anstatt in die Finanzierung von Gehältern!«
Wieder dieses gönnerhafte Gelächter der Gäste, wie Helmut registrierte. Es kribbelte unter seinem sportiv geschnittenen Anzug. Das waren die Momente, die ihn innerlich erschaudern ließen. Er genoss den vorzüglichen Rotwein, ihm schmeichelte der teure Stoff des Anzuges auf seiner Haut, er liebte die schönste Frau dieser Erde und er feierte mit diesem braunen Gesindel. Während in Polen Menschen starben, soffen sie hier Champagner. Nachdem er den Nazi in seinem eigenen Folterkeller massakriert hatte, schlürfte er edle Weine, plauderte mit den Vorgesetzten seines Opfers und wagte unterdessen den einen oder anderen Blick auf Isoldes Figur. Unter diesem Anzug, unter dem feinen Hemd versteckte sich ein seltsam erregter Körper: Die Vorfreude auf Isolde und ihren Körper, die Gänsehaut, mit Feinden zu feiern. Er spürte die Nähe von Isolde.
»Aber es gibt noch einen weiteren Grund zu dieser Festivität!«
Nun wieder diese respektvolle Stille. Was kam jetzt? Die nächste Spende an die NSDAP? Ein neuer Frontbericht?
»Meine Tochter, meine Isolde, mein Ein und Alles, steht hier vorne und sieht nicht nur glücklich aus. Nein: Sie ist es auch! Helmut, ich danke dir dafür, dass du meine Tochter glücklich machst. Ja, ich duze dich jetzt. Das bin ich dir schuldig! Meine Damen und Herren: Ich gebe hiermit die Verlobung von Isolde Winz und Helmut Rems bekannt. Auf das glückliche Paar!«
Isolde pfiff auf alle Hemmungen und fiel Helmut um den Hals. »Ich liebe dich, mein Herz!«
»Na, das nenne ich aber eine Überraschung!« Anderes konnte Helmut in diesem Moment nun nicht sagen. Er hielt sich zuerst zurück. Alle Gäste sahen teils erwartungsvoll, teils abwartend in seine Richtung.
»Nun musst du erwidern!«, flüsterte ihm seine Verlobte ins Ohr.
Helmut holte tief Luft. »Meine sehr geehrten Damen und Herren!« Der Anfang war getan.
»Liebe Isolde!«
Wieder waren einige Sekunden gewonnen.
»Lieber Herrmann Winz, sehr geehrte Frau Winz!«
Nun musste er etwas liefern.
»Ich bin stolz. Ich bin der stolzeste, glücklichste Mann hier im Reich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich das Entscheidende nur Isolde persönlich zuflüstern werde.« Er erntete süffisantes Auflachen für diese leichte Anzüglichkeit, die gar nicht so gemeint war.
»Aber Ihnen darf ich verraten, dass mich die Liebe von Isolde glücklich macht. Ich verspüre deshalb weniger Verpflichtung ihr gegenüber, sondern das unbändige Verlangen, ihr so unverwechselbares Lächeln für alle Menschen dauerhaft erlebbar zu machen.« Was rede ich?, schoss es ihm in den Kopf. »Wenn Isolde glücklich ist, dann hat sie dieses Lächeln. Und damit macht sie wiederum alle anderen Menschen glücklich. Das ist Auftrag genug!«
Unentschlossene Stille ergriff die Gesellschaft.
»Und das ist natürlich absolut uneigennützig gemeint!« Wohlwollendes, gemurmeltes Gelächter kam auf, die Anspannung in Helmut, die auch Isoldes Vater ergriffen hatte, war sichtbar. Helmut fuhr sich mit der Hand über die Stirn, Herr Winz atmete gefühlt drei Kubikmeter Luft aus. Aber etwas schien noch zu fehlen. Wieder nippte Helmut an seinem Glas. Sofort wurde ihm der Fauxpas bewusst. »Heil Hitler!«
»Heil Hitler!«, brüllte es zurück, Hacken klackten, Arme wurden gereckt.
Die Feier wurde zusehends ausgelassener, zahlreiche Männer und ihre Gattinnen gratulierten dem Paar. Irgendwann kam auch Paul Werner auf Helmut zu und schüttelte ihm die Hand. Durch seine runde Brille schwappte Misstrauen zu Helmut herüber. Oder Missgunst? Neid? »Der Kriminalkommissar Rems … Sie haben es geschafft!« Mit gespielter Bewunderung schweifte sein Blick durch den Saal. »Alle Achtung!«
»Verzeihen Sie, Herr Werner. Bei allem Respekt, Sie verwechseln etwas. Ich bin mit Frau Winz verlobt, nicht mit dem Haus.«
»Sind Sie sich da sicher, Rems? Wir erforschen erst einmal das Böse, das Kranke, das Übel. Wenn wir damit fertig sind, erforschen wir das Hintersinnige.« Er nahm mit forschendem Blick einen Schluck von seinem Champagner.
»Damit haben Sie doch bereits begonnen. Ist Ihnen das Böse bei den Zigeunern zu langweilig geworden?«
»Glauben Sie mir, wir werden uns des Themas noch annehmen. Ich behalte Sie im Auge, Rems. Vergessen Sie das nicht.«
»Geht es um die Frau?«, Helmut nickte zu seiner plaudernden Verlobten.
»Nein, Rems. Nicht wirklich. Es geht mir darum, dass wir ab morgen eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Der Volkskörper muss entlaust werden. Kommunisten, Homosexuelle, Sozialdemokraten, Halbherzige und so weiter. Das ganze lähmende, teure und belastende Gesocks. Wir werden eines Tages so weit sein, es jemandem an der Nasenspitze anzusehen, wenn er uns krank macht.«
Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete Helmut, wie ein schneidiger junger Mann in SS-Uniform Himmler etwas zuflüsterte. Die Blicke der beiden Männer erschienen einen Hauch zu vertraut, ja fast zärtlich zu sein, wie er festzustellen meinte. Mit der Ermordung von Röhm, dem damaligen SA-Chef, ist das Schwule wohl in den eigenen Reihen nicht ausgemerzt worden. Die Haustür wurde geöffnet und der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, Obergruppenführer Heydrich, stürmte mit seinem sechsköpfigen Mitarbeiterstab durch die Halle, direkt auf den Gastgeber zu. Es wurde gegrüßt, gescherzt und die Schultern wurden geklopft wie Wiener Schnitzel. Sehr zackig war das alles. Interessiert beobachtete Helmut den Reichsführer SS Heinrich Himmler. Ob er seinen Untergebenen Heydrich schätzte? Das Misstrauen und die Eifersüchteleien unter den Nazis waren groß und wurden stetig stärker. Heydrich löste sich von Winz und kam auf Helmut zu. »Gratulation, Kommissar! Eine wunderbare Frau!«
»In der Tat! Vielen Dank! Und Heil Hitler!«
»Sie haben recht! Heil Hitler!«, ergänzte er eher pflichtschuldig. »Und, glotzt mich Himmler an? Ärgert er sich, dass ich ihn noch nicht begrüßt habe, indem ich mich ihm zu Füßen werfe und dieselben küsse?«
»Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich in die Fragen der zwischenmenschlichen Abgründe meiner Vorgesetzten nicht einmische.« Helmuts Augen traten die Flucht in das Weinglas an.
»Sie leben gut hier, Rems. Und vor allem können Sie sich sicher fühlen. Bei den Kontakten und Verbandelungen, die Sie haben. Aber riskieren Sie nicht zu viel!«
Helmut wurde kalt, es fröstelte ihn. Diese Zurechtweisung hatte einen gefährlichen Unterton.
»Aber machen Sie sich keine Sorgen, Rems. Sie sind ja ganz weiß im Gesicht!« Er grüßte flüchtig mit einem erhobenen Glas zu Himmler hinüber. Dieser erwiderte knapp. »Schon um Aufnahme bei der SS beworben?«
Das war der wunde Punkt.
Doch Heydrich schüttelte mit gespieltem Verständnis sein Haupt. »Aber sicher. Sie sind ja – trotz ihres jungen Alters – ein alter Kriminalkommissar. Aus guter Schule gewissermaßen. Ernst Gennat hat ja in höchsten Tönen von Ihnen erzählt. Ein erstklassiger Kommissar mit großer Zukunft, hat er geschwärmt. Da kann man sich das eine oder andere schon mal erlauben.«
Eine kleine Pause trat ein.
»Viel zu früh ist er gestorben. Wir hätten noch einiges von ihm zu erwarten gehabt. Schade. Und schade für Sie. Ein solcher Förderer kann ganz nützlich sein, sollte man in Schwierigkeiten geraten. Und das geht ja ziemlich schnell.«
War das eine Drohung?
»Heil Hitler!«, brüllte ihm Himmler ins Ohr und schaute ihm durch die randlose Brille in die Augen. Der Mann hatte leicht zugelegt, wie Helmut feststellte. »Und meine besten Wünsche! Ein prächtiges Weib!«
»Na, na«, nuschelte Heydrich, »das Wort Weib hört die gute Frau bestimmt ungerne. Eine solch elegante Erscheinung hat nichts mit unserem Ideal des BDM-Mädchens gemein.«
Himmler überhörte den Kommentar. »Wann können wir mit Kindern rechnen?«
»Zuerst sollte geheiratet werden«, versetzte Heydrich. Er schien entschlossen zu sein, sich heute mit dem Reichsführer SS ernsthaft anzulegen.
»Ach was, Heydrich! Seien Sie nicht so verspannt. Ab morgen geht es für Sie doch erst so richtig los! Heute wird gefeiert. Haben Sie schon alle Männer beisammen? Immer noch Ärger mit dem SD?«
»Meine Herren«, Helmut hob sein Glas, »Sie entschuldigen? Mein künftiger Schwiegervater möchte eine Unterredung mit mir.«
Heydrich guckte ihn mit spöttischem Blick über sein Glas an, sagte aber nichts. Dafür schlug ihm Himmler derart unsanft auf das linke Schulterblatt, dass der Wein über seine Hand schwappte.
»Suchen Sie sich besser eine Waschgelegenheit, bevor Sie Ihrem Schwiegervater in spe unter die Augen treten.« Heydrich sagte dies mit völlig gleichmütigem Gesichtsausdruck. Sollte es ein gut gemeinter, aber gänzlich überflüssiger Tipp sein? Oder war es eine ironische Anmerkung? Hatte er sich überhaupt etwas dabei gedacht? Heydrich war eine Sphinx.
Auf der Gästetoilette setzte sich Helmut erst einmal in eine Kabine und stützte sein Gesicht auf seine Handflächen. Einer der wenigen wirklich intimen Orte waren nur die Toiletten im Dritten Reich. Und ein geeignetes Refugium für die eigene Gedankenwelt. Eine seiner mentalen Stützen war das Buch »Die Kunst des Krieges« von Sun Tsu, ein jahrhundertealtes chinesisches Werk der Taktik und Kriegskunst. Eine Schrift voller asiatischer Weisheiten, niedergeschrieben in schnörkelloser Sprache, aber dafür mit einigen blumigen Geschichten. So schrieb Helmuts heimlicher Meister, dass Opportunismus und Flexibilität zwar keine zivilen, dafür aber militärische Tugenden seien. Diese These stellte gewissermaßen die moralische Überlebensstrategie für ihn dar. Helmut, der aus Überzeugung diesen Staat bekämpfte, Leben, Freiheit und Gesundheit riskierte. Nicht die moralische Biegsamkeit besaß, um sich innerlich mit dem neuen System zu arrangieren, stur für seine Ideale focht. Das war sein ziviles Ich. Helmut, der verborgene Krieger, jedoch zog andere Saiten auf. Sein offizielles Ich ging zum Schein mit der Zeit, war ein Mitglied der Gesellschaft. Sicher, er war kein Mitglied von SS oder SA. Auch hatte er es bisher erfolgreich vermeiden können, Mitglied der NSDAP zu werden. Seine Zeit beim legendären preußischen Kriminalisten Gennat sowie seine Beziehung zur Familie Winz alleine schützten seine Rolle als Sonderling in dem Sicherheitsapparat der Diktatur. Zwei Faktoren, die ihm dabei halfen, sein Doppelleben und sein Arrangement mit den Herrschenden zu verbergen, waren seine Leistungsfähigkeit als Kriminalist und seine Liebe zu Isolde. Helmut stützte sich von den Knien auf und öffnete die Tür. Am Waschbecken schwappte er kaltes Wasser in sein Gesicht und betrachtete sich kritisch im Wandspiegel. Seine Liebe zu Isolde war echt und aufrichtig. Seine Leistungen als Polizist musste er jedoch organisieren, fingieren, erschwindeln.
Berlin, 6. April 2008
»Schlüsselbude ist Dortmund, Schlüsselbude ist Dortmund!« Die Schlachtrufe der Fußballfans dröhnen durch die brechend volle Kneipe in Kreuzberg.
»Das ist hier eine Schicksalsgemeinschaft, keine beliebige Kneipe!«, stellt ein vom Szeneleben der letzten 30 Jahre sichtlich gezeichneter Mann neben Achim fest. Er ist immer auch dann da, wenn Achim sich hier ein Spiel von Borussia Dortmund ansieht.
»Noch ein Flens!«, ruft Achim über einige Köpfe zur Theke hinüber. Aus einer seiner abgetragenen, ehemals teuren Jeans, die er nur in Ausnahmefällen anzieht, holt er einen Zehn-Euro-Schein heraus. Heute ist ein solcher Fall. Wenn er in die Schlüsselbude geht, nimmt er die Klamotten, die er auch dann herauskramt, wenn er mit dem Fahrrad durch den Regen oder bei einem Umzug helfen muss. Die Luft in der Schlüsselbude ist durch die Raucher zum Schneiden, die Sicht reicht nur wenige Meter, die Stimmung ist dafür auf dem absoluten Höhepunkt.
»Hömma! Flens ist alle!«, dröhnt es von der Thekenmannschaft zu ihm herüber.
»Dann gib mir was anderes!« Ihm ist nach sechs Flaschen Flensburger Pilsener schon ein wenig blümerant. »Oder hast Du Kaffee?«
Ein dreckiges Lachen jenseits des Tresens ertönt: »Nur wenn Du Kuchen mitbringst!«
Die Kneipe ist eine wahre Spelunke, lebt vom Alkohol, für den Alkohol. Und für den Fußball. Allerdings sind hier nur Fans von Borussia Dortmund gelitten. Das Spiel plätschert jetzt noch einige Minuten zur Pause hin, zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen im Dortmunder Stadion steht es 0:0. Der Abpfiff wird mit erleichtertem Gegröle gefeiert. Mental regiert hier der Pott. Die Gäste sind gesellschaftlich bunt gemischt, echte Ruhrpöttler nur knapp in der Mehrheit. Aber vom Banker über den Polizisten bis hin zu altgedienten APO-Schlägern aus den guten, alten Kreuzberger Tagen ist alles vertreten.
Chris klopft Achim auf die Schulter. »Na, noch fit? Hast ganz schön gebechert!«
»Mach Dir mal keine Sorgen, Meister.« Achim winkt ab.
»Ja, Meister…«, echot Chris mit versonnenem Blick in die Ferne. Dann kehrt das Hier und Jetzt wieder in seine Augen. »Weiß Cordula eigentlich, dass Du hier bist?«
»Klar!« Achim stellt die Flasche weg. »Warum fragst Du?«
»Naja, meine bessere Hälfte hasst es, wenn ich hier bin. Sage ihr immer, dass ich bei einem Kumpel bin und da gucke.« Er klopft seinem Nachbarn, dessen Namen Achim nicht kennt, auf den Rücken.
»Und was bringt dir das? Du riechst doch eh wie ein feuchter Aschenbecher nach fünf Minuten Präsenz hier.«
Verschmitzt lächelt Chris zurück. »Ich hab zwei Kleiderschränke. Nach dem Spiel gehe ich zu ihm, ziehe mir meine Sachen wieder an, die ich getragen habe, als ich von zu Hause weg bin und der Kumpel wäscht mir meine Klamotten.« Chris zeigt auf den Typen neben sich.
Achims Handy vibriert in seiner Hosenasche. Es ist die Nummer von Hubertus, einem freundschaftlich verbundenen Kollegen aus dem LKA-Leitungsstab. Das Ohr am Puls der Macht innerhalb der Behörde.
»Ja, Moment. Ich muss mal raus.« Achim bugsiert sich mit dem Handy am Ohr durch die Menschenmenge und wird von der Kneipe ausgespuckt.
»Sag bloß, Du bist wieder in dieser Kneipe?«, fragt Hubertus. »Da hält man zum falschen Club!«
»Ach so ist das! Du bist Bayer-Fan! Leverkusen... Wie kommt man den auf sowas?«
»Bayer Leverkusen? Bist Du verrückt? Ich bin Berliner. Besser: West-Berliner. Da hält man zu Hertha!«
Grinsend stützt sich Achim mit seiner linken Hand an der Häuserwand ab. »Ach Hertha. Darauf bin ich nicht gekommen, entschuldige bitte. Ich halte das immer noch für eine Wurstmarke.«
»Kommste Dir jetzt überlegen vor, Kollege? Findest du dich nun witzig? Sollte Überlebenswille zu Deinen Instinkten gehören, dann schalte mal um auf Ernst. Man fragt nach den Einsatzplänen vom 5. April. Und es geht um den Besuch zweier Polizisten in einer Kneipe in Oberschöneweide.«
Mist, denkt Achim. Was will man von mir? »Gibt`s eine Beschwerde?«
»Nein«, murmelt Hubertus, »aber irgendwer von den hohen Tieren hat euch auf dem Kieker. Keine Ahnung warum, aber wenn einer nach den Dienstplänen und einem Bericht in Oberschöneweide fragt und mich meine Instinkte nicht trügen, bin ich über diese Dreieckspeilung zu dem Schluss gekommen, dass sich da eine Person oder Institution für etwas oder jemanden interessiert, der am 3. April im genannten Bezirk etwas gemacht hat, was vielleicht auch von politischem Interesse ist. Und neben dem Kampf gegen Wirtschaftsvergehen im großen Stile ist es eben die Extremismus-Bekämpfung, die stets das Interesse der höheren Dienstränge weckt. Hast Du was angestellt?«
»Ich? Nein!«, beteuert Achim voller gespielter Unschuld.
»Soll ich Nils mal vorwarnen?«
»Bist Du verrückt?«, zischt Achim eine Spur zu scharf ins Telefon. »Der macht sich nur unnötig ins Höschen. Aber danke für den Tipp!«
Achim beendet das Gespräch und schon greift jemand nach ihm. Es ist Chris. »Mach hinne! Es geht gleich weiter! Wir müssen die drei Punkte mitnehmen!«
Grübelnd sucht Achim seinen Platz wieder auf und winkt nochmal in Richtung Zapfhahn, beschließt aber sofort, dass Sorgen und Fußball einander ausschließen. Es geht nur eines von beidem. Und wenn er in die Runde der Gäste guckt, sieht nicht nur er das so. Die Borussen geraten zu Beginn der zweiten Hälfte stark unter Druck. Als sich alle mit Getränken eingedeckt haben, herrscht in der Kneipe eine angespannte Stille. Jeder ist mit seinen Gedanken, Befürchtungen und Hoffnungen alleine – und doch sind sie im Ziel und im Schicksal vereint. So muss es sich im U-Boot auf Feindfahrt angefühlt haben, wenn man sich auf gefährlicher Seerohrtiefe dem feindlichen Geleitzug näherte. Achim starrt wie alle anderen Gäste konzentriert und schicksalsergeben auf die Leinwand. Und keine sechs Minuten nach Wiederanpfiff fällt das 0:1 für Leverkusen. Ein lauter, entsetzter Aufschrei aus 100 zumeist männlichen Kehlen erlöst alle Anwesenden und man verfällt in kopfschüttelndes Lamentieren. »Volltreffer Mitschiffs!«, brüllt er und erntet irritierte Blicke. Aber das ist ihm egal. Seefahrersprache ist hier wohl eine Fremdsprache.
Berlin, 27. September 1939
Seinen Wagen ließ Helmut in der Prinz-Albrecht-Straße stehen und ging auf die ehemalige Kunstgewerbeschule zu, dem neuen Sitz der Geheimen Staatspolizei (Gestapo). In dieser Straße wurden nun einige Gebäude als Sitz des neuen Reichssicherheitshauptamtes genutzt. Helmut war verwirrt gewesen, als er die schriftliche Verfügung erhalten hatte mit der Bitte, in diesem Haus sein neues Büro zu beziehen. Als Kriminalbeamter hätte er eigentlich weiterhin am Werderschen Markt, dem eigentlichen Dienstsitz des neuen Amtes V des Reichskriminalamtes logieren dürfen. Die Eingangstür wurde vom Wachhabenden erst geöffnet, nachdem Helmut seinen neuen Dienstausweis vorgezeigt hatte. Das alles musste sich noch einspielen, dachte er für sich. Im alten Dienstgebäude war er wohl bekannt und musste sich nicht ausweisen. Es war ganz offenkundig der erste Tag des neuen Reichssicherheitshauptamtes nicht nur für ihn. Dann blieb er stehen und wendete sich nochmal zu dem Soldaten in SS-Uniform um. »Wo ist Raum 202?«, fragte er den Posten.
»Woher soll ich das wissen? Ich achte nur darauf, dass Berechtigte hier Einlass finden. Und das sind Sie ja wohl. Auch wenn die Berechtigten keine Mitglieder der SS oder zumindest der SA sind, Herr Kriminalkommissar.«
Der vergiftete Unterton entging Helmut nicht. Kaum wollte er diesen überhören und weitergehen, entschied er sich um. Er musste das verdammte Obrigkeitsspiel mitmachen und den lockeren Ton in der preußischen Kripo vergessen.
»Name und Dienstrang. Aber sofort!« Er blieb äußerlich ruhig, zückte sein Notizblock mitsamt Bleistift und blickte ihm dann mit scheinbarer Gelassenheit in die Augen.
Der Angesprochene antwortete mit unterschwelliger Verachtung in seiner Stimme: »SS-Sturmmann Fritz Kerl.«
»So«, war das vorerst letzte leise Wort von Helmut. Dann brüllte er: »Unterstehen Sie sich, einem engen Mitarbeiter von Arthur Nebe derart patzig zu kommen, Sie kleiner Spritzer!« Dann holte er Luft. »Ich erwarte zudem künftig ein lautes, respektvolles ‚Heil Hitler, Herr Kriminalkommissar!‘ zu hören! Ist das klar, Sturmmann Kerl?« Die letzten Worte sprach er mit Nachdruck aus.
Kerl nahm schlagartig Haltung an und erwiderte eilig: »Jawohl, Herr Kriminalkommissar! Und Sieg Heil!«
Diese Prunkbauten haben ihren eigenen Reiz, freute sich Helmut. Das Gebrüllte hallte so schön durch die Luft. Es musste nicht alles von Speer entworfen worden sein, um den Stil der Zeit zu verstärken. Beiläufig, als sei nichts gewesen, drehte er sich weg und murmelte nur ein »Geht doch!«.