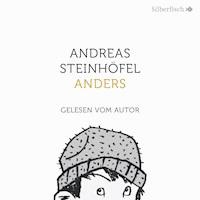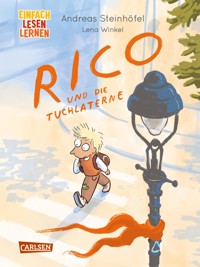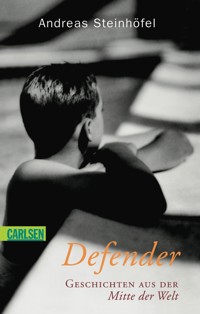
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Von seiner Mutter kann Johannes, der Defender, nichts erwarten, aber immerhin gibt es in seinem Leben Mimi Kaminski - Kioskbesitzerin, gute Freundin, unverheiratet, übergewichtig und schwer zuckerkrank. Und noch jemand glaubt an Defender, Hosianna, der zerstreute, belesene Menschenfreund, der ihm die Möglichkeit gibt, Bücher und vor allen Dingen sein eigenes Leben neu zu sortieren. Der Tod des Vaters und Ehemannes, der Anruf des ehemaligen Geliebten, die Befreiung der Schwester aus der Psychiatrie, die Inszenierung der ersten Liebe - in den ""Geschichten aus der Mitte der Welt"" geht es um Momente, in denen die Weichen in einem Menschenleben gestellt werden. Nach seinem erfolgreichen Roman ""Die Mitte der Welt"" legt Andreas Steinhöfel nun einen Band mit Erzählungen vor. Es sind Geschichten mit uns bekannten Helden aus dem erfolgreichen Roman, die geschickt miteinander verbunden sind. "
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Von Andreas Steinhöfel sind im Carlsen Verlag erschienen:Die Mitte der Welt Beschützer der Diebe David Tage Mona Nächte Der mechanische Prinz Defender Paul Vier und die Schröders Dirk und ich Es ist ein Elch entsprungen Froschmaul Geschichten Trügerische Stille O Patria Mia! Rico, Oskar und die Tieferschatten Rico, Oskar und das Herzgebreche CARLSEN Newsletter Tolle neue Lesetipps kostenlos per E-Mail!www.carlsen.de Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. Veröffentlicht im Carlsen Verlag Oktober 2004 Copyright © 2001, 2004 Carlsen Verlag GmbH, Hamburg Umschlagbild: Nina Rothfos Umschlaggestaltung: Doris K. Künster / Britta Lembke Corporate Design Taschenbuch: Dörte Dosse E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 3-978-3-646-92041-3 Alle Bücher im Internet unterwww.carlsen.de
SANDMANN 7
HERBSTASTERN 12
WINTERLANDSCHAFT 39
DANIEL ZU LIEBEN 56
DIE KATZE 72
INTERVIEW 101
MERLE 129
DEFENDER 149
SANDMANN
Du glaubst nicht an Träume, oder? Hey, Defender, glaubst du an Träume?
Mann, was für eine Frage. Natürlich glaube ich an Träume. Aber wer gibt so etwas schon gerne zu? Hosianna, ganz der Vernunft verpflichteter Professor, würde sich an den Kopf fassen, wenn ich ihm damit käme. Oder sogar noch einen Schritt weiter ginge: Wenn ich behauptete, dass ich vom Sandmann nicht nur geträumt habe, sondern dass er existiert.
Als ich fünf Jahre alt war, sah ich ihn zum ersten Mal. Er stand am Fußende meines Bettes, ein Schatten im Schatten, vielleicht stand er dort schon seit Stunden. Er wäre als Spielzeug zwischen anderen Spielzeugen durchgegangen, hätte ich welche besessen.
Ich war aus einem wirklich fiesen Traum erwacht. In diesem Traum hatte ich mich an Bord eines Schiffes befunden, das unter düsterem Himmel über ein endloses, schäumendes Meer trieb. Ein Sturm tobte. Eine haushohe Woge hatte meine Mutter und deren ständige Vertretung, Mimi Kaminski, über Bord gefegt.
Ich war allein.
Aus den Fluten stiegen Ungeheuer. Sie hakten sich an der Schiffswand hinauf, sie schlitterten über das Deck auf mich zu. Spitze Zähne glimmten, irgendwo mussten Sterne leuchten oder ein verschwommener Mond.
Ich schrie und riss die Augen auf.
Und sah den Sandmann.
Groß war er nicht. Kann ich nicht behaupten. Er stand leicht gekrümmt, wie unter einer schweren Last. Sein Gesicht war zerfurcht, Falten und Runzeln, vielleicht waren es auch Narben. Nase und Mund waren kaum zu erkennen, und Augen so winzig, die lagen so tief, dass ich mir eine Farbe für sie ausdenken musste.
Ich entschied mich für Meerwasserblau.
Verschrumpelte Hände hatte er, der Sandmann, die waren auch nicht hübsch. Und an jeder Hand befanden sich, das schwöre ich, sechs Finger.
Sechs Finger.
Er winkte mir zu.
Ich wusste, was er von mir wollte. Und weil ich ihm vertraute, schloss ich trotz meiner Angst die Augen, sank zurück in den Traum, war im nächsten Moment wieder auf dem Schiff.
Der Sturm tobte noch immer. Und die verdammten Ungeheuer waren nicht etwa verschwunden, o nein. Wenn überhaupt, waren es noch mehr geworden. Von ihren Zähnen tropfte zäher Schleim. Wo er zu Boden fiel, ätzte er Löcher in die Planken. Ich war fünf Jahre alt. Ich machte mir in die Hosen vor Angst.
Aber neben mir stand der Sandmann. Er schrie: Da habt ihr, und da, und da …! Mit jedem Schrei schleuderte er feinen Sand auf die Ungeheuer. Da war nichts, worin er den Sand transportierte. Er trug keinen Beutel, er hatte keine Manteltaschen. Der Sand war einfach vorhanden. Er griff ihn sich aus der Luft.
Da, und da, und da …!
Und aus der Nacht wurde Tag. Die Ungeheuer zerflossen, lösten sich auf. Wurden zu Sonnenlicht und Meerwasser und Regenbogenfarben. Pure Magie, würde ich sagen.
Ich öffnete die Augen und sah mein Zimmer, schloss die Augen und schlief weiter, tief und fest. Als ich am Morgen erwachte, war der Sandmann verschwunden. Logisch. Aber meine Mutter war da, und am selben Vormittag, als ich in Mimi Kaminskis Laden auflief, stellte ich beruhigt fest, dass es meine dicke Ersatzmutter auch noch gab. Jedes einzelne ihrer mindestens einhundert Kilo.
Abends fand ich vor dem Fußende meines Bettes ein paar winzige Sandkörnchen. Mit fünf Jahren wundert dich so etwas kein bisschen. Mit fünf Jahren erwartest du förmlich so einen übernatürlichen Scheiß. Ich hob die Sandkörnchen auf und schnupperte daran. Sie rochen nach Zimt und Orangen.
Und das war alles.
Oder beinahe alles.
Denn ich sah den Sandmann noch einmal wieder, viele Jahre später.
Ich träumte. In diesem Traum befand ich mich … überall. Es war verrückt. Da war eine Winterlandschaft und darin ein blasshäutiges Mädchen, wie in Eis gegossen, mit einer Axt in den Händen, und es verwandelte sich und wurde zu einem anderen Mädchen, rote Haare und ein wilder Blick, der mir ganz und gar nicht gefiel, genauso wenig wie die Axt, die jetzt in ihren Händen lag. Und dann war da ein Junge, der stand in einem Garten, hinter einem grauen Vorhang aus Regen, vor einer Art Fischteich oder so was – ich sah die Tropfen aufplatschen und hochfliegen und wieder aufplatschen. Und aus dem Teich wurde ein gewaltiger See, Schiffe darauf und so weiter, und dieser Junge wurde kleiner, jünger, verletzlicher. Ein Kind.
Szenenwechsel, zwei Typen jetzt in einem Auto auf schwarzer Straße, Scheinwerfer stachen in ein dichtes Schneegestöber. Irgendwas stimmte mit den beiden nicht, stimmte ganz und gar nicht. Aber da verwandelten sich Fahrer und Beifahrer auch schon in zwei andere Jungen, und nun wurde die Sache vollends absurd, denn diese beiden neuen Jungen standen vor der Chinesischen Mauer und die endete, was weiß ich, irgendwo in der Wüste, jedenfalls nicht da, wo sie hingehörte, denn plötzlich erhoben sich Pyramiden aus orangerotem Wüstensand und davor stand ein blondes Mädchen mit blutenden Füßen, und es lag ein Rhythmus über all diesen Bildern wie Trommelklang, als klatschten, außerhalb der Szenerie, ein Haufen Leute anfeuernd in die Hände.
Ich weiß nicht, warum ich schrie.
Aber ich erwachte.
Und ich sah meinen alten Freund, den Sandmann.
Er stand am Fußende meines Bettes. Die vielen Jahre hatten ihn nicht verändert. Gekrümmt stand er, das Gesicht so runzlig, wie ich es in Erinnerung hatte … und dieser meerwasserblaue Blick. Langsam, als bereitete es ihm große Mühe, hob er eine Hand und winkte mir zu. Und ich folgte ihm, wie ich ihm schon einmal gefolgt war vor langer Zeit.
Sonne. Wasser. Ein Strand. Gemeinsam gingen wir am Rand des unendlichen Meeres spazieren, der Sandmann und ich. Wellenschwappen, der Himmel so blau, ein leuchtender Tag. Dieser gedrungene Mann an meiner Seite zeigte auf den Boden zu unseren Füßen. Ob ihr es wisst oder nicht, früher oder später kommt jeder von euch hierher, sagte er. Ihr lauft über diesen Sand, mit dem ich seit Jahrhunderten eure Ungeheuer verjage. Eine Hand voll für jedes der Biester, mehr brauche ich nicht. Er sammelt sich hier, dieser Sand. Wie beiläufig fügte er hinzu: Du weißt, dass die anderen dich auch gesehen haben?
Er verabschiedete sich von mir. Ich sah ihm nach. Seine Füße hinterließen keine Abdrücke im Sand.
Es war seltsam.
Pure Magie.
Ich weiß nicht, warum, aber ich wünschte, ich könnte mich an seine Stimme erinnern.
Na ja, wie auch immer: Der Sandmann existiert. Mag sein, ihr werdet ihn nie zu Gesicht bekommen. Oder ihr denkt, ihr seid zu alt für solchen Kinderkram. Doch lasst euch nicht täuschen. Der Sandmann existiert. Legt euch hin, schließt die Augen, schlaft ein. Lauscht euren Ängsten. Dann ist er da. Er steht vor eurem Bett, und dort wacht er. Wacht und wartet, wartet und wacht, voller Geduld, Stunde um Stunde, Traum um Traum. Die ganze Nacht über hält er die Hände zu Fäusten geballt, und zwischen den sechs Fingern jeder Hand rieselt Sand zu Boden.
Feiner Sand.
Manchmal kann man ihn sehen und fühlen, diesen Sand.
Manchmal ist da nicht mehr als ein entfernter Duft von Zimt und Orangen.
Und manchmal hat man weniger Angst.
HERBSTASTERN
Früher war das abgelegene, vor langer Zeit vom Angelverein erstandene Grundstück sein Lieblingsort gewesen. Wie ein spitzwinkliges Dreieck lag es in der Landschaft, von Hecken umstanden, die über die Jahre hinweg mehr als mannshoch gewachsen waren. Ansonsten gab es nur Wiesen und Felder hier draußen, keinen Menschen weit und breit. Die Hecken versperrten den Blick auf das Vereinshäuschen und auf den zum Fluss hin angelegten Teich. Vor allem aber verbargen sie den Garten vor den Blicken gelegentlicher Sonntagsspaziergänger; den großen Garten mit seinen alten Obstbäumen und den verwilderten Blumenbeeten, um den nie jemand sich wirklich gekümmert hatte. Herbstastern wuchsen in diesem Garten. Wegen der Astern waren sie hierher gekommen.
Nachdem sie auf der weitläufigen Wiese vor dem Grundstück geparkt und den Motor abgestellt hatten, schien das Trommeln des Regens auf dem Wagendach lauter geworden zu sein. Jule zog den Schlüssel aus dem Zündschloss. »Da wären wir also.«
Er nickte langsam. »Ja. Da wären wir.«
»Ich … kann noch nicht. Gib mir noch eine Minute, okay? Ich muss mich nur kurz daran gewöhnen, dass wir hier sind.« Sie lächelte ein wenig unschlüssig. »Ist ein komisches Gefühl, nach all den Jahren.«
»Kein Problem. Lass dir Zeit.«
»Aber ich komme mit«, verkündete Hendrik vom Rücksitz. »Wo ist der Teich? Sind da wirklich Fische drin?«
»Sei nicht so ungeduldig, Kleiner.«
»Ich bin kein Kleiner!«
Dennis grinste. »Dann eben nicht.«
Die Autoreifen hatten, wie er beim Aussteigen bemerkte, eine tiefe Doppelschneise im hohen Gras hinterlassen. Unter der Karosserie war ein Schaben wie von Armeen kleiner Tiere gewesen, die alle gleichzeitig versuchten, sich durch das Blech nach oben zu fressen. Es hatte nie eine anständige Zufahrt zum Grundstück gegeben. Immer hatten sich irgendwelche Landwirte oder Dorfbewohner dagegen gesperrt, die Besitzer der umliegenden Wiesen und Felder.
Er wartete, bis Hendrik aus dem Wagen gekrabbelt war, dann warf er die Beifahrertür hinter sich zu und atmete tief durch. Frühherbst. Es roch nach abgeflammten Feldern und frisch umgestochener Erde, dazu kam der satte, vom nahen Fluss herangetragene Duft des Uferröhrichts; schließlich das würzige Aroma verfaulenden Obstes, es stach vom Grundstück herüber durch die Hecken. Offenbar hatte niemand sich die Mühe gemacht, die Äpfel, Birnen und Pflaumen einzusammeln, die im Laufe des Sommers an den Bäumen gereift waren. Das Obst musste jetzt über den ganzen Garten verstreut liegen – sehen konnte man es nicht, dazu waren die Hecken zu hoch und zu dicht. Auch nichts dran gemacht, an den Hecken. Seit einer Ewigkeit nicht beschnitten.
Er drehte sich um, erstaunt darüber, wie vertraut ihm alles geblieben war. Weit hinten der aufgeschüttete Bahndamm, über den sie gekommen waren; da war der Weg noch befestigt. Ein paar hundert Meter weiter entfernt das Dorf, sichtbar nur die roten Häuserdächer, der Rest war verdeckt durch den Bahndamm. Die Dächer hatte er früher von hier aus nicht sehen können, fiel ihm ein, dazu war er zu klein gewesen. Nach links schlossen die Wiesen sich an, ein grüner Teppich löste den nächsten ab. An manchen Stellen war der Boden feuchter als an anderen, dort wuchs das Gras besonders dunkel und saftig. Zur Rechten schwangen Hügel sich auf, unten stand jetzt, das war neu, ein Klärwerk. Den gewundenen Weg, den der Fluss nahm, konnte man ebenfalls erkennen; abwechselnd drängten entlang seines Verlaufs auf beiden Uferseiten Pappeln und Erlen gegeneinander.
»Gehen wir endlich rein?«, quengelte Hendrik. »Ich werde ganz nass auf dem Kopf!«
»Du bist schon ganz nass.«
»Mir ist kalt außerdem.«
»Gleich.«
Nur ein paar Kilometer weiter flussabwärts, überlegte Dennis, musste irgendwo die Furt kommen, in der er als Kind einmal ein Mädchen mit dem Taschenmesser verletzt hatte. Kaum zu fassen, wie leichtsinnig er damals gewesen war. Ein Kind eben. Falls das Mädchen noch in der Stadt wohnte, schoss es ihm durch den Kopf, könnte er sie besuchen. Sich bei ihr entschuldigen. Damals hatte er es entweder nicht für nötig gehalten oder einfach den Mut nicht aufgebracht, er wusste es nicht mehr genau. Mein Gott, er war kaum älter gewesen, als Hendrik jetzt war, das alles lag so lange zurück. Und viel Zeit war ihm damals nicht geblieben. Etwa drei Monate nach dem Vorfall am Fluss hatte seine Mutter ihn und Jule geweckt, mitten in der Nacht. Nur zwei gepackte Koffer, das war alles. Raus in die Kälte, es hatte noch nicht geschneit, aber gerochen hatte es bereits nach Schnee. Kalt. Frostig. Anfang Dezember. Schlaftrunken ins Auto, eine lange, lange Fahrt. Wieder eingeschlafen, aufgewacht in einem neuen Leben.
Neben ihm kickte Hendrik gelangweilt nach einem imaginären Ball, sein Fuß durchpflügte das nasse Gras. Regentropfen nahmen unter seinen Tritten die falsche Richtung, sausten von unten nach oben, fielen wieder herab. Hendrik war der Einzige von ihnen, der Gummistiefel trug. Seltsam, überlegte Dennis, dass ausgerechnet sein kleiner Bruder der Vorausschauendste unter ihnen war. Fuhr von zu Hause weg, fuhr hunderte von Kilometern weit, und dachte daran, seine Gummistiefel mitzunehmen. Eigentlich hätte diese Rolle Jule zukommen müssen. Waren ältere Geschwister nicht dafür da, an alles zu denken?
»Den-ni-his!«, nörgelte Hendrik.
»Reg dich ab, okay?«
Auf dem Weg zur Gartentür sah er nach links, zum Fluss. Man ahnte nur wegen des beständigen, vom Regen fast übertönten Gluckerns und Plätscherns, dass er keine zwanzig Meter entfernt von der Hütte verlief. Goldrute und Springkraut wuchsen hoch an seinem Ufer, dazwischen graugrünes Schilf. Der Regen hatte alles zerhämmert, die Köpfe der Pflanzen hingen traurig und matt nach unten. Seit drei Tagen kam es nur so vom Himmel runter, es hatte ununterbrochen geschüttet, zu Hause schon. Gewitterwolken über dem ganzen Land, von Süden bis Norden. Man begann bereits zu vergessen, wie ein normaler, lichter Sommertag aussah. Wie Sonnenschein sich auf der Haut anfühlte. Einen ungünstigeren Zeitpunkt, hierher zu kommen, zum Häuschen, zum Fluss, auf diese Wiese, haben wir kaum erwischen können, dachte er.
Nun, man konnte sich eben nicht alles aussuchen. Er hoffte, dass die Herbstastern im Garten die Unwetter der letzten Tage besser überstanden hatten als die Pflanzen am Flussufer. Keine schöneren Blumen als diese gebe es auf der Welt, hatte sein Vater einmal gesagt. Dennis schloss die Gartentür auf, dann die Tür zur Hütte. Hendrik drängelte sich an ihm vorbei.
»Hey, Kleiner, wolltest du dir nicht den Teich angucken?«
»Nee, nicht mehr. Ich bleib hier, bis der Regen aufhört.«
»Da kannst du lange warten.«
»Mir doch egal.«
Es war auffallend aufgeräumt in der Hütte. Trübes Licht sickerte durch das einzige Fenster. Auf der Fensterbank scharten sich allerlei Nippes um einen vertrockneten Kaktus. Staub überall, eine millimeterfeine Schicht. An der rückwärtigen Wand standen ein Kühlschrank und eine kleine Spüle. Ein Tisch, zwei nüchterne Holzstühle, ein alter Sessel mit zerschlissenem Polster. Das Sofa mit den geschwungenen Lehnen stand da, wo es immer gestanden hatte. Neu bezogen irgendwann, stellte er fest, mit billigem Stoff. Rechts davon, auf dem Fußboden, stapelten sich Zeitschriften: Der Blinker, Fisch und Fang. Dazwischen Wochenend, Neue Revue, der Stern. Genau wie früher. Zahllose Urkunden und Fotografien schmückten die Wände. Und überall dazwischen hingen präparierte Fischköpfe. Sie stachen aus dem Mauerwerk. Als Kind hatte er geglaubt, ihre Körper seien dahinter versteckt, ragten tief in die Wand, so dass auf der Außenseite des Hauses ihre Schwänze herausschauen mussten. An die zwei Dutzend mochten es sein. Alle mit weit aufgerissenen starren Mäulern, die nadelspitze, gefährlich wirkende Zähne entblößten. Hechte vor allem, ein paar Zander, ein einzelner mächtiger Barschkopf. Gelbgrüne Glasaugen starrten ins Leere.
»Viele Fische«, sagte Hendrik.
»Mhm.«
Dennis betrachtete neugierig die alten Fotos. Manche der darauf abgebildeten Gesichter kamen ihm vage bekannt vor. Er versuchte, sich an die dazugehörigen Namen zu erinnern. Nichts. Eigentlich interessierten sie ihn auch nicht, diese vergessenen Gesichter. Er suchte nach etwas anderem, nach einem ganz speziellen Foto. Seine Augen huschten von links nach rechts, auf und ab. Da war es. Er hatte zu weit oben danach gesucht, ganz automatisch. Als Kind hatte er immer ein wenig aufschauen müssen, um es zu betrachten. Aber jetzt … Mit jedem Zentimeter, den du wächst, dachte er, verändert sich dein Bild von der Welt. Er schloss die Augen, öffnete sie wieder.
Gelb vom Rauch unzähliger Zigaretten und ein wenig verblasst war das Foto. Schwarzweiß. Das einzige existierende Bild, das ihn gemeinsam mit seinem Vater zeigte. Er konnte sich nicht entsinnen, wann es aufgenommen worden war oder von wem. Der Junge auf dem Bild musste sechs oder sieben Jahre alt sein. Der Fisch, den der Vater geangelt hatte, war von erbärmlichen Maßen, doch der Kleine war sich dessen nicht bewusst. Er hielt das tote Tier mit der traurig herabhängenden Schwanzflosse auf beiden Händen der Kamera entgegen, als wäre es die großartigste Trophäe der Welt. Sein Vater war ein Held.
»Hey, hier ist ein Radio!«, rief Hendrik hinter ihm begeistert.
»Mach ruhig an«, sagte Dennis abwesend. Er studierte den Fisch. Es war ein … Schwierig, schwarzweiß. Und es war ewig her, dass er die Namen von Fischen hatte aufsagen können wie das kleine Einmaleins. Ein Karpfen? Eine Schleie, ein Döbel? Oder doch nur eine Barbe? Eine Hand des Mannes auf dem Foto lag auf der Schulter des Jungen. Der Junge sollte eigentlich allen Grund haben zu lächeln, tat es aber nicht. Für ein Kind sah er zu ernst aus, die hellen, kaum sichtbaren Augenbrauen waren zusammengezogen. Skepsis oder Misstrauen. Der Vater lachte, war aber nicht ganz bei der Sache. Er sah irgendetwas an, das sich hinter dem Fotografen befand.
Dennis fuhr zusammen, als das Radio losdröhnte. Er wirbelte herum. Hendrik blickte schuldbewusst zu ihm auf. »Ehm … Soll ich’s lieber wieder ausmachen?«
»Nee, ist okay. Such einen besseren Sender, hm? Ich geh mal raus und gucke, wo Jule bleibt.«
»Ist gut.«
Das zufriedene Summen seines Bruders begleitete ihn zur Tür hinaus. Jule stand am Teich und starrte auf das Wasser. Der Regen hatte den Boden völlig aufgeweicht, um jeden ihrer Füße hatte sich eine kleine Pfütze gesammelt. Dennis hätte sie gern umarmt, wusste aber, wie unwirsch sie auf so etwas reagierte. Und wie umarmte man die eigene Schwester? O Gott, was für bescheuerte Fragen einem durch den Kopf gehen konnten.
»Und?«, sagte er, als er neben ihr stand. »Hast du nach den Astern geschaut?«
»Sie sind wunderbar.« Ihre Stimme durchdrang kaum das Rauschen des Regens.
»Wie viele nehmen wir mit?«
Ein Achselzucken. »Keine Ahnung. Wie viele werden wir wohl brauchen?«
»Weiß ich auch nicht.«
»Na ja. Am besten jede Menge. Was macht Hendrik?«
»Kramt so rum.«
»Er versteht das alles nicht, was meinst du?«
»Möglich.« Eine Pause entstand. Regentropfen klatschten auf den Teich, verwandelten die Oberfläche in einen sprühenden Teppich, in eine sich jede Sekunde neu formierende Kraterlandschaft. Wasserlinsen trieben hin und her wie aufgeregte, winzige grüne Boote. Irgendwo quakte eine Ente.
»Willst du nicht reinkommen?«, fragte er.
»Nein.« Jule steckte die Hände in die Hosentaschen. »Ich fühl mich ganz wohl hier.«
»Du wirst dich erkälten.«
»Nein, werde ich nicht. Ich war noch nie erkältet.«
»An was denkst du?«
»Alles Mögliche.« Sie wandte sich ihm zu. Sie hatte geweint. Merkwürdig, dass man Tränen von Regentropfen unterscheiden konnte. »Lass mich einfach. Ist schon alles in Ordnung.«
»Die Astern –«
Sie winkte ab. »Pflücke ich gleich. Kümmer dich um Hendrik. Wer weiß, was der in der Hütte anstellt.«
»Er wird die schweinischen Zeitungen rauskramen und sich die nackten Frauen angucken.«
»Pornos etwa?«
»Quatsch. Nur Zeitungen.«
»Na ja. Solange er keine Streichhölzer findet und rumzündelt.«
»Abbrennen kann die Hütte nicht, schätze ich. Bei dem Regen.«
»Ja. Schlimm.«
Er ging zurück in die Hütte. Hendrik hatte einen alten Comic, den das Kind irgendeines Vereinsmitglieds hier vergessen haben musste, aus dem Zeitschriftenstapel gefischt und saß damit auf dem abgehalfterten Sessel. Er sah kurz auf, als Dennis eintrat, steckte dann einen Daumen in den Mund und las weiter. Er würde genervt reagieren, wenn Dennis ihn auf den Daumen im Mund aufmerksam machte, also wozu? Das Radio plärrte. Ein Werbejingle wurde eingespielt. Regen prasselte auf das Hüttendach. Man konnte sich verlieren in diesem monotonen Geräusch, wenn man ihm zu lange lauschte. Es war hypnotisch. Mann, wenn doch dieser Regen endlich aufhörte.
Er widmete sich erneut dem Foto. Dieser Fisch … Ja, definitiv eine Schleie. Wie hatte er die typischen wulstigen Lippen bloß vergessen können, die dunkle Färbung der Schuppen? Er hatte sich so gut ausgekannt. Hatte seinen Vater hundert Mal zum Angeln begleitet, wenn nicht öfter. Gute Ausflüge waren das gewesen, jedenfalls die meisten. Selten hatten sie geredet, gar nicht, eigentlich, worüber auch? Männer unter sich, so nannte man das wohl. Er wollte grinsen. Es gelang ihm nicht.
Wie alt war ich gewesen, überlegte er, als ich Papa das letzte Mal zum Angeln begleitet habe? Acht Jahre alt. Welcher Monat ist gewesen, Juli oder August? Eher August. Ja, genau. Spätsommer. Etwas früher als jetzt. Wir sind vormittags aufgebrochen, am Wochenende. Samstag. Wir haben auf dem Fels am See gesessen, praktisch den ganzen Tag lang, und kein Fisch hat angebissen. Total tote Hose.
Über beinahe acht Stunden hinweg hatte Dennis die Laune seines Vaters stufenweise in den Keller rutschen sehen. Viel Aussicht auf Erfolg bestand inzwischen wirklich nicht mehr. Der Nachmittag schlich seinem Ende entgegen, dann stand die Fahrt nach Hause an. Die würde eine weitere gute Stunde dauern. Bis sie daheim ankamen, würde es dunkel sein. Er hatte solchen Hunger. Eigentlich müsste sein Vater hören, wie ihm der Magen knurrte. Das letzte Brot hatte er schon vor drei Stunden verdrückt, den letzten Apfel vor zwei. Vielleicht hätte er bei seiner Mutter bleiben sollen, die hätte ihn sicher fernsehen lassen.
Auf der Hinfahrt war sein Vater noch bester Stimmung gewesen. Da hatte er erzählt, wie der Dieter Ferchlandt neulich einen kapitalen Hecht gezogen hatte und wie er von allen Freunden aus dem Verein wahnsinnig dafür bewundert worden war. Ausgerechnet der Ferchlandt, diese Niete! Die würden schon bald sehen, dass andere Männer auch ordentlich zu angeln verstanden. Augen würden die machen, groß wie Untertassen. Die würden schon sehen. Wer war schon Dieter Ferchlandt?
Wo der See begann, beim Angelladen der alten Frau Hembach, hatte er dann angehalten, um eine nagelneue Rolle zu kaufen. Dazu zweihundert Meter beste Schnur, ein paar Köderfische, zwei Sechserpacks Bier. Teuer sei die Rolle, hatte Dennis die alte Frau Hembach sagen hören, aber ihr Geld wert. Das würde seiner Mutter nicht gefallen, das mit der Rolle, sie rechnete zu Hause mit jedem Pfennig. Allerdings war es eher unwahrscheinlich, dass sie es überhaupt herausbekommen würde.
Und nun diese Pleite.
Der See war spiegelglatt. Ab und zu zogen Segelboote vorüber, dümpelten lustlos dahin in der Flaute. Vom Ufer hielten sie Abstand. Fünf oder sechs zählte Dennis, das waren nicht viele. Das Wetter war nicht nach Segeln. Und die Saison war ohnehin bald vorbei. Im Spätsommer war hier nur noch wenig los. Bald schon würde der See abgelassen, der Pegel stand schon jetzt niedriger als gewohnt. Vom kiesigen Felsvorsprung, auf dem er und sein Vater saßen, bis hinunter zum Wasser waren es drei oder vier Meter. Da musste man aufpassen, dass man dem Rand nicht zu nahe kam, abglitt und hinunterstürzte.
Sein Vater erhob sich aus seinem Campingstuhl, holte langsam eine der beiden Angeln ein, löste den alten Köderfisch, warf ihn achtlos in den See. Er griff in den Keschereimer, holte einen größeren Fisch heraus und zog ihn auf. Der Fisch zappelte, als ihm, von hinten nach vorn, die lange Nadel mit dem silbernen Vorfach unterm Rückgrat entlangfuhr, seine Kiemen klappten schnell auf und wieder zu. Ein Drilling wurde befestigt, die Angelrute holte aus. In silbernem Bogen sauste der Fisch durch die Luft, traf aufs Wasser, tauchte unter. War verschwunden. Einen Augenblick später zog der Schwimmer langsam nach links, dann nach rechts, kam schließlich zur Ruhe. Sein Vater brummte etwas Unverständliches, setzte sich wieder hin und blickte auf den See. Was dachte der wohl in all dieser Zeit? Man konnte auf das Wasser gucken und an gar nichts denken, war Dennis irgendwann aufgefallen. Dann war man wie verzaubert. Ging es seinem Vater genauso? War auch er verzaubert? War er auf dem Mond in Gedanken, oder in Amerika? Am Südpol?
Etwa zehn Minuten mochten vergangen sein, als plötzlich Bewegung in den Schwimmer kam. Er zog vom Ufer fort nach draußen, ganz rasch, viel schneller, als der kraftlose kleine Köderfisch dies schaffen könnte. Dennis bemerkte, wie plötzliche Hitze seinen Körper durchströmte. Er sah zu seinem Vater. Der hatte sich halb aus seinem Stuhl erhoben, angespannt, die Augen zusammengekniffen. Anbiss, dachte Dennis jubelnd, Anbiss!
Was hab ich gemacht, was hab ich gemacht an all diesen Nachmittagen am See? Immer nur dagesessen, auf das Wasser gestarrt, auf den Schwimmer, und dabei gehofft, dass etwas passiert? An nichts gedacht, so wie er? An den Scheißsüdpol? Ist das wirklich so aufregend gewesen? Papa hat so gut wie nie mit mir gesprochen. Sobald wir aus dem Wagen draußen waren, alles runtergeschleppt hatten auf den Fels, sobald die Angeln fertig gemacht und ausgeworfen waren, hat Ruhe geherrscht. Acht Jahre alt bin ich gewesen. Wie viel länger hätte ich das noch mitgemacht? Wann hätte ich die Stille nicht mehr ertragen, wann zu reden begonnen? Hätte sich dadurch überhaupt etwas verändert? So, wie ich aus meinem Schweigen herausgewachsen wäre, wäre er vielleicht in derselben Zeit immer weiter in seines hineingewachsen, oder?
Damals hat mir das Schweigen noch gefallen. Die Ruhe. Der stille See. Hin und wieder hat ein Windstoß kleine Wellen darüber gejagt. Und wie der Himmel sich darin spiegelte, blassblau. Und die Wolken ganz zerfasert, als hätte man sie mit einer großen Gabel zerkratzt. Ja, daran erinnere ich mich am besten, an die Farbe des Himmels. Oder die Bäume am Ufer: grün und an den Rändern schon von leichtem Gelb das Laub. Eine eigene Angelrute hätte ich gern besessen, damals, ja, jetzt fällt’s mir wieder ein, das weiß ich noch. Mann, eine eigene Rute! Die hatte ich mir zu Weihnachten gewünscht. Bloß vier gute Monate wären es bis dahin noch gewesen. Aber es hat kein gemeinsames Weihnachtsfest mehr gegeben.