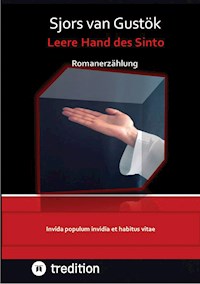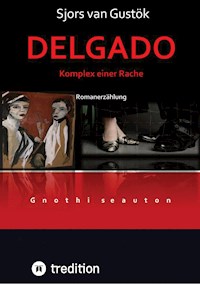
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gnade und Fluch dreier inniger Freundschaften. Lebenslänglich. Diese Geschichte ist in emotionalen Dichten auf dramatischen Pfaden des Perfiden, des Erotischen und auch der Gewalt erzählt. Nimm und lies! Es endet liebevoll, ebenso knallhart: Hans erlebt seit den Sechzigern bis dato drei abfolgende Männerfreundschaften, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Innerhalb seiner ersten beiden Freundschaften wächst ein Motiv, Rache zu nehmen, zu töten. Es kommt zur Selbstjustiz. Der dritte Freund ist Autist. Er ist der Gesprächspartner, der Anker - für Hans. DELGADO ist ein "Erstling."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sjors van Gustök
Jahrgang 1951, gelernter Industriekaufmann,
vormals in wirtschaftlichen Unternehmen mit
weitreichenden Organverantwortungen tätig.
Das Buch:
Von der Gnade und dem Fluch dreier inniger Freundschaften. Lebenslänglich.
Diese Geschichte ist in emotionalen Dichten auf dramatischen Pfaden des Perfiden, des Erotischen und auch der Gewalt erzählt. Nimm und lies! Es endet liebevoll, ebenso knallhart.
DELGADO ist ein „Erstling“.
Einer Tochter zugeeignet.
Sjors van Gustök
Delgado
Komplex einer Rache
© 2021 Sjors van Gustök
Umschlag, Illustration: Sjors van Gustök
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-48059-9
Hardcover
978-3-347-48062-9
e-Book
978-3-347-48070-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Heft 1: Dämonen bleiben
01. Nachruf
02. Wenn Wolken auf Berge treffen
03. Sandkasten voll Asche
04. Sandkasten ohne Sand
05. Blutsbrüder
06. Goebbels, Stalin und Theuerland
07. Kredit des Todes
08. Fortunas Wände
Heft 2: Schlüssel am Bund
01. Englischer Einkauf
02. Nicht die Stadt
03. Bittere Befreiungsschläge
04. Der heiße Draht
05. St. Lucia und der schwarze Admiral
06. Portbou
07. Art der ersten Liebe
08. Hoek van Holland
09. Am Treuebund
10. Hummel Hummel
Heft 3: Mietverhältnisse
01. Hochzeiter
02. Meg Aggadear
03. St. Eligius‘ Werkstatt
04. Wie Rheuma in den Händen entsteht
05. Folgschaften
06. Upside Down
07. Projekt Knuffel
08. Grenzdorf und Massendefekt
09. Lilith
Heft 4: Die Straße der Brillanten
01. Bohnerwachs und Bunsenbrenner
02. Neues Leben
03. Dickes Mäuschen
04. Kottkott und Konsorten
05. Zwei schlechte Gewissen
06. Vernagelte Fenster und Türen
07. Gute Ödeme
08. Das kleine „o“ im großen „D“
Heft 5: Allobates amissibilis
01. Die Afrikaner
02. Die Party
03. Die Kunst von Strategie und Taktik
04. Der besondere Doktor
05. Die erkaltete Sonne
06. Sandkasten voll Sand
07. Toter Zoo
08. Condor: From: SPC To: TXL
09. Die Frage Testament
Heft 6: Metronom
01. Karussell
02. Welche die fehlen
03. Euer Ehren
04. Dinner der Wahrheit
05. Das Paket
Vorwort
In meinem Familien- und Freundeskreis konnte ich nicht verheimlichen, dass ich an einem Text für eine Romanerzählung arbeitete. Ich habe letztlich zugelassen, dass mir abschnittweise über die Schulter gesehen – und so auch schon mitgelesen wurde. Mich erreichte die Resonanz eines Freundes mittels einer digitalen Nachricht:
„Ich wünsche Dir viel Schaffenskraft. Das Werk wird auch Dich verändern. Es grüßt Dich Dein …”
Diese Prognose hat sich für mich erfüllt. Vielleicht spüren meine Leser auch Veränderungen, die in ihnen vorgehen.
In dieser Fiktion „steht die Frage im Raum, inwieweit es möglich sein könnte, aus einer Kausalkette auszusteigen, die Schuld und Unschuld determiniert. Der bitterste Tropfen dieser Frage sei die völlige Unverantwortlichkeit des Menschen für sein Handeln und sein Wesen.“ (vgl. Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches, Köln 2006, S. 93). „Die Erscheinungen werden wie gewohnt nicht genau beobachtet, sondern nur zu einem Faktum kumuliert und somit isoliert. Handeln und Erkennen werden so in der Regel rudimentär. Die Tatbestände bestehen aus Vielfältigkeit und Dynamik. Alles ist ein beständiger Fluss. Ursachen sind oft nicht erkennbar; sie liegen dazwischen, davor oder dahinter.“ (vgl. a.a.O., S. 494, 495).
In dieser Story werden in hohem Maße emotional Szenarien dreier Freundschaften beleuchtet, um das Geschehen einer Tötung, vielleicht sogar eines Mordes, näher zu erklären.
Ähnlichkeiten mit lebenden und bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig.
gez. Sjors van Gustök
Heft 1 – Dämonen bleiben:
Fünfziger … Achtziger, Rückblicke Zwanziger … Vierziger
01. Nachruf
Noch an der Hand des Vaters fiel Hans auf, was für Trauerreden allgemein über Verstorbene gehalten wurden! Er war ein sehr früh verständiges Kind, der kleine Hans. Er hörte sehr aufmerksam zu, wenn sie redeten über die, die er kannte, und wo er mitgehen durfte, wenn sie abreisten.
Das waren die? So handelten die? So haben die gelebt? So haben die gedacht und viel Gutes getan? Jenes und dieses waren Stationen in ihren unterschiedlichsten Leben und so weiter und so weiter.
Wie wenig. Wie oberflächlich. Wie gewöhnlich.
Absichtlich nichts sagen und absichtlich wenig wissen?
Diese Haltung schreibt Hans bis heute den meisten Rednern an Gräbern zu. Wozu diese Heuchelei?
Das will er so nicht haben, wenn er einmal gehen wird; beigesetzt wird. Eine auf ihn zugeschnittene Trauerrede hat er längst parat liegen. Vielleicht wird er sie hier und da noch ergänzen, aber prinzipiell ändern keinesfalls.
„Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Trauernde, liebe Angehörige, liebe Frau Lansink.
Sie nenne ich zuletzt, weil der Verstorbene mir aufgegeben hat, in meiner Ansprache den Kreis von außen nach innen zu ziehen. Auf dem aufgestellten Portrait sehen wir Hans Savin-Lansink in der Mitte seines erfüllten Lebens.
Ich betone das erfüllte Leben deshalb, weil der Verstorbene schon viele Jahre vor seinem Tod den einmal von ihm aufgenommenen Gedanken in Gesprächen angewendet hat: Es sei wichtig, in seinem Leben nicht lebensmüde zu werden, sondern lebenssatt. So fiele es nicht schwer, Abschied zu nehmen und eigentlich wäre er schon zu jeder Zeit satt gewesen. Vielleicht ein Zeichen dafür, wie intensiv er gelebt hat und weil ihm vor Augen war, dass nicht nur sein Tod, sondern auch die Zeit danach ihn bedeckt; letztlich, wenn irgendwann auch keiner mehr da ist, der ihn kennt und von ihm weiß.
Jetzt, für die, die ihn nicht so gut kannten, soll ich sagen, was er noch zu Lebzeiten konzipiert hat: Schon früh hatte der Hausarzt beurteilt, dass der Junge die Frequenz eines Erwachsenen habe. Er war durch die Lebensumstände gefordert, was ihn, von Kindesbeinen an, Verantwortung lehrte. Aber es war ihm auch die Liebe der Eltern geschenkt, die das Rüstzeug für alle seine Lebensphasen waren.
Von seinen Geschwistern wurde er jedoch auf unterschiedliche Weise argwöhnisch behandelt. Vielleicht eine Eifersucht, dass sich alles um den Nachzügler drehte, obwohl er kein Wunschkind war. Deshalb fühlte er sich stets zu derjenigen Schwester hingezogen, die er nur vom Bild her kannte, die vor seiner Geburt als kleines Mädchen ihr Leben verlor. Ich soll das Bild von dieser Schwester zeigen, was er ausgesucht hat. Das tue ich, gebe es durch die Reihen.
Das Mädchen ist Inga. In Gedanken traf Hans sich oft mit ihr im Himmel und riskierte nicht, die Frage Gott und das Leben nach dem Tod in diesem Fall beiseite zu schieben, damit es seinem Wunsch entsprechend förderlich ist.
In der Schule, außer in den anfänglichen Jahren, mühte er sich ab. Trotzdem fuhr er den Slalom dann erfolgreich. Er war beruflich sehr engagiert, erfreute sich der vielen Privilegien in den von ihm bekleideten Positionen. Aber es gab auch die vielen Kehrseiten in seinem Leben, die er als Ansammlungen des Scheiterns bezeichnete.
Eines ist jedenfalls nicht gescheitert, es wurde jetzt nur durch seinen Tod aufgelöst. Ich spreche von Liebe und Loyalität und den vielen glücklichen Jahren, die er mit seiner Frau Lana haben durfte. Liebe Frau Lansink, im Namen ihres verstorbenen Mannes spreche ich aus, dass er Ihnen tief dankbar war, dass Sie seinen Heiratsantrag angenommen hatten und dann, wie auch vorher schon, viel der Zeit mit ihm teilten. Er hat Sie hier, so wörtlich, als einen von Gott geschickten Ausgleich bezeichnet, für alle Scheiße, die er erleben musste und auch als Zeichen einer Vergebung für alle Momente, in denen er versagt, gefehlt und Schlimmes angerichtet hatte.
Auch lieber Max, Ihnen soll ich von Ihrem Vater sagen, dass er mit Ihnen in Liebe verbunden war und auch Ihre Gegenliebe gespürt hat, die sein Leben sehr bereichert hat. Sie sollen weiter ein glückliches Leben führen, im Kreise Ihrer Familie.
Wie ist Hans Savin zu beschreiben? Arrogant oder umgänglich? Zu ernst oder albern? Einfühlsam oder sarkastisch? Schwach oder stark? Vorwitzig oder zurückhaltend? Wissend oder unwissend? Egoistisch oder selbstlos? Es gäbe viel mehr Polaritäten aufzuzeigen, die ihn betreffen. Ich soll es aber damit bewenden lassen.
Nun zu den Fragen: Er bemerkte, dass er den ganzen Katalog, fallweise von anderen herangezogen, hat über sich ergehen lassen. So oft und insgesamt so widersprüchlich, dass es ihm irgendwann egal war, welche Beurteilungen er kassierte und auch noch nach seinem Tod erhalten würde. Er war den vielen, die er kannte, nicht gleichgültig und nur darauf kam es ihm an. Deshalb war er dankbar für die Menschen, die er auf seinen Wegen antreffen konnte. Viele von ihnen, so seine Anmerkung, waren ihm gegenüber ungerecht und verletzend. Aber er sagte auch, dass er Gleiches zu verantworten hatte. Auch er sei ungerecht und verletzend gewesen, etwa in gleichem Maße.
Nun aber zu dem, was er besonders betont haben wollte, so ist es mir aufgetragen. Etwas, was zu sagen ist, trotz der Gewissheit, dass es nicht recht verstanden werden kann, weil konkrete Inhalte nicht wiedergegeben wurden. Nur das soll ich sagen: Es gibt nur vier Menschen, die über einen wesentlichen Teil seines Lebens und der damit verbundenen Gefühlslage Bescheid wissen. Es ist erstens sein bester Freund, zweitens ein von ihm mandatierter Rechtsanwalt und Notar, drittens sein weiterer autistischer Freund und Wegbegleiter in den letzten ihm verbliebenen Jahren, dessen Teilnahme heute nicht vorzusehen war und viertens, auch Sie, Sie wissen Bescheid, liebe Frau Lansink, so steht es hier, er habe es Ihnen gegenüber von der Seele geredet.
Er spricht Sie davon frei, seine Geheimnisse bewahren zu müssen. Er lässt Ihnen die Wahl, wem Sie berichten und wem nicht. Es wird aber eine weitere Person geben, der sich offenbart wird. Diese Aufgabe erfüllt der Rechtsanwalt und Notar als Vollstrecker seines letzten Willens. Alle diejenigen, die davon dann noch erfahren, werden fassungslos sein. Alle diejenigen, die nicht davon erfahren werden, aber nunmehr wissen, dass da etwas war, was verborgen wurde, werden sich den Satz, seinerzeit von König Ludwig II. gesprochen, in Erinnerung rufen müssen: Ich will mir und meiner Nachwelt ein ewig Rätsel bleiben.
Wir nehmen jetzt Abschied von Hans Savin-Lansink. Hören wir einen Song, den er sich gerne und oft angehört hatte und Sie sollen dabei daran denken, dass er ein vielseitig interessierter Mensch war. Der viel über seine Stärken und Schwächen nachgedacht hat. Der als alles überblickender Adler stets mit seinem inneren Schweinehund gekämpft hat. Der nicht ausstehen konnte, wenn seine Intelligenz unterschätzt wurde. Der ein Gespür für Defektoren hatte und stets den zukünftigen Kooperationswert dieser Menschen mit seiner Fähigkeit zu sofortigen Sanktionen kalkuliert und abgeglichen hat. Der niemals vernehmen konnte, was andere an ihm schätzten, höchstens niedergeschrieben in Arbeitszeugnissen. Der in seinen Beziehungen zu Menschen seiner Wertschätzung seiner Regel nachkam, sich von Tag zu Tag um den erhaltenswerten Status quo zu bemühen. Der nur lachte, wenn es wirklich was zu lachen gab, nicht aber, wenn es nur üblich und banal erwartet wurde. Der weniger auf sich stolz war, mehr mit sich zufrieden. Der niemals ein anderer gewesen sein mochte. Der nur auf Reisen ging, wenn er an einem anderen Ort erwartet wurde oder einen Bezug zu den Regionen für sich darstellen konnte, in die er sich begab. Der gegen Geld und Gut nichts einzuwenden hatte, wenn es redlich und nicht zu Lasten anderer erworben wurde. Der nicht zwischen Pflichten und Muße unterschieden hat, weil er die Zeit dafür als den Kredit ansah. Der sich niemals selbst langweilig geworden ist und es auch verstanden hat, in schwierigen Situationen rechtzeitig eine Schicksalsliebe zu entwickeln, um nicht eo ipso unterlegen zu sein. Life Has Its Little Ups And Downs, so Charlie Rich.”
Dies wird also zu seiner Beerdigung gesagt werden, die seinem Wunsche entsprechend nicht mit einem Pfaffen gestaltet sein soll. Bis dahin dürfte ihm jedoch noch einiges an Zeit verbleiben, seine Erinnerungen aushalten zu müssen. Mit ihm noch sein Freund Konrad, der aus eigener Sicht allen Erinnerungen entgegengehen muss. Es besteht zu ihm kein Kontakt mehr. Das hatte sich so schon vor langer Zeit so ergeben müssen, das wurde so entschieden. Gerne würde er den „Konni“ wiedersehen. Vielleicht wird es sich ergeben. Vielleicht ist es aber besser so, wie es ist.
02. Wenn Wolken auf Berge treffen
Hans hatte sich einst darüber lustig gemacht. Seine einige Jahre ältere Schwester betonte oft, wenn auch leise, vorsichtig, nahezu zurückhaltend, Heidi zu sein. Das war akut, bis sie gerade mal so die Pubertät hinter sich gelassen hatte. Hans feixte deshalb oft in der Familie oder egal vor wem, um seine Schwester zu ärgern, sie bloß zu stellen, schließlich attackierte sie ihn auch, wie es unter Geschwistern vorkommt.
Ulla hatte die Geschichten von Heidi, geschrieben von Johanna Spyri, stets griffbereit, dazu bebilderte Fortsetzungsheftchen und sie sah sich jede Verfilmung über diese Heidi an. Sie ließ sich vom Vater zur Jugendvorstellung zum Kino bringen, sie versäumte im Fernseher dazu keine Serie.
Noch viele Jahre später sprach Hans seine Schwester mit dem Schalk im Nacken mit Heidi an. Sie ging gar nicht darauf ein, überhörte es, war daran gewöhnt. Bei den späteren und seltenen Besuchen bei der Schwester stand immer noch die Heidi-Literatur im Bücherregal, inzwischen deutlich abgegriffen. Die beiden Geschwister kamen damals nach der Beisetzung der Mutter eine Zigarettenlänge draußen im Hof des Gasthauses, in das die Trauergemeinde zum Leichenschmaus eingeladen war, in ein Gespräch. Einige Erinnerungen aus der Kindheit wurden aufgewärmt und Hans steuerte wieder auf das Phänomen Heidi los, der alten Leidenschaft der Schwester. Es war aber nicht mehr nach Art, seine Schwester damit zu piesacken. Schließlich waren sie keine Kinder mehr. Er hatte noch vor Augen, wie sie sich seinerzeit sonderlich verhielt und wie tief sie in dieser Figur Heidi steckte. Heidi war ihm damals zu blöd. Das Großvatergetue, der Geißen Peter und die immer böse Tante Dete. Das waren nicht Tibor, Tarzan, Prinz Eisenherz und schon gar nicht Akim. „Heidi war für mich bedeutsam“, sagte die Schwester, „vielleicht erzähle ich es dir später einmal.“
Hans stufte seine Schwester weniger hintersinnig und weniger fantasiebegabt ein, wie der Papa, der Ulla oft ein Dappschaf nannte, auch passend zum Ältesten, dem Bruder Otto, der auch mit seiner Familie angereist war. Er hatte es damals als zwecklos angesehen, ihr bei Schularbeiten helfen zu können.
Ulla und Hans setzten sich wieder an die große Kaffeetafel der bäuerlichen Gaststube zum Papa, dem Bruder und den anderen. Allseitig wurde bewundert, dass die aufgebahrte Mutter wunderschön ausgesehen hat. Ihr langes, tiefschwarzes Haar, ihr hübsches, leicht rosiges Antlitz und das bestechend weiße Totenhemd kamen inmitten der Kranz- und Blumenpracht voll zur Geltung, es fiel das Wort „Schneewittchen“. Hans nahm vor all den nicht zum engeren Kreis gehörenden Gästen, die seine Mutter niemals vorher gesehen hatten, stolz Abschied. Es waren die Nachbarn, wovon viele seine Mutter gerne einmal besucht hätten, aber sie wollte niemand Fremdes mehr sehen; seit Jahren nicht.
Wieder für eine Zigarettenlänge draußen, sprach Hans die Schwester nochmals auf Heidi an. Sie wich aus, redete von Philosophen und Buchautoren, denen sie sehr gut folgen könne und deren Ansichten ihr gefielen. Besonders gut empfand sie Hermann Hesse.
Ja, der Schwager hatte einmal eine abfällige Bemerkung zum Lesestoff seiner Frau gemacht, kopfschüttelnd, sie hätte wohl einen Tick. Hans erinnerte sich. Er war damals verwundert. Er hatte seiner Schwester solche Literatur gar nicht zugetraut, dachte auch daran, dass er bis auf die Bücher von Karl May und Henry Miller und die ihm aufgegebene Lehrliteratur kaum etwas an weiterem Lesestoff zur Hand genommen hatte.
Unerwartet trat Ulla an ihren Bruder sehr nah heran und sah ihm mit ernstem Gesicht in die Augen. Mit eindringlicher Stimme sagte sie: „Ich war Heidi, weil ich mich von den Bergen umgeben geschützt fühlte, und weil ich dort gerne erwartet und immer gut behandelt wurde. Der Geißen Peter war damals mein bester Freund.“
Hans dachte: von den Philosophen zum Geißen Peter? Er konnte deshalb mit den Worten der Schwester wenig anfangen. Von dieser Zeit an nannte er seine Schwester jedoch niemals mehr Heidi. Hans erwähnte den Teil seiner Kindheitserinnerung ihr gegenüber nicht mehr. Es mutete ihm alles zwar komisch und mysteriös an, eben zu unerklärlich, aber die so nicht gekannte angespannte Körperhaltung und das ernste Gesicht der Schwester hielten ihn davon ab, weitere Fragen zu stellen. Es schien ihm besser so zu sein. Die Figur „Heidi“ saß jedoch in seinem Kopf fest; dieses Mädchen mit dem nicht einmal spektakulären Leid, beigebracht durch die böse Tante Dete.
Hans sah seine Schwester in ihrer sonnenklaren, unverbrauchten und naiven Freude, inmitten von Schweizer Bergen und Almen vor sich. Dieses Bild von ihr wird ihm für immer bleiben. Doch, ähnlich wie bei den Spökenkiekerschen, wandelte sich die vorüberziehende große Wolke, von einer schneeweißen in eine bedrohlich schwarze, die sogleich fortgerissen wurde. Sie legte Erinnerungen frei und löste damit den Knoten, der wie eine praktische Erinnerungshilfe in einer Hosentasche wirkt und doch auch störenden und zwingenden Druck ausübt.
Ausgerechnet vor der Kulisse dieser Schweizer Berge, als Hans viele Jahre später mit Familie eine Freizeit in einem Chalet am Fuße des Wiggis verbrachte, drängten sich ihm seine Erinnerungen auf. Die Rebby war bei ihm. Eine große, starke und pfeilschnelle Hündin mit grauen, braunen und schwarzen Fellzeichnungen. Sie hatte einem Kopf, der durch ihre Augen und ihren Blick faszinierte. Kaum jemand ging an dieser Hündin achtlos vorbei. Sie war eine Schönheit auf ihre Art.
Damals sah Hans durch die weit geöffnete Flügeltüre des großen Versammlungssaals, auf einer Tagung von straff organisierten Tierversuchsgegnern, diese große Hündin sich durch die Reihen der Teilnehmer bewegen. Er saß an der Bar im Foyer des Hotels und wunderte sich, dass nicht zu erkennen war, zu wem das Tier gehörte. Das ging über alle die Stunden, die er am Tresen, mit viel Kaffee, Mineralwasser und letztlich auch einem Cognac aushielt. In dieser Sache war er voll bei der Tagesordnung jener Veranstaltung, suchte aber nicht den direkten Kontakt mit den jeweiligen Referenten und nicht mit dem Publikum. Schließlich war Hans nur seiner ehrenamtlich in hohem Maße engagierten Frau Marion als Chauffeur, Sponsor ihrer Belange und Begleiter gefällig.
Zum Ende der Versammlung, im Gewühl des Aufbruchs, stand Marion plötzlich mit einem Benno, einem massigen Lehrertyp, und dieser auffälligen Hündin vor Hans.
„Wir müssen sie mitnehmen, bitte, ich möchte sie haben, Benno kann sie nicht behalten, er hat schon so viele Tiere. Sie heißt Rebby“, sagte Marion bettelnd.
Beide redeten auf Hans ein. Die sei so lieb, sie suche ein neues Zuhause und andere könnten sie nicht nehmen und sie solle doch nicht wieder in einem Tierheim landen.
Hans zeigte sich überfordert, unschlüssig, nachdenklich. Er sagte weder ja noch nein. Er erkundigte sich, was das denn für eine Rasse sei, wollte Zeit schinden, um ein Argument zu finden, das Tier nicht mitzunehmen. Dieser Benno zog die Schultern hoch: „Vielleicht so eine Art Mastiff oder Molosser oder eine Mischung aus beidem.“
Dann bekam Hans gar nicht so recht mit, dass er, wie heimlich ferngesteuert, plötzlich mit Marion und auch mit dieser Hündin, vor seinem Mercedes auf dem großen, schwach beleuchteten Parkplatz stand. Es war regnerisch, schon dunkel, alle anderen Teilnehmer waren schon weg. Ohne Halsband, ohne Leine und ohne Berührung mit den für sie fremden Menschen, stand diese Rebby am Auto, als Hans eine der hinteren Türen öffnete und die Innenbeleuchtung aufhellte. Es war eine gespenstische Situation, frei von jeder Hektik. Hans dachte noch daran, eine Unterlage für die Rückbank des Wagens zu richten, aber hatte dazu nichts Passendes dabei. Die drei Wesen, zwei Menschen und ein Hund, standen da, ohne Blickkontakt zueinander. Abwartend. Dass die Hündin jetzt noch weglaufen würde, schien ausgeschlossen, wohin auch? Sie folgte ihrem Instinkt.
Minuten verstrichen, bis sie endlich auf die Rückbank sprang, wo sie sich dann nahezu sofort kringelte, ihre Augen und Kopf vom Hinterlauf bedeckt, sich nicht mehr rührte.
Auf der nächtlich langen Fahrt nach Hause stieg Hans die starke Ausdünstung der Hündin in die Nase. Es war aber nicht der Geruch von regennassem Fell eines Hundes, und keinesfalls die Ausdünstung eines ungepflegten Hundes, es war der Geruch von Stress, so schwer das auch zu erkennen ist, so schwer das auch zu beschreiben ist. Hans wusste, wie Stress riecht. Der riecht bei Mensch und Tier gleich.
Hans und wohl auch Marion waren in Gedanken dabei, sich das Leben mit einem aufgenommenen Hund vorzustellen, und wie es zu Hause harmonieren würde. Schließlich gab es noch eine Katze und einen Kater dort, die das Revier des Atriumbungalows innen und außen beanspruchten.
Kaum wurde die Haustüre geöffnet, als Hans zwei riesige Klobürsten im Flur sah. Er war erschrocken. So kannte er sie noch nicht. Die eine Klobürste war rotbraun; es war der Seppl. Die andere schwarzweiß gestreift mit hellgoldenen Flecken; das war die Lollo. Rebby – so hieß das neue Familienmitglied – hetzte ohne auf Marion und Hans zu achten, pfeilschnell an der fauchenden Palastwache vorbei. Die verlegen wirkende Hündin zeigte, dass sie keine andere Wahl hatte, aber dass sie ab jetzt hierher gehören würde. Durch den langen Flur, das große Wohnzimmer, bis hin ins anschließende, tieferliegende Kaminzimmer, gelangte Rebby zum Sofa, hinter welchem sie sich verdrückte und dort ausharrte.
Nach wenigen Tagen normalisierten sich die Abläufe in Haus und Hof ein wenig. Die Tiere schlossen ein fragiles Friedensabkommen mit kleinen Unterbrechungen. Anfänglich wurde Rebby von den Katzen nicht nur gemieden, sie wurde sogar hier und da angegriffen. Die Hündin reagierte jedoch niemals aggressiv. Sie zeigte sich stets ruhig und gelassen. Rebby verließ sich wohl, ähnlich wie ein Karatekämpfer, auf ihre Verteidigungsmöglichkeiten. Sie wendete davon jedoch keine ihrer Möglichkeiten an. Rebby reagierte in solchen Fällen mit der Standhaftigkeit ihrer überlegenen Höhe, hielt dazu ihren Kopf so lange hoch, bis das Geschwister-Katzenpaar frustriert die Attacken einstellte.
Wochen später kam es sogar dazu, dass die Katzen sich auf die unterkühlte und zitternde Hündin legten, um sie liebevoll zu wärmen. Das geschah gleich nach einer notwendigen Operation, die Rebby überstehen musste. Als Hans und Marion sie vom Tierarzt abholten vor einen Heizkörper auf eine Decke gelegt wurde, eilten die beiden Katzen fürsorglich herbei. Rebby genoss diese plötzliche Liebe ihrer Mitbewohner. Jetzt war sie angekommen, jetzt hatte sie ein Zuhause. Jetzt war sie in Sicherheit.
Rebby war auf Frauchen fixiert. Ein leises Wort reichte aus und sie folgte auf Schritt und Tritt. Ständig war sie in Berührung mit ihrer Herrin. Hans gegenüber blieb das Verhalten der Hündin ein anderes. Sie hielt Abstand und entzog sich auch seinen versuchten Streicheleinheiten. Wenn es sich ergab, dass er die Hündin ausführen musste, ließ sie sich nicht von ihm anleinen. Sie lief zwar stets in seiner Nähe, beachtete auch die Richtungen, die er vorgab, lief jedoch niemals vor ihm, immer hinter ihm und vorzugsweise auf der anderen Seite des Weges, wenn es möglich war. Ging es wieder zurück ins Haus, wartete sie hinter ihm in einem größeren Abstand so lange, bis die Haustüre geöffnet war. Erst wenn Hans deutlich zur Seite trat, lief sie an ihm schnell vorbei und zurück auf ihren Platz, wenn Marion nicht zu Hause war. War sie da, lief sie gleich zu ihr, egal wo sie sich gerade aufhielt. Es gab viele solcher Beispiele zum sonderbaren Verhalten der Hündin gegenüber ihrem Herrchen. Zum Beispiel, dass sie nicht fraß, wenn er neben ihr stand. Das war nicht der Fall, wenn Marion zugegen war.
Die Frage kam auf, ob das Tier von einem Mann, irgendeinem Vorbesitzer gequält oder misshandelt worden war. Diese Frage blieb offen, konnte nicht geklärt werden.
Jedenfalls sorgte auch Hans mit aller Liebe für Rebby, obwohl sie ihn mit ihrem abweisenden Verhalten ein wenig kränkte. Er respektierte das Tier, ähnlich wie er einen Menschen respektierte; als Persönlichkeit, so wie sie war. Wenn er sich darüber beklagte, dass er sich, wenn überhaupt, einen Hund mit mehr Gegenliebe gewünscht hätte, witzelte Marion darüber sarkastisch:
„Du hast keinen juristischen Anspruch darauf, kümmere dich nur um das, was du einklagen kannst.”
Dann, in der langen Zeit danach, in der Schweiz, drängten sich alle seine Erlebnisse und Erfahrungen mit der Hündin auf, weil er durch die Freizeit nicht abgelenkt war und er die Hündin auch als Mittelpunkt inmitten des Geschehens um sich herum wahrnahm.
Rebby fiel natürlich auch anderen Menschen auf. Damals gab es eine Nachbarin, die Hunde nicht mochte. Vorlaut und spitz fragte sie, wie das so wäre, weil sie doch viel auf Reisen seien und viel in Hotels, ob sie denn keine Schwierigkeiten wegen des Hundes mit der Unterbringung hätten.
Hans konterte, dass in guten Hotels der Hund nicht als Hund angesehen würde, weil er auf Reisen mit einem besonderen Halsband ausgestattet sei. Mit diesem Halsband sei ein Hund kein bloßer Hund mehr. Damit ließ er die Nachbarin stehen, die Jil Sander trug, obwohl ihre Polster die Röcke nicht fallen ließen, die Gucci Schuhe trug, obwohl die wassergezogenen Füße die schlanken Formen der Schuhe sträflich verunstalteten.
Später, sie konnte es nicht mehr aushalten, fragte sie, ob sie das Halsband einmal sehen könnte. Hans erklärte ihr, dass Reisen derzeit nicht vorgesehen seien und das Halsband deshalb im Schließfach einer Bank untergebracht sei. Damit ließ er sie stehen. Nun war geklärt, dass jene hundeverachtende Nachbarin nun auch „an der Nadel“ hing.
Damals gab es jedoch Sequenzen bezüglich Rebby, die Hans sehr nachdenklich machten. Die Hündin war betont lieb und ruhig. Sie bellte nie, ließ sich auch nicht dazu animieren, so wie einst der Dackel, mit dem Hans zusammen aufgewachsen war und den er bekam, vom Vater, vorausschauend, um von nachteiligen familiären Situationen eine Ablenkung zu haben. Und vielleicht auch, um frühzeitig die Übernahme von Verantwortung durch Zuständigkeit zu erlernen.
Einmal in Grenzdorf, die Familie hatte das neue Haus direkt am See bezogen, schnellte die schwarze Hündin eines Nachbarn durch das Buschwerk, welches die Grundstücke trennte, schoss ungestüm auf Rebby zu, die damit beschäftigt war, im Laub herumzustöbern. Die überraschten Beobachter konnten es nicht verhindern. Plötzlich sprang die große, zottelhaarige Spitzhündin des Nachbarn Rebby an und versetzte ihr einige schnelle Bisse, die sofort sichtbare Blutspuren hinterließen. Rebby schien kurze Zeit wehrlos, dann bäumte sie sich auf, drückte die kräftige und große Angreiferin zu Boden und fand sofort deren Kehle, die sie durchbiss. Die Hündin des Nachbarn war sofort tot. Was jetzt?
Rebby zeigte an sich keine Veränderung, sie verhielt sich schier teilnahmslos. Sie wurde zurück ins Haus gebracht und der Nachbar holte einen Handwagen, mit dem er seine Hündin fortschaffte.
„Eure war im Recht“, sagte er, „jetzt ist das eben so“.
Damit war die naheliegende Frage beantwortet, ob etwas nach dem Vorfall zu klären wäre. Hans überdachte die Schuldfrage. Irgendwann später hatte der Nachbar einen neuen Hund. Einen Cockerspaniel, noch niedlich, noch verspielt. Der Nachbar trug Rebby nichts nach. Es war zwischen ihnen wieder so harmonisch wie zuvor. Aber noch im gleichen Jahr gab es ein ähnliches, vergleichbares Schauspiel:
Hans und Marion hatten Besorgungen gemacht und ruhten sich in einem Straßencafé aus. Rebby lag mit loser Leine unterm Tisch. Die Berührung mit Frauchens Fuß war obligatorisch.
An einem der Tische saßen Leute, auch mit einem Hund. Rebby hatte das registriert, jedoch diesen Hund wie immer nicht weiter beachtet. Sie schien gegen Reize anderer Hunde auf Entfernung immun zu sein. Das war bei dem anderen Hund, auch einer Hündin, nicht so.
Die andere Hündin zog ihren Kopf plötzlich aus ihrem Halsband heraus, ihre Besitzer schrien auf, signalisierten lautstark „Vorsicht!“ – und schon wurde Rebby von dieser ebenfalls ziemlich großen Hündin blitzschnell angegriffen.
Der Kampf wurde unterm Tisch ausgetragen. Der verschob sich, der Tischplatte wurden durch das Gerangel gefährliche Stöße versetzt und dadurch fielen natürlich Gläser um.
Bevor Reaktionen gestartet werden konnten – es ging alles blitzschnell –, war der Kampf vorbei. Rebby hatte die Kehle dieser auf dem Rücken am Boden liegenden Hündin fest im Fang, biss aber nicht zu. Die unterwürfige Angreiferin wäre von Rebby weiterhin so festgehalten worden, hätte Hans nicht beherzt eingegriffen. Die Besitzer des kriegerischen Hundes entschuldigten sich aufgeregt und zogen ihren Hund wieder an seinen Platz zurück. Rebby verhielt sich wieder so, als sei nichts passiert. Ruhig.
Jetzt, im Anblick jener schönen Bergkulisse am Ferienort in der Schweiz, fiel Hans ein, dass er ein vergleichbares und eigenes Erlebnis mit Rebby hatte. Er wollte sie mal so ärgern, wie er es mit seinem Dackel Bo in Kindertagen gemacht hatte. Auf allen Vieren hatte er sich neben dem Dackel auf dem Boden platziert und ihn, während er fraß, ein wenig weggedrängt. Bo knurrte und jaulte, aber vergnügt. Er fraß dann mit noch mehr Gier und Tempo seinen Napf leer. Rebby hingegen hatte nicht die verspielte Ader des Dackels, wusste Hans nach einem Versuch. Die Hündin bäumte sich blitzschnell gegen ihn, riss ihren Fang weit auf und stieß damit gegen Hans Nacken, stoppte aber sofort wieder ihren Angriff und stand ruhig da. Hans spürte noch ihren Fang, als er sich wieder erhob. Die Hündin widmete sich erst wieder ihrem Fressen, als Hans deutlich auf Abstand ging.
Dieses Erlebnis war für Hans nachhaltig. Ein domestiziertes Tier verlangte unmissverständlich Respekt und Distanz, wenngleich sie dann, Jahre später, aus größerer Entfernung fröhlich in Richtung des Motorgeräusches von Hans Auto hastete und ihren Kopf, freudig winselnd und mit spürbarem Gewicht auf seinen Schoß presste, als er die Autotür öffnete. Eine für Hans überraschend wie fremde Geste ihrer Zuneigung, geschehen als er gemeinsam mit seinem Sohn das mit der Hündin schon lange Zeit von ihnen getrennt lebende Frauchen besuchte.
Die liebe Rebby war jedenfalls bereit, zu töten. Reaktiv und effektiv. Sie hatte es einmal gezeigt und war im Zweifelsfall jederzeit dazu bereit.
Hans erinnerte sich plötzlich an die Antwort seines Vaters, der ihm aus seinen Jugendzeiten und seinen Kriegserlebnissen erzählt hatte, als er, Hans – damals war er noch ein Sextaner – ihn, seinen Vater, fragte, ob er es wirklich getan hätte, den Bauern und auch den Offizier zu erschießen.
„Ja, ich hätte es getan“, antwortete der Vater damals mit bewegter Stimme. Seine Antwort war eindeutig und absolut glaubwürdig, zumal er eindringlich unterstrich: „Was denkst du denn, mein Sohn? Es ging um mein Leben! Lass‘ dir nichts gefallen, wenn jemand dein Leben bedroht, dich gesundheitlich schädigen will. Wehre dich auch, wenn dir jemand deine Ehre nehmen will. Jemand, der selbst keine hat!“
Die Worte des Vaters hatte Hans stets im Gehör. Er stellte sich die Situation in den Zwanzigern bildlich vor, wie der Vater sommertags mit Freunden durch Wald und Wiese streunte. So wie in Peter Rossegers Gedicht beschrieben, leuchteten wohl auch die Kirschen so schön und so rot. Die großen Jungs kletterten übermütig in Bäume; für jeden stand ein Baum bereit. Ein wütend mit einer Mistgabel fuchtelnder Bauer näherte sich unerwartet im Laufschritt und positionierte sich unter dem Kirschbaum, in dem der Vater zwischen den Ästen seinen Halt gefunden hatte, um die Kirschen zu genießen.
„Komm runter, ich stech‘ dich ab!“, brüllte der Bauer mit sich überschlagender Stimme.
„Was willst du? Mich abstechen? Aufspießen wegen der paar Kirschen?“, rief der Vater zurück und zog einen geladenen Revolver aus der Brusttasche seiner Jacke. Er zielte ruhig und gelassen auf die sonnenbrandrote Glatze des Bauern. Die Waffe, und das entschlossene Gesicht vom Mundräuber vor Augen, rannte der Bauer, was das Zeug hielt. Die vom Bauern weggeworfene Mistgabel nahm der Vater mit. Sie stand später bei Großvater im Schuppen seines Schrebergartens.
Hans erinnerte sich: Den Revolver hatte der Vater durch eine seinerzeitige Verbindung zur Organisation „Stahlhelm“, die um Nachwuchs warb. „Da kam ich an sowas ran“, kommentierte er, „ich wollte meine Freunde damit überraschen und vielleicht auch Schießübungen machen.“ Jedenfalls waren sich die Jungs dann schnell einig, lieber das Weite zu suchen.
Hans war klar, dass er sich auch in einem solchen Fall nicht hätte abstechen lassen. Wer weiß schon, was der Bauer mit seiner Mistgabel tatsächlich angerichtet hätte? Der Mut seines Vaters imponierte ihm noch heute. Auch das couragierte Verhalten des Vaters zu einer bedrohlichen Situation später.
Im Krieg wird er im Kessel von Knin sein und die verheerenden jugoslawischen Partisanenkämpfe überstehen, seine vorgegebene zivile Verwendung nach dem Endsieg in der Ukraine wird sich auflösen, Deutschland in Schutt und Asche liegen. Während der englischen Besatzungszone in Westfalen wird hingegen später die Laufbahn des Vaters im öffentlichen Telefonbau beginnen. Hans‘ Vater wurde im Straßenkampf verwundet, kam um einen Millimeter mit dem Leben davon. Alle seine Kameraden um ihn herum fielen in diesem Krieg. Hans‘ Vater, Funker in der Kompanie, bot zu einem späteren Zeitpunkt, in einer erneut bedrohlichen Situation, dem befehlshabenden Oberstleutnant an, dass er einen Funkspruch, als Befehl für ein offensichtliches Himmelfahrtskommando, im Kessel von Knin im Kampf gegen Titos Truppen, kurz vor Kriegsende, „nicht mehr bekommen hätte“. Wenn er, der Oberstleutnant, da nicht mitmache, solle er gefälligst an erster Stelle den Kampf anführen.
Der Vorgesetze ergriff seine Pistole, erfuhr Hans vom Vater. Seine Kameraden hoben in diesem Augenblick, wie auf Kommando, ihre Gewehre schussbereit gegen den Oberstleutnant an, um ihn, Hans‘ Vater, vor diesem Mann zu beschützen. Auch Hans‘ Vater erhob sein Gewehr, rief den anderen aber zu, dass sie nichts machen sollten, er würde das erledigen; er nähme das auf seine Kappe.
Der militärische Vorgesetzte und die Befehlsempfänger standen sich damals drohend gegenüber. Hans‘ Vater schrie diesen Mann unter höchster Anspannung an: „Tun Sie es lieber nicht, ich schieße schneller und treffe!“
Der Offizier tat es nicht und der Vater musste es nicht tun, damit war der Krieg für diese Einheit beendet. Hans‘ Vater kam in amerikanische Gefangenschaft in Österreich. Wenige Wochen später setzte er sich als abkommandierter Schreiberling selbst auf die Entlassungsliste und war frei für den Weg zurück zur Familie. Jedenfalls war er mutig. Er rettete damals seinen Kameraden das Leben.
Immer wieder wollte Hans, dass sein Vater von früher erzählte. Es war ihm egal, ob es sich dabei um Wiederholungen handelte. Stets gab es Nuancen zu den Erlebniserzählungen. Wie zum Beispiel, dass sein Bruder gefallen sei, in einem Abschnitt in Frankreich, wo es niemals Kampfhandlungen gegeben hätte. Der Bruder sei vielleicht liquidiert worden, hieß es. Zwar sei als Todesursache Herzversagen mitgeteilt worden, aber wenn jemand ein starkes Herz gehabt habe, dann Onkel Paul. Der Bruder sei aber schon immer aufmüpfig gewesen, was ihm einst eine gebrochene Nase eingebracht hätte, als er als Schlosserlehrling seinem Lehrherrn wohl in einem ganz bestimmten Fall den Gehorsam verweigert hätte.
Hans kannte ein Foto mit seiner schief gestellten Nase von ihm. Der Vater monierte immer wieder, dass die Eltern weder in dieser Sache noch zur Todesursache in Frankreich näher nachgefragt hätten. Irgendwie habe er das aber verstehen können, denn es wären damals andere Zeiten gewesen.
03. Sandkasten voll Asche
Sie sprachen sich mit „Panther“ oder „Alter“ an. Wechselseitig, mal so, mal so. Ihre beiden Namen waren somit gleich. Alles andere eher nicht. Es schien anderen zufällig, ob „Panther“ oder „Alter“ gesagt wurde. Diese Anrede wurde nicht sonderlich bedacht, geschweige denn verabredet. Hans kann jetzt sagen, dass jeweils der „Panther“ anklang, wenn Freude und Erbauliches eine Rolle spielte, und umgekehrt „Alter“, wenn Leid und Verbindlichkeit zugegen waren, immer dann, wenn es ernsthaft zuging.
Freunde und Bekannte wollten die beiden auch so ansprechen, weil diese Benennungen sich als Spitznamen aufdrängten. Deren Zungen waren dafür jedoch zu schwer, weil keine Regel „Wer ist Wer?“ zu erkennen war. So ließen sie es bleiben.
Für Freunde und Bekannte, für Außenstehende waren sie Hans Savin und Konrad Schnober, genannt Konni.
„Alter“ und „Panther“ leben beide noch, haben zwar ihre Jahre auf dem Buckel, stehen aber noch voll im Leben. Allerdings ein jeder für sich. Mit fünfzehn lernte Hans Konni kennen. Das war gut so – oder auch nicht. Jedenfalls war es eine von den markanten und bedeutsamen Weichenstellungen des Lebens, die nicht an jeder Ecke ihren Vergleich finden, und die sich, mit der Zeit von Knäulen zu roten Fäden abwickeln.
Hans war vor einem Jahr in ein fertiggestelltes Eigenheim zwischen bewaldeten Anhöhen gezogen. Das neue Domizil lag in einem Hans nicht vertrauten Stadtteil seiner Heimatstadt. Das Klingelschild aus Messing „Savin“ war endlich angebracht.
Kurz nach dem Einzug, er hatte gerade sein großes Zimmer mit allem Pipapo eingerichtet, stand er am Grabe seines bis dahin besten Freundes Norbert Schwerdt auf dem großen Friedhofsgelände am Stadtrand. Die trauernde Familie hatte ihn zu sich hergewunken. Ein Offizier der Bundeswehr in Uniform, Schwager von Norbert, schien die tragende Säule der Familie zu sein. Für Hans war das damals ein Privileg. Die anderen jungen Männer mit langen Haaren, mit denen er vorher auf Abstand zum Grab beisammenstand, wurden von der Familie freundlich beachtet, aber nicht herangebeten.
Vor der organisierten Busfahrt zum Friedhof wurde für Norbert das Seelenamt in einer katholischen Kirche, nahe seinem alten Gymnasium, zelebriert. Er kannte die reichlich ausstaffierte Kirche gut. Als einziger Evangelischer von siebenhundert Schülern, samt Lehrerkollegium alle katholisch, ging er damals mit in den wöchentlichen katholischen Schülergottesdienst für die Sexta A, B und C. Hans hätte sonst im Selbststudium das Neue Testament lesen müssen, mit prüfbarer Aufgabenstellung. Ihm war nicht danach. In jener Diaspora hatte er den Besuch dieser Kirche als diplomatisches Tun eingebracht, damit die Nachteile seiner Frisur, die langen Haaren à la Beatles, nicht so voll durchschlugen. „In die Kirche geht er ja zumindest“, hieß es unter den Referendaren, Studienräten und Oberstudienräten, von denen gut ein Drittel das Amt eines Paters bekleidete.
Norbert, sein verstorbener Freund, bekomme den Zauber ja nicht mit, dachte Hans, während des Seelenamtes. Norbert hatte zu Lebzeiten für Kirche und Pfaffen nichts übrig. Solche unterhielten sich mit den Augen, sprachen abstoßend feierlich und stellten wohl so einiges an Unheiligem hinter ihren Altären an, so die Gedanken. In einem Gespräch mit dem Vater von Hans hatte Norbert seine Meinung in Diskussionslaune einmal angesprochen und gleich hundert Punkte dafür geerntet. Hans‘ Vater erweiterte Norberts Anschauung, indem er wörtlich von sich gab, dass Pfaffen und Studienräte die niederste Kaste von allen seien, weil sie allesamt borniert, hinterlistig und verklemmt seien und sich trotzdem für berufen hielten, anderen Menschen den stets richtigen Pfad aufzeigen. Sie würden sich sogar erdreisten, über andere Menschen ein Urteil zu fällen; zu richten. Dieser Ansicht konnte Hans sich leicht anschließen.
Ein älterer Junge aus dem Hause, Hardy, sprach Hans damals an, ob er gelegentlich sommertags Tennisbälle bei Turnieren auf den Plätzen des nahegelegenen Tennisclubs aufsammeln möchte. Er selbst sei in diesem Verein ein „Junior“ und könne das vermitteln. Es gäbe für die Stunde zwei Mark. Wenn ja, dann würde er mit ihm gemeinsam zu den Tennisplätzen gehen.
Hans war einverstanden. Schon bald hatte er eines Nachmittags sein Debüt als Balljunge. Er hatte sich extra eine weiße Jeans angezogen, dazu ein weißes Unterhemd mit kurzen Ärmeln. Auch hatte er weiße Turnschuhe übergestreift, die natürlich nicht so werthaltig wie die Tennisschuhe der übrigen Spieler waren. Aber er machte einen guten Eindruck bei allen. Alles lief gut. Hans machte seine Sache richtig.
An einem Tag bekam er neben seinem Lohn auch einen nagelneuen Tennisball von einem der Trainer geschenkt. Auf dem Weg nach Hause wechselten Hardy und er in hohen Bögen den Ball, während sie sich auf den linken und rechten Bürgersteig aufgeteilt hatten. Spielend machten sie ihren Weg nach Hause.
Einen der Bälle konnte Hans nicht fangen. Er landete in einem Garten hinter einer kopfhohen Mauer des Grundstücks. Mittels Hardys Räuberleiter konnte Hans sich an der Mauer hochhangeln und sah, dass der Garten höher gelegen war. Er hatte daher keine Bedenken, schnell abzuspringen, um den Ball zu holen. Wieder auf der Mauer angelangt, warf er den Ball Hardy zu. Neben der Mauer stand sehr gelegen ein Kirschbaum, von welchem ein Ast ein Stück weit über die Mauerkrone ragte. Hans ließ sich daran baumeln und dann auf den Bürgersteig fallen.
In diesem Moment stoppte der Wagen seines Mathematiklehrers, des stellvertretenden Direktors seines Gymnasiums, mit quietschenden Reifen neben ihnen. Der Lehrer stieg aus, gab Hans ohne Vorwarnung eine böse gesetzte Ohrfeige. Sein Ohr schien davon taub zu sein. Der Lehrer brüllte, dass er morgen etwas erleben könne, stieg wieder in den allen Schülern gut bekannten dunkelgrauen Volkswagen Käfer, und brauste wütend davon. Hardy beachtete der aufgebrachte Leher nicht, obwohl er auch auf dem gleichen Gymnasium war, in das Hans zur Schule ging.
Hans war damals über die Haltung des Lehrers sehr erschrocken. Schnell bemerkte er, dass Hardy sich in den kommenden Minuten eigenartig von ihm distanzierte. Er müsse noch mal zurück in den Tennis-Clubraum, wohin Hans jedoch nicht mitkommen könne, weil der nur für Mitglieder sei, entschuldigte er sich und ließ Hans einfach stehen.
Hans schlief in der Nacht sehr unruhig. Er überlegte hin und her, was jetzt auf ihn zukommen könnte.
In der zweiten Schulstunde des nächsten Tages war er schlauer. Die Klasse hatte Deutsch bei ihrem Klassenlehrer Dr. phil. Lobeda, der die Klasse für ein neues Aufsatzthema sensibilisierte. Sie sollten eine Kurzgeschichte schreiben, die eine gute Tat beinhaltete, eine Geschichte die als heldenhaft bezeichnet werden könne. Hans war auf des Lehrers Erklärungen konzentriert. Plötzlich wurde die Tür zum Klassenzimmer aufgerissen und es kamen, mit schnellen Schritten und hintereinander weg, der Mathematiklehrer Oberstudienrat Kosseck, der mit seiner elitären Hornbrille wie der Reporter Thilo Koch aussah, der Direktor Scheunemann, der sich Hauptstudienrat nannte, ein Mann wie Albert Speer, in seiner sehr abgemagerten Verfassung, und der Hausmeister Kwiatkowski. Sie stürmten forsch in die Klasse und bauten sich auf dem Podest vor der Tafel auf.
Kosseck, dessen Spitzname wegen seiner nach unten lang ausgelegten und wie angeheftet wirkenden lappenartigen Ohren „Lupo“ war – gleich dem Hund aus den Kauka-Figuren – ergriff sofort das Wort:
„Herr Doktor Lobeda, Sie entschuldigen bitte! Die Sache aber fordert eine Reaktion. Der Herr Direktor sieht das auch so. Ihr Schüler Savin meinte, am helllichten Tag Kirschen klauen zu müssen. Eine Unverschämtheit von diesem Bengel. Ich gebe die Sache nun in Ihre Hände, schließlich sind Sie der Klassenlehrer. Dieser Bursche da… Ein Dieb… Und das an unserer Schule!“
Lobeda nickte, sah hinüber zu Hans in die zweite Bankreihe, gleich vornean, und stütze sich dabei mit dem rechten Arm auf seinem Pult ab. Seinen linken Arm stützte Lobeda angewinkelt in seine Hüfte. Er sah so lässig wie unnahbar aus.
Lobeda behielt den Blick auf Savin bei, als wolle er das in der Klasse erschienene Tribunal nicht weiter beachten. Hans stellte sich artig hin, um einer eventuellen barschen Aufforderung dazu zuvorgekommen zu sein. In diesem Moment fühlte er sich auf sich alleine gestellt. Er wartete ab. Seine Klassenkameraden nahm Hans gar nicht mehr wahr. Er sah Lobeda unbewegt an, bis der sagte, dass Hans sich wieder setzen könne.
Direkt Angst hatte Hans jetzt nicht. Es war so, dass er seine Kräfte sammelte und sich fragte, ob er jetzt geschlagen werde oder einen Brief mit nach Hause bekäme oder sonst, wer weiß was, vielleicht in den Karzer müsse.
Das Dreigestirn verließ die Klasse wieder so wie es gekommen war: in militärisch zackigen Schritten. Oberstudienrat Kosseck, genannt Lupo, schien mit sich zufrieden; der hagere Direktor hingegen schien eher hilflos oder peinlich berührt. Er hielt deshalb seinen Blick in Richtung Boden gesenkt. Und Hausmeister Kwiatkowski genoss offensichtlich immer noch seine dekorative Funktion als Saalwache, was ihm wichtig ins Gesicht geschrieben stand, mit seiner Pomade im Haar, einem Möchtegern-Clark Gable sehr ähnlich. Erbärmlich!
Lobeda setzte seinen Unterricht wie gewohnt fort, beendete ihn jedoch einige Minuten vorm Läuten zur großen Pause.
„Die anderen gehen in die Pause, Hans bleibt hier!“, rief er, und fuhr sich dabei mit seinen Fingern durch seinen dichten Haarschopf, als müsse er sich für ein Gespräch mit Hans richten.
Lobeda sah dem berühmten Lex Barker zum Verwechseln ähnlich. Hans glaubte, Lobeda wäre sich dessen bewusst. Sein ganzer Habitus erinnerte Hans immer wieder an Tarzan und Old Shatterhand. „Hast du Kirschen geklaut?“, fragte Lex Barker seinen Schüler. Sie sahen sich geradewegs in die Augen.
„Nein“, versicherte Hans. „Die schmecken überhaupt nicht. Es ist ein modriger alter Sauerkirschbaum. Die Kirschen sind auch schon völlig überreif und total verschrumpelt.“
„Kennst du die Leute, die Eigentümer?“
„Nein, Herr Doktor Lobeda.“
„Du könntest dich bei diesen Leuten entschuldigen.“
„Wegen was denn, ich habe nur meinen Ball aus deren Garten geholt? Mehr nicht.“
„Es ist gut Hans, du kannst jetzt auch in die Pause gehen.“
Damit war für Lobeda der Fall erledigt. Nicht so für Hans. Von einigen Lehrern aus dem Kollegium hörte er zu allen möglichen Gelegenheiten „Sensationsfotos kannst du machen, aber dich ordentlich benehmen kannst du nicht.“ Oder: „Klauen kannst du, aber Mathematikaufgaben lösen nicht.“ Solches und Ähnliches wurde ihm in etlichen Varianten und Kombinationen immer wieder vorgeworfen.
Die Geschichte über seine „Sensationsfotos“ würde er seinem neuen Freund Konni einmal ausführlich erzählen. Was sich zu diesem Thema begeben hatte, blieb Hans auf ewig in seinen Gedanken präsent. Daraus hatte er für sich etwas gelernt. Es schien offensichtlich egal, ob jemand wirklich so ist, wie es scheint, oder ob jemand nicht so ist, wie es scheint.
Lupo, später ein Bundestagsabgeordneter und Landrat, vorher wurde er noch Major der Reserve bei der Bundeswehr – dieser Rang wurde ihm, obwohl er vorher niemals beim Militär war, auf lächerliche Art und Weise durch politische Machenschaften geschenkt – musste wohl viel Zeit aufgewendet haben, um Hans im Lehrerkollegium zu markieren. Bis Hans diese Schule verließ, war dieser unschöne Zustand für ihn geblieben. Die Klassenkameraden hatten einen Blitzableiter in ihm gefunden. Auch wurde er deswegen ständig angegriffen, weil er sich, deutlich reifer als seine Mitschüler, mit deutlich älteren Mädchen abgeben konnte. Und da war ja noch sein prächtiger Haarschopf, auf den viele seiner Mitschüler neidisch waren. Hans schöne Haare ließen ihn ein wenig wie Berry Ryan aussehen.
Lobeda kümmerte sich leider nicht weiter um ihn. Er stellte auch im Lehrerkollegium nicht klar, dass Hans ein Diebstahl, nach Gang bisheriger Dinge, nicht vorzuwerfen sei, was für den zu Unrecht beschuldigten Hans eine bittere Enttäuschung darstellte. Vielleicht wollte der Lehrer sich nicht mit der Obrigkeit in der Schule anlegen, um nicht eine Beförderung vom Studienrat zum Oberstudienrat zu gefährden.
Sein von Lupo geimpfter Nachfolger, Hans‘ neuer Klassenlehrer nach seiner Versetzung in die Quinta, war Oberstudienrat Böhme, ebenfalls Deutsch. Böhme war auch nicht besser. Kein Stück. Böhme sah mit seinen schwarzgrauen Haaren, seinem kirchlich anmutenden Hemd unter seinem immer dunklen Sakko, aus wie der Schah von Persien. Nur Epauletten, Goldknöpfe und Orden fehlten noch zur Uniform. Eine Schahbanu hatte er offensichtlich nicht an seiner Seite.
„Vielleicht aber einen schwulen Kaiser“, wurde spekulierend in der ganzen Schule gemunkelt.
Böhme war jedes Mal regelrecht verzückt, wenn er im Zuge von Geschichten über Kreuzzüge, das Gedicht von Ludwig Uhland „Kaiser Rotbart“ vortragen konnte. Er schloss dabei sogar seine Augen und hielt seinen Kopf theatralisch gen Himmel gerichtet, während er laut, deutlich und eindrucksvoll intonierend zu dem ihn scheinbar glücklich machenden Vers gelangte:
„Da wallt dem Deutschen auch sein Blut,
er trifft des Türken Pferd so gut,
er haut ihm ab mit einem Streich,
die beiden Vorderfüß‘ zugleich.
Als er das Tier zu Fall gebracht,
da faßt er erst sein Schwert mit Macht,
er schwingt es auf des Reiters Kopf,
haut durch bis auf den Sattelknopf,
haut auch den Sattel noch zu Stücken
und tief noch in des Pferdes Rücken;
zur Rechten sieht man wie zur Linken,
einen halben Türken heruntersinken.“
Hans hatte damals mit einem ungezogenen Zwischenruf ergänzt:
„Und das auf einem humanistischen Gymnasium!“
Ob vorlaut oder altklug, mag dahingestellt sein. Jedenfalls erntete er dafür vom Herrn Pädagogen eine wahrhaft kräftige Ohrfeige und einen Eintrag ins gefürchtete Klassenbuch.
„Savin stört den Unterricht.“
Wodurch und weshalb, wurde nicht erwähnt.
Hans legte sich ab diesem Moment damals, für sich selbst, für sein Empfinden zurecht, dass er später einmal behaupten könnte, auf einem humanistischen Gymnasium zu einem Blutreporter und Dieb befördert worden zu sein.
Hans ergänzte seine Behauptung wenige Jahre später, als er Max Frisch „Andorra“ im Rahmen eines schulischen Lehrplans lesen und interpretieren musste: dass ein Mensch sich irgendwann so verhält und das würde, wofür er von anderen fälschlich gehalten wird…
Eine gewisse Angst stieg in Hans auf.
Norbert wurde neunzehn Jahre alt. Neben Hans in der Reihe jener Kirche, unausweichlich, saß Rolf-Dieter Ehle-Wesing, Spitzname „Kottkott“, den er aus dem Café Fortuna kannte, dem angesagten Treff in der City. Damals schon Lloyd-Schuhe, Blazer, elitäre Gesichtszüge, elitäres Gehabe und akkurat kurzer Haarschnitt, aber von Benehmen keine Spur. Rolf-Dieter grunzte, schluchzte, amüsierte sich unentwegt mit ersticktem Lachen während der gesamten Trauerrede.
„Lass es, oder gehe hinaus. Ich kann dir auch eins in die Fresse geben“, drohte Hans ihm flüsternd.
Der Zweimetertyp, im gleichen Alter wie Norbert, wurde sofort still und verhielt von da an angemessen. Er zeigte Respekt vor Hans‘ Drohung, obwohl er auf ihn herunterblicken konnte. Außerdem war dieser „Kottkott“, wie er genannt wurde, nahezu fünf Jahre älter als Hans.
Hans kannte diese Art schlechter Manieren. Nicht von sich selbst, aber dass es Leute gibt, die Trauer nicht ernstlich und nicht still aushalten können. Über diesen Kottkott wollte er jedoch nicht weiter feinsinnig nachdenken. Ganz im Gegenteil: am Grabe hatte er diesen Kerl vor allen Anwesenden mutig aufgefordert, sofort zu gehen. Hans hatte ihm dabei das langstielige Schippchen aus der Hand genommen, gerade als der an der Reihe war, Sand auf den Sarg zu streuen. Auf dem mit einem Blumengesteck drapierten Sarg lag die hellblaue Mütze von Norbert, die er so oft trug.
„Was soll das?“, schnaubte Kottkott abwehrend, um seine Verlegenheit zu kaschieren. Er parierte jedoch und verschwand.
Die Blicke aller, während er den Friedhof verließ, müssten ihm im Nacken gebrannt haben. Hans gab schweigend das Schippchen weiter. Erst jetzt sah er dieser sehr gut aussehenden schwarzhaarigen Birgitta in die Augen. Noch nie hatte er mit ihr ein Wort gewechselt. Hans erinnerte sich nur an Norberts Beschreibung dieser Frau. Auch später hatte sich kein Kontakt zu ihr ergeben wollen. Ab und zu sah er sie in der Stadt und stellte sich vor, dass Norbert an ihrer Seite wäre; fröhlich, überschwänglich und glücklich.
Nach der Beisetzung wurde Hans beim Leichenschmaus im nahe gelegenen Landgasthaus von vielen Trauergästen angesprochen. Die Leute wollten wissen, was sein Verhalten gegenüber diesem Kottkott bedeutete. Hans gab Auskunft. Ausführlich und gnadenlos deutlich beschrieb er diesen Kottkott, obwohl er die erschreckenden Informationen über ihn nicht aus erster Hand hatte, und er selbst bei dessen Missetat natürlich nicht dabei war. Hans reichte, was Norbert über ihn berichtet hatte.
Norberts Schwester Klara kam auf ihn zu.
„Hans, das war kurios. Stell dir vor, mir wurde die Mütze von Norbert aus Frankreich zugestellt, ohne Absender, ohne Mitteilung, ohne alles.“
Hans erklärte Klara geduldig die Hintergründe. Auf seinem Weg nach Hause blickte er gedanklich zurück in die Zeit, als er erstmals bei Norbert zu Hause war. Er hielt damals Norberts weiße 250er BMW, ein von ihm günstig erstandenes Polizeimotorrad, bewundernd fest. Er und Norbert genossen vergnüglich den Start und den unverkennbaren Sound des Motors. Norbert bezeichnete die Maschine als seinen Schimmel, und der bekäme jetzt neues Motoröl, und er las begeistert die Beschriftungen der glitzernden Dose, die er vom Boden aufgehoben hatte.
Sie hatten anschließend das Motorrad in den maroden Sandkasten gestellt, in welchen im Winter die Asche vom Dauerbrenner, Herd und Badeofen des Hauses aufgeschüttet wurde. Norbert machte dort die fälligen Ölwechsel selbst. Die Asche könne das Altöl aufnehmen, erklärte er. So viel wäre es ja nicht, behauptete er Hans gegenüber. Hans, der keinerlei Verständnis für das Ablaufen von Altöl in Mutter Erde hatte, konnte jedoch kein Veto vorbringen. Norbert wollte es nicht hören. Art und Weise der Altölentsorgung war damals eine der Unsitten dieser Zeit. Hans ließ aber nicht locker, woraufhin Norbert löblich reagierte und eine alte Blechdose aus dem Keller holte, in die erst mal das Öl abfließen konnte.
Leider fuhr Norbert selten mit seinem Krad herum. Nur einmal konnte Hans ein glücklicher Sozius sein. Ständig war Norberts „Schimmel“ defekt, ständig musste er dran rumschrauben.
Hans überlegte in der Kirche, noch während des Hinkniens und Wiederaufstehens, Hinsetzens und wieder Hinkniens während der Totenmesse, wer das Motorrad jetzt übernehmen würde. Diese Frage hatte er aber schnell ad acta gelegt, weil er selbst an Motorrädern nicht sonderlich interessiert war. Mopeds und Motorräder verband Hans mit Halbstarken und Rockern, von denen er keiner sein wollte. Außerdem wären Zweiräder ja auch nur Gefährte für gutes Wetter.
„Passen Sie bitte, als der Erwachsenere von euch beiden, auf meinen Sohn auf, Herr Schwerdt“, hatte Hans‘ Vater Norbert gebeten, als er ihn damals von zu Hause abholte. Norberts Gesicht strahlte unter seinem keck aufgesetzten blauen Barett. Er versprach, sein Bestes zu tun und vorsichtig zu sein.
Mit dieser Mütze auf dem Kopf, ähnelte Norbert ein wenig Bob Dylan. Das wusste er. Er genoss den Vergleich.
Die großen Ferien hatten begonnen. Hans hatte unter schweren und lautstarken Auseinandersetzungen mit seinem fürsorglichen Vater durchsetzen können, dass er mit Norbert für viele Tage mit zu dessen Schwester nach Frankfurt am Main reisen durfte. Sie wollten erst dahin fahren und dann weiter sehen.
Hans bekam letztendlich doch großzügig Reisegeld. Ein Teil davon in einem für Notfälle verschlossenen Umschlag. Diese Art der Handhabung – es könnte väterliche Liebe gesagt werden – hatte Hans‘ Vater bereits zu anderen Anlässen gegenüber seinem älteren Geschwister praktiziert. Jetzt war es an ihm.
Hans spürte des Vaters Sorge und Zuwendung. Mit einem warmen Gefühl dachte er daran, auch gerne wieder nach Hause zurückzukommen. Den Umschlag hatte der Vater mit in den „Affen“ gelegt, seinen alten Tornister aus dem Krieg, den jetzt Hans lässig am langen Arm tragen und wissen würde, welche Wege dieser Tornister schon hinter sich hatte.
Es war schon ein gewisses Prozedere, als sein Vater ihm erklärend half, den Affen optimal mit Pullover, Hemden und Shirts und Artikeln zur Körperpflege zu bestücken. Der noch rechtzeitig vom Schwager beschaffte Bundeswehrschlafsack und die Luftmatratze steckten in einem riesigen Campingbeutel. Norbert hatte neben seiner Umhängetasche einen großen Handkoffer dabei, worin er auch Hans‘ Ersatzwäsche, Hose und Blouson unterbrachte. Besser fürs Gepäcknetz in der Bahn, dürfte der Vater gedacht haben.
Von wegen Bahn. Sie wollten trampen. Dieses Geheimnis hatte sie allerdings nur ihren Bekannten im Café Fortuna verraten und kein Wort darüber zu Hause verloren, weil es jeweils zu unnötigen und nervigen Diskussionen mit den Alten geführt hätte.
„Tu, was du willst, mein Sohn, und nicht was andere wollen. Halte deine Sachen beisammen, denn du weißt nicht, wann deine Reise beendet ist!“, hatte Hans’ Vater noch zum Abschied gesagt. Mahnende Worte, die Hans aber vollends akzeptieren konnte, denn er dachte in gewissen Fragen gleichsam.
Die Mahnungen des Vaters hatten wirklichen Wert, wenngleich nicht immer und zu jeder Zeit daran zu denken war.
Norberts Schwester war schon lange mit einem Berufssoldaten der Bundeswehr verheiratet. Sie lebten im Stadtteil Frankfurt-Fechenheim, zufällig auch der Geburtsort von Hans‘ Mutter.
Hans hatte in der Tat die beiden kennen gelernt. Die Schwester etwas später, ungeplant erst auf der langen Tour zurück, und deren Mann, besagten Offizier, erst bei der Trauerfeier.
Es passierte, dass die beiden Freunde schon an der ersten Autobahnauffahrt einen großen Benz erwischten. Sie durften bis nahe Frankfurt/Main mitfahren. Der Fahrer, ein redseliger Handelsvertreter für Spritzlacke, stoppte jedoch bei jedem zweiten Autobahnhalt und holte sich dann jeweils ein kleines Fläschchen mit buntem Emblem aus seinem Kofferraum, welche er routiniert öffnete und den klaren Inhalt ruckartig in sich hinein kippte. Sie wagten erst nicht zu fragen, was er da trinke. Doch als der Fahrer frug, ob er seinen beiden Passagieren auch was anbieten könne, wollten sie doch wissen, was es sei.
„Guter Alkohol“, erklärte der Mann bereitwillig. Er hatte bereits eine knallrote Birne. Ganz spurgetreu fuhr er auch nicht mehr. Hans und Norbert hielten Blickkontakt und waren sich sofort einig. Sie beschlossen wortlos: „Bei nächster Gelegenheit nichts wie raus hier.“
Noch ein ganzes Stück vor Kassel war es dann so weit. Etwas angespannt bedeuteten sie dem fülligen, verschwitzten Chauffeur, dessen Hemd nun gar nicht mehr zu passen schien, dass sie hier aussteigen wollten. Ihr Wohltäter schien etwas irritiert, vielleicht sogar beleidigt, aber er fuhr von der Autobahn ab, ließ die beiden aussteigen, und verschwand kurz darauf in einer Waldschneise. Womöglich wollte er die Gelegenheit nutzen, seinen Rausch in einem schattigen Bereich auszuschlafen.
Hans und Norbert hielten, nur ein paar Schritte weiter, an der Auffahrt – nach wie vor in Richtung Frankfurt/Main – wieder ihre Daumen hoch. Ein großer, bequemer Citroen hielt an. Der Fahrer, ein Franzose, fuhr bis Lyon, erfuhren sie.
„Machen?“ fragte Norbert Hans.
„Machen!“ antwortete Hans, ohne zu zögern.
Damit waren Frankfurt-Fechenheim und die Schwester einvernehmlich gestrichen. Die beiden konnten sich mit dem sympathischen älteren Herrn nicht gut austauschen, denn der sprach weder Deutsch noch Englisch und die beiden nicht Französisch. Die lange Fahrt vollzog sich jedoch in kameradschaftlich guter Atmosphäre. Man tauschte Zigaretten, Gitane gegen Camel, wechselten Wortbrocken wie amour, demoiselle, le beatnik, Citroen, Mercedes, de Gaulle, Adenauer und Brigitte Bardot. An der letzten Raststätte, kurz vor der Grenze, telefonierte Norbert mit seiner Schwester und sagte ihren geplanten Besuch ab, während Hans in der Zwischenzeit am Exchange französische Franc einwechselte.
Der nette Franzose fuhr die beiden Schlafenden weiter durch die Dämmerung und direkt zur Auberge de Jeunesse in Lyon. Er war sehr umsichtig mit seinen jungen Fahrgästen, hatte diesen besonderen Service aber vorher nicht signalisiert.
Es war bereits tiefe Nacht. Ein herrlicher Sternenhimmel zeigte, dass sie schon weit von zu Hause fort waren. Hier waren tausendfach mehr leuchtende Sterne zu sehen als in Westfalen. Sogar Sternschnuppen fuhren droben umher, deren Präsenz sie zu Hause sehr selten sichten konnten.
Die beiden Freunde zeigten ihrem Franzosen gegenüber ihre ganze Dankbarkeit für diese wunderbare und sichere Fahrt, in dem sie, symbolisch, die Windschutzscheibe seines Autos wischten und ihm, indem sie sich daraufhin an ihre Brust fassten, damit von Herzen alles Gute zu wünschten.
Hans und Norbert wurde jedoch in jener Herberge, mangels erforderlichem internationalen Jugendherbergsausweis, kein Quartier zugewiesen. Die Speisenausgabe war ebenfalls schon geschlossen.
Alles schien sehr ruhig zu sein in diesem Haus. Nur ein paar Jugendliche saßen noch rauchend auf der Eingangstreppe und tranken aus einer herumgereichten Literflasche billigen Rotwein. Eine kleine Gruppe Algerier, gleichsam betroffen, grillte Fleisch und Baguette im hinteren Bereich des Areals. Sie luden die beiden Deutschen unkompliziert und freundlich ein, doch mit ihnen mitzuessen. Die Aufsicht der Jugendherberge tolerierte das Lager und auch, wenn einer von ihnen die sanitären Bereiche im Gebäude aufsuchen musste. Es war wohl so Usus, dass keiner der jungen Leute den nächtlichen Straßen überlassen sein sollte.
Mit brennenden Hälsen verbrachten Hans und Norbert die Nacht auf ihren Luftmatratzen. Das Fleisch, welches sie von den Algeriern bekommen hatten, war fast bis zur Geschmacklosigkeit scharf gewürzt. Ihre Schlafsäcke benötigten sie nicht. Es war die ganze Nacht hindurch warm. Gleich morgens nach dem Frühstück, wofür an der Rezeption für Essensmarken und sonstige Auslagen ein Obolus entrichtet werden konnte, hatte Norbert eine bereits für das Ausland frankierte Ansichtskarte mit einem Bild vom nächtlichen Lyon gekauft. An Ort und Stelle schrieb er ein paar Zeilen an seinen Vater. Er warf die hübsche Karte gleich im Foyer in den Briefkasten. Der liebe Papa sollte nun doch wissen, auf welcher Tour er sich mit Hans befand. Norbert schien stolz darauf zu sein, wie weit sie unbeschadet gekommen waren; mitten durch Frankreich.
Mit relativ wenigen Autos – ein Lastwagen war auch darunter, der sah aus wie ein Container mit Augen – erreichten die Freunde den kleinen Ort Lambesc, Aix-en-Provence. Sie fanden am Ortsrand, etwas versteckt hinter einer hohen und bewachsenen Böschung, einen verwaisten Lagerplatz, rundherum mit Buschwerk abgeschirmt und inmitten einiger Schrottteile sowie einem riesigen Baum, fast so wie der von Robin Hood im Sherwood Forrest. Sie bezogen eine verblichene schwarze Limousine, die Kommissar Maigret gehört haben könnte. Zwar ausgeschlachtet und voller Glassplitter, aber zumindest ihr Gepäck hatte einen trockenen Raum, falls es regnen würde. Außerdem war dieses Auto ein gutes Versteck. Sie bliesen ihre Luftmatratzen auf und rollten ihre Schlafsäcke aus.
Norbert hatte einen typischen Campingschlafsack dabei. Ziemlich bunt, aber sicherlich angenehmer als der von Hans, der mit seinem schon in der ersten, doch sehr kühlen Nacht, eine weniger gute Erfahrung machte. Sein Bundeswehrschlafsack war schwer, zwängte ein, wärmte nicht richtig und sammelte noch blöderweise Kondenswasser im Fußbereich, was ihm, in Anbetracht einer noch nicht entdeckten Möglichkeit zur Körperpflege, höchst unangenehm aufstieß. Seinen gut gelaunten Freund Norbert schien das alles sehr zu amüsierten. Er konnte den blöden Spruch: „Unrasiert und ungewaschen woll‘n wir unsre Frauen vernaschen“, entgegen seiner sonst üblichen, eher ernsthaften Art, nicht unterdrücken.
Dieses Autowrack blieb nun ihr Domizil für die Tage im Süden Frankreichs. Norbert hatte Urlaub für drei Wochen genehmigt bekommen, Hans mit noch fünf Wochen Ferien hatte alle Zeit der Welt. Ihre Haare sollten während der Reise, wie geplant, richtig schön lang werden. Sie hatten beide schon einen ziemlichen Putz, auch Matte genannt, als sie losfuhren. Wenn sie wieder nach Hause kämen, wären sie nicht nur toll braungebrannt, sondern würden auch jeden Kober – so die abfällige Bezeichnung unter Konkurrenzgesichtspunkten – im Café Fortuna ins Abseits stellen. Selbstverständlich von gewöhnlichen Gammlern, mit Haartracht teilweise bis zum Steißbein, einmal abgesehen. Die Sorte war ohnehin nicht im Café Fortuna anzutreffen.
Hans und Norbert pflegten sich aus der Not heraus mit Tafelwasser. Halbwegs frisch genug, unternahmen sie ein paar Ausflüge. Später entdeckten sie einen kleinen Kanal in der Nähe, welcher ihnen endlich sogar ein erfrischendes Bad ermöglichte.