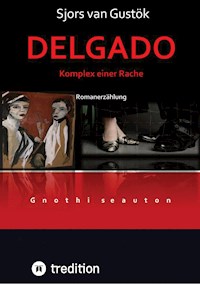9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einem beruflich etablierter Mann aus Deutschland wird in seinem Urlaub in Bulgarien von einer Sinteza die schwierige existentielle Situation ihres Mannes offenbart. Die beiden Männer schließen Freundschaft. Auch der Mann aus Deutschland steckt in einer existentiell bedrohlichen Situation. In stetig wachsender Verbindung und wechselseitiger Zuneigung finden sie Möglichkeiten, sich diesen Bedrohungen wirksam entgegen zu stellen. Ein gigantisches Projekt wird von beiden ins Leben gerufen. Es ist getragen von Verantwortung und Liebe gegenüber an den gesellschaftlichen Rand gepressten Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Diese Geschichte ist aufgeschrieben, damit sie nicht verloren geht. Mögen sich unsere Kinder und Enkel ein Bild machen.
„Mench Man sitzt by mengem ManUnd waist nit, was mench Man kannUnd wißt mench Manwer mench Man werDo but mench Manmenchem Man Zucht und Er“
(Ruolman Merswin im Jahre 1465)
Einem Sinto zugeeignet
Sjors van Gustök
Leere Hand des Sinto
Romanerzählung
© 2022 Sjors van Gustök
Umschlag/Illustration:
Juschko -Reinhard Schmidt-, Trainer im „Shotokan-Karate-Dojo Lingen e.V.“ (Originale Hand) und Sjors van Gustök
Druck und Distribution im Auftrag des Autors Sjors van Gustök:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Softcover:
978-3-347-53944-0
ISBN
Hardcover:
978-3-347-53945-7
ISBN
E-Book:
978-3-347-53949-5
ISBN
Großdruck:
978-3-347-53950-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor Sjors van Gustök verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie
40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel: Specksteinspiel
Szenario 1: Der Exorzist
Szenario 2: Grand Ulica Piotrkowska
Szenario 3: Alles Zäckmäcks
2. Kapitel: Sundowner
Szenario 1: Haufen toter Motten
Szenario 2: Wege der Frachten
Szenario 3: Pater Julius‘ Zählwerk zurück
3. Kapitel: Fluch und Segen
Szenario 1: Kampf mit Muttermilch
Szenario 2: Fest im Ethanol-Feuer
Appendix: Personen und Begriffsbestimmungen
Vorwort
Die Leser möchte ich bitten, meine geschriebenen Worte Zigeuner im Alltag jeweils zutreffend durch die Worte „Sinti, Roma, Jenische“ zu ersetzen. Sie akzeptieren das „Z-Wort“ nicht; zu Recht. Wenn es in dieser Romanerzählung vorkommt, ist es dem Zeitabschnitt, dem fallweisen Nichtwissen um die Bedeutung dieses Wortes und der angewendeten Sprache der Romanfiguren geschuldet. Es ist von „Reisenden“ zu sprechen.
Was passierte zwischen Menschen, die sich nicht mehr vertrauen? Sie könnten sich belogen, sich betrogen, sich nicht geholfen oder sich wehgetan haben, egal, ob seelisch oder körperlich. Wenn aber das alles nicht gewesen ist, trotzdem das Vertrauen entschwunden ist, woran hätte es noch gelegen haben können, wenn nicht Taten eine Rolle spielten?
An bösen Gedanken? Die zu lesen ist wohl nicht möglich. Allenthalben ist ein Gesichtsausdruck zu deuten. Wenn wiederum der nicht zu einer Tat passt, ist damit kein Weiterkommen. Manche haben eben so oder so ein Gesicht und in bestimmten Momenten ein so oder so verändertes Gesicht. Ein Bettler, der von einem böse drein blickenden Menschen ein großzügiges Almosen erhält, wird nicht die Vertrauensfrage stellen.
Es bleibt der Rest, der Vertrauensverlust verursachen kann, der etwas auslöst, der Stimmung und Empfinden zwischen Menschen beeinflusst: die nackte Sprache, ob gesprochen oder geschrieben. Wodurch das alles?
Witz wird nicht verstanden, Ironie nicht gespürt, Unsicherheit nicht wahrgenommen, Metapher nicht kapiert, Zitat nicht gekannt, Sorge nicht erkannt, Rat nicht gewollt, Wortbedeutung anders interpretiert, die Übersetzung inkorrekt gemacht. Das alles kann alltäglich überwunden werden, aber wehe, es kommt ein Schuss mangelndes Selbstbewusstsein hinzu; dann treten sie ein, bedrückend, bisweilen quälend: Vertrauensverluste.
Trotzdem kann es geboten sein, sich damit zu arrangieren, den Menschen weiter zugeneigt zu sein. Eine afrikanische Weisheit, ein Sprichwort besagt „Wenn du schnell gehen willst, dann gehe allein. Wenn du weit gehen willst, gehe mit anderen.“ Wir alle stehen also auch vor den weiten Wegen, die zu gehen nur mit einem oder mehreren anderen Menschen möglich sind. Etwaige Vertrauensverluste müssen dabei von Fall zu Fall verdrängt, damit Beeinträchtigungen hingenommen werden.
Ulli ist mit „einem“ nicht nur weit gegangen, sondern auch recht schnell. Vertrauensverluste untereinander gab es dabei nicht. Sie haben sich selten etwas unmittelbar gesagt. Nicht, weil sie stumm waren. Im Gegenteil. Jeder von ihnen hatte seine lebendige Sprache. Sie verständigten sich durch Taten! „Laut gegeben“ hatten sie sich allerdings schon. Sie sprachen sich eindringlich mit ihren Namen an, wenn Aufmerksamkeit signalisiert werden musste. „Er“ konnte kaum Deutsch und kaum Englisch. Ulli so gut wie kein Bulgarisch. Manchmal musste es reichen, sich wechselseitig die Wörterbüchlein hinzuhalten.
Lesen Sie die Geschichte aus der Sicht von Ulli. Er möchte gelebtes Vertrauen nachvollziehen lassen, Emis Maria Torýow ans Herz legen, einen Mann, der „Grand Hand Ouvert“ in fünffacher Diaspora spielte.
Wer wäre nicht gerne an der Seite des Sinto gewesen?
Die in dieser Romanerzählung gewählten Orte, bezeichnete Unternehmen und Organisationen sind fiktiv, diese dienten lediglich zur Anschauung. Rückschlüsse auf frühere und jetzt real existierende Gegebenheiten wären rein zufällig.
gez. Sjors van Gustök
1. Kapitel: Specksteinspiel
Szenario 1: Der Exorzist
Die Konferenz endete pünktlich. Es war noch Zeit bis zum Check-in. Die Sitzplätze im Wartebereich waren allesamt belegt, inmitten der aufrechten Menschentraube nicht mehr zu sehen. Ich hatte mich diesem Filz entzogen, stand am Rand, ganz hinten. „Die Flüge nach Köln-Bonn und Berlin sind in wenigen Minuten zum Einsteigen bereit“, lautete die Durchsage. Die ergab dann die Bewegung der Masse aus allen Richtungen zum Nadelöhr. Das Gedränge verdichtete die letzten möglichen Reste der Abstände, als durch eine zweite Durchsage das Bereithalten der Pässe gefordert wurde. Zwischen einigen Hälsen hindurch konnte ich direkt auf den Hinterkopf einer Frau sehen, die mir durch ihre scharf geschnittene, stufige Frisur auffiel. Die kurzen Haare gaben ihren Nacken völlig frei. Ich sah einen Pilz, einen Champignon mit weißem Stiel und brauner Kappe, frei schwebend. Näher zum schmalen Durchgang am Helpdesk aufgerückt, vernahm ich die Endloshinweise des schicken Fräuleins vom Bodenpersonal. „Links, rechts, rechts, links, links, rechts…“ Den Champignon wollte ich mir gerne noch von vorne angesehen haben, aber ich wurde nach rechts geschickt und der wohl nach links. „Nicht schlimm“, ging es mir instinktiv durch den Kopf, „wohl auch eine, um die es besser einen Bogen zu machen gilt.“
Mit meinem schmalen Diplomatenköfferchen auf dem Schoß, saß ich nun im mittleren Bereich des Fliegers und freute mich auf die Landung in Köln-Bonn. Drei neue Freunde erwarteten mich im Café gleich gegenüber dem Bahnhof, dem zentralen Treffpunkt „im Loch vom Bonner Loch“, und das war eine Garantie für gute Gespräche. Ich nannte sie „die Zäckmäcks“, weil deren Nachnamen Zeckerin, Mackowski und Eckes und ihr Auftreten als richtige Macker mich darauf brachten. Die halfen mir, mich an die Leute der Stadt und ihre rheinländische Leichtigkeit zu gewöhnen.
Schon ab dem Frühling und dann über die Sommermonate hinweg war es in Bonn für mich überhaupt zu mild und zu schwül, an dieser Stelle besonders. Mangels jeglicher Lüftchen können dort die Atmungsorgane so gut wie nicht durchgepustet werden und Pollenflüge geben manchem den Rest. Hals-Nasen-Ohren-Ärzte boten in der Stadt in ihrer Präsenz deshalb eine hohe Dichte und therapierten mit Freude über ihre vollen Wartezimmer vor sich hin. „Sie haben nichts, das ist Ihr subjektives Empfinden“, wurde mir einmal gesagt. Ab diesem Zeitpunkt kam ich mit diesem Klima bestens klar. Mir blieb auch nichts anderes übrig, denn ich war von meinem Arbeitgeber für wohl zwei bis drei Jahre detachiert, hatte eine kleine City-Wohnung, gleich am Anfang der Einkaufsstraße, hinter dem Café.
Ein Passagier trat an mich heran und deutete auf den Abschnitt von seiner Bordkarte.
„Sie sitzen wohl auf meinem Platz“, sagte er freundlich, aber auch erwartungsvoll. Ich nannte ihm meine Reihe und meine Platznummer, so wie ich es hätte belegen können. „Ja, habe ich auch, hier, kann ich Ihnen zeigen“, sagte der Mann und hielt mir den Beweis hin. Wir waren uns schnell einig, dass eine der Stewardessen kommen müsse, um das Malheur zu klären. Nach unseren kurzen Handzeichen signalisierte eine durch ihr Kopfnicken, dass sie gleich zur Verfügung stünde. Sie war gerade jemandem behilflich, sein Handgepäck in der oberen Ablage zu verstauen. „Hier spricht Ihr Kapitän, willkommen auf unserem Flug nach Berlin, wir rollen jetzt zur Startposition und werden in wenigen Minuten …“, war zu hören. Sofort dachte ich an meinen Koffer. Der ist im Flieger nach Köln-Bonn. Der ist richtig. Ich bin im Flieger nach Berlin. Ich bin falsch. Aufgeschreckt und aus dem Sitz hochgeschnellt, hastete ich der Stewardess entgegen und hatte nur den einen Satz auf den Lippen: „Ich muss hier raus, ich muss nach Köln-Bonn!“ Nach kurzem Blick auf meinen Bordkartenabschnitt, Köln-Bonn stand ja fett drauf, fragte sie mich, wie ich denn „hier hinein“ kommen konnte. „Das müssen Sie mir sagen“, war meine spontane Antwort, „und hoffentlich ist mein Koffer nicht auch noch falsch geladen worden.“ Nach ihrer schnellen und kurzen Abstimmung in der Führerkanzel wurde der Einstieg wieder geöffnet und war für mich somit zum Ausstieg geworden. Sie brachte mich schnellen Schrittes zum Abzweig der Gänge und ich war erleichtert, „in der richtigen Röhre“ zu sein, um in den Flieger nach Köln-Bonn aufgenommen zu werden. Als letzter Passagier für diesen Flug suchte ich entspannt meinen Platz. Es konnte nur der freie Platz im Gang sein, der im mittleren Bereich des Flugzeuges, den ich schon von weitem entdeckte. Aus meiner Entspannung wurde dann Spannung, als ich mich setzte und anschnallte. Ich saß neben dem Champignon! Nicht nur einfach so, vielmehr, weil der mich von seinem Platz in der Mitte „sowas von angewidert“ fixierte und mir, durch sein unnötiges Hin und Her auf seiner Sitzfläche und das Nesteln an seiner Kostümjacke, klarmachte, dass der sich durch mich ungeheuer gestört fühlte. Der Champignon war eine verdammt hübsche Frau, so in meinem Alter. „Ich bin ein netter Mann, ich nutze ein teures Herrenparfüm, meine Hände sind gepflegt und ich trage einen guten Anzug, dazu blank geputzte Schuhe, habe ich gedacht – und „Was hat sie gegen mich?“ Ein denkbarer Verbündeter auf dem Fensterplatz, ein junger Mann, war eingenickt. Dem war dadurch jede Beobachtung des Verhaltens der Dame neben mir entgangen.
Es kam im Flugzeug zu keinerlei Wortwechsel zwischen der Dame und mir. Sie saß mit Blick stur geradeaus neben mir und ich riskierte kein Wort, geschweige denn einen Flirt. Dann der Hammer! Das muss an der milden Luft gelegen haben, die wir beide vor dem Flughafengebäude am Anfang der Taxireihe atmen konnten: „Hatten Sie auch in München zu tun?“, fragte sie mich und sie konnte dabei ihren Blick in meine Augen vollends halten. Ich konnte meinen Blick in ihre Augen nicht vollends halten, was mich am nächsten Tag noch ärgerte, antwortete jedoch artig:
„Ja, beruflich, ab und zu muss ich dahin.“ „Sie haben am Band eben einen sehr nervösen Eindruck gemacht“, setzte sie fort, „im Flugzeug waren Sie doch noch ganz ruhig und entspannt – oder nicht?“ Ich erklärte ihr, dass ich öfters unsicher bin, ob bei meinen häufigen Flügen meine Koffer immer mitkommen, denn ich hätte damit so meine Erfahrungen gemacht. „Wohin geht es jetzt?“, wollte sie von mir wissen. Endlich eine Gelegenheit, „eine meiner interessanten Antworten“ zu geben: „Ich muss zum Bahnhof in Bonn, wo Sie hinmüssen, kann ich Ihnen nicht sagen.“ Sie lachte. Sie hatte verstanden. „Ich muss auch zum Bahnhof, ich habe noch eine Bahnfahrt vor mir“, sagte sie betont sachlich, „aber zum Kölner Hauptbahnhof.“ „Erst München, jetzt geht es weiter, ganz schön reisefreudig – wohin geht es denn noch?“ Besseres konnte ich nicht hervorbringen. Sie gab ihr Reiseziel an: Olpe. „Ach, Sauerland“, bemerkte ich, „kenne ich.“ Sie sah auf die Uhr. Ich sah auf die Uhr. Es wurde für uns beide Zeit. „Wollen wir mal telefonieren?“, fragte ich und war gefasst auf eine Antwort à laChampignon. „Können wir, haben Sie eine Karte von sich?“, fragte sie, während ihr Taxifahrer ihren offensichtlich sehr schweren Koffer „in zwei Etappen“ in den Kofferraum verbrachte. Sie nahm meine Visitenkarte entgegen und steckte sie in ein Täschchen an ihrer Kostümjacke und stieg mit einem „Tschö - Schönes Wochenende“ in den Wagen. Mein Koffer wurde von meinem Taxifahrer dann auch in den Kofferraum gelegt, „in einer Etappe“.
So wie ich war, setzte ich mich zu den Freunden im Café an den Stammtisch. Einer betrieb eine kleine Druckerei und hatte Faible für amerikanische Autos. Der andere hatte einen „Rent An Office Service“ und wollte irgendwann für sich und seine Familie ein Haus bauen. Der dritte im Bunde betrieb mit seiner Frau „Die Rhein-Mosel-Finanz“, ein Beratungsunternehmen für Geldanlagen und Steuerersparnismodelle. Der vierte im Bunde war ich: Einer von mehreren Geschäftsführern in einer Unternehmensgruppe, vergleichbar mit Hapag Lloyd, nur nicht so groß und nicht so bedeutend. Ich war beauftragt, insbesondere im Ressort „Fernreisen und Containerdienste“ mit meinem Stab für die weitere Entwicklung des Unternehmens Sorge zu tragen - und entsprechend bei ministeriellen Stellen und Botschaften anderer Länder die Freiräume dafür zu schaffen. Am Stammtisch gab es durch unsere verschiedenen beruflichen Hintergründe reichlich Gesprächsstoff und die rein private Seite kam auch nicht zu kurz.
In der anschließenden Woche fand ich einen Zettel meines Sekretariats auf dem Schreibtisch. Eine Frau Emily Kube bäte um meinen Rückruf. Sie sei die Dame, mit der ich im Flieger von München gesessen hätte. Die Telefonnummer war ordentlich notiert.
„Wer ist die Dame, kennen wir die hier?“, fragte meine Sekretärin und es war zu spüren, dass sie Aufklärung erwartete. „Rein privat, danke, Miss Moneypenny“, sagte ich, jetzt wirklich gut gelaunt. „So, ich Moneypenny? Hören Sie mal, ich bin glücklich verheiratet!“, reagierte sie schnippisch. „Ist ja gut, dann bin ich ein Moneypenny“, sagte ich mit hoffentlich nicht so wahrnehmbarem unterdrückten Lachen. Ich rief Emily sofort an, bedankte mich für ihren Anruf und sagte gleich, dass wir besser nach Feierabend telefonieren, ich würde sie anrufen, gab ihr auch gleich meine private Telefonnummer. „Ja, bis heute Abend“, wurde wechselseitig bestätigt. Gegen neun rief ich sie an: Ich sei also der Herr Ulli Riediger, eröffnete sie das Gespräch. Sie bot mir das Du an. Dann erzählte sie, dass sie in München den verbliebenen Rest aus ihrer leergeräumten und gekündigten Mietwohnung eingepackt und die Übergabe an den Vermieter erledigt habe. Sie sei in München als Lehrbeauftragte an der „Akademie der Bildenden Künste München“ gewesen und werde nach einer kleinen Auszeit wieder in Köln tätig werden. Wohin ich denn noch mit dem Zug gefahren sei, wollte sie wissen, das hätte ich nicht gesagt und gefragt haben wollte sie das nicht. „Nirgendwo hin“, war meine Antwort, „ich wohne nicht weit vom Bahnhof in Bonn entfernt.“ Um mein Interesse an ihr zu untermauern, fragte ich sie, was denn ihren Koffer so schwer gemacht habe. „Specksteine waren das, modellierte Specksteine, kleines Abschiedsgeschenk von meinen Studenten, von Bildhauertalenten, es war Teil einer experimentellen Projektarbeit“, verriet sie. Dann kam das, was so gut wie immer kommt. „Und da wir ja gerade in einer Fragestunde sind …bist du verheiratet?“ „Bin ich nicht, ich war es“, sagte ich und merkte, dass sie das Interesse an mir untermauerte.
Ein neuer Termin für mich. Jetzt mal dort, wo zu atmen ist. Hamburg! Der Unterschied in Luftdruck und -feuchte macht sich nach einem so kurzen Flug sofort wohltuend bemerkbar. Ich war in einem Hotel in Rotherbaum untergebracht und ging an zwei Abenden, während der dreitägigen Besprechungen in der Zentrale meines Arbeitgebers, „Deutsche Chargeur Universel Aktiengesellschaft“, nahe St. Pauli-Landungsbrücken, eigene Wege, nahm nicht an den Abendessen im Kollegenkreis teil. Es wurden mir andere wichtige Termine zugetraut, deshalb konnte ich mich getrost abseilen. Mich zog es in die Milchstraße nach Pöseldorf. Dort die Suppen zu essen, im Gasthaus Goldstrand, ließ ich mir bei keinem der Termine in Hamburg nehmen. Die verschiedenen Toptschetas und die Tarators hatte ich alle durch, es fehlten mir noch mindestens zwanzig andere Suppen von der Karte. Ich genoss aber nicht nur die Gaumenfreuden. Der Inhaber des Lokals war mehr als mein Freund, ich möchte sagen, mehr als mein Bruder. Dem Bedienungspersonal war das nicht bekannt, ich wollte an diesem Ort nicht davon schwätzen. Der hier Verantwortliche war ein sympathischer und aufmerksamer Angestellter, ein schwarzhaariger großer Typ, sicherlich ein gut ausgebildeter Gastronom. Der Boss war hier noch nicht zu sehen. Der widmete sich anderen Dingen - und andere Unternehmen konnte er auch sein eigen nennen. Der Boss war Emis Maria Torýow. Wir hatten viel miteinander zu tun.
Emily und ich haben uns wiedergesehen. Wir verbrachten einen Sonntag im Volksgarten Köln. Es lenkte dort alles vom Alltäglichen ab. Wir konnten zum Besonderen kommen, gleichzusetzen mit Beschnuppern. „Du kennst also das Sauerland?“, knüpfte sie an das Gespräch, seinerzeit am Taxistand vor dem Flughafen in Köln-Bonn, an. Ich spulte ab, was mir aus eigenem Erleben heraus in den Sinn kam. „Ich bin dort auch schon herumgekurvt“, sülzte ich meinen Report runter.
Ich hätte einmal in noch jungen Jahren mit einem Freund ein Gespräch in einer „Altenaer Kunststofffertigung“ gehabt. Es ging um die Idee, ein Spielzeug produzieren zu lassen: Eine hohle und schön anzusehende bunte Scheibe, an verschiedenen Stellen so eingekerbt, dass sie „Musik macht“, wenn sie an elastischen Bändern in Rotation gebracht würde. Etwas für die Kinder, etwas für die Straße. Es hätten dadurch „Klick Klack“, „Hula Hoop“ und „Jo-Jo“ abgelöst werden können. Ich hätte uns schon als reiche Männer gesehen. Das sei aber schnell erledigt gewesen. Der Produktionsleiter erklärte, dass das Spielzeug mittels Spritzguss hergestellt werden müsse. Die Werkzeugaufsätze dafür würden in der Herstellung einen Millionenbetrag überschreiten. In Kierspe hätten wir dann übernachtet - zufällig an diesen Ort gelangt. Am Abend, in einer Kneipe, seien viele Männer in schwarzen Anzügen zu sehen gewesen. Am Tresen hätte ich gefragt, ob hier alle zu einer Beerdigung gehören würden. Wir wollten nicht stören. Der Wirt klärte auf, dass alle aus der Kirche kämen. Es wäre zur Predigt geladen worden, Mariä Heimsuchung, und zur Kirche ginge eben hier jeder im schwarzen Anzug. Am Tresen seien volle Pilsgläser in einer Halterung, über kleinen offenen Flämmchen, schräg hingehängt worden. Wir hätten sowas vorher noch nicht gesehen. „Ja, manche wollen ihr Bier da angewärmt, soll den Magen schonen“, warf sie ein, „ist aber schon längst in der Gastronomie verboten worden.“ „Ach so, Sauerland …ich war mal im Krankenhaus …bekam von einer Krankenschwester zur Gewährleistung einer besseren Nachtruhe ein Mittel auf den Nachttisch gelegt …habe dann nach ihr geklingelt …ihr gesagt, dass ich das „nicht runter kriege“. Ihre Stimme hatte sich dann überschlagen …in hellen Tönen und mit außergewöhnlich stark „rollendem R“ hat sie mir klar gemacht, dass das ein Zäpfchen sei und „rektal“ zugeführt werden müsste. Die war auch schwarz angezogen, mit einem langen Rock und mit einer weißen Schürze umgebunden …und eine strenge Frisur hatte die …ganz stramm hinten zu einem Dutt gemacht …die sah aus wie Olivia Oyl …dünn wie ein Spargel …die kam übrigens aus Olpe.“ Ein glatter Fehlschlag! „Du meinst also, wir Frauen sind da alle so?“, sagte sie deutlich mürrisch. „Nein, auf keinen Fall, du bist eine Ausnahme“, konterte ich, etwas hilflos geworden. „Aufpassen, aufpassen!“, dachte ich, sie ist sauer. Sauerland. Das würde passen. „Noch was von deinen Erlebnissen …?“, nutzte sie die etwas eingetretene Stille und forderte mich damit auf, doch noch weiter bei dem Thema Sauerland zu bleiben. Ich kam dem nach. Es wäre ja sonst still geblieben. Ich erzählte, dass ich mal anfänglich einen Chef hatte, der auch aus dem Sauerland war. Der habe als bornierter Katholik betont, dass er sich mit mir doch recht gut verstehe.
„Also, Sie als Westfale und ich als Sauerländer sind uns doch wohl einig“, habe der immer gesagt, wenn wir einen geschäftlichen Vorgang gemeinsam beurteilten. Der habe auch jeden Montag auf die Evangelischen geschimpft, weil die sogar am Sonntag in seiner Wohnstraße Autos waschen würden. „Ich habe übrigens eisern verschwiegen, dass ich auch evangelisch war und selbstverständlich auch, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin, ja, und auf Siegerländer hat er geschimpft, er sei froh, dass das Rothaargebirge die Sauerländer schützen würde, vor allem vor der Sprache, die hätten so was Amerikanisches auf der Zunge, was ihn abstoße“, erklärte ich.
Ich lud Emily in den Biergarten ein. Wir saßen dann gemütlich beieinander.
„Mal eine ungewöhnliche Frage“, sagte sie, „würdest du mich einmal zu Hause besuchen?“
Ich sagte sofort zu. Sie erklärte, nach einer gescheiterten Ehe wieder bei den Eltern im Haus zu wohnen und bald würde eine Feier stattfinden. Ein Onkel würde seinen Achtzigsten feiern und ihre Eltern würden für ihn ins Haus einladen, weil der selbst für die Ausrichtung einer Geburtstagsfeier nicht die Möglichkeiten habe und von einer Reservierung in einem Gasthaus absehen möchte, ihm sei Rummel in Gasthäusern und Kneipen zuwider. „Ich fühle mich geehrt, danke“, bekräftigte ich, „als was willst du mich den vorstellen?“, brachte ich noch schnell unter.
„Einfach als Freund, ich will da nicht solo sitzen, denn alle meine Schwestern und Cousinen haben Partner und die sind auch da, und übrigens, bei uns geht es auch ziemlich katholisch zu, ist auch nicht meine Sache, ich denke aber, du wirst das gut überstehen, scheinst ja robust genug zu sein“, offenbarte sie und fragte, woher ich denn eigentlich aus Westfalen käme.
„Münsterland, Grenze zu Holland, aus einer kleinen Ortschaft, Rübbelke.“
„Da bist du dann raus gekommen, in die weite Welt hinaus?“
„Ja, so wie du auch mal raus gekommen bist, Rübbelke war ja nicht ummauert, wir sind da alle weg, außer Oma und Opa, die sind geblieben.“
Schon so viele Jahre ist es her. Ich war in Bulgarien, in Nessebar. Ich hockte alleine oberhalb des Strandes zwischen strohigem Bewuchs. Mit Blick auf das Meer und dem sich schon angekündigten Sonnenuntergang befand ich mich nun in menschenleerer Umgebung. Ich hatte mir den „gemeinsamen Urlaub“ anders vorgestellt und deshalb die Schnauze voll, bin deshalb zurückgeblieben. Das mit mir und meiner Frau befreundete Ehepaar befand sich im Dauerstreit. Meine Frau mischte sich ständig ein, wohl um „sie“ zu unterstützen. Ich riet ihr, nicht nur einmal, davon ab und erntete dafür Uneinsichtigkeit, Widerstand, Sturheit. Deswegen ging ich nicht mit zurück in das Hotel und verzichtete auf das Buffet zum Abendessen. Ich überlegte, ob ich meine Koffer packen sollte.
Es war dann für mich nicht recht zu erkennen, was sich da unten zwischen den seichten Wellen bewegte. Ich hielt es für angespültes Holz oder von Kindern vergessene Schwimmreifen oder Wasserbälle. Dann sah ich ein Bild, das einem Gemälde gleichkam: Aus dem Meer erhob sich langsam ein Mann. Er watete, etwas wackelig, über den Unterwasserteppich aus Felssteinen an Land. An etwas hatte er aber seinen Halt gefunden. Dann kletterte neben ihm ein Pferd aus den Fluten, größer und größer zu sehen. Ich stellte an mir einen beschleunigten Herzschlag fest. Das war für mich Abenteuer, Märchen, Film. Der Mann führte das Pferd an der Mähne langsam den Strand hoch, direkte in meine Richtung. Ich ging diesem Gespann entgegen, wollte alles aus der Nähe sehen. Wir trafen aufeinander. Vor mir stand der schlanke und durchtrainierte Mann mit nacktem Oberkörper, einer durchnässten -, noch an seinem Bein klebenden rötlichen Hose aus dünnem Stoff. Seine Haare waren pechschwarz, schulterlang. Das Pferd mit üppiger Mähne hielt inne, stand dann als schwarz lackiertes Wunder neben ihm. Wir Männer sahen uns in die Augen. Nur kurz, dann setzte der Mann sich und sein Pferd so in Bewegung, dass sie an mir vorbei gehen konnten. Ich sah hinterher. Nach einigen Metern drehte der Mann sich um und hielt sein Pferd an. Er winkte mich mit nur einer Handbewegung heran. Als ich bei ihm war, hielt er mir ein Büschel von der langen Mähne des Tieres hin, eine Aufforderung, danach zu greifen. Ich umschloss diese Strähnen mit fester Hand und wusste dabei nicht, was zu erwarten war. Er ging dann etliche Schritte voraus, signalisierte mir, dass ich mit dem Pferd folgen möge. Es war für mich ein erhabenes Gefühl, dieses Pferd zu führen. Ich vergaß die Zeit, auch hatte ich keine Idee, wohin es jetzt gehen sollte. Ich sah, dass das Pferd ein Hengst war und wunderte mich, wie ruhig sich dieser Schöne verhielt. Ich folgte nun mit dem Rappen seinem Herrn, der sich nicht einmal mehr umdrehte, um zu sehen, ob ich noch in kurzem Abstand aufgeschlossen war. Erst nach einer halben Stunde war eine Siedlung oder auch ein Anwesen, nicht genau auszumachen, im Blickfeld. Der Mann drehte sich um, übernahm das Pferd wieder, nickte mir freundlich zu. Er drehte eine Hand fast unmerklich im Halbkreis und deutete in Richtung des Strandes. Bevor ich etwas sagen konnte, was nur auf Englisch oder Deutsch gegangen wäre, stand ich auch schon alleine da. Auf dem Weg ins Hotel deutete ich die Zeichen des Pferdebesitzers so wie „morgen, gleiche Stelle, gleicher Ort“. Ich würde hingehen, auch wenn ich das missverstanden haben sollte, es wäre ja nichts zu vergeben.
„Der Hengst ist ein Andalusier“, redete ich vor mich hin, „ganz sicher.“
Ich war auf dem Weg „zu dem Achtzigsten". In einer anheimelnden Wohnstraße fand ich die wohl letzte Lücke, um mein Auto zu parken. Ich hatte einen kleinen Biedermeierstrauß für die Dame des Hauses dabei und für Emily eine Geschenkbox. „Boarischer Genuss“. Die hatte ich vor dem Abflug aus München eigentlich für mich gekauft, aber ich verschenkte sie gerne. Ich trug wie so oft meinen legeren schwarzen Anzug, mit weißem Hemd und schwarzen Socken in schwarzen, fast geschlossenen Sandalen. Emily führte mich gleich in den Garten des Hauses. Sie hakte sich unter, während unseres Ganges über den Weg dorthin. Eine gewisse Mühe hatte sie schon, ihr Lachen zu verbergen.
„So fröhlich? Lachst du mich aus?“, fragte ich sie irritiert und noch rechtzeitig, bevor wir die Geburtstagsgesellschaft im schönsten Sonnenschein erreichten.
„Die halten dich für einen Geistlichen“, klärte sie mich auf, „aber keine Sorge, siehst toll aus.“