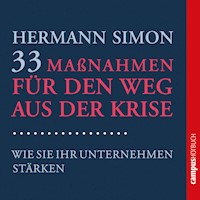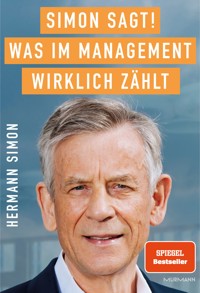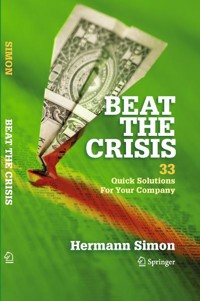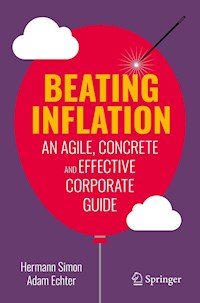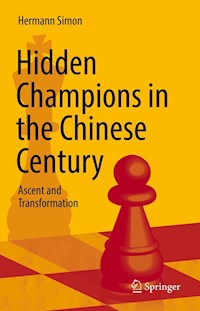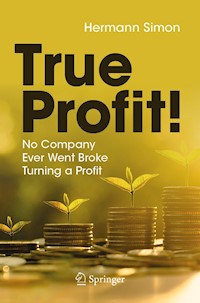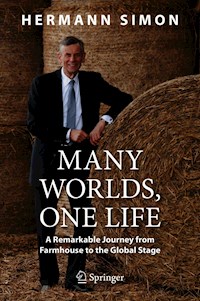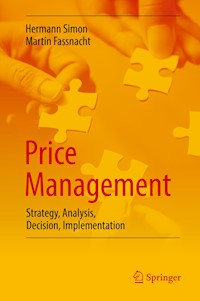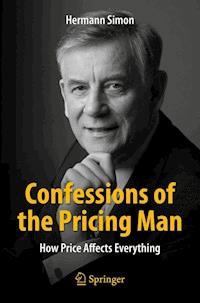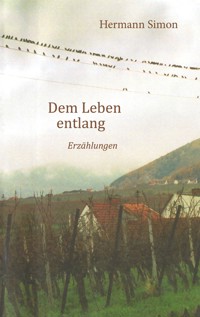
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem ruhigen schwedischen Dorf kehrt der erfahrene Seemann Lennart nach neun Monaten auf See zurück. Mit seinen Geschichten aus Asien und der Erinnerung an die geheimnisvolle Siri bringt er einen Hauch von Abenteuer in das beschauliche Leben der Dorfbewohner. Während sein Freund Simon von einem Ferienhaus am See träumt, enthüllt Lennarts Reise die Kontraste zwischen der Armut in fernen Ländern und den Wünschen der Menschen in der Heimat. ("Lennart, der Seemann") Diese und weitere 25 heitere und nachdenklich stimmende Erzählungen sind eine kleine Auswahl aus dem literarischen Schaffen des Paderborner Autors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Waltraut
Gefährtin meiner späten Jahre
Inhalt
Die Sache mit dem ersten Satz |
Wie ich zum Briefschreiber wurde |
Wie ein Kettenbrief zu eindringlicher Quasselei auswucherte |
Vulgär-Wörtern auf der Spur |
Wer keinem Reiseziel nachrennt, kann sich nicht verirren |
Die Verbal-Exhibitionistin |
Wie die Feste fallen |
Moni und Manni |
Ruhrpott-Mix |
Mama holt ihre Kindheit nach |
Bei 180 pfeift mein Schiebedach |
Meine dritte Absage |
Wie mir das Wörtchen „tack“ zum Kennzeichen einer Kultur wurde |
In Deutschland alles Schule? |
C’est rouge, Monsieur! |
Wie eine Bildrede in mir rumorte |
Telefonieren mit Marga |
Lennart, der Seemann |
Salzburger Vorstadt Numero 15 |
Von einem Friedhofsbesuch und vom Verschwinden der Freundin |
Glück im Unglück |
Hoffnungsvoll verrückt! |
Vom Zursprachekommen des im Kinde Schlummernden |
Die unvergessliche Bahnfahrt |
Ein Schicksalswort |
Ein Letztes |
Empfehlung
Um nach Hause zu gelangen,
öffnen wir nicht Türen,
sondern Buchdeckel.
Und bereiten einen Freiraum in uns,
wo Heimat sein kann.
Aus Lettland
Die Sache mit dem ersten Satz
Die meisten Schreiber vermeiden es, im Gespräch mit dem Leser über Textgestalt und Aufmerken erzeugende Situationen nachzudenken; wie kommt ein Leser leicht und interessiert in die Lektüre hinein und wird zum Weiterlesen angestachelt.
Der professionelle Vielleser Reich-Ranicki zitiert die ersten Zeilen des Romans „Die Blechtrommel“ von Günter Grass: „Zugegeben: Ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt, mein Pfleger beobachtet mich, lässt mich kaum aus dem Auge.“ Und er bekennt, dass diese Einleitung ihn vom Beginn an ins Zentrum des Romangeschehens gezogen habe.
Ein Autor macht jene Romanbetrachtung zur Einleitung in den Roman „Lewins Mühle“. Johannes Bobrowski beginnt so: „Es ist vielleicht falsch, wenn ich jetzt erzähle, wie mein Großvater die Mühle weggeschwemmt hat, aber vielleicht ist es auch nicht falsch. Auch wenn es auf die Familie zurückfällt.“ Und so fort bis zu dem Gipfel eines schriftstellerischen Skrupels, dass der Leser schon in den ersten Sätzen Verdacht schöpfen könnte, hinter welches Licht der Autor ihn zu führen sich anschicke. Doch an der Binsenwahrheit kommt auch Bobrowski nicht vorbei: einfach mit der Erzählung beginnen, sonst komme man zu nichts.
Bei einem Roman benötige ich 50 Seiten, bis die Entscheidung herangereift ist, die Lektüre zu beenden oder weiterzulesen. Dagegen schlägt mich eine Kurzgeschichte mit ihrem ersten Satz in ihren Bann. Ein Trompetenstoß wie dieser: „mit einem Erdbeben beginnen, um sich dann langsam zu steigern“ schießt wohl über jedes Ziel hinaus.
Über derartige Bedenken, wie eine Erzählung zu beginnen wäre, bin ich eingeschlafen. Mein Traum-Ich ließ keine Ruhe aufkommen, nahm den Faden auf und sah mich in der Rolle eines Lehrers, der eine Gruppe von Schreibschülern durch eine Aufgabe verlocken sollte, schlummernde Begabungen zum eigenständigen Schreiben hervorzukitzeln.
Immer noch träumend, suchte ich im Fundus der im Gedächtnis präsenten Literatur nach ersten Sätzen, die einen Leseimpuls vermitteln, also auch eine Erzählung in Gang bringen könnten, die auf dem Papier sich entfalten sollte.
Es tauchten drei erste Sätze auf, die ich nach dem Erwachen in den realen Büchern wiederfand und abschrieb:
„Lydia Sinclair war knapp siebzehn, als sie auf dem Besitz ihres Mannes in den Anden ankam“ (und dort ihr Irgendwo fand, wo sie hingehörte).
„Als ich elf war, habe ich mein (Spar-) Schwein geschlachtet und bin zu den Dirnen gegangen.“
„Ich bin jemand, den es immer wieder zu den Orten hinzieht, wo er früher gewohnt hat, zu den Häusern und ihrer Umgebung.“
Mein Traum-Ich erhob jene ersten Sätze zu Titeln noch schlummernder Geschichten und forderte meine Schreibschüler auf, zu einem Titel eine Erzählung zu schreiben, sei es aus der Erfahrung, sei es aus der Fantasie.
Alle schrieben. Als der letzte Stift auf der Tischplatte abgelegt war, stellte ich die kitzlige Frage: Wer möchte vorlesen? Ich blickte in die Runde der gesenkten Köpfe. Hat wohl wenig Anklang gefunden, sagte mein Traum-Ich.
Aber doch! Es schaute mich eine Schreiberin Kik an, schon ein wenig spitzbübisch. Dann bitte, lesen Sie, wir sind gespannt!
Ich bin Mutter eines Sohnes, der zwar lange schon die 11 Jahre überschritten hat; doch kann ich mir gut vorstellen, wie er sich mit 11 Jahren in jener Situation verhalten hätte, also lasse ich meine Fantasie mal von der Kette und lese:
Als mein Sohn Hannes 11 Jahre alt war, hat er sein Sparschwein geschlachtet und ist zu den Dirnen gegangen.
Aufregung kam im Dirnenhaus auf, als mein schmächtiger, kindlich wirkender Hannes den Empfangssalon betrat.
„Na, Kleiner, hast dich wohl verlaufen. Suchst du deine Mama? Oder weißt du bereits, wie man mit einem Mädchen spielt?“
„Will kein Mädchen, ich will eine Frau!“
„Schau dir den an! Weißt du denn schon mit einer Frau was anzufangen?“
„Als ob ich dir das erklären müsste.“
„Na dann! Ich führe dich zu einer sehr netten Dame, die auf deine Wünsche lieb eingehen wird. Sie ist etwas füllig, könnte wie deine Mutter sein.“
„Eine richtige Mutter?“
„Was verstehst du unter einer richtigen Mutter?“
„In einem dänischen Kinderbuch habe ich gelesen: Bei einer richtigen Mutter kann man sich unterstellen, wenn‘s regnet.“
„So was! Dann wirst du kaum enttäuscht werden bei uns.“
„Guten Tag, Madame, ich habe dir etwas mitgebracht.“
„Guten Tag! Du darfst mich Ines nennen.“
Hannes knotete sein Taschentuch auf und schüttelte den Inhalt auf den Tisch, Münzen und ein paar Scheine.
„Oh, wie ich sehe, hast du fleißig gespart. Wenn wir ins Geschäft kommen sollen, musst du mir deine Wünsche nennen.“
Hannes schwieg eine Weile. Er suchte nach einer passenden Antwort.
„Weißt du, heute ist wieder so ein grässlich heißer Tag. Mich gelüstet es nach einem Eis bei Signor Salvatore. Was meinst du dazu?“
„Oh ja, den kenne ich gut, wir dürfen ihn Onkel Salvatore nennen. Aber zuvor möchte ich dir ein Geschenk kaufen, Ines.“
Ines machte sich ein wenig frisch. Dann ging das ungleiche Paar durch die Fußgängerzone und steuerte auf ein Schuhgeschäft los.
„Guten Tag! Ich möchte für meine Freundin ein Paar Schuhe kaufen. Rote bitte! Es kommen nur rote in Frage, mit hohem Absatz.“
„In welcher Größe darf ich welche vorlegen?“
„37 oder besser 38. Die werden besser passen. Denn bei dieser Hitze schwellen meine Füße leicht an.“
„Dieses schlicht gehaltene Paar in Kirschrot dürfte Ihrem Gusto entsprechen.“
„Nicht nur meinem. Meinem kleinen Freund müssen sie ebenfalls gefallen!“
„Bin einverstanden! Die nehme ich.“
Hannes folgte der Verkäuferin zur Kasse.
„Die Schuhe ziehe ich sofort an. Meine Sandalen dürfen Sie mir bitte einpacken.“
Sie verließen das Schuhgeschäft. In beider Köpfe nahm der Eissalon von Signor Salvatore Kontur an.
„Du darfst mich bei der Hand führen, Hannes. Die neuen Schuhe wollen eingelaufen sein.“
„Ah, mein kleiner Freund besucht mich heute endlich mal wieder! Stellst du mir deine hübsche Mama vor?“
„Nicht doch, Signor Salvatore! Das ist meine Freundin, genau seit heute um 10 Uhr 45.“
Hannes gab immer dann eine exakte Antwort, wenn er erwachsen wirken wollte.
„Heute haben wir wieder alle Sorten vorrätig, Hannes, du darfst wählen, und den Geschmack deiner Mama kennst du ja.“
„Haben Sie was an den Ohren, Signor?“
„Entschuldige bitte, ist doch deine Freundin! Daran werde ich mich rasch gewöhnen können.“
Die beiden schwiegen und genossen den Wohlgeschmack von Eis, wie Signor Salvatore empfohlen hatte.
„Ich habe noch eine Arbeit im Haus zu erledigen. Also dann. Besuch mich öfter. Sooft du kommst, lade ich dich in den Eissalon von Signor Salvatore ein.“
„Zieh aber die roten Schuhe an, wenn du mit mir ausgehst.“
„Immer nur für dich, mein kleiner Freund!“
„Versprochen?“
„Versprochen!“
*
Als ich erwachte, meldete sich ein Versehen zu Wort. Ich hatte versäumt, meinen Schülern die Buchangaben mitzuteilen, damit ihnen die Quellen nicht vorbehalten sein sollten, aus denen jene ersten Sätze entnommen sind. Das will ich tagesbewusst nachholen:
Lisa St Aubin de Terán: „Hüter des Hauses“.
1996.
Eric-Emmanuel Schmitt: „Monsieur Ibrahim
und die Blumen des Koran“. 2001.
Truman Capote: „Frühstück bei Tiffany“. 2016
(Original 1958)
Der Traum schmeichelte mir: gut geträumt, alter Junge, es ging doch!
Das Tagesbewusstsein driftet mit mir voraus, wenn ich in der Schreibgruppe meinen Text lesen werde. Eine weibliche Spürnase wird dich stellen und mit ihrer Frage löchern: Sag mal, wer kümmert sich dann um die Bedeutung des letzten Satzes zum Abschluss eines Romans oder einer kurzen Erzählung?
Im Schnelldurchlauf begann ich meinen Speicher durchzukämmen. Schon bald meldete er mir zwei Treffer:
Der Roman „Meine sibirische Flickendecke“ von Tatjana Kuschtewskaja – die Kenntnis dieses Namens taugt kaum dazu, das Literaturwissen eines Gebildeten aufzuglänzen –, dem ein Epilog angeheftet ist, der zu der Frage veranlasst, ob die Autorin im Nachhinein eine Verstehenshilfe anböte. Weniger das, als sie für sich ihre Schreibweise reflektiert. Wenn sie den letzten Satz klar vor Augen habe, könne sie die thematisierten Begebenheiten darauf ausführen, das Erzählen laufe ihr unter dem Sog des Endsatzes leicht aus der Feder. Im Grunde wendet sie sich wie zur Verabschiedung an den Leser, indem sie ihm Teilhabe an der Mentalität des Baikalsees wünscht, von paradiesischer Natur verzaubert an einem guten Ort in Harmonie mit sich selbst.
Ganz und gar nicht zartfühlend mit der eigenen Schreibweise beendet der Isländer Jón Kalman Stefánsson eine Kurzgeschichte mit dem Titel „Was sich verändert“. Es geht um die Veränderung einer Toilette, genannt Plumpsklo, in eine Toilette mit Wasserspülung. Der Leser gewinnt leicht die Vorstellung, dass die Neuerung in Gestalt der lärmenden Druckspülung Unfrieden ins Haus bringt. Die Lockerung des althergebrachten Gespensterglaubens entzweit die Generationen. Die Kinder schließen nicht die Toilettentür, aus Furcht vor den sonst menschenfreundlichen Gespenstern, die den Unruhestiftern sich böswillig verändern. Der alte Großvater verdammt die Neumodigkeit und zieht den Dunghaufen hinter dem Schafstall vor, wie man es seit der Besiedlung Islands getan hat. Und unbehindert von Wetter und Wind in Kälte und Nässe.
Die Schwiegertochter hat die schwankenden Schritte des Greises zu stützen. Und so geschah es auch in einer Schneesturmnacht im tiefen Winter. Als sich der Alte aus der Hocke vom Dunghaufen erhebt, schreit er ein Triumphgebrüll, aus dem seine Begleiterin heraushört: „Zum Teufel noch mal, in meinem ganzen Leben habe ich nicht so prächtig geschissen!“
Das vulgäre Wort, das der Autor seinen Lesern nicht erspart, ist nur im letzten Satz der Begebenheit, steht wie ein Pfahl eingerammt zur Abwehr jeglicher Veränderung, die fortschrittlich oder modern daherkommt, steht fest als letztes Wort.
Unvorstellbar etwa? Nachzulesen ist der Satz von Jón Kalman Stefánsson in „Wortlaut Island“, 2000, S. 260.
Die in deutscher Sprache veröffentlichten Romane, gewebt aus der tief empfundenen Neigung der Isländer, „Etwas von der Größe des Universums“ (ein Romantitel) in sich zu tragen. Die Wortungsversuche spüren dem Unbegreiflichen nach, was Naturgewalten und die Sehnsüchte der Grenzüberschreitung in den Menschen wach hält. Folglich sind erste und letzte Sätze für einen isländischen Roman oder eine Erzählung ohne Bedeutung. Lediglich die Schriftform gebietet Textanfang und Textende, quasi wie das Leben nur als Ausschnitt eines großen Geschehens zu verstehen ist.
Wie ich zum Briefschreiber wurde
Der Anfang ist mir abgetrotzt worden. Nur widerwillig nahm ich den Bleistift in die Hand und schrieb: Ich lade Dich zu meinem Geburtstag ein.
Sieben Kleinbögen lagen vor mir, die mit der Einladung beschrieben werden sollten. Mutter war in dieser Sache unnachgiebig geblieben, nachdem ich schon einige Male Einladungen erhalten hatte, handgeschriebene und handgemalte. Die Druckbuchstaben torkelten in bunten Farben über die Blätter, die Ecken verziert, wie ich es im Poesiealbum meiner älteren Schwester gesehen hatte.
Zu meinem siebten Geburtstag sollte ich gleichfalls schriftlich einladen. Und tat, wie mir geheißen war: Ich lade Dich zu meinem Geburtstag ein, schrieb ich auf jeden Bogen. Ich begann sie zusammenzufalten, zum Austragen ins Briefformat zu bringen. Und wähnte, den Schreibkram hinter mich gebracht zu haben, als ich Mutters kritischen Blick im Nacken spürte. Ein angewöhntes Deutungsmuster mahnte mich: Sie will dir mit Einwänden kommen.
Den einfachen Mitteilungssatz nannte sie unfreundlich. Mir dagegen reichte der vollends aus. Sie forderte mich auf, erzählende Sätze hinzuzufügen, von der Art, was meine Gäste erwarten sollte, worauf sie sich freuen dürften. Mir fiel wenig an Zutaten ein, umso weniger, da ich von der Auffassung nicht lassen mochte, der Mitteilungssatz enthalte alles Wichtige, was für den Eingeladenen von Belang sei.
Also schrieb ich freundliche Ergänzungen. Welche, weiß ich heute nicht mehr, bis auf diesen kompletten Einladungsbrief:
Lieber Karlchen!
Ich lade Dich zu meinem Geburtstag ein. Von meinen Eltern wünsche ich mir einen Drachen. Dann können wir in den Herbstferien unsere Drachen gemeinsam steigen lassen.
Ich trug die sieben Briefe aus und bemühte mich, nicht gesehen zu werden, weil Briefträger ungesehen agierten. Ich war erleichtert. Für mich war die Briefschreiberei damit erledigt, endgültig Schluss und vorbei. Oder wenigstens für ein Jahr. Denn schon drohte die Vorfreude auf den Festtag zu veröden, weil es mir argwöhnte, die siebenfache Variation des einzig wichtigen Einladungssatzes wäre ein Trick, mittels dessen mir meine Schreibfaulheit mit abgenötigtem Schreibfleiß ausgetrieben werden sollte. Das Geburtstagsfest wäre demzufolge der Preis für meine Schreibmühe.
Nach Einwurf der Briefe legte sich mein Misstrauen bald. Es war geschafft. Der Festtag durfte wieder ungetrübt erwartet werden.
Doch wehe dem, der den Punkt schreibt und sich den absoluten Schluss dabei denkt! Das beabsichtigte Ende sollte sich als einen unerwarteten Anfang herausstellen.
Nach zwei Tagen lag ein Antwortbrief von Karlchen in unserem Hausbriefkasten. Er schrieb:
Lieber Hermann! Ich schreibe Dir heute einen Brief. Wann lässt Du Deinen Drachen steigen?
Karlchen hatte unsere Korrespondenz auch in formaler Hinsicht nach vorn entwickelt: das zusammengefaltete Blatt trug außen neben genauer Adresse und Absender oben rechts eine handgemalte Briefmarke, durch einen handgemalten Stempel entwertet als Beleg dafür, dass der Brief zur Zustellung angenommen worden war.
Karlchen war ein Jahr älter als ich und besuchte normenfolglich eine um einen Zähler höhere Volksschulklasse. Ein Zweit- und ein Drittklässler hatten also die Wechselseitigkeit des Briefschreibens entdeckt und versahen das Postwesen gleich mit.
Hernach verwandelte sich unser Hausbriefkasten in einen unvergleichlichen Anziehungspunkt. Werktäglich zur Postzeit zwischen 10 und 12 Uhr wurde er von mir in Fünfminutenabständen kontrolliert. In den so ereignisarmen Sommerferien trugen wir viele Briefe hinüber und herüber und hielten uns voreinander unentdeckt. Die Straße trennte unsere Häuserreihen, was uns in die Einbildung hineinsog, wir lebten auf getrennten Kontinenten. Ich schrieb also unverdrossen meine Antwortbriefe:
Lieber Karlchen! Ich schreibe Dir heute einen Brief. Wann lässt Du Deinen Drachen steigen?
Und von Karlchen erhielt ich jedesmal zur Antwort:
Lieber Hermann! Ich schreibe Dir heute einen Brief. Wann lässt Du Deinen Drachen steigen?
In unseren reibungslosen Postverkehr funkte meine Schwester hinein. Sie war einige Jahre älter als wir und besuchte bereits das Gymnasium. Sie fand unseren Briefwechsel ausnahmslos blöd. Und den ersten Satz völlig überflüssig. Der Empfänger sähe doch selbst, dass er einen Brief erhalte. Und zum zweiten, eine Frage mit gleichlautender Gegenfrage zu beantworten, führte zu rein gar nichts. Ein Brief, der als solcher gelten wollte, müsste eine Neuigkeit enthalten, die dem Empfänger bis zum Lesen unbekannt zu sein hätte.
Ich murmelte meine Zustimmung Sie war ja schließlich die Gymnasiastin im Haus.
Doch dass der Briefinhalt von solchem Gewicht wäre, kam mir wie eine absonderliche Idee vor. Und Karlchen wohl auch. Jedenfalls wechselten unsere Briefe mit dem standardisierten Inhalt tagtäglich hinüber und herüber, durch die Sommerferien hindurch. Es ging uns doch einzig darum, dass wir eine gerade entdeckte Wechselbeziehung, die Kontinente verband, in Gang hielten. Wir fanden unser Genügen daran, dass der Briefverkehr funktionierte. Unsere Entdeckerfreude verstanden wir vor jeder Besserwisserei zu schützen.
Die Zeit war uns nicht vergönnt, dass sich die Leere des Briefinhalts hätte bemerkbar machen können. Zwei Monate später verzog meine Familie. Die Frage nach dem Termin des Drachensteigens geriet ebenfalls außer Sichtweite. Geblieben ist die Freude am Zustandebringen einer Wechselbeziehung und am Überraschtwerden von Unerwartetem. Sie hat sich wie ein Sediment auf meinen Seelengrund abgelagert, von woher der Wunsch nach Briefverbindungen zu jeder Zeit in den darauffolgenden Jahrzehnten wieder auftauchen konnte.
Etwa 30 Jahre später führte mir ein Ereignis vor Augen, dass es Karlchen und mir um das Tun des Briefetauschens gegangen war, also rein um die Funktion und nicht um den Transport von Inhalten. Es wurde Pfingstgottesdienst gehalten für Kinder und Jugendliche unter freiem Himmel. Einzelne Wolken zogen rasch vorüber. Der Wind am Boden frischte böig auf. Der Altarraum wurde geschützt von einem Baldachin aus weißem Zeltstoff. Der Prediger legte sich ins Zeug, um den Kindern Pfingsten näher zu bringen. Er predigte lange. Einem Jungen viel zu lange. Er rief in das Wortgebrause hinein: „Sag doch mal, wie geht denn Pfingsten?!“
Da trat mir unser Unterfangen vor Augen, wie wir Sieben- und Achtjährigen entdeckt hatten, wie Post geht. Der kecke Fragesteller vom Pfingstgottesdienst schien mir im gleichen Alter zu sein und ebenso wie wir in die Welt eingelassen, herausfinden zu müssen, wie etwas geht.
Der Prediger reagierte nicht auf den Zwischenruf. In dem Moment, als die Lacher unter den Mitfeiernden sich beruhigten, fegte eine Windböe unter das Zeltdach und blies es zum Ballon auf. Ich konnte beobachten, wie die Erdnägel, die die Halteleinen an den Boden pressten, sich um zwei Handbreit hoben. Dabei wünschte ich mir, der Junge wäre zu seinem Pfingsterlebnis gekommen, wenn der Baldachin über dem Altarraum entschwebt wäre, mit dem Brausen des Pfingstwindes.
Ich hatte 7 Mal den Punkt hinter den Einladungssatz zu meinem 7. Geburtstag geschrieben. Aber das gereichte mir nicht zur endgültigen Beendigung der Briefeschreiberei. Es artete zu einer lebenslangen Korrespondenz aus. Bis dato.
Wie ein Kettenbrief zu eindringlicher Quasselei auswucherte
Jette Pedersen ist mir aus einer Kettenbriefbeteiligung geblieben. Unentwegte Briefmarkenfreunde weltweit hatten sich ein Forum geschaffen, um mit Tauschpartnern in Kontakt zu kommen: „The Forever Stamp Exchanger“. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, wenn die Kette weiterhin wie ein Spinnennetz über den Globus zieht, unbeschadet davon, dass sowohl Jette als auch ich an der Briefmarkensammelei ermüdet sind.
Diese Kette ist ausnahmsweise harmlos; sie greift dem Teilnehmer nicht ins Portemonnaie und spielt auch nicht Schicksal. An Kosten fallen lediglich die Portis an, um 50 gestempelte Briefmarken zu versenden, also Briefporto. Der Teilnehmer schicke seine Briefmarken an die erste Adresse auf der Liste, die nicht ausgestrichen ist, und streiche diese hernach aus. Den eigenen Namen mit Adresse positioniere man ans Ende der Liste und diene der Kettenwirkung, indem man mindestens fünf Kopien der Liste an Briefmarkenfreunde weitergibt. Das ist schon alles.
Und es funktioniert. Ich zum Beispiel erhielt meine erste Sendung von einem US-Soldaten von den Philippinen.
So meint man. Und so dachte ich auch. Wenn sich nur nicht weltverbreitete Geschwätzigkeit einmischte, persönliche Notizen auf Zettelchen zu kritzeln und dem an sich neutralen Kettenbrief beizuschmuggeln!
Die Partnerin auf meiner Liste, der ich mein Markenpäckchen zu schicken hatte, um hernach ihre Adresse auszustreichen, wie es das Reglement befahl, ging schon bald dazu über, mir zu Weihnachten die standardisierten Grüße zu senden: Glaedilig Jul og godt Nytår, Jette.
Im vorigen Jahr, es war fast noch November, schickte mir Jette zwei identische Weihnachtsgrußkarten, identisch bis zu den als Porto verwendeten Briefmarken. In einem Abstand von nur vier Tagen trafen die Briefe aus Dänemark ein.
Was tun? Meine Reaktion schmorte so die 14 Tage vor sich hin. Dann kam mir der lösende Einfall: Ich schickte Jette Pedersen an die Thorsgade im Norden von Kopenhagen gleichfalls zwei in allem identische Weihnachtsgrußkarten, und ebenfalls im Abstand von vier Tagen gab ich sie zur Post. Ob Jette die Anspielung bemerkte?
Der Vorgang ruhte bereits in den Vorkammern des Vergessens, da kam Post aus Dänemark. Gegen alle Erwartung lag ein langer Brief vor mir, mit der Schreibmaschine geschrieben. Als ob auch in Dänemark, wie beim unbeliebten Nachbarn Schweden, die Haustüren nach außen aufgingen, so legte Jette los: „Vor einiger Zeit habe ich zwei in allen Details gleiche Weihnachtsgrüße von Dir erhalten, und zwar in einem Abstand von nur vier Tagen. Ich sehe mich veranlasst, Dir zu sagen: Pass auf Dich auf! So hat es auch bei meinem Vater angefangen!“
Das Stichwort „Vater“ wirkte in der Briefschreiberin offenbar wie ein Auslöser, der einen hoch aufgetürmten Kieshaufen ins Gleiten bringt. Da rollten mir kleine und große Kiesel, mitunter ganze Brocken entgegen.
Hört nur zu, was Jette schrieb:
„Ich musste meine Mama aus dem Altersheim abholen. Denn Vaters Aggressivität hatte sich bis zu der Grenze gesteigert, wo man sein Verhalten Mama gegenüber leider gewaltsam nennen musste.
Und Glück im Unglück! Ich fand bald schon einen Platz für Mama auf einer kleinen Insel. Es gibt dort nur wenige Autos, und die müssen Schritt fahren. Die Bewohner des Seniorenheimes und einer psychiatrischen Einrichtung können sich völlig frei auf der Insel bewegen. Mama fühlte sich vom ersten Augenblick an dort wohl.
Vater bleibt in dem ehemals gemeinsamen Seniorenheim im Norden von Kopenhagen. Er scheint Mama nicht zu vermissen. Er besteht darauf, dass ich ihn jeden Sonntagnachmittag besuche, wie es sich für eine einzige Tochter schicke. Zu Mama fahre ich, wenn ich es an einem Samstag einrichten kann. Ich darf dann die Fähre nicht verpassen. Das fällt mir bei meinem angeschlagenen Organisationstalent nicht leicht.
Mit Mama führe ich Gespräche über gegenwärtige Verhältnisse, die uns angehen. Vater dagegen setzt jedes Mal neu an, mit mir unsere Familiengeschichte aufzuarbeiten. Im deutschdänischen Krieg 1864, als um die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg gekämpft wurde, hat auch ein Mats Pedersen teilgenommen. Der war Berufssoldat und hatte sich 12 Jahre lang dem harten Training unterworfen: Schanzen, Exerzieren, Handhabung der Waffen und Fechten für den Nahkampf. Bis es zur entscheidenden Schlacht kam.
Der Korporal Pedersen stieß auf einem Erkundungsgang auf einen Preußen. Der zog den Säbel und nötigte dem Dänen ein Gefecht auf. Pedersen bemerkte bereits nach den ersten Attacken, dass der Preuße schlecht focht. Nachdem dieser wiederholt seine Deckung vernachlässigt hatte, packte Pedersen die Wut: Was? Für so eine Stümperei hätte er 12 Jahre geübt? Nicht mit Pedersen! Er fintierte, fasste den Säbel mit beiden Händen und hieb von schräg oben dem Gegner den Kopf herunter. Eigentlich schade um den Jungen in Preußens Galauniform, hätte Pedersen gedacht. Aber wer sein Handwerk nicht ordentlich gelernt hat, darf sich halt nicht so weit vorwagen, schlussfolgert Vater.
Und dieser Mats Pedersen ist unser Urahn, Jette! In dir steckt eine Pedersen, Jette. Vergiss das dein Leben lang nicht! Denke stets daran und lass dir von schöntuenden Fatzken nichts vormachen. Jette, du bist und bleibst eine Pedersen!
So kann Vater dranbleiben. Sonntagnachmittage lang.
Bis zum Überdruss kenne ich nun schon die ellenlange Aufzählung der Helden, Seefahrer und Kaufleute, die nach Vaters Darstellung die Familie Pedersen im Laufe ihrer Geschichte hervorgebracht haben soll.
Bei einem Besuch im Frühjahr unterbrach ich Vaters familiengeschichtlichen Monolog:
Vater, ich möchte dir eine nette Neuigkeit erzählen. Freddi, mein Jugendfreund, ist überraschend aufgetaucht. Nach 21 Jahren auf den Weltmeeren. Er wolle sich nun eine Arbeit an Land suchen. Mit einem Schiffsausrüster in Kopenhagen sei er in ein Bewerbungsgespräch eingetreten.
Bis zur Entscheidung darüber wohnt Freddi bei mir. Stell dir vor! Wir sind verliebt wie damals, als ob zwei Jahrzehnte der Trennung unserer Liebe nichts anhaben konnten.
Ist das der Strick, der unsere Hühnernester zu kontrollieren pflegte und zur Rede gestellt stotterte, er wollte in absehbarer Zeit um deine Hand anhalten, sobald er eine Arbeit gefunden hätte?
Genau das ist er, mein Freddi! Er ist der nette Junge von damals geblieben.
Der Hund ist nicht das Pulver wert, mit dem ich ihn erschießen sollte, wenn du mich nicht hier eingesperrt hättest! Kein Wunder, dass Mama bereits getürmt ist. Dann ist er also in das Schwalbennest zu dir gekrochen, unter die Dächer in der Thorsgade?
Nein, wir konnten in eine größere Wohnung umziehen, in die dritte Etage!
In die dritte? Na ja, so verhält sich das.
Das reicht auch hin. Du weißt, was du zu tun hast. Du bist eine Pedersen, vergiss das nicht, Jette.
Ich war empört und strafte Vater damit, dass ich ihn an den folgenden Sonntagen nicht besuchte.
Ich fühlte mich seit Langem erstmals wieder rundherum zufrieden, wir drei in unserer behaglichen Wohnung. Freddi hatte seinen Hund, einen Terriermischling, mitgebracht. Der hörte auf den Namen ‚Das Vieh‘, dänisch ‚faeet‘, was der Hund den Menschen jedoch nicht übel nahm. Ich fühlte, dass das Tier mich sofort ins Herz geschlossen hatte.
Als Freddi drei Nächte in Folge nicht nach Hause kam und als das Vieh mich am 4. Morgen mit drei Welpen überraschte, war die Sache klar. Rasend gern hätte ich mit einem Elchstutzen hinter ihm her geschossen. Aber bedauere, ich bin nur eine verspätete Pedersen.
Enttäuschung und Wut wühlten in mir. Ich war dabei, jede Fassung zu verlieren. Da traf mich der Blick bettelnder Hundeaugen. Ich streichelte dem Vieh über den Kopf und redete auf die junge Mutter ein: Nein, ich jage dich nicht fort auf die Straße hinter dem verlausten Freddi her. Wir sorgen uns gemeinsam um deine prächtigen Welpen, ziehen sie groß und finden ein Zuhause für sie. Was meinst du dazu, Vieh?
Noch nie zuvor habe ich in so dankbare Augen geschaut. Sie gaben mir zu verstehen, worauf es im Leben ankommt.
Freddis Gerümpel, vornehm Hausrat genannt, zu beseitigen, hat mich zwei Monate gekostet. Meinen Keller und meinen Abstellplatz auf dem Dachboden hat er mir vollgemüllt, ohne dass ich etwas davon bemerkt hatte. Einige brauchbare Dinge habe ich vors Haus gestellt und mit einem Schild versehen: Bitte mitnehmen!
Ich wusste bereits, dass ich in dieser Wohngegend von Idioten umzingelt war, aber müssen die sich auch noch wie Analphabeten benehmen?
Frau Pedersen, das war nicht vereinbart! Schauen Sie sich doch Ihren Müllabladeplatz an!
Ich dachte bei mir, der alte Hektiker von Hauswart übertreibt mal wieder. Das kennen wir zu Genüge. Aber was ich da zu sehen bekam, spottet jeder Beschreibung. Als ob ganz Nørrebro auf den Stichtag hin seine Rumpelkammern geleert hätte! Fahrradwracks die Menge, ein Elektroherd, Fernseher, Plastikzeugs in Unmengen, ein halber Kleiderschrank, Bettgestelle und als krönender Abschluss eine verpinkelte Matratze.
Hier musste schnell gehandelt werden. Ich hängte mich ans Telefon. Die erste Entrümpelungsfirma, die ich an den Apparat bekam, lehnte entrüstet ab: Thorsgade, sagen Sie das noch einmal, die Straße liegt doch in Nørrebro, wo die Leute wie wild demonstrieren. Unser Wagen ist dort einmal in einen Umzug hineingeraten. Zwei Reifen wurden zerstochen. Nein danke! Uns reicht‘s!