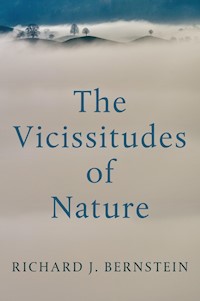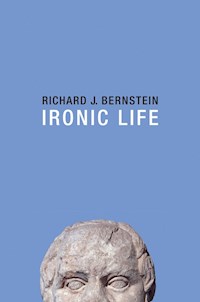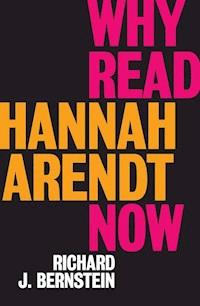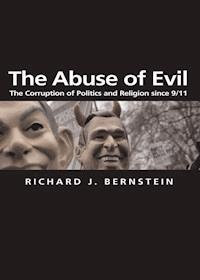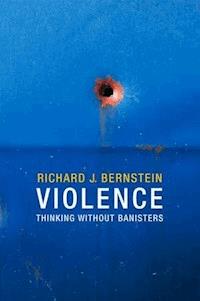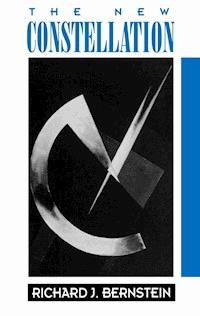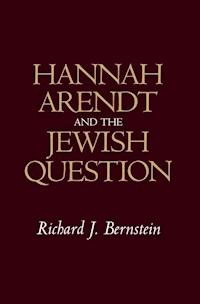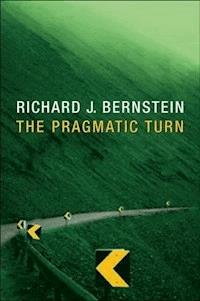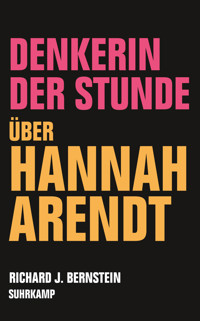
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum Hannah Arendt die Denkerin der Stunde ist.
»Ein wunderbares Buch.« Jerome Kohn
»Begreifen«, schreibt Hannah Arendt in ihrem Hauptwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, bedeute, »sich aufmerksam und unvoreingenommen der Wirklichkeit zu stellen, was immer sie ist oder war«. Zur Lebenswirklichkeit der 1906 geborenen Arendt gehörten Antisemitismus und Gestapo-Haft ebenso wie Flucht, Staatenlosigkeit und die Erfahrung, von der US-Regierung systematisch über den Vietnamkrieg belogen worden zu sein. 45 Jahre nach ihrem Tod gehören zu unserer Gegenwart die schrecklichen Zustände in Flüchtlingslagern auf Lesbos oder in Libyen, der Aufstieg autoritärer Bewegungen und ein US-Präsident, der selten die Wahrheit sagt.
»Liest man Hannah Arendt heute«, so Richard J. Bernstein, »überkommt einen ein fast schon unheimliches Gefühl zeitgenössischer Relevanz.« Bernstein, der Arendt als junger Professor noch selbst kennengelernt hat, bietet anhand zentraler Themen einen kompakten Überblick über das Denken der Theoretikerin und zeigt, inwiefern ihr Werk die heutigen finsteren Zeiten erhellen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Denkerin der Stunde
Über
Hannah Arendt
Richard J. Bernstein
Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn
Suhrkamp
Für Jerry Kohn
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Einleitung
Staatenlosigkeit und Flüchtlinge
Das Recht, Rechte zu haben
Loyale Opposition: Arendts Kritik des Zionismus
Rassismus und rassistische Segregation
Die Banalität des Bösen
Wahrheit, Politik und Lüge
Pluralität, Politik und öffentliche Freiheit
Die Amerikanische Revolution und der revolutionäre Geist
Persönliche und politische Verantwortung
Danksagung
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Einleitung
Als Hannah Arendt im Dezember 1975 starb, kannte man sie in erster Linie wegen der Kontroverse um ihren Bericht über den Prozess gegen Adolf Eichmann und wegen des Schlagworts von der »Banalität des Bösen«. In den Vereinigten Staaten und in Deutschland gab es einen Kreis von Bewunderern und Kritikern, die auch ihre anderen Schriften studiert hatten, doch sie galt nicht wirklich als bedeutende politische Denkerin. In den Jahren seit ihrem Tod hat sich dieses Bild grundlegend geändert. Ihre Bücher wurden in Dutzende Sprachen übersetzt. Überall auf der Welt interessieren sich Menschen leidenschaftlich für ihr Werk. Schier endlos scheint die Menge an Büchern, Konferenzen und Artikeln zu sein, die sich mit Hannah Arendt und ihren Ideen beschäftigen. In jüngerer Zeit gab es eine ganze Flut an Diskussionen über Arendt und Verweise auf sie in den sozialen Medien. Woher rührt dieses wachsende Interesse – und warum interessiert man sich gerade in letzter Zeit besonders für ihr Werk? Arendt war ausgesprochen empfindsam für einige der tiefgreifendsten Probleme, Wirrungen und gefährlichen Tendenzen im modernen politischen Leben. Viele davon sind keineswegs verschwunden, sondern haben sich im Gegenteil noch verstärkt und sind noch gefährlicher geworden. Wenn Arendt von »finsteren Zeiten« sprach, dann meinte sie damit nicht ausschließlich die Schrecken des Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Sie schreibt:
Falls es die Funktion des öffentlichen Bereichs ist, Licht auf die menschlichen Angelegenheiten zu werfen – durch Bereitstellung eines Erscheinungsraumes, in dem die Menschen mit Taten und Worten, zum Guten oder Schlechten, zeigen können, wer sie sind und was sie tun können –, so ist es dunkel, wenn dieses Licht gelöscht wird von »Glaubwürdigkeitslücken« und »unsichtbarer Herrschaft«, von einer Rede, die das, was ist, nicht offenlegt, sondern unter den Teppich kehrt, von moralischen und sonstigen Ermahnungen, die unter dem Vorwand, alte Wahrheiten hochzuhalten, jede Wahrheit in bedeutungslose Trivialität verwandeln.1
Man kann sich nur schwer der Schlussfolgerung verweigern, dass wir heute in finsteren Zeiten leben, die die ganze Welt verschlingen. Arendt behauptet jedoch auch, dass wir selbst in den finstersten Zeiten darauf hoffen können, irgendeinen Lichtschimmer zu entdecken – ein Licht, das weniger Theorien und Begriffen entspringt als vielmehr dem Leben und der Arbeit von Individuen. Ich möchte zeigen, dass Arendt für solche Erhellung sorgt, dass sie uns dabei hilft, einen kritischen Blick auf unsere gegenwärtigen politischen Probleme und Turbulenzen zu werfen. Sie ist eine scharfsinnige Kritikerin gefährlicher Entwicklungen im modernen Leben, und sie macht deutlich, welche Möglichkeiten es gibt, die Würde der Politik wiederherzustellen. Aus diesem Grund lohnt es sich, sie heute immer und immer wieder zu lesen.
Wer aber ist diese Hannah Arendt? Beginnen möchte ich mit einem kurzen Abriss einiger zentraler Stationen ihres Lebens, die ihr Denken prägten. Sie selbst fand Gefallen an Machiavellis Anrufung der Göttin Fortuna (die für das »Glück«, das »Schicksal« oder auch die »Kontingenz« steht). Das Schicksal kann es, wie wir wissen, gut oder schlecht meinen. Anders als ihr enger Freund Walter Benjamin, der immer vom Unglück verfolgt zu sein schien und schließlich Selbstmord beging, war Arendts Fortuna ihr in den entscheidenden Momenten des Lebens gewogen. Geboren 1906 in eine säkulare deutsch-jüdische Familie, wurde sie zu einer herausragenden Vertreterin einer begnadeten Generation deutsch-jüdischer Intellektueller. In den frühen zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts studierte sie bei den bedeutendsten Philosophen und Theologen Deutschlands, unter anderem bei Edmund Husserl, Martin Heidegger, Karl Jaspers und Rudolf Bultmann. Angesichts des bedrohlichen Aufstiegs der Nationalsozialisten und ihres rabiaten Antisemitismus entschloss sich Arendt dazu, ihren zionistischen Freunden zu helfen, indem sie die antisemitische Propaganda der Nazis eingehend erforschte. 1933 wurde sie festgenommen und acht Tage lang verhört. Sie weigerte sich, zu verraten, woran sie arbeitete, wurde schließlich aber wieder freigelassen. Das war außerordentliches Glück, denn wie wir wissen, wurden viele andere unter ähnlichen Umständen in den Kellern der Gestapo ermordet.
Daraufhin beschloss Arendt, Deutschland auf illegalem Wege zu verlassen. Sie emigrierte in die Tschechoslowakei und gelangte von dort nach Paris – Zufluchtsort für viele Juden, die vor den Nazis flohen. 18 Jahre lang war Arendt offiziell staatenlos, bis sie amerikanische Staatsbürgerin wurde. Das ist der Hauptgrund dafür, dass sie für die Not der Staatenlosen und den bedrängten Status von Flüchtlingen so sensibel war. Illegale deutsche Exilanten in Paris standen vor dem Problem, dass sie über keine offiziellen Papiere verfügten, die ihnen eine Arbeitserlaubnis verschafft hätten, weshalb viele ein extrem prekäres Leben führten. Arendt hatte das Glück, bei verschiedenen jüdischen und zionistischen Organisationen Beschäftigung zu finden, unter anderem bei der Jugend-Alijah – der Organisation, die gefährdete junge Juden aus Europa nach Palästina schickte. In Paris lernte sie Heinrich Blücher kennen, der einer nichtjüdischen deutschen Familie entstammte, am Spartakusaufstand teilgenommen hatte und Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands gewesen war. 1940 heirateten sie. Im Mai 1940, kurz vor dem deutschen Einmarsch in Frankreich, ordneten die französischen Behörden an, alle »feindlichen Ausländer« zwischen 17 und 55 Jahren in Internierungslager zu stecken. Arendt kam nach Gurs, ein Lager im Süden Frankreichs nahe der spanischen Grenze. In einem längeren Artikel, den sie kurz nach ihrer Ankunft in New York verfasste, verwies sie ironisch auf einen neuen Menschentyp, der durch die Zeitgeschichte entstanden sei – »Menschen, die von ihren Feinden in Konzentrationsläger und von ihren Freunden in Internierungsläger gesteckt werden«.2 Arendt gelang es, in der kurzen Zeit, als die Nazis Frankreich überfielen, aus dem Lager Gurs zu fliehen. Viele der Frauen, denen die Flucht nicht glückte, wurden schließlich auf Befehl von Adolf Eichmann nach Auschwitz deportiert. Während der Internierung war Arendt von ihrem Mann und ihrer Mutter getrennt worden. Sie hatte erneut Glück, denn es gelang ihr, sich wieder mit ihnen zu vereinen – erneut dank einer Reihe glücklicher Zufälle.
Nunmehr bestand die Herausforderung darin, als staatenloser, illegaler deutsch-jüdischer Flüchtling einen Weg aus Europa heraus zu finden. Arendt stand dabei vor einem doppelten Problem: Wie sollte sie an ein Visum für die USA kommen und wie sollte sie es von Frankreich aus nach Portugal schaffen, um von dort aus ein Schiff nach New York zu nehmen? Es gibt beklemmende Parallelen zwischen den kafkaesken Schwierigkeiten, die europäische Juden erlebten, und den horrenden Hindernissen, die muslimische Flüchtlinge aus Syrien heute überwinden müssen, wenn sie auf legalem Wege in die USA gelangen wollen. In beiden Fällen schlugen bzw. schlagen diesen Flüchtlingen enormes Misstrauen und Feindseligkeit entgegen und sie haben mit äußerst strengen Visaregelungen zu kämpfen. Erneut hatte Fortuna ihre Hand im Spiel (es hat fast den Anschein, als sei Arendt von dieser Göttin beschützt worden). Hannah und Heinrich bekamen Visa über Varian Fry, den Leiter des Emergency Rescue Committee in Marseille. Sie entgingen der französischen Polizei, die nach ihnen suchte, und flohen aus Frankreich über Spanien nach Lissabon, wo sie drei Monate auf ein Schiff warteten, das sie in die Vereinigten Staaten brachte. Im Mai 1941 trafen Arendt und ihr Mann in New York ein, einen Monat später kam auch Hannahs Mutter dort an.
Rückblickend erkennen wir, wie viel Glück Arendt hatte, wie sehr zufällige Ereignisse den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuteten. Sie hätte während ihres Verhörs in Berlin umgebracht werden können. Es hätte sein können, dass ihr die Flucht aus Gurs nicht gelungen und sie letztendlich nach Auschwitz gebracht worden wäre. Es hätte sein können, dass sie kein Visum erhalten hätte und wie so viele Juden in Frankreich gestrandet und dann in ein deutsches Konzentrationslager deportiert worden wäre. Als Arendt in New York eintraf, war sie 35 Jahre alt und konnte kaum Englisch. Ihre Muttersprache war Deutsch, und sie hatte diese Sprache immer geliebt, insbesondere die deutsche Dichtung. Vor 1941 war sie noch nie in einem englischsprachigen Land gewesen. Trotzdem machte sich Arendt daran, die Sprache zu lernen. Unterstützt von Freunden, die ihr dabei halfen, ihre Texte auf Englisch zu verfassen, begann sie, Artikel in lokalen jüdischen Periodika zu veröffentlichen. Sie fand Arbeit bei jüdischen Organisationen, unter anderem bei der Commission on European Jewish Cultural Reconstruction, und sicherte sich einen Posten als Lektorin im Schocken-Verlag.
1944 schickte sie das Exposé für ein Buch, das sie schreiben wollte, an den Verlag Houghton Mifflin. Sie nannte es »Elemente der Schande. Antisemitismus – Imperialismus – Rassismus«. Die nächsten vier Jahre arbeitete sie intensiv an diesem Buch. Was thematische Bandbreite und Inhalt anging, änderte sie mehrfach ihre Meinung. Erst relativ spät während des Schreibprozesses beschloss sie, den Fokus zu wechseln und sich mit dem Totalitarismus zu befassen. 1951 erschien schließlich The Origins of Totalitarianism, ein Buch mit mehr als 500 eng bedruckten Seiten (die von Arendt überarbeitete und daher mit dem englischen Original nicht identische deutsche Ausgabe erschien 1955 unter dem Titel Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft). In seiner endgültigen Form bestand das opulente Werk aus drei Hauptteilen: Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft. Es wurde denn auch sofort als wichtiger Beitrag zur Totalitarismusforschung anerkannt. Tatsächlich führt der Titel etwas in die Irre, denn man könnte annehmen, Arendt liefere eine historische Darstellung der Ursprünge und Ursachen des Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Doch Arendt verfolgte ein ganz anderes Projekt. Sie wollte den disparaten »unterirdischen Strömungen« nachspüren, die sich in der fürchterlichen Originalität des Totalitarismus »kristallisierten«. Wie bei all ihren größeren Schriften war die Rezeption der Elemente und Ursprünge kontrovers – und ist es bis heute geblieben. Trotzdem etablierte sie sich mit diesem Buch als wichtige politische Denkerin. In den folgenden 25 Jahren veröffentlichte Arendt weitere provokative Bücher und Aufsatzsammlungen: The Human Condition (1958, dt. 1960 unter dem Titel Vita activa oder Vom tätigen Leben), Rahel Varnhagen: The Life of a Jewess (1958, dt. 1959 unter dem Titel Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik), Between Past and Future (1961, dt. erst 1994 als erweiterte Aufsatzsammlung unter dem Titel Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I), Eichmann in Jerusalem (1963, dt. 1964), On Revolution (1963, dt. 1965 unter dem Titel Über die Revolution), Men in Dark Times (1968, dt. erst 1989 unter dem Titel Menschen in finsteren Zeiten), On Violence (1970, dt. im selben Jahr unter dem Titel Macht und Gewalt), Crises of the Republic (1971, dieser Band wurde in dieser Form nie ins Deutsche übertragen) sowie (posthum) The Life of the Mind (1978, dt. 1979 unter dem Titel Vom Leben des Geistes). Seit ihrem Tod wurden und werden weiterhin zahlreiche unveröffentlichte Manuskripte von ihr publiziert. Ich will hier keinen Überblick über ihr Werk geben, sondern mich auf zentrale Themen konzentrieren, die für die Probleme und Wirrungen, mit denen wir es heute zu tun haben, von Relevanz sind. Ich möchte zeigen, warum wir Hannah Arendt heute lesen sollten – inwiefern ihr Leben und ihr Werk die heutigen finsteren Zeiten erhellen können.
Staatenlosigkeit und Flüchtlinge
Wie abstrakt unsere Theorien auch klingen oder wie überzeugend unsere Argumente erscheinen mögen: Ich habe immer geglaubt, daß dahinter Ereignisse und Geschichten stehen, die zumindest für uns die volle Bedeutung dessen, was wir da zu sagen haben, in nuce enthalten. Das Denken selbst – sofern es mehr ist als eine technische, logische Operation, die elektronische Maschinen weit besser ausführen können als das menschliche Gehirn – erwächst aus der Aktualität von Begebenheiten; Momente lebendiger Erfahrung müssen seine Anhaltspunkte bleiben, wenn es sich nicht verlieren soll in den Höhen, zu denen das Denken aufsteigt, oder in den Tiefen, in die es hinabsteigen muß.3
Diese Passage macht ein grundlegendes Merkmal von Hannah Arendt als politischer Denkerin deutlich. Sie war der Ansicht, seriöses, ernsthaftes Denken müsse in der eigenen gelebten Erfahrung gründen. Arendts primäre Erfahrung in der Zeit, als sie aus Deutschland entkam, aus Frankreich floh und nach New York gelangte, war die eines staatenlosen deutsch-jüdischen Flüchtlings. Hätte Arendt keine Unterstützung von Flüchtlingsorganisationen bekommen, hätte sie kein Visum und keine finanzielle Unterstützung erhalten, um in die USA reisen zu können. Als sie in New York eintraf, wurde sie von Hilfsorganisationen in bescheidenem Maße dabei unterstützt, dort heimisch zu werden. Ihr ganzes Leben lang waren viele von Arendts engsten Freunden ebenfalls Flüchtlinge, die vor den Nazis geflohen waren. Ihre gelebte Erfahrung als staatenloser Flüchtling prägte ihr frühestes Denken in Paris und New York. Wie Arendt berichtet, war sie sich als Kind ihres Jüdischseins kaum bewusst. Doch in den zwanziger Jahren erfuhr sie die Bösartigkeit des nationalsozialistischen Antisemitismus am eigenen Leib. In einem Fernsehgespräch mit Günter Gaus, in dem sie über diese Zeit in ihrem Leben sprach, sagte sie: »Ich gelangte zu einer Erkenntnis, die ich damals immer wieder in einem Satz ausgedrückt habe, darauf besinne ich mich: ›Wenn man als Jude angegriffen ist, muß man sich als Jude verteidigen.‹ Nicht als Deutscher oder als Bürger der Welt oder der Menschenrechte oder so.«4
In den dreißiger und vierziger Jahren beschäftigten sich ihre Schriften überwiegend mit der Judenfrage und dem Zionismus. Sie wurde regelmäßige Kolumnistin der deutsch-jüdischen Zeitung Aufbau, die in New York erschien und vor allem von anderen deutsch-jüdischen Exilanten gelesen wurde. Mit Feuereifer plädierte sie für die Schaffung einer internationalen jüdischen Armee, die Hitler bekämpfen sollte – und zwar noch bevor die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten. 1943, gerade einmal zwei Jahre nach ihrer Ankunft in New York, veröffentlichte sie in einer etwas entlegenen jüdischen Zeitschrift den Essay »We Refugees« (»Wir Flüchtlinge«). Sie schrieb über dieses Thema höchst kenntnisreich, witzig, ironisch und doch auch zutiefst melancholisch. Gleich zu Beginn des Artikels erklärt sie: »Vor allem mögen wir es nicht, wenn man uns ›Flüchtlinge‹ nennt. Wie selbst bezeichnen uns als ›Neuankömmlinge‹ oder ›Einwanderer‹.«5 Einst sei ein Flüchtling jemand gewesen, der aufgrund irgendeiner Tat oder einer politischen Überzeugung gezwungen war, Zuflucht zu suchen. Das aber habe sich geändert, denn die meisten derjenigen, die flohen, hätten nicht einmal im Traum daran gedacht, radikale Ansichten zu vertreten. Arendt erklärt, sie seien nicht wegen irgendetwas, was sie gesagt oder getan hätten, zur Flucht gezwungen gewesen, sondern, weil die Nazis sie alle als Angehörige der jüdischen Rasse dazu verdammt hätten. »Mit uns hat sich die Bedeutung des Begriffs ›Flüchtling‹ gewandelt. Von nun an sind ›Flüchtlinge‹ Menschen, die das Pech hatten, mittellos in einem neuen Land anzukommen und auf die Hilfe der Flüchtlingskomitees angewiesen zu sein.«6 Viele Flüchtlinge würden so tun, als seien sie optimistisch, und hofften, sich in einem neuen Land ein neues Leben aufbauen zu können. Arendt spottet über die Absurditäten des Bemühens, sich in einem neuen Land möglichst schnell anzupassen, und erzählt die Geschichte von einem deutschen Juden, der wie sie nach Frankreich geflohen war. Kaum dort angekommen, »gründete er einen dieser Anpassungsvereine, in welchen deutsche Juden sich wechselseitig versicherten, dass sie schon Franzosen seien. In seiner ersten Rede sagte er: ›Wir sind in Deutschland gute Deutsche gewesen, und deshalb werden wir in Frankreich gute Franzosen sein.‹ Das Publikum applaudierte begeistert, und keiner lachte; wir waren glücklich, dass wir gelernt hatten, unsere Loyalität unter Beweis zu stellen.«7 Doch die traurige Wahrheit, so Arendt, sei, dass wir unser Zuhause, unseren Beruf und unsere Sprache verloren hätten. Wir haben viele Familienangehörige und Freunde verloren, die in Konzentrationslagern ermordet wurden. Wir bekamen den »freundlichen Rat«, zu vergessen und nicht über den vergangenen Schrecken zu reden. Niemand will etwas davon wissen. Doch dieser vermeintliche Optimismus hat etwas Oberflächliches und Falsches an sich. Ein solcher Optimismus kann sich leicht in sprachlosen Pessimismus verwandeln – und manche von uns haben irgendwann sogar den Gashahn aufgedreht und Selbstmord begangen.