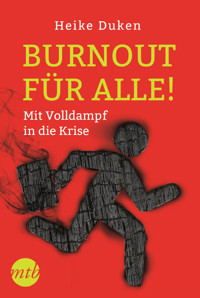5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte von Müttern und Töchtern, Schuld und Vergebung und der Frage, wie wir zu den Menschen werden, die wir sind.
Die Schatten der Vergangenheit reichen weit in der Familie Fux – von 1925, als zwei Brüder schon als kleine Jungen zu Soldaten erzogen werden und in den Dreißigerjahren entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen, bis zum heutigen Tag. Ina, die Tochter des einen Bruders, entfremdet sich von ihrer Familie und ihrer Geschichte. Sie wird mit neunzehn schwanger und beschließt, ihre Tochter Floh trotz der fehlenden Unterstützung des Vaters alleine großzuziehen. Als junge Frau stellt Floh, angetrieben vom Zorn auf den unerreichbaren Vater, auf Staat und Gesellschaft, Recherchen über ihre Familie an. Was sie entdeckt und dass sie selbst schwanger wird, verändert alles. Die Geschichte droht sich zu wiederholen, doch Floh ist entschlossen, zusammen mit ihrem Großvater den Fluch des Gestern zu überwinden und nach dem zu suchen, was Familie trotz allem zusammenhält.
Inspiriert von der wahren Familiengeschichte von Heike Duken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Die Schatten der Vergangenheit reichen weit in der Familie Fux – von 1925, als zwei Brüder schon als kleine Jungen zu Soldaten erzogen werden und in den Dreißigerjahren entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen, bis zum heutigen Tag. Ina, die Tochter des einen Bruders, entfremdet sich von ihrer Familie und ihrer Geschichte. Als sie mit 19 schwanger wird, beschließt sie, ihre Tochter Floh trotz der fehlenden Unterstützung des Vaters alleine großzuziehen. Als junge Frau stellt Floh, angetrieben vom Zorn auf den unerreichbaren Vater, auf Staat und Gesellschaft, Recherchen über ihre Familie an. Was sie entdeckt und dass sie selbst schwanger wird, verändert alles. Die Geschichte droht sich zu wiederholen, doch Floh ist entschlossen, zusammen mit ihrem Großvater den Fluch des Gestern zu überwinden und nach dem zu suchen, was Familie trotz allem zusammenhält.
Die Autorin
Heike Duken, geboren 1966 in München, studierte Psychologie und arbeitet in Nürnberg als Psychotherapeutin in ihrer eigenen Praxis. Sie schreibt, seit sie die Buchstaben kennt, ihr erstes Werk war eine Piratengeschichte in der dritten Klasse. Ihr erster Roman bei Limes, »Wenn das Leben dir eine Schildkröte schenkt«, wurde mit einem Stipendium des Deutschen Literaturfonds gefördert und von Presse und Lesern hochgelobt.
Von Heike Duken ebenfalls erschienen:
Wenn das Leben dir eine Schildkröte schenkt
Besuchen Sie uns auch auf www.limes-verlag.de
Heike Duken
DENNFAMILIESINDWIRTROTZDEM
Roman
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Copyright © 2021 by Limes Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenISBN978-3-641-26581-6V004www.limes-verlag.de
Für Jan Richard Duken, meinen Vater
Das wäre sicher schön
Ina, 1985
Sie luden mich in ihr Haus ein, und ich ging hin. Man musste ja darüber sprechen. Irgendwie. Ich klingelte. Was sollte schon passieren. Ich war aufgeregt, ja, aber ich war auch stolz, und da würden sie nicht dagegen ankommen. Sollte es schwierig werden, würde er mir helfen. Ariel. Er hatte jetzt Zeit gehabt, um über alles nachzudenken, hatte sich fangen können. Er würde mir beistehen, er würde ihnen nicht erlauben, über mich herzufallen.
Dana öffnete die Tür, Ariels Schwester. Was machte sie hier? Dana studierte doch in Haifa. War das Semester schon zu Ende?
»Hallo Dana.«
»Hallo Ina. Da bist du ja.«
Sie lächelte, ein gutes Zeichen. Dana würde es am ehesten verstehen.
»Komm doch rein«, bat sie, und ich betrat die Wohnung. Es gab keinen Flur, man stand sofort im Wohnzimmer. Schrankwand, Sofa, zwei Sessel, Couchtisch, Teppich. Auf einer Kommode Pokale und Medaillen, von Dana und von ihrem Bruder, Ariel. Sie Leichtathletik, er Schwimmen. Wie spießig das alles war. Fast wie in Deutschland.
Ariel war nicht da. Er würde sicher gleich kommen.
Martha, seine Mutter, erhob sich aus dem Sessel. »Hallo Ina«, sagte sie. »Wie schön, dass du gekommen bist.«
Sie lächelte auch.
Es würde also nicht so schlimm werden. Sie verurteilten mich nicht, sie hassten mich nicht.
»Das ist Ruth«, sagte Martha. »Meine Schwester, Ariels Tante.«
Die Tante lächelte nicht, sie gab mir lediglich die Hand.
Martha bot mir den zweiten Sessel an und nahm wieder auf ihrem Platz.
»Möchtest du Tee?«, fragte mich Dana.
»Nein, danke.«
Sie war auf meiner Seite. Ich spürte es. Sie war nur zwei Jahre älter als ich. Wir waren uns auf einem Ausflug begegnet, damals am See Genezareth, es war schon ein paar Monate her. Wir hatten darüber gelacht, wie hübsch die Männer hier waren. Wie gefährlich.
Es gab noch eine weitere Person im Raum. Sie stand weder auf, noch wurde sie mir vorgestellt. Eine alte Frau. Sie saß etwas abseits auf einem Stuhl neben der Anrichte mit den Medaillen. Ihre Hände lagen in ihrem Schoß. Sie trug ein Kostüm, als hätte sie sich schick gemacht, doch die Hausschuhe an den Füßen passten nicht dazu. Sie hatte weißes Haar, ihr Gesicht war voller Falten und Flecken. Es musste Ariels Großmutter sein. Er hatte nur ein- oder zweimal über sie gesprochen, obwohl sie nebenan wohnte. Man sah sie nie draußen, auch bei den Versammlungen nicht. Sie sei ein bisschen seltsam, hatte Ariel gesagt und gelacht. Ja, das war sie wohl. Sie schaute auf ihre Hände.
»Du bist schwanger?«, fragte Dana unvermittelt.
»Ja.«
»Bist du sicher? Warst du beim Arzt?«
»Ja, ich war beim Arzt. Zehnte Woche ungefähr.« Es sollte neutral klingen, nicht gleich so euphorisch. Immer langsam! Aber ich lachte, ich konnte nicht anders.
»Passiert«, sagte Dana. »Ist ja nicht so schlimm.«
Sie saßen nun schweigend da, Dana, Martha, Tante Ruth und die alte Frau, die immer nur ihre Hände betrachtete. Wirklich seltsam.
»Wo ist Ariel?«, fragte ich.
»Er musste weg«, sagte Martha, seine Mutter. »Er hat Dienst. Du weißt ja.«
»Er hat Dienst? Nein, das wusste ich nicht.«
Ariel hatte doch gesagt, er würde freibekommen und auf jeden Fall da sein. Vor zwei Tagen, am Telefon. Auf einmal war ich allein mit seiner Familie. Zum Glück war wenigstens Dana da.
»Wo willst du es machen lassen?«, fragte Martha. »Hier oder in Deutschland? Die Zeit wird knapp.«
»Am besten hier«, schlug Ruth vor, Ariels Tante. »Wir sind für dich da. Bringen dich hin. Wir sind bei dir.«
»Oh nein, ich möchte es behalten.«
Sie starrten mich an. Ruth zog die Augenbrauen nach oben. Sie aß zu viele Zitronen, hatte Ariel über seine Tante gesagt. Deswegen schaute sie immer so säuerlich drein.
Er war nicht da. Nur Dana konnte mir noch helfen.
»Ich könnte mir vorstellen herzukommen, hier zu leben«, sagte ich.
Martha antwortete mir sofort. Als hätte sie sich längst alles zurechtgelegt. »Das wäre sicher schön. Aber Ariel, mein Sohn, er möchte das nicht. Er ist zwanzig Jahre alt. Er ist beim Militär. Er erlebt viel Schlimmes. Danach macht er seine Reise, du weißt doch, dass nach seiner Militärzeit der Kibbuz für eine Reise aufkommt. Denkst du nicht, sie steht ihm zu? Nach dem Dienst? Und dann? Er wird studieren. Es wird also nicht gehen, dass du herkommst und hier lebst.« Sie beugte sich zu mir hin und nahm meine Hand. »Vielleicht ist es schwer. Du bist verliebt. Vielleicht hattest du Träume. Aber es ist zu früh für euch, einfach zu früh. Du kannst noch viele Kinder haben. Ich weiß einen Arzt.«
Ich zog meine Hand weg.
»Ich werde das Kind bekommen. Auch ohne Ariel. Ich kann hier leben und arbeiten, ich falle ihm nicht zur Last. Soll er seinen Dienst machen, seine Reise.«
Damit hatten sie nicht gerechnet. Ich würde Ariel zu nichts zwingen, so war ich nicht. So waren wir beide nicht. Ich würde hier leben wie die anderen auch. Erst als Kandidatin, dann als Mitglied. Ich würde arbeiten, von mir aus in der Küche an der Dishmachine oder auf der Plantage, es war mir egal. Ich würde eine von ihnen werden. Das war neu für sie. Das mussten sie erst einmal verdauen.
»Ich möchte ihm nichts kaputt machen, wisst ihr.«
Nichts lag mir ferner. Ariel. Er hatte dunkles Haar und blaue Augen, und ich hatte ihn lange nur heimlich angeschaut, monatelang, und nicht gedacht, dass er sich für mich interessieren könnte. Nicht Ariel, der hübscheste Kibbuznik von allen. Doch dann diese Nacht, als die Freiwilligen aus Mexiko ihr Abschiedsfest feierten. So viel Tequila! Die Party fand im Freien statt, die Nacht war sternenklar, und immer noch war es so heiß, dass uns beim Tanzen der Schweiß nur so herunterlief – und später auch, als wir uns im Arm hielten, Ariel und ich, und noch später, als wir betrunken in den Laken lagen. Da erzählte er mir vom Militärdienst. Drei Jahre. Er musste auf Menschen schießen, manchmal sogar auf Kinder. Kam ein Kind auf sie zu, wussten sie nicht, ob die Puppe in der Hand nur ein Spielzeug oder eine Höllenmaschine war. Und wenn er freihatte, kam er nach Hause, und alles war ganz normal und ganz friedlich, aber nicht für ihn, er träumte und wachte voller Angst auf und klammerte sich an mich.
Was also wussten sie von Ariel, seine Mutter und seine Tante und seine seltsame Großmutter. Sie kannten ihn nicht so, wie ich ihn kannte, ich, Ina, die ein Kind von ihm bekam. Sein Dienst und seine Reise würden nichts daran ändern. Er würde zurückkommen, und ich würde für ihn da sein.
Dana stand vom Sofa auf. »Das tust du aber.« Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Du machst Ariels Zukunft kaputt.«
Ich hatte sie bestimmt falsch verstanden. Immer noch war ich im Englischen nicht ganz sicher. Ich lächelte, mehr fiel mir im Augenblick nicht ein.
»Sei nicht so hart«, sagte Martha.
»Du kannst das Kind nicht kriegen«, sagte Dana. »Es wird hier nicht willkommen sein.«
Das war nun nicht mehr falsch zu verstehen. Trotzdem kam es erst langsam bei mir an. Ich hörte auf zu lächeln. Dana? Warum? Ich starrte sie stumm an. Sie wich meinem Blick nicht aus, sondern sah mir direkt in die Augen. Ja, sie meinte, was sie sagte. Sie war nicht auf meiner Seite. Eine Falltür ging auf, und ich fiel. Meine Ohren gingen zu, ich fühlte mich taub.
Ich riss mich von Danas bohrendem Blick los und starrte auf den Teppich mit seinem hässlichen Muster. Ich war allein. Niemand würde mir helfen. Ob Ariel wirklich Dienst hatte? Vielleicht wartete er nebenan. Draußen ein Held – und hier, für mich? Nein, ich tat ihm bestimmt unrecht. Er hatte nicht freibekommen.
Na gut, dachte ich. Ihr werdet schon sehen. Sie saßen vor mir, diese Frauen. Sie hielten zusammen, aber es würde ihnen nichts nutzen. Sie wollten mir Vorschriften machen, und da kannten sie mich schlecht. Meine Mutter hatte das schon versucht, mein ganzes Leben lang. Das war ich gewohnt! Sie brauchten nicht zu denken, dass ich jung und dumm war und einfach machte, was sie mir befahlen.
»Ich werde das Kind bekommen. So oder so.«
»Nein«, sagte Dana. »Du wirst eine Abtreibung vornehmen lassen. Noch in dieser Woche. Hier ist dein Termin.«
Sie hielt mir einen Zettel hin.
»Niemals.«
»Du wirst allein damit sein«, sagte Martha. »Ganz allein. Das Kind wird keinen Vater haben. Denk an das Kind, Ina, an sein Schicksal.«
»Es wird hier nicht willkommen sein«, bekräftigte Ariels Tante Ruth.
Ich verstand noch immer nicht ganz, was los war. Was sie gegen das Kind hatten. Gegen mich. Mein Kind war nicht willkommen? Doch, das war es. Bei mir. Ich heulte los. Ich wollte nicht, aber ich heulte.
»Es ist doch erst ein kleiner Haufen Zellen«, sagte Dana. »Mach dich nicht unglücklich. Und das Kind auch nicht.«
Ich stand auf. »Was sagt Ariel denn?«
Martha antwortete mir. »Er hat uns aufgetragen, dieses schwere Gespräch mit dir zu führen. Er sah sich nicht in der Lage dazu. Er will das Kind nicht. Er will keine Beziehung mit dir. Eine Liebelei, Ina, mehr nicht. Nimm die Erinnerung mit nach Hause.«
»Ich gehe jetzt«, sagte ich.
Er sah sich nicht in der Lage dazu.
Ich bewegte mich langsam. Sie würden mich aufhalten. In meinem Kopf ein Durcheinander. Na gut, dann Deutschland. Ein Baby. Ich war die Mutter. Ich würde schon für es sorgen. Und diese Leute hier, die würden sicher irgendwann ein Einsehen haben. Die hatten doch ein Herz.
Ich hielt die Klinke in der Hand.
Eine Liebelei. Sie wussten nichts über Ariel und mich. Über seine Albträume und seinen Schweiß in der Nacht. Wie er sich an mich klammerte im Morgengrauen.
Ich konnte ihn nicht anrufen, er war im Dienst. War er das wirklich? Ich musste wohl einen Flug buchen. Meine Mutter anrufen. Ich hatte keine Wohnung. Ich hatte nichts.
Da hast du dir ja was Schönes eingebrockt, Ina Fux, würden sie zu Hause sagen. Typisch!
Ich wandte mich noch einmal um. Alle saßen sie da, so ruhig, so im Recht. Mein Baby, es war nicht willkommen. Es war ein Nichts für sie.
Die alte Frau stand plötzlich auf und hatschte zu mir her. Sie nahm mit beiden Händen meine Hand und sah mich an.
»Es tut mir leid«, sagte sie auf Deutsch. Ohne jeden Akzent.
»Dann tun Sie doch was! Sind Sie Deutsche?«
»Nein, ich bin Israelin.« Sie schaute mich weiter an und hielt meine Hand. »Es tut mir leid, Mädchen.«
Dann öffnete sie die Haustür und schob mich hinaus.
Sleep well
Paul, 1925
Ich stapfte durch den Schnee und zog Gerd mit dem Schlitten hinter mir her. Mein Bruder war zwar noch klein, aber schwer, und der Schnee tief. Unter der Mütze wurde mir heiß, unter der Jacke, dem kratzigen Wollpullover, dem Unterhemd. Nur meine Hände in den Handschuhen und meine Füße in den Halbschuhen froren. Die Stiefel vom letzten Jahr passten mir nicht mehr, und ich wusste nicht, ob der Onkel mir neue kaufen würde. Es war der erste Winter hier.
»Du isst zu viel!«, rief ich meinem Bruder auf dem Schlitten zu.
Aber er verstand ja noch nichts so richtig und schrie nur: »Snella, snella!«
Der sollte erst mal richtig sprechen lernen. Ich war schließlich kein Maulesel. Trotzdem versuchte ich, noch etwas schneller zu ziehen, denn das Schlimmste war, wenn Gerd heulte. Auweia. Dann schrie er den ganzen Ort zusammen, und der Onkel wurde wütend davon. Das konnte ich verstehen, weil man das Geheule wirklich nicht aushalten konnte.
»Enten, Enten!«, rief Gerd.
»Wir dürfen nicht zum Weiher, das weißt du genau.«
»Enten, Pauli!«
»Im Winter gibt es gar keine Enten, du Dummkopf.«
Jetzt war eine Weile Ruhe. Nur der Schnee knirschte, und die Kufen machten ein Geräusch, immer wenn ich wieder einen Schritt vorwärtsschaffte. Und ich schnaufte. Am liebsten wäre ich einfach zu Hause geblieben, aber der Onkel schickte uns jeden Tag raus, jeden Tag, egal bei welchem Wetter.
»Ihr seid doch Buben und nicht aus Zucker, ihr beiden, raus mit euch«, hatte er gesagt, und bei ihm gab es keine Widerrede. Meckern zwecklos, das hatte ich schnell gelernt. Nur der Gerd, der musste das noch lernen.
»Enten!«, fing er jetzt wieder an, und seine Stimme klang, als würde er gleich wieder losheulen. Aber wir durften nicht zum Weiher. Es war gefährlich.
»Du bist der Ältere, du trägst die Verantwortung«, hatte der Onkel mir gesagt. »Das ist etwas sehr Wichtiges im Leben, verstehst du? Verantwortung.«
Er behandelte mich eben nicht wie ein Baby, der Onkel.
Gerd quengelte und riss an seiner Mütze herum, die ihn genauso kratzte wie mich mein Wollpullover.
»Lass die Mütze auf!«
Ich ging hin und setzte sie meinem Bruder wieder richtig auf den Kopf. »Nein!«, quietschte er, strampelte trotzig mit den Beinen und griff wieder nach der Mütze.
»Lass ihm seinen Trotz nicht durchgehen«, hatte der Onkel gesagt. »Das muss man frühzeitig unterbinden.«
»Hör auf«, schrie ich also und zwang die kleinen Finger an seiner Hand auseinander, damit er die Mütze losließ, und dann drückte ich seine Beine grob auf den Schlitten.
Er fing sofort zu weinen an und jammerte los. »Aua, aua!« Am liebsten hätte ich ihm eine verpasst. Aber dann machte er so ein Gesicht und sah mich so an, mit seinen Kulleraugen, er schob die Unterlippe vor, und da tat er mir wieder leid. Ich konnte nicht anders, als ihn zu trösten. Ich fiel immer wieder auf ihn herein.
»Ist ja gut, Gerd, ist ja gut«, sagte ich, nahm ihm kurz die Mütze vom Kopf und wuschelte ihm durch die Haare. Das half gegen das Kratzen. Dann gab ich ihm einen Stups auf seine Nase, sie war voller Rotz, und Gerd lachte wieder, als wäre nichts gewesen. Zum Glück. Kein Geheule mehr.
»Komm, steig ab«, sagte ich, »Wirst schon sehen, es sind keine da. Enten, Enten! Und dann gehen wir nach Hause, ja?«
Er kletterte vom Schlitten, umarmte meine Beine und sagte: »Liebhaben, Pauli.«
Nicht das schon wieder. »Ja, liebhaben, Gerd. Ist ja gut. Lass mich los.«
Ich nahm ihn bei der Hand, und wir gingen ein Stück oberhalb des Weihers. Gerd verschwand fast im Schnee, kämpfte sich aber tapfer durch. Ich setzte ihn auf eine Bank in der Sonne. Da war es ein bisschen wärmer, und meine Schuhe konnten vielleicht trocknen. Oben fiel der Schnee rein, die Socken waren nass, und meine Füße taten weh, so eisekalt waren sie.
»Siehst du, weit und breit keine Enten. Es ist zu kalt. Sie sind in Afrika, deine Enten.«
Auch am Hintern wurde es eisig auf der Bank. Wir konnten noch nicht nach Hause, es war zu früh. Der Onkel würde sich ärgern und uns wieder rausschicken.
»Komm, wir bauen einen Schneemann«, schlug ich vor und ließ Gerd auf der Bank sitzen. Ich machte einen Schneeball und rollte ihn durch den Schnee. Es klappte gut. Die Kugel wurde größer und größer.
»Schau mal, Gerd!«
Doch Gerd saß nicht mehr auf der Bank. Ich sah nur noch seinen Kopf mit der Mütze, und der bewegte sich in Richtung Weiher.
»Gerd, nicht! Bleib stehen!«, rief ich.
Aber er hörte nicht auf mich, sondern stolperte weiter, den Abhang hinunter, er kreischte und lachte dabei. Für ihn war das ein Spiel.
»Gerd, na warte!«
Ich rannte los. Ich würde ihm ordentlich eine verpassen. Der musste mal gehorchen lernen, der Blödmann.
»Pauli, Pauli!«, rief er und rannte von mir weg aufs Eis, aber er kam nicht weit, ein paar Schrittchen vom Ufer entfernt brach er ein und war weg.
Ich sprang ihm sofort hinterher, brach genauso ins Eis ein, die Kälte zog mir fast die Beine weg, aber ich stand, das Wasser bis zum Bauch, und sah vor mir das Loch im Eis mit Gerds Mütze. Ich fischte nach der Mütze, dann nach einem Arm in einer dicken Jacke, und dann zog ich den ganzen nassen, schweren Klumpen heraus, der mein Bruder war, und zerrte ihn ans Ufer.
Gerd schrie wie am Spieß. Zum Glück. Er war nicht tot. Ich verpasste ihm eine. Zog ihn hoch und schleifte ihn hinter mir her auf die Bank.
»Warum machst du so was? Du bist klitschnass! Und ich krieg die Haue!« Statt einer Antwort heulte und schluchzte er nur. »Setz dich hier in die Sonne und sei still. Du musst trocknen. Wir bleiben so lange hier, bis du trocken bist.«
Er nickte und zog den Rotz hoch. Der Dummkopf.
Wir saßen und warteten. Die Sonne schien. Trotzdem fingen Gerds Zähne an zu klappern, und er begann, fürchterlich zu zittern. Dann ging es bei mir los, das Bibbern und Zähneklappern. Man konnte es bestimmt bis in den Ort hören. Ich setzte mir Gerd auf den Schoß und umarmte ihn, damit wir es ein wenig wärmer hatten. Wenn nur seine Sachen trockneten. Ich würde mich schon hineinschleichen, so triefnass, am Onkel vorbei, aber mein kleiner Bruder war ein Dummerjan, der ließ sich bei allem erwischen.
Abwechselnd rieb ich ihm die Arme und umarmte ihn dann wieder ganz fest, damit er aufhörte, so furchtbar zu zittern. Aber es half nichts. Wir saßen und saßen, die Sonne verschwand schon langsam hinter den Bäumen. Es wurde noch kälter.
»Du musst auch mal auf mich hören«, sagte ich. »Bald ist es dunkel, und wir können nicht nach Hause.«
Jetzt war mir zum Heulen zumute. Was sollte ich bloß machen? Das wurde nichts, wir wurden kein Stück trockener. Gerd sah mich zähneklappernd an. Die Haare, die unter seiner Mütze herausschauten, waren steifgefroren. Die ganze Mütze und die Jacke auch.
»Liebhaben, Pauli«, sagte er, die Lippen blau.
»Ja, liebhaben, Gerd.«
Es wurde dunkel. Nur der Schnee leuchtete weiß. Die Bäume weiter hinten waren schwarz.
Später, als wir zusammen im Bett lagen, zitterte Gerd immer noch. Und er weinte. Jetzt hatte er Grund dazu.
»Ich bin schuld!«, hatte ich dem Onkel gesagt. »Ich bin mit ihm zum Weiher! Er wollte nicht, ich bin schuld!«
Trotzdem bekam ich nur eine ordentliche Ohrfeige, die mir immer noch im Ohr weh tat. Und Gerd kriegte die ganze Tracht Prügel ab, mit dem Kochlöffel.
Er war doch noch so klein, er verstand es doch noch nicht.
»Ohne Essen ins Bett!«, brüllte dann der Onkel, und ich half Gerd, seinen Schlafanzug anzuziehen.
Jetzt lagen wir da, in unserem Bett, wir hatten eins zusammen, und mein Bruder zitterte und weinte neben mir, und ich hatte Hunger, einen so großen Hunger wie noch nie.
»Gerd? Hör mal! Weißt du noch, wie Mama ›Gute Nacht‹ sagt?«
Er antwortete nicht, aber er wurde ruhiger.
»›Sleep well in your klappriges Bettgestell‹, sagt sie immer. Sie kommt nämlich aus England.«
»Mama«, sagte er, aber wahrscheinlich konnte er sich gar nicht mehr richtig an sie erinnern.
»Sie kommt bald zurück«, flüsterte ich. »Schlaf jetzt. Morgen gibt es Frühstück.«
Ich würde bestimmt zehn Brote verdrücken. Mit Marmelade.
Endlich hörte Gerd auf zu zittern. »Sleep well, Gerd, in your klappriges Bettgestell«, sagte ich und merkte, dass er schon eingeschlafen war.
Pipifloh
Ina, 1985
Ich saß im Bus nach Tel Aviv. Ein Fensterplatz. Ich wollte es nicht, aber ich sah die ganze Zeit hinaus. Israel ist klein. Von den Golanhöhen kann man das Meer sehen und hinüber nach Syrien und in den Libanon, und von Eilat ist es ein Katzensprung nach Gaza. Trotzdem dauerte die Fahrt Stunden über Stunden, sogar Tage, sie hörte gar nicht mehr auf. Ich starrte hinaus, das Land zog an mir vorbei, die Farben, der Staub, die Kibbuzim und Siedlungen mit den grünen Flächen rundherum, die Soldaten mit ihren Maschinengewehren und ihrem strengen Blick, wir wurden angehalten, überprüft, durften schließlich weiterfahren. Ariel, dachte ich nur, Ariel, und all das fraß an mir, fraß mich richtig auf, Stück für Stück fehlte etwas von mir, das hätte mein Land sein sollen, meine Heimat, hier war mein Glück, woanders würde es nicht auf mich warten, ich war mir ganz sicher. Hier hätte ich zur Welt kommen sollen, hier in diesem kleinen Land, das wäre so viel besser gewesen. Ich wäre jemand anders geworden, mit einem anderen Namen. Nicht Fux.
Dieser Name: Fux.
Ich wäre gerne zum Militär gegangen. Vielleicht sogar zum Geheimdienst. Um auf Israel aufzupassen, auf die Menschen. Hier waren sie gut. Gute Menschen. Wer so viel Leid erfahren hatte, musste gut sein.
Wie dumm ich mich fühlte. Ich schämte mich. Es war doch offensichtlich, dass ich nicht eine von ihnen war, ich war eine von den anderen, den Deutschen. Wie hatte ich das vergessen können. Ariel war im Recht, ich nicht. Er hielt zu seiner Familie. In Deutschland waren alle auf ihn wütend, meine Mutter, mein Vater, meine Freundin, alle, ich nicht. Ich verstand Ariel. Es ging nun einmal nicht, er konnte für eine Deutsche nicht seine Familie verraten. Es war wie ein Gesetz, dagegen kam man nicht an.
Doch mit jedem Kilometer, den dieser Bus fuhr, wurde ich weniger und weniger und wollte am liebsten gar nicht mehr da sein, aber jetzt hatte ich ja eine Verantwortung, ich musste da sein, für das Baby. Immer wenn ich an mein Kind dachte, fing ich an zu weinen. Die Frau neben mir, eine Fremde, strich mir über den Arm, aber das half nichts, im Gegenteil, ich weinte noch mehr. Wo kam das ganze Wasser nur her? Ich wollte nicht weg von hier, noch weniger nach Hause, was sollte das überhaupt für ein Zuhause sein, Deutschland? Ich hasste es.
Dann saß ich endlich im Flugzeug, nach den Prozeduren, den Durchsuchungen und Befragungen. Sie schauten sich jeden Passagier genau an, wegen der Anschläge.
Wieder Fensterplatz. Ich sah jetzt nicht mehr hinaus. Ich achtete auf die Sicherheitshinweise, die Vorführung der Stewardess. Dann drückte mich die Beschleunigung in den Sitz, wir hoben ab, einen kurzen Moment lang schwebte ich, so kam es mir vor, das Geräusch des einfahrenden Fahrwerks, ich schloss die Augen. Vielleicht konnte ich schlafen.
Ein Baby in meinem Bauch. Ein echtes Baby. Und ich dachte: Soll ich denn wirklich? Es gab noch die Möglichkeit. In Holland, die meisten fuhren nach Holland. Ich hatte noch Zeit.
Holland? Wie bitte? Klopf-klopf, du da! Hallo, Ina Fux!
Wer oder was sprach da zu mir? Der kleine Zellhaufen etwa?
Denk lieber nicht daran sagte er.
Doch, ich dachte daran. Mir brauchte man mit Lebenschenken oder mit dem lieben Gott oder so was nicht zu kommen. Wir waren immerhin in den Achtzigern, wir hatten Rechte, wir Frauen, und wir hatten Holland.
Es ruckelte. Das Anschnallzeichen leuchtete auf, und ich schloss den Gurt. Bitte keine Turbulenzen, dachte ich. Bitte! Mir war doch sowieso immer übel, jetzt seitdem … Ich suchte im Fach vor mir nach der Kotztüte. Sie hatte ein lachendes Gesicht drauf und ein Bild, wie man sie nach Gebrauch verschließen sollte. Das Flugzeug sackte leicht ab, und ich umklammerte die Tüte fest mit meiner Hand.
Ein Kind ohne Vater. Und ich? Arm und doof würde ich werden. Sozialhilfe. Ha, studieren, die Madame! Ausgeträumt, Ina. Das Schlaflied fiel mir ein. Gerade jetzt das blöde Lied.
Weißt du, wie viel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viel Wolken gehen
weithin über alle Welt?
Gott der Herr hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet
an der … Pff.
Aber das Ganze hat einen Vorteil!
Ach ja? Welchen denn, du Zellhaufen? Mir fällt keiner ein.
Ist doch ganz einfach. Ich werde nur dich haben und nur dich liebhaben, egal was du machst, und auch wenn es mir vielleicht schwerfällt. Also manchmal …
Was soll das denn bitte heißen?
Mir fiel ein Satz von meiner Mutter ein: »Erst zieht man sie frech, dann werden sie groß.«
Omi! Omimi!
Oh Gott. Meine Mutter. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Sie würde ja die Omi werden von … Ich konnte sie schon hören. Die Omimi.
»TYPISCHINA. DASWARJAKLAR. DASHASTDUJATOLLHINBEKOMMEN, GRATULATION. HABICHESDIRNICHTGLEICHGESAGT? JETZTISTSCHLUSSMITDENSPERENZCHENUNDWIESTELLSTDUDIRDASVOR, BITTESCHÖN? WERDENDLICHERWACHSEN. DASKOMMTÜBERHAUPTNICHTINFRAGE, FRÄULEIN. JETZTISTSCHLUSSMITWOLKENKUCKUCKSHEIM. SCHAUNICHTSO. FANGBLOSSNICHTSOAN. HÖRAUFZUHEULEN.«
Die Omi ist wohl nicht so ein gutes Thema, hm?
Nein. Aber was weißt du kleiner Pipifloh in meinem Bauch schon von deiner Oma? Hm?
Ich dachte an den Vormittag am Markt in Jerusalem. In dem ganzen Getümmel und unter den vielen Arabern stand eine jüdische Frau mit einem kleinen Jungen an der Hand vor einem Stand mit Gewürzen. Sie trug eine Kopfbedeckung und einen langen Rock, sie war eine Religiöse. Der Junge wollte ihr sagen, welches Gewürzpulver sie zu kaufen hatte, das knallrote gefiel ihm am besten, und die Frau lachte und sagte zu ihrem Jungen: »Was weißt du kleiner Pipifloh schon von einer Shakshuka!«
Die Stewardess brachte Essen und Getränke. Rindfleisch mit Kartoffelpüree, ein Joghurt und ein Kuchen. Ich hatte Hunger. Aber das Fleisch roch merkwürdig, ich wusste nicht wonach, mir wurde jedenfalls schlecht davon. Ich klappte die Alufolie zu, verschloss das ganze Paket wieder, so gut es ging, es roch immer noch, und ich musste doch etwas essen. Aber der Mann neben mir öffnete nun seine Schale, alle aßen das Rindfleisch, es stank im ganzen Flugzeug nach so etwas wie Verwesung oder Schimmel oder nur nach einem Gewürz, ich hatte keine Ahnung.
In der linken Hand hielt ich die Kotztüte. Sie war meine Rettung, vielleicht bekam ich so den Joghurt und den Kuchen hinunter. Aber erst brauchte ich eine Cola.
»Bitte, haben Sie eine Cola für mich?«
»Warten Sie.«
Die Stewardess lächelte ihr Plastiklächeln und verteilte ihre Plastiklöffel und den Kaffee, aber ich brauchte Cola, sonst konnte ich nichts essen.
»Ist Ihnen nicht gut?«
»Doch, ich bräuchte nur bitte eine Cola.«
»Einen Moment müssen Sie schon warten.«
»Ich weiß!«
Jetzt war ich unhöflich geworden. Sie würde mich extralange warten lassen. Sie würde mich den Rest des Fluges warten lassen.
Auf dem Kuchen glänzte etwas. Das war nicht gut. Ich konnte nichts essen, was glänzte. Ich konnte nur den Joghurt essen, er schmeckte einwandfrei. Nach nichts.
Und das ging jetzt neun Monate so? Wer hielt so was aus?
Die Wolken waren verschwunden, ich konnte unten schneebedeckte Berge sehen, Täler, kleine Ansiedlungen. Es dauerte jetzt nicht mehr lange. Conny würde am Flughafen auf mich warten. Wir hatten uns sechs Monate nicht gesehen. Juhu, ein Baby!, hatte sie in ihrem letzten Brief geschrieben. Sie war die Einzige die sich freute.
Bitte, iss den Kuchen, Mama. Ich hab so Hunger! Das ist nichts Ekliges, was da glänzt. Nur Butter. Oder Margarine. Oder Öl, Pflanzenöl. Nichts Ekliges jedenfalls.
Ich will nicht kotzen, hörst du?
Und ich will den Kuchen!
Der war ganz schön frech, der Pipifloh. Das konnte ja heiter werden, wenn der mal wirklich einen Mund zum Quaken hatte und Hände, um Sachen zu zerdeppern.
Kuchen! Sonst gehe ich zum Jugendamt und sage, erst wollte sie nach Holland fahren, und dann hat sie mir nichts zu essen gegeben. Sie ernährt sich sowieso sehr schlecht und unregelmäßig, diese Frau, die sich meine Mutter nennt.
Sehr lustig. Haha! Aber denk mal scharf nach.
Ach so. Dafür müsste ich erst einmal … nicht nach Holland fahren.
Schlaues Kerlchen.
Oder schlaues Mädchen! Die können auch schlau sein, verstehst du?
Ach, was weißt du schon.
Jaja, ich kleiner Pipifloh.
Ich wollte nicht, aber ich musste lächeln. Zum ersten Mal seit ungefähr einhundert Tagen. Ob es wirklich ein Mädchen war? Oh weh. Das würde was geben. Das ganze Geschrei, die Tränen, sich im Klo einsperren und zu spät heimkommen und rauchen und Verweise kriegen und einfach auf alles pfeifen. Oh weh. Ich würde alles zurückbekommen. Wahrscheinlich doppelt und dreifach.
Das Flugzeug setzte auf, bremste ab. Ein Rauschen. Draußen war es Nacht. Es regnete. Das Flughafengebäude war grell erleuchtet. Conny wartete dort auf mich.
Ich lächelte immer noch.
Paulchen, mein Paulchen
Paul, 1930
»Ich werde kein Soldat«, sagte Gerd.
»Jeder wird Soldat. Wirst schon sehen.«
»Ich nicht. Ich werde Tierarzt und bringe die Kälber auf die Welt. Und den Pferden helfe ich, wenn sie lahmen oder eine Kolik haben.«
An so etwas merkte man, wie dumm mein Bruder war. Er war jünger als ich, aber daran lag es nicht. Er war dumm und ein Feigling. Wenn erst die große Zeit kam, würde er es schon merken, dann würden es alle merken, sagte der Onkel, und dann würden sich ein paar Leute noch wundern.
Gerd auch, glaubte ich.
Er lag neben mir auf dem Bauch, wir hatten immer noch ein Bett zusammen.
»Paul?«, fragte er.
»Ja?«
»Denkst du, sie sind noch in Panama?«
»Ja. Oder auf See.«
»Ich wäre auch gerne dort, in Panama. Aber der Delfin, er hat mir leidgetan.«
»Du mit deinen Tieren. Das ist doch bloß ein Fisch. Der Papa hat ihn gefangen, und dann haben sie ihn gegessen. Das hat er doch geschrieben.«
»Delfine sind keine Fische. Delfine sind Säugetiere und sehr klug.«
»Du liest zu viel, Gerd. Das sagt der Onkel auch. Du musst mehr exerzieren.«
»Ich will aber nicht.«
Das war Gerds Dummheit und sein Eigensinn. Ich mochte es nicht, wenn er so war. Er wollte nur, dass wieder was passierte.
»Auch wenn du nicht willst«, sagte ich. »Es ist nicht schlimm, das Exerzieren.«
Er brauchte doch nur das Holzgewehr zu nehmen und auf die Kommandos zu hören. Ich versuchte immer wieder, ihn zu überreden, aber er hörte nicht auf mich. Dabei war es so einfach. Der Onkel übte mit mir in der Küche: Auf- und Abmarschieren. Halt! Liiiinksum, Stillgestanden, und: Rühren! Rühren mochte ich am liebsten und dann wieder Strammstehen.
»Sehr gut, du bist zu gebrauchen, Paul!«, sagte der Onkel, wenn ich alles richtig machte. Und wenn ich mit Ernst bei der Sache war, passierte auch nichts. Außerdem stimmte es ja. Deutschland musste wieder groß werden. Wir lebten alle in Knechtschaft, aber dem Gerd war das egal. Den Tag zuvor hatte er eine Mädchenhaarspange gefunden und sich ins Haar gesteckt. Er sah so lustig damit aus, mit der kleinen Blume dran, und er hüpfte hoch, um sich im Spiegel anzuschauen, und er rief: »Oh, wie hübsch, schau mal, verehrter Bruder!«, und machte dabei die Stimme von einem Mädchen nach, wir haben uns fast totgelacht.
Aber dann kommt der Onkel herein, um zu sehen, was wir treiben; er mag es nicht, wenn wir laut sind und lachen. Ich hab nicht daran gedacht. Ich hab nicht aufgepasst. Der Onkel sieht den Gerd mit der Haarspange, packt ihn sofort am Arm und zerrt ihn die Treppe hinunter und nach draußen. Das ist dem Gerd peinlich, draußen auf der Straße mit der Haarspange, er stolpert hinter dem Onkel her und schreit. Er hält ja nicht viel aus, mein Bruder, das muss man schon sagen. Ich renne los und folge den beiden. Der Onkel schleift den Gerd durchs ganze Viertel und deutet immer wieder auf die Haarspange und ruft: »Schaut euch das Mädchen an, seht ihr, das spielt noch mit Puppen, und am Sonntag zieht es sich ein Kleidchen an!«
Der Gerd schreit bald nicht mehr, er weint. Er hat Angst. Ich auch. Dem Onkel fällt immer etwas Besonderes ein, wenn er wütend ist. Ich bin meistens brav und exerziere schön, da fällt ihm nicht so viel ein, bei Gerd aber schon. Nur nachts, da soll ich mit den Händen über der Bettdecke schlafen, ich weiß auch nicht warum, und wenn meine Hände doch einmal unter der Bettdecke sind, weil ich im Schlaf nicht darauf achte, sie machen das einfach, meine Hände, ich kann nichts dafür, dann schlägt mich der Onkel grün und blau. Und ich weiß erst einmal gar nicht, wie mir geschieht, mitten in der Nacht, und am nächsten Tag kann ich kaum sitzen.
Wer Soldat werden will, muss schon etwas aushalten.
Der Onkel zieht den Gerd zum Fluss hinunter und befiehlt ihm, sich einen Zweig auszusuchen. Da steht eine Weide, und mit den Weidenzweigen tut es unendlich viel mehr weh als mit dem Teppichklopfer, und der Kochlöffel zerbricht immer gleich, das hat der Onkel am Gerd schon oft ausprobiert.
»Nein, der ist für Mädchen«, ruft er dem Gerd zu, der ihm irgendeinen Zweig zeigt, das Gesicht verheult. »Du willst doch ein ganzer Mann sein, oder nicht?«
Gerd nickt nur. Ich kann seine Angst sehen. Er sucht einen stärkeren Zweig aus, fast schon einen Ast, und der Onkel sagt: »Ja, der ist in Ordnung.«
Er gibt Gerd sein Taschenmesser und lässt ihn den Ast absägen, was ewig dauert. Ich hoffe die ganze Zeit, dass Gerd bald fertig wird, der Geduldsfaden vom Onkel ist ja nur ganz kurz, besonders wenn er sowieso schon wütend ist. Aber diesmal wartet er bloß, schaut dem Gerd zu und grinst. Es ist gemein. Ich kann nicht hinsehen. Ich muss an das Gewehr denken, das echte, das im Keller. Der Onkel hat es mir gezeigt. Er hat mir beigebracht, wie man es auseinandernimmt und reinigt und wieder zusammenbaut. Ich bin immer zu langsam. Denn wenn der Soldat seine Waffe nicht zur Verfügung hat, dann ist das der gefährlichste Moment. Dann ist der Soldat vollkommen hilflos. Trotzdem muss er die Waffe reinigen, sonst funktioniert sie nicht und hat im entscheidenden Moment Ladehemmung. Also muss der Soldat sein Gewehr wahnsinnig schnell auseinandernehmen und wieder zusammenbauen können. Soldaten üben das die ganze Zeit.
Ich habe auch gesehen, wie der Onkel die Munition überprüft und das Gewehr geladen hat und wie er damit fortging und wiederkam und wie er das Gewehr wieder entladen und es zurück in den Keller gebracht hat. Ich habe genau zugeschaut. Ich habe es mir gemerkt.
Ich hasse den Onkel, auch wenn das undankbar ist und es dem lieben Gott nicht gefällt. Mir gefällt auch so manches nicht, na und?
Das sind gotteslästerliche Gedanken. Ich werde sie beichten müssen. Aber dann habe ich wenigstens etwas Richtiges für den Pastor.
Dem Gerd geschieht es manchmal auch recht. Was steckt er sich eine Mädchenhaarspange an. Immer muss er den Onkel provozieren. Er ist eigensinnig und exerziert nicht und bemüht sich nicht. Er passt gar nicht in unsere Familie. Lauter Kapitäne, das sind die Fuxens. Ein Admiral, das wird einmal aus mir werden, jawoll, ein Admiral!
Der Onkel schlägt mit dem Weidenast auf den Gerd ein, und bei jedem Schlag gibt es erst ein Pfeifen, und dann knallt es. Der Gerd schreit wie am Spieß, dann weint er und bettelt: »Nicht, Onkel, nicht.«
Das nützt ihm nichts, der Onkel wird bloß noch wütender, wenn Gerd so bettelt. Er ist eben eine Memme. Er kann kein Soldat werden, aber das macht eigentlich nichts. Tierärzte werden auch gebraucht. Vor allem in der Landwirtschaft, wenn Deutschland wieder groß ist.
Der Onkel hört nicht auf, bis eine Frau mit einem Kind an der Hand die Böschung herunterkommt und ruft: »Herr Doktor, Sie bringen ihn ja um!«
Der Onkel starrt die Frau an. Er sieht irgendwie irre dabei aus, als wäre er gar nicht da, sondern ganz woanders. Er schubst den Gerd ins Gras. Der wimmert nur noch. Es ist schrecklich. Ich frage mich, ob ich auch so wimmern würde, und ich nehme mir ganz fest vor, noch härter zu werden, hart wie Stahl.
Der Onkel stapft dann einfach davon. Die Frau geht auch mit dem Kind weg und schüttelt dabei den Kopf. Gerd liegt am Boden. Er sieht aus wie im Krieg. Er drückt sein Gesicht ins Gras. Sein Rücken bebt. Er kommt mir unheimlich klein vor, sein Rücken, und er zittert.
Da tut er mir richtig leid, der Gerd.