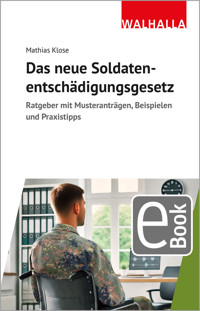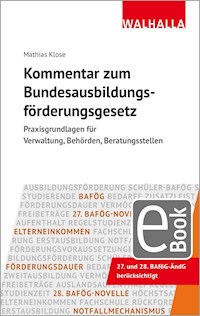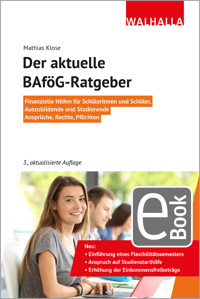
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Anspruch auf Bildung und Förderung
Der Ratgeber Der aktuelle BAföG-Ratgeber unterstützt Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende, aber auch Eltern, sich im Antragsdschungel zurechtzufinden und so Rechte und Ansprüche der Ausbildungsförderung des Bundes – besser bekannt als BAföG – bestmöglich auszuschöpfen. Beantwortet werden wichtige Fragen wie:
- Ist eine Förderung bei einer weiteren oder anderen Ausbildung nach einem Fachrichtungswechsel oder Ausbildungsabbruch möglich?
- Welche Rechte und Ansprüche gelten in Minijobs?
- Welchen Einfluss haben arbeitsrechtliche Besonderheiten?
- Welche sozial- und strafrechtlichen Folgen haben falsche Angaben im Förderungsantrag?
- Wie werden Einkommen und Vermögen angerechnet?
- Welche Freibeträge gelten?
Zahlreiche Praxis-Tipps, Musterformulierungen und -anträge sowie die Darstellung der aktuellen Rechtslage helfen bei der finanziellen Absicherung der Ausbildung oder des Studiums.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
3. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected]
Kurzbeschreibung
Anspruch auf Bildung und Förderung
Der Ratgeber Der aktuelle BAföG-Ratgeber unterstützt Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende, aber auch Eltern, sich im Antragsdschungel zurechtzufinden und so Rechte und Ansprüche der Ausbildungsförderung des Bundes – besser bekannt als BAföG – bestmöglich auszuschöpfen. Beantwortet werden wichtige Fragen wie:
Ist eine Förderung bei einer weiteren oder anderen Ausbildung nach einem Fachrichtungswechsel oder Ausbildungsabbruch möglich?Welche Rechte und Ansprüche gelten in Minijobs? Welchen Einfluss haben arbeitsrechtliche Besonderheiten? Welche sozial- und strafrechtlichen Folgen haben falsche Angaben im Förderungsantrag? Wie werden Einkommen und Vermögen angerechnet? Welche Freibeträge gelten?Zahlreiche Praxis-Tipps, Musterformulierungen und -anträge sowie die Darstellung der aktuellen Rechtslage helfen bei der finanziellen Absicherung der Ausbildung oder des Studiums.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Grundlagen
2. Ausbildung im In- und Ausland
3. Förderungsfähige Ausbildungen
4. Persönliche Voraussetzungen
5. Förderungsumfang
6. Einkommen und Vermögen
7. Förderungsdauer
8. Förderungsarten und -bedingungen
9. Förderungsantrag und -entscheidung
10. Rechtsschutz
Auszüge aus referenzierten Vorschriften
Vorwort
Ansprüche kennen und erfolgreich durchsetzen
Abkürzungen
Ansprüche kennen und erfolgreich durchsetzen
Das Recht auf Bildung und Bildungsförderung wird in Deutschland von verschiedenen Gesetzen geregelt. Die in der Praxis bedeutsamste Förderungsmöglichkeit mit über 190.000 geförderten Personen stellt das Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG) dar, das die weiterführende allgemeinbildende Schulausbildung und die berufsbildende Ausbildung fördert.
Ausbildungsförderung nach dem BAföG erhält, wer die persönlichen Voraussetzungen für eine förderungsfähige Ausbildung erfüllt und finanziell bedürftig im Sinne des Ausbildungsförderungsrechts ist.
Dieser Ratgeber soll Ihnen helfen, BAföG-Förderung zu erhalten und die damit verbundenen Rechte und Ansprüche bestmöglich ausschöpfen zu können. Zu diesem Zweck wird zunächst ausführlich die Rechtslage dargestellt, erklärt und mit vielen Praxishinweisen verbunden. Auf diese Weise haben Sie einen hilfreichen Ratgeber zur Hand, der Sie durch die – nicht immer einfachen und teilweise schwer zu verstehenden – gesetzlichen Regelungen führt.
Das besondere Augenmerk des Ratgebers gilt den Problemen, die in der Praxis am häufigsten auftreten:
Förderung einer weiteren oder anderen Ausbildung nach einem Fachrichtungswechsel oder Ausbildungsabbruch
(Nicht-)Anrechnung von Einkommen und Vermögen, etwa bei Darlehensverträgen, Treuhandverträgen, Sparbüchern oder bei Vermögensübertragungen vor Ausbildungsbeginn
Rechte und Ansprüche in Minijobs
sozialrechtliche Folgen falscher Angaben
strafrechtliche Folgen falscher Angaben
Im abschließenden Kapitel Rechtsschutz finden Sie dann konkrete Hinweise und Erklärungen zum Ablauf des ausbildungsförderungsrechtlichen Widerspruchs- und Klageverfahrens, zusammen mit verschiedenen Musterformulierungen. Diese ermöglichen es Ihnen, schnell und unkompliziert förmliche Rechtsbehelfe ordnungsgemäß einzulegen.
Ergänzt und abgerundet wird dieser Ratgeber durch die Darstellung der Rechtsschutzmöglichkeiten im Bereich Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht ist zwar vom Ausbildungsförderungsrecht getrennt, dessen praktische Bedeutung für Auszubildende und Studierende ist jedoch enorm. Rechtsstreitigkeiten sind häufig, etwa weil der Arbeitgeber bei Krankheit den Lohn nicht bezahlt oder grundlos kündigt. Daher finden Sie auch dazu Praxis-Tipps und Musterformulierungen, mit denen Sie Ihre Rechte bestmöglich durchsetzen können.
Die 3. Auflage berücksichtigt die Änderungen, die sich durch das 29. Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (29. BAföGÄndG) ergeben, etwa die Einführung eines Flexibilitätssemesters und einer Studienstarthilfe, die Verlängerung der Frist für die förderungsunschädliche Vornahme eines Fachrichtungswechsels oder die Erhöhung der Freibeträge beim Einkommen. Die Änderungen treten ab dem Schuljahr bzw. dem Wintersemester 2024/2025 in Kraft.
Mathias Klose
Abkürzungen
AFBGGesetz zur Förderung der beruflichen AufstiegsfortbildungBAföGBerufsausbildungsförderungsgesetzBAföG-ZuschlagsVVerordnung über die Zuschläge zu dem Bedarf nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz bei einer Ausbildung im AuslandBGBBürgerliches GesetzbuchBVFGBundesvertriebenengesetzECTSEuropäisches System zur Anrechnung von StudienleistungenEUEuropäische UnionEWREuropäischer WirtschaftsraumGGGrundgesetzHärteVVerordnung über Zusatzleistungen in Härtefällenp. a.per annoSBG ISozialgesetzbuch Erstes Buch(Allgemeiner Teil)SGB IISozialgesetzbuch Zweites Buch(Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende)SGB IIISozialgesetzbuch Drittes Buch(Arbeitsförderung)SGB VISozialgesetzbuch Sechstes Buch(Gesetzliche Rentenversicherung)SGB VIIISozialgesetzbuch Achtes Buch(Kinder- und Jugendhilfe)SGB XIISozialgesetzbuch Zwölftes Buch(Sozialhilfe)StGBStrafgesetzbuch1. Grundlagen
Ausbildungsstätten
Fernunterricht
Ausbildungsstättenverzeichnisse
Mindestdauer
Keine vorrangigen Leistungen
Ausbildungsstätten
Die Förderung einer Ausbildung ist nur an zugelassenen Ausbildungsstätten möglich. Grundsätzlich sind dies nur öffentliche schulische und hochschulische Ausbildungsstätten. Voraussetzung für eine Förderung ist in jedem Fall die Absolvierung eines Ausbildungsabschnitts mit einer Dauer von mindestens einem halben Studien- oder Schuljahr an einer der öffentlichen Ausbildungsstätten.
Ausnahmsweise kann auch der Besuch von privaten Ausbildungsstätten oder anderen Ausbildungsstätten gefördert werden.
Gefördert wird nicht nur der Besuch der Ausbildungsstätte selbst, sondern auch die Teilnahme an Praktika, die in Zusammenhang mit dem Besuch der Ausbildungsstätte stehen.
Förderungsfähig ist im Einzelnen der Besuch der folgenden Arten von Ausbildungsstätten und -möglichkeiten:
Weiterführende allgemeinbildende Schulen
Zu den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen zählen Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und integrierte Gesamtschulen.
Die Ausbildung ist jedoch nur förderungsfähig, wenn die Schülerin bzw. der Schüler entweder
ledig und kinderlos ist, nicht bei ihren bzw. seinen Eltern wohnt und von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende, zumutbare Ausbildungsstätte nicht erreichbar ist,
nicht bei den Eltern wohnt, einen eigenen Haushalt führt und verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft verbunden ist (oder war) oder
nicht bei den Eltern wohnt, einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt.
Berufsfachschulen und berufliche Grundbildung
Die Berufsfachschule ist eine Schule von mindestens einjähriger Dauer bei Vollzeitunterricht, für deren Besuch keine Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit vorausgesetzt wird. Sie hat die Aufgabe, allgemeine und fachliche Lehrinhalte zu vermitteln und die Schülerin bzw. den Schüler zu befähigen, den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu erlangen, einen Teil der Berufsausbildung in einem oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen abzuleisten oder sie bzw. ihn zu einem Berufsausbildungsabschluss zu führen, der nur in Schulen erworben werden kann, zum Beispiel:
die Hotelberufsfachschule
die Fachschule für Sozialpädagogik
die Berufsfachschule Druck und Medien
Die Ausbildung ist jedoch nur förderungsfähig, wenn die bzw. der Auszubildende entweder
ledig und kinderlos ist, nicht bei ihren bzw. seinen Eltern wohnt und von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte nicht erreichbar ist,
nicht bei seinen Eltern wohnt, einen eigenen Haushalt führt und verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft verbunden ist (oder war) oder
nicht bei seinen Eltern wohnt, einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt.
Der Begriff der Zumutbarkeit ist objektiv zu bestimmen. Es sind ausschließlich ausbildungsbezogene Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Familiäre oder soziale Gesichtspunkte sind unerheblich. Eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte ist vorhanden, wenn die von der Wohnung der Eltern aus erreichbare Ausbildungsstätte nach Lehrstoff, Schulstruktur und Bildungsgang zu dem angestrebten Ausbildungs- und Erziehungsziel, also zum selben Abschluss, führt.
Auszubildende wohnen nur dann bei ihren Eltern, wenn sie mit ihnen in einer häuslichen Gemeinschaft leben. Erforderlich dafür ist das Vorliegen einer häuslichen Familienwohngemeinschaft, die dadurch geprägt ist, dass die bzw. der Auszubildende sich regelmäßig in einem Zustand von Abhängigkeit von verschiedenartigen Zuwendungen befindet. Auszubildende wohnen beispielsweise nicht bei den Eltern, wenn sie lediglich in Schul- oder Semesterferien bei den Eltern wohnen oder sich während eines kurzzeitigen Praktikums in der Wohnung der Eltern aufhalten.
Fachschulklassen
Die Fachschule vermittelt eine vertiefte berufliche Fachbildung und fördert die Allgemeinbildung. Sie setzt grundsätzlich den Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung und/oder eine entsprechende Berufstätigkeit oder praktische Tätigkeit voraus.
Die Förderung ist möglich, wenn die bzw. der Auszubildende
nicht bei ihren bzw. seinen Eltern wohnt und von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte nicht erreichbar ist,
einen eigenen Haushalt führt, verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft verbunden ist bzw. war, oder
einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt
oder wenn
der Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt und sie in einem zumindest zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss vermittelt oder
der Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt.
Der Begriff der Zumutbarkeit ist objektiv zu bestimmen. Es sind ausschließlich ausbildungsbezogene Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Familiäre oder soziale Gesichtspunkte sind unerheblich. Eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte ist vorhanden, wenn die von der Wohnung der Eltern aus erreichbare Ausbildungsstätte nach Lehrstoff, Schulstruktur und Bildungsgang zu dem angestrebten Ausbildungs- und Erziehungsziel, also zum selben Abschluss, führt.
Auszubildende wohnen nur dann bei ihren Eltern, wenn sie mit ihnen in einer häuslichen Gemeinschaft leben. Erforderlich dafür ist das Vorliegen einer häuslichen Familienwohngemeinschaft, die dadurch geprägt ist, dass die bzw. der Auszubildende sich regelmäßig in einem Zustand von Abhängigkeit von verschiedenartigen Zuwendungen befindet. Auszubildende wohnen beispielsweise nicht bei den Eltern, wenn sie lediglich in Schul- oder Semesterferien bei den Eltern wohnen oder sich während eines kurzzeitigen Praktikums in der Wohnung der Eltern aufhalten.
Fachoberschulklassen
Die Fachoberschule baut auf einem mittleren Schulabschluss auf und vermittelt allgemeine, fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 11 und 12 und führt zur Fachhochschulreife. Die Jahrgangsstufe 11 beinhaltet Unterricht und fachpraktische Ausbildung und kann durch eine einschlägige Berufsausbildung ersetzt werden. Den Auszubildenden an Fachoberschulen sind Auszubildende am einjährigen Berufskolleg in Baden-Württemberg zur Erlangung der Fachhochschulreife sowie an der Berufsoberschule in Rheinland-Pfalz gleichgestellt.
Die Förderung ist möglich, wenn
die bzw. der Auszubildende nicht bei ihren bzw. seinen Eltern wohnt oder von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte nicht erreichbar ist, einen eigenen Haushalt führt und verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft verbunden ist (oder war) oder einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt oder
der Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt.
Abendschulen
Abendschulen bieten eine Ausbildung, die im Grundsatz neben einer – zumindest möglichen – Berufstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung am Abend betrieben wird:
Abendhauptschulen
Abendrealschulen
Abendgymnasien
Berufsaufbauschulen
Die Berufsaufbauschule ist eine Schule, die in Vollzeit mindestens ein Jahr neben einer Berufsschule oder nach erfüllter Berufsschulpflicht von Jugendlichen besucht wird, die in einer Berufsausbildung stehen oder eine solche abgeschlossen haben. Sie vermittelt eine über das Ziel der Berufsschule hinausgehende allgemeine und fachtheoretische Bildung und führt zu einem mittleren Schulabschluss.
Kollegs
Das Kolleg führt in einem Bildungsgang von in der Regel drei und höchstens vier Jahren zur allgemeinen oder zu einer fachgebundenen Hochschulreife.
Höhere Fachschulen
Die Höhere Fachschule baut auf einem mittleren Bildungsabschluss oder einer gleichwertigen Vorbildung auf und führt in vier bis sechs Halbjahren zu einem Abschluss, der in der Regel durch eine staatliche Prüfung erlangt wird und den unmittelbaren Eintritt in einen Beruf gehobener Position ermöglicht. Er führt unter besonderen Umständen zur allgemeinen oder zu einer fachgebundenen Hochschulreife.
Akademien
Akademien sind berufliche Ausbildungsstätten, die keine Hochschulen sind und deren zu einem gehobenen Berufsabschluss führender Bildungsgang mindestens fünf Halbjahre dauert, zum Beispiel:
der Studiengang „Sozialwesen“ mit dem Abschluss Diplom-Sozialpädagogin bzw. Diplom-Sozialpädagoge – Berufsakademie
ein Aufbaustudium „Dolmetschen“ an der Fachakademie für Fremdsprachenberufe am Sprachen- und Dolmetscherinstitut
Für den Besuch von Akademien, die keine Abschlüsse verleihen, die nach Landesrecht Hochschulabschlüssen gleichgestellt sind, wird Ausbildungsförderung nur geleistet, wenn die zuständige Landesbehörde dies anerkennt.
Hochschulen
Hochschulen bereiten auf Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern. Voraussetzung der Zulassung ist der Nachweis der für das gewählte Studium erforderlichen Qualifikation, etwa die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife. Erfasst werden Hochschulen jeder Art und jeder Organisationsform, zum Beispiel:
Universitäten
Fachhochschulen
Kunsthochschulen
Ausbildungsstätten kraft Rechtsverordnung
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann durch Rechtsverordnungen bestimmen, dass Ausbildungsförderung für den Besuch von bestimmten Ausbildungsstätten geleistet wird. Zu nennen sind hier besonders:
Verordnung über die Ausbildungsförderung für Medizinalfachberufe (MedizinalfachberufeV)
Verordnung über die Ausbildungsförderung für den Besuch von Ausbildungsstätten für kirchliche Berufe (KirchenberufeV)
Verordnung über die Ausbildungsförderung für den Besuch von Ausbildungsstätten für Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (PsychThV)
Verordnung über die Ausbildungsförderung für den Besuch von Instituten zur Ausbildung von Fachlehrern und Sportlehrern (BAföG-FachlehrerV)
Verordnung über die Ausbildungsförderung für soziale Pflegeberufe (SozPflegerV)
Verordnung über die Ausbildungsförderung für den Besuch von Ausbildungsstätten, an denen Schulversuche durchgeführt werden (SchulversucheV)
Förderungsfähig ist eine Ausbildung nur, wenn die Ausbildungsstätte auch tatsächlich besucht wird.
Ein tatsächlicher Besuch ist anzunehmen, wenn eine Auszubildende bzw. ein Auszubildender einer Ausbildungsstätte organisationsrechtlich zugehört und die Ausbildung an ihr tatsächlich betreibt. Die bloße Schuleinschreibung oder Immatrikulation an einer Hochschule ist nicht ausreichend. Wird eine Ausbildung beendet, abgebrochen oder auch nur unterbrochen, wird die Ausbildung nicht mehr tatsächlich betrieben. Besucht eine Auszubildende bzw. ein Auszubildender einzelne Lehrveranstaltungen nicht oder bleibt sie bzw. er aus ausbildungsbedingten Gründen, etwa während einer kurzen Zeitspanne vor dem Abgabetermin einer Hausarbeit, den Lehrveranstaltungen fern und widmet sich dem häuslichen Studium, so betreibt sie bzw. er das Studium nach wie vor. Ebenso wenn eine Studierende bzw. ein Studierender das Studium nachlässig betreibt.
Praktika
Ausbildungsförderung wird auch für die Mindestteilnahmedauer an einem Praktikum geleistet, das in Zusammenhang mit dem Besuch einer der Ausbildungsstätten gefordert wird und dessen Inhalt in Ausbildungsbestimmungen geregelt ist.
Fernunterricht
Bei den oben dargestellten Ausbildungsstätten handelt es sich um solche, die ihre Ausbildung in Form des Direktunterrichts erbringen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist aber auch eine Ausbildung in Form von Fernunterricht förderungsfähig.
Der Fernunterricht ist nicht zu verwechseln mit dem während der Corona-Pandemie weit verbreiteten Distanzunterricht. Distanzunterricht ersetzt aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie den normalerweise stattfindenden Präsenzunterricht.
Fernunterricht hingegen ist die auf vertraglicher Grundlage erfolgende, entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind und der Lehrende oder seine Beauftragte bzw. sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen.
Eine ausschließliche oder überwiegende räumliche Trennung von Lehrendem und Lernendem liegt vor, wenn nach dem Lehrgangsprogramm der begleitende Direktunterricht weniger als die Hälfte des Gesamtunterrichts ausmacht, also der Zeitaufwand zur Bearbeitung der vom Fernunterrichtsveranstalter versandten Unterrichtsmaterialien die Zahl der Direktunterrichtsstunden übersteigt.
Ausbildungsförderung wird für die Teilnahme an Fernunterrichtslehrgängen geleistet, soweit sie unter denselben Zugangsvoraussetzungen auf denselben Abschluss vorbereiten wie:
Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
integrierte Gesamtschulen
Berufsfachschulen, einschließlich der Klassen der beruflichen Grundbildung ab Klasse 10
Fach- und Fachoberschulklassen, wenn deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt und die bzw. der Auszubildende nicht bei ihren bzw. seinen Eltern wohnt und
von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte nicht erreichbar ist,
sie bzw. er einen eigenen Haushalt führt und verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft verbunden ist (oder war) oder
einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt
Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, wenn deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt und sie in einem zumindest zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln
Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt
Abendhauptschulen
Berufsaufbauschulen
Abendrealschulen
Abendgymnasien und Kollegs
Höhere Fachschulen
Akademien
Hochschulen
durch Rechtsverordnung bestimmte Ausbildungsstätten
Ausbildungsförderung wird nur für die Teilnahme an Lehrgängen geleistet, die nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz zugelassen sind oder von einem öffentlich-rechtlichen Träger veranstaltet werden.
Auszubildende sollten sich unbedingt vor Beginn der Ausbildung beim Anbieter erkundigen, ob die Ausbildung nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz zugelassen ist oder es sich um einen öffentlich-rechtlichen Träger handelt.
Ausbildungsförderung wird für die Teilnahme an Fernunterrichtslehrgängen nur geleistet, wenn
die bzw. der Auszubildende in den sechs Monaten vor Beginn des Bewilligungszeitraums erfolgreich an dem Lehrgang teilgenommen hat,
sie bzw. er die Vorbereitung auf den Ausbildungsabschluss in längstens zwölf Monaten beenden kann,
die Teilnahme an dem Lehrgang die Arbeitskraft der bzw. des Auszubildenden voll in Anspruch nimmt und
diese Zeit zumindest drei aufeinanderfolgende Kalendermonate dauert.
Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen und von der bzw. vom Auszubildenden durch eine Bescheinigung des Fernlehrinstituts nachgewiesen werden. Die Bescheinigung wird nur anerkannt, wenn sie vom hauptberuflichen Mitarbeitenden des Fernlehrinstituts, der den Lehrgang pädagogisch betreut, unterschrieben ist.
Die Teilnahme an dem Lehrgang nimmt die Arbeitskraft der bzw. des Auszubildenden voll in Anspruch, wenn die Unterrichtszeit mindestens 20 Wochenstunden zu jeweils 60 Minuten beträgt. Ob die Teilnahme an einem Fernunterrichtslehrgang mindestens 20 Wochenstunden dauert, ist nach der konkreten Ausgestaltung des Lehrgangs im Bewilligungszeitraum und der regelmäßigen wöchentlichen Belastung eines durchschnittlich begabten Teilnehmenden zu beurteilen und nicht nach den Angaben des Fernlehrinstituts; maßgebend ist, ob der vermittelte Unterrichtsstoff quantitativ demjenigen eines Direktunterrichts von mindestens 20 Wochenstunden entspricht.
Ausbildungsstättenverzeichnisse
Um Klarheit und Sicherheit für Auszubildende zu schaffen, wird in den einzelnen Bundesländern ein Verzeichnis über die im jeweiligen Land gelegenen Ausbildungsstätten geführt, für deren Besuch Ausbildungsförderung zu leisten ist, und der von Fernlehrinstituten mit Hauptsitz in diesem Land herausgegebenen, gleichgestellten Fernunterrichtslehrgänge. Darin wird angegeben, welcher Schulgattung die Ausbildungsstätte oder der Lehrgang zugeordnet ist sowie ob und für welche Dauer ein Praktikum gefördert wird.
Die Ausbildungsstättenverzeichnisse der Länder sind im Internet einzusehen:
Baden-Württemberg: www.ausbildungsstaetten-bw.de
Bayern: www.studieren-in-bayern.de/index.php?id=157&search=y#suchergebnis
Berlin: http://asv.stw.berlin
Brandenburg: https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/wissenschaft/ausbildungsfoerderung/ausbildungsstaettenverzeichnis
Bremen: https://www.transparenz.bremen.de/bafoeg-ausbildungsstaettenverzeichnis-172052?asl=bremen02.c.732.de
Hamburg: https://ausbildungsverzeichnis.hamburg.de
Hessen: www.hmwk-hessen.de/ausbildungsstaetten_bafoeg.php
Mecklenburg-Vorpommern: www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Foerderungen/BAfoeG
Niedersachsen: https://www.astv.niedersachsen.de/
Nordrhein-Westfalen: https://extra.bezreg-koeln.nrw.de/ausb-st/
Rheinland-Pfalz: https://addinter.service24.rlp.de/cgi-bin-inter/bafoeg1.mbr/start
Saarland: www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mbk/Bildungsserver/Unterricht_und_Bildungsthemen/Berufstudienorientierung/ausbildungsstaettenverzeichnis.html
Sachsen: www.lds.sachsen.de/lfabf/?art_param=780
Sachsen-Anhalt: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/2_bauordnungkommunales/207/bafoeg/ausbildungsstaetten_1.pdf
Schleswig-Holstein: www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Broschueren/Wissenschaft/Ausbildungsstaettenverzeichnis.html
Thüringen: https://tlvwa-apps.thueringen.de/ausbildungstaettenverzeichnis
Mindestdauer
Ausbildungsförderung für ein Praktikum und für die Ausbildung an der Ausbildungsstätte wird nur geleistet, wenn der Ausbildungsabschnitt mindestens ein Schul- oder Studienhalbjahr dauert und die Ausbildung die Arbeitskraft der bzw. des Auszubildenden im Allgemeinen voll in Anspruch nimmt.
Das ist der Fall, wenn nach den Ausbildungsbestimmungen oder der allgemeinen Erfahrung die Ausbildung – bestehend aus Unterricht, Vorlesung, Praktika, Vor- und Nachbereitung – 40 Wochenstunden erfordert, das heißt die Ausbildung in Vollzeit durchgeführt wird. Bei Hochschulausbildungen ist grundsätzlich von einer Vollzeitausbildung auszugehen, wenn dies in der Eignungsbescheinigung bestätigt wird oder wenn im Durchschnitt pro Semester 30 ECTS-Leistungspunkte vergeben werden.
Im schulischen Bereich ist eine Vollzeitausbildung nur anzunehmen, wenn die Unterrichtszeit mindestens 20 Wochenstunden zu jeweils 60 Minuten beträgt.
Für die Beurteilung, ob eine Studierende bzw. ein Studierender einem Vollzeitstudium nachgeht, kommt es nicht darauf an, ob die Lehrveranstaltungen der Hochschule auf das Wochenende oder etwa in die Abendstunden verlegt werden, um der bzw. dem Studierenden so die Möglichkeit zu geben, neben dem (Vollzeit-)Studium einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, da dann der Anspruch auf Ausbildungsförderung von den zufälligen organisatorischen Vorgaben der Hochschule abhängig sein würde.
Grundsätzlich ist nach dem BAföG nur eine einzige Ausbildung förderungsfähig. Eine vollständig in Teilzeitform durchgeführte Ausbildung ist jedoch nicht förderungsfähig und schließt daher die Förderung einer zusätzlichen weiteren Ausbildung nicht aus.
Im schulischen Bereich ist der Religionsunterricht mitzuzählen, auch wenn eine Auszubildende bzw. ein Auszubildender im Einzelfall nicht daran teilnimmt.
Die Ausbildungsdauer bei einer im Wege des Fernunterrichts absolvierten Ausbildung muss wenigstens drei aufeinanderfolgende Kalendermonate dauern. Eine Förderung ist längstens für zwölf Monate möglich.
Keine vorrangigen Leistungen
Selbst wenn die vorgenannten Voraussetzungen für eine Ausbildungsförderung vorliegen, ist die Förderung ausgeschlossen, wenn eine andere (Sozial-)Leistung Vorrang gegenüber der Ausbildungsförderung nach dem BAföG besitzt.
Arbeitslosengeld
Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung nach dem SGB III schließt nach § 2 Abs. 6 Nr. 1 BAföG die Förderungsfähigkeit nach dem BAföG aus.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung. Das Arbeitslosengeld wird von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt.
Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung setzt voraus, dass die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer sich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend gemeldet und die Anwartschaftszeit erfüllt hat, also im Regelfall in der Rahmenfrist von zwei Jahren mindestens zwölf Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden hat. Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung kann aber auch dann bestehen, wenn die berufliche Weiterbildung nicht aus der Arbeitslosigkeit heraus erfolgt, sondern sich unmittelbar an eine beendete Beschäftigung anschließt.
Bei einer Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer, die bzw. der vor Eintritt in die Maßnahme nicht arbeitslos war, gelten die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld als erfüllt, wenn sie bzw. er bei Eintritt in die Maßnahme einen Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit hätte, der weder ausgeschöpft noch erloschen ist oder die Anwartschaftszeit im Fall von Arbeitslosigkeit am Tag des Eintritts in die Maßnahme der beruflichen Weiterbildung erfüllt hätte.
Neben der Zahlung von Arbeitslosengeld können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei beruflicher Weiterbildung durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn die Weiterbildung notwendig ist,
um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzugliedern,
um eine ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder
weil ihnen wegen eines fehlenden Berufsabschlusses die Notwendigkeit der Weiterbildung anerkannt wurde, die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat und die Maßnahme sowie der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen sind.
Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Förderung wird durch einen sogenannten Bildungsgutschein bescheinigt.
Arbeitslosengeld II bzw. Bürgergeld
Arbeitslosengeld II, jetzt auch Bürgergeld genannt, bei beruflicher Weiterbildung schließt die Förderfähigkeit nach dem BAföG aus.
Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II erhalten vom zuständigen Jobcenter Arbeitslosengeld II, sofern sie erwerbsfähig sind. Dieses wird weitergezahlt, während Leistungen zur beruflichen Weiterbildung erbracht werden.
Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des BAföG dem Grunde nach förderungsfähig ist, können Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II durch das Jobcenter haben.
Folgende Leistungen kommen in Betracht:
Werdenden Müttern wird nach der zwölften Schwangerschaftswoche bis zum Ende des Monats, in welchen die Entbindung fällt, ein Mehrbedarf gewährt, ebenso für Erstausstattungen für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt.
Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen, ist ein Mehrbedarf anzuerkennen.
Bei Personen, die aus medizinischen Gründen einer kostenaufwendigen Ernährung bedürfen, wird ein Mehrbedarf in angemessener Höhe anerkannt.
Soweit ein Härtefall vorliegt, das heißt im Einzelfall ein unabweisbarer, besonderer Bedarf besteht, wird ein Mehrbedarf anerkannt.
Sollten Sie unsicher sein, ob Sie vorrangig oder ergänzend Leistungen der Bundesagentur für Arbeit oder des Jobcenters beanspruchen können, lassen Sie sich dort – oder vom Amt für Ausbildungsförderung – beraten. Alle Sozialbehörden sind gesetzlich zur Beratung und Auskunft verpflichtet.