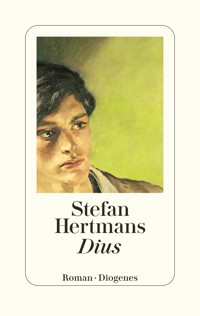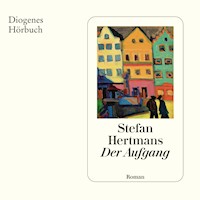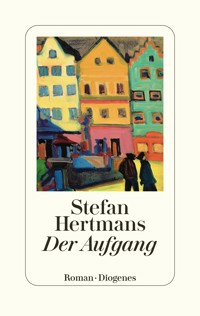
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Stefan Hertmans sich zum Kauf eines alten Hauses in Gent entschließt, ahnt er nichts von den Geschichten, die sich hinter dessen Mauern abgespielt haben. Er macht sich auf die Suche nach den Spuren der früheren Bewohner und entdeckt die fesselnde Geschichte eines SS-Offiziers und dessen pazifistischer Frau. Angetrieben von einem tiefen Bedürfnis nach Verständnis, tastet sich Hertmans an diese Figuren heran und beleuchtet damit zugleich die Tragödie eines ganzen Landes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stefan Hertmans
Der Aufgang
Roman
Aus dem Niederländischen von Ira Wilhelm
Diogenes
Seht ihr das Tier, das läuft,
und zwar überall auf die gleiche Weise?
Alessandro Baricco, Die Barbaren
Im ersten Jahr des neuen Jahrtausends fiel mir ein Buch in die Hände, aus dem ich erfahren sollte, dass ich zwanzig Jahre im Haus eines ehemaligen Mitglieds der SS gewohnt hatte. Nicht, dass es vorher keine Hinweise darauf gegeben hätte: Selbst Notar De Potter hatte an dem Tag, als ich mit ihm das Haus besichtigte, den früheren Bewohner beiläufig erwähnt; ich schenkte dem jedoch nur wenig Aufmerksamkeit. Vielleicht verdrängte ich es danach auch, beeindruckt, wie ich damals war von den schmerzvollen Gedichten Paul Celans, den Zeugnissen Primo Levis und den ungezählten Büchern und Dokumentarfilmen, die sprachlos machten angesichts des Unvermögens einer ganzen Generation, das Undenkbare in Worte zu fassen. Doch nun musste ich zusehen, wie sich meine intimen Erinnerungen mit einer Wirklichkeit vollsogen, für die ich keine Vorstellungskraft besaß, die ich aber auch nicht länger von mir stoßen konnte. Es war, als spukten plötzlich Gespenster durch die mir so wohlbekannten Zimmer; nur zu gerne hätte ich ihnen einige Fragen gestellt, doch sie gingen ungehindert durch mich hindurch. Gegen nichts hegte ich einen größeren Widerwillen, als über Menschen zu schreiben, wie sie sich jetzt, Geistern gleich, in mein Leben schlichen. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich das Haus zum ersten Mal sah. Es muss im Spätsommer 1979 gewesen sein. Ich ging in einem kleinen Stadtpark spazieren, an den ein paar alte Häuser grenzten; die Zäune erlaubten einen Blick auf sie. Um die verrosteten Gitterstäbe eines der Zäune wanden sich die dicken, fast schwarzen Äste eines Blauregens. Schwer von Staub hingen späte Blütentrauben herab, dennoch rührte mich ihr Duft – er führte mich zurück in den verwilderten Garten meiner Kindheit; neugierig starrte ich durch die Stäbe. Mitten im verwahrlosten Hinterhof schoss ein schlanker Ahorn auf, zwischen undefinierbarem Müll und einem Kohlenschuppen mit einem Häuflein Spaltholz davor. Ungefähr fünf Meter vom Zaun entfernt fiel mein Auge auf das zerbrochene Fenster eines baufälligen Rückgebäudes, daneben erstreckte sich eine Veranda, durch deren hohes Bogenfenster man in die dunklen, leeren Räume des Haupthauses sehen konnte, wo fern und vage das Licht der Vorderseite schimmerte.
Eine merkwürdige Erregung erfasste mich; ich verließ den Park, ging einmal um den Häuserblock und fand mich in einer etwas trostlosen Straße wieder. Das fragliche Gebäude war ein großes Patrizierhaus mit einer pockennarbigen Fassade, durch die sich über Jahrzehnte die Feuchtigkeit gefressen hatte. Es besaß hohe Fenster, und die abblätternde Farbe auf der Haustüre hatte bessere Zeiten gesehen; es war nicht zu übersehen, dass das Haus seit Längerem leer stand. In einem der Fenster hing eine von Kondenswasser aufgeweichte Verkaufsanzeige. Es fing an zu nieseln, wie es nur in alten Städten nieseln kann; der Kupferdeckel des Briefkastens klapperte missmutig im Wind.
Das Haus stand im Genter Stadtviertel Patershol, benannt nach dem schmalen, höhlenartigen Zugang, der über einen Kanal zu einem mittelalterlichen Kloster führte und durch den die Ordensbrüder nicht nur Lebensmittel heranschipperten, sondern, wie der Volksmund behauptete, heimlich auch Huren. Grund und Boden waren ursprünglich einmal im Besitz der Grafen von Flandern; in dem an eine Burg aus dem zwölften Jahrhundert grenzenden Viertel hatten jahrhundertelang Patrizier und wohlhabende Bürger gewohnt, bevor mit dem Aufkommen des Proletariats viele der großen, vornehmen Häuser durch kleine Arbeiterhäuser ersetzt wurden, die Armut sich in den schmalen Gassen ausbreitete und die Gegend einen schlechten Ruf bekam. Alles war am Verfallen, als sich Ende der Sechzigerjahre im Zuge der Studentenrevolte die Boheme hier niederließ. Das Haus, vor dem ich nun stand, lag am nordöstlichen Rand des Viertels, in einer Straße namens Drongenhof, nicht weit von dort, wo die Leie träge und dunkel an den feuchten Häusern entlangfloss.
Wichtige Entscheidungen in meinem Leben habe ich selten mit Bedacht gefällt. Fast immer befand ich mich dabei in einer Art Trance, die mir das Gefühl gab, von einer unsichtbaren Hand im Rücken vorwärtsgestoßen zu werden und wie der sprichwörtliche Narr kopflos meinem Schicksal entgegenzustolpern. Ich zog ein Notizbuch aus meiner abgetragenen Lederjacke und notierte mir die Telefonnummer. Noch am gleichen Tag rief ich an. Zwei Tage später besichtigte ich das Haus; es war im Besitz der frankobelgischen Familie De Potter, die sich noch rasch einiger Besitztümer entledigen wollte, da mit dem Jahreswechsel die liegenschaftsbezogenen Steuerabgaben empfindlich erhöht werden sollten.
Bei der Besichtigung des Hauses entgingen mir der Schimmel und die Feuchtigkeit keineswegs, auch nicht das Brackwasser in den vollgelaufenen Kellern oder die verstreut herumstehenden vermoderten Möbel, vor allem aber sah ich das hohe Treppenhaus, den wunderbaren Kamin aus rosabräunlichem Marmor im vorderen Wohnzimmer, den langen Flur, verkleidet mit schwarzglänzendem, mit einer Bordüre aus graugeädertem Carrara abgesetztem Ardenner Stein, und die breiten Dielen in den großen Räumen der oberen Stockwerke – das unbekannte Leben zog mich unaufhaltsam an.
Wir gingen vom Keller bis zum Dachboden, der Aufgang dauerte fast zwei Stunden, denn Notar De Potter erstellte währenddessen, unter der ständig eingeforderten Beipflichtung meinerseits, eine detaillierte Bestandsaufnahme. Auf dem Dachboden sah ich von einem staubgrauen Balken ein Seil hängen; im hohen, spitz zulaufenden Dach fehlten einige Ziegel, durch die der graue Stadthimmel zu sehen war. Irgendwo hörte ich Tauben mit den Flügeln schlagen.
Schon immer mochte ich den für alte Häuser so typischen Geruch von Feuchtigkeit und Verfall. Vielleicht lag das daran, dass ich als kurz nach dem Krieg geborenes Kind an der Hand meiner Mutter noch an vielen von Bomben beschädigten Häusern vorbeigekommen war, wodurch feuchtes Gemäuer und Schimmel für mich zu dem werden konnten, was die berühmte Madeleine für Proust war. Einem noch erinnerungslosen Kind ist selbst der Geruch nach Verderbnis eine Quelle des Glücks.
Ich kaufte das Haus aus einem Impuls heraus und für einen Betrag, für den man heute nicht einmal mehr einen Mittelklassewagen bekommt. Da ich nicht gerade begütert war, lieh ich mir das Geld zinslos von meinem Vater und versprach ihm, es in monatlichen Abschlägen so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Damals erledigte man solche Transaktionen noch in bar; bis heute sehe ich die makellosen Hände meines Vaters vor mir, wie sie die sorgfältig zusammengesparten Geldscheine auf die kalbslederne Schreibunterlage des Notars blättern.
Das Buch trug den Titel Zoon van een »foute« Vlaming (Sohn eines »falschen« Flamen). Der Autor hieß Adriaan Verhulst, ich hatte bei ihm studiert. Der inzwischen emeritierte Geschichtsprofessor genoss während seiner akademischen Laufbahn großes Ansehen, gehörte den Vorständen des öffentlichen Rundfunks und zahlreicher kultureller Institutionen an, war Verfasser vieler wissenschaftlicher Artikel und bekannt nicht nur für seine liberalen Ansichten, sondern auch für seinen rigiden und ernsten Charakter. In den nicht ganz unproblematischen Bekenntnissen, verfasst gegen Ende seines Lebens, erinnert er sich irgendwann auch des Hauses, in dem er seine Kindheit verbracht hatte, wobei er mich namentlich als den aktuellen Bewohner erwähnt. Als ich das las, starrte ich ungläubig auf das Buch in meinen Händen; ich hatte das Haus gerade wieder verkauft und nahm mir vor, meinem ehemaligen Professor einen Besuch abzustatten, doch bevor es dazu kam, starb er. Ich stand widerwillig vor einer Wand aus Rätseln und Schweigen.
Nun gut, dachte ich, dann werde ich eben nicht die Geschichte eines SS-Mannes erzählen; solche Geschichten gibt es ohnehin zuhauf. Ich werde die Geschichte eines Hauses und seiner Bewohner erzählen. Allerdings dauerte es Jahre, bis ich das Material für die nun folgende Geschichte zusammenhatte. Einige Augenzeugen leben noch, sie sind hochbetagt und haben mir ihre Erinnerungen, soweit das möglich war, in vielen Einzelheiten geschildert. Erst später, nachdem ich alles mühsam durchgearbeitet hatte, wurde mir klar, dass der sonst so gewissenhafte Historiker Adriaan Verhulst niemals Einsicht in die Gerichtsakten genommen hatte, in denen die ganze Wahrheit stand. Er hätte es problemlos tun können, doch dann wäre das Porträt seines Vaters wohl kaum so milde ausgefallen.
I
Da macht’ es zögern mich mit weitern Fragen.
Dante, Paradies, Dritter Gesang
1
Adriaans Vater, Willem Verhulst, wurde am 10. Juli 1898 in Berchem bei Antwerpen geboren, in derselben Gemeinde, wo er 1975 nach vielen Irrungen und Wirrungen auch begraben wird – etwa vier Jahre bevor ich jenes Haus in Gent erstand, in dem er jahrzehntelang gewohnt hatte.
In einem merkwürdigen, vermutlich im Gefängnis verfassten autobiografischen Fragment mit dem Titel Wils jeugd (Wils Kindheit und Jugend) sieht Willem Verhulst ein Omen darin, dass er um ein Haar am 11. Juli zur Welt gekommen wäre – dem Gedenktag der Goldene-Sporen-Schlacht des Jahres 1302, einer zum nationalistischen Gründungsmythos erklärten Schlacht, in der eine Handvoll flämischer Bürgermilizionäre, notabene mit Unterstützung wallonischer Truppen, auf dem Groeningekouter unweit von Kortrijk die Armee des französischen Königs Philipp IV. schlug.
Willem stammte aus einer großen Familie mit neun Kindern, vier Jungen und fünf Mädchen; er war der Benjamin und sofort der Augenstern der Mutter. Der Vater führte in der Boomgaardstraat unweit des Albertparks, zwischen dem Groen Kwartier und Oud-Berchem, eine Diamantschleiferei. Ein Jahrhundert nach seiner Geburt ist die Boomgaardstraat eine ganz normale Straße mit noch recht jungen Bäumen. Als ich sie entlanggehe, entladen einige orthodox gekleidete jüdische Männer vor einem im Souterrain liegenden Lager gerade einen Lastwagen. Da hier nur wenige Häuser über eine derartige Lagerfläche verfügen, vermute ich, dass sich dort durchaus eine Diamantschleiferei befunden haben könnte. Ich erkundige mich bei den Männern danach; einer der Männer fragt zurück, warum ich das wissen wolle. Gern hätte ich ihm geantwortet, dass ich das Elternhaus eines ehemaligen Mitglieds der SS suche, halte es dann aber doch für ratsamer zu schweigen.
An den ehemaligen Obstgarten, der der Straße den Namen gab, erinnert heute noch ein Altenpflegeheim mit dem arkadischen Namen Ten Gaarde. Auch das alte Wirtshaus De Hand, wo Willems Vater regelmäßig ein Gläschen zu viel trank, gibt es noch. Nicht weit von hier muss früher einmal ein Kutscher gewohnt haben; es soll hier immer nach Pferdemist gestunken haben. Ich habe eine alte Radierung gefunden, auf der die Straße und ein romantischer Bauernhof abgebildet sind. Kopfweiden und Schnee, ein Reetdach, Felder – eine Ansicht aus verlorenen Zeiten. Heute schieben sich hier in endlosen Staus die Autos vorbei, grau wie die Seelen in Dantes Hölle.
Hinter dem Haus führte Willems Schwester Caroline, Carlo genannt, eine »Tanzschule für Salontänze«; die Schellackplatten lagen in dünnen braunen Hüllen mit tintenblauem Aufdruck auf dem Tischchen neben dem Grammofon. Damals der letzte Schrei. Man hörte nur das Scharren von Füßen auf dem mit feinem Sand bestreuten Fichtenholzboden und die rhythmischen Anfeuerungsrufe einer jungen Frau; am Schluss der Tanzstunde, während die letzten Takte der Musik verklangen, kamen die Kinder hereingerannt und tobten zwischen den schwarzgekleideten Paaren umher.
Unter ihnen der vierjährige Willem.
Es muss an einem Frühlingsabend gewesen sein, als der kleine Junge auf einmal zu Boden stürzt. Er stöhnt, rollt mit den Augen, die Bewegungen sind ruckartig und gehen in heftige Krämpfe über. Schaum tritt ihm vor den Mund, die Schwestern kreischen auf und schreien nach der Mutter; die stürzt herbei, sieht das zuckende Kind, versucht, den auf den Bretterboden schlagenden Kopf zu stützen, steckt den Finger in den Mund des Jungen, damit er sich nicht die Zunge abbeißt – er erbricht sich und würgt, die Augen treten hervor. Die Mutter kennt die Fieberkrämpfe der Kinder, schickt eines der Mädchen nach einem mit kaltem Wasser getränkten Tuch und hält das Kind fest, bis die Spasmen abnehmen. Langsam kommt der Junge zu sich, stammelt, jammert und weint. Die Mutter trägt ihn ins Haus und legt ihn aufs Sofa, wo er in einen tiefen Schlaf fällt; als er Stunden später erwacht, bekommt er warme Milch und ein Butterbrot mit Pflaumenmus. Beim Trinken verschüttet er die Hälfte und fängt wieder an zu weinen. Er will zur Toilette, stößt gegen den Türrahmen. Wieder Weinen und dann sein Schrei: Mama, ich seh nichts mehr! Die Mutter eilt herbei, betrachtet prüfend ihr Kind und sieht, dass die Augen ins Leere starren. Sie murmelt ein Stoßgebet, hilft dem Jungen zum Klo im Innenhof, setzt ihn aufs Holzbrett und legt ihm die Hand aufs Knie, während er pullert. Es wird alles wieder gut, Wimpje, sagt sie. Sie trägt ihn zum Sofa zurück, wo der Junge erneut einschläft und erst erwacht, als es schon dunkel ist. Inzwischen ist der Vater nach Hause gekommen, er bewegt die Hand vor den Augen des Kindes hin und her. Das eine Auge folgt der Hand, das andere nicht. Vielleicht ist ja auch das andere Auge bis morgen wieder gut, sagt der Vater, immerhin sieht er ja mit dem rechten noch was.
Doch das andere Auge wird nicht wieder gut. In den nächsten Monaten stößt sich der Junge überall, hat immer wieder kleine Wunden am Kopf und ständig aufgeschürfte Knie. Will er die Treppe rasch hinuntereilen, stürzt er; ein ums andere Mal schätzt er Abstände falsch ein, stolpert über Bordsteinkanten und Türschwellen, läuft gegen die großen Kartoffelhorden in der Waschküche, bleibt an einem Nagel hängen und reißt sich die Hüfte auf. Die Nachbarskinder hänseln ihn, gehen dicht vor ihm her, wollen ihn verwirren, skandieren im Chor: Hier kommt Willem Schiel, der sieht nicht mehr viel! »Es stimmt. Was ich sehen sollte, habe ich nicht gesehen«, schreibt er später mit gewagter Ironie, »dafür aber vieles, was ich besser nicht gesehen hätte, und so zu tun, als wäre ich blind, kam mir später sehr zupass, und ich konnte es mir nur schwer abgewöhnen.«
2
Willem sitzt unter dem Glasdach hinter dem Haus und spielt mit Murmeln. Drinnen erklingt die immergleiche Melodie, eine seiner Schwestern übt Klavier. Er hört den Vater singen: Je crois en toi, Maître de la nature / Semant partout la vie et la fécondité. Das heute noch in Frankreich bekannte Lied mit dem Titel Le crédo du paysan rühmt Gott den HERRN für die Schöpfung und die Fruchtbarkeit der Erde, doch die Zeilen, die Gott zur Ehre gereichen sollen, verballhornt der Vater, indem er jedes dieu durch bête ersetzt: Bête Tout-Puissant, qui fis la créature – es hallt durchs ganze Haus, bis seine Frau ruft, dass es nun aber genug sei. Der Diamantschleifer ist überzeugter Darwinist und will die Kinder vor dem behüten, was er den Wahnsinn des Glaubens nennt, er zitiert Voltaire auswendig und nennt Priester Schwarzröcke und Kohlenträger.
Der Junge bekommt Panikattacken, wenn seine Mutter nicht in der Nähe ist; er weigert sich einzuschlafen, bevor er unter das Bett geschaut hat. Er will nicht länger aufs Plumpsklo im Hinterhaus, weil er Angst hat vor dem schwarzen, stinkenden Loch. Die Schatten des Kerzenlichts grausen ihn, und quietscht eine Türe, fängt er an zu zittern. Bei Gewitter verkriecht er sich, überzeugt, ein Geist komme sein anderes Auge holen. Die Schwestern verwöhnen ihn, manchmal darf er zu einer von ihnen ins Bett – was ihn später zu der Bemerkung veranlasst: »Ich habe schon immer bei den Frauen Trost gesucht, dabei war ich sehr schüchtern, ein paar Frauen würden das aber wohl bestreiten.«
Er wird ein richtiger, wenn auch sympathischer, Lausebengel, mindestens einmal in der Woche schicken ihn die Eltern ohne Abendessen ins Bett. »Hatte ich etwas ausgefressen, ging ich von selber«, schreibt er. »So kam ich weiteren Strafen zuvor.« Bis zu seinem sechsten Lebensjahr trägt er ein Kleidchen, was damals aus hygienischen Gründen üblich war, er spielt mit Puppen und erinnert sich später, viele von ihnen aufgerissen zu haben, um nach den Eingeweiden zu suchen. Auch ihre Augen will er ständig »reparieren«, weshalb viele blinde Puppen im Haus herumliegen.
Eines Tages kommt die Mutter mit zwei Ärzten in sein Zimmer. Bis ins hohe Alter erinnert er sich an jedes Detail, sogar die Namen weiß er noch: Dr. Van Rechtesteen und Dr. Bayence. Er ist ungefähr sechs Jahre alt. Als Van Rechtesteen etwas Unverständliches murmelt und sich suchend umblickt, deutet die Mutter auf das Tischchen mit Willems Bilderbüchern. Der Arzt reißt von einem der Bücher das Titelblatt ab. Willem protestiert, schreit. Nicht! Das ist mein Lieblingsbuch! Der Arzt spricht beruhigende Worte, geht auf ihn zu, rollt dabei das widerspenstige Blatt zu einem Trichter und drückt ihn dem Kind auf das Auge; er gießt eine Flüssigkeit hinein. Willem verliert das Bewusstsein.
Als er wieder zu sich kommt, liegt er im Bett, die Augen mit einer nach Desinfektionsmittel riechenden Kompresse verbunden. Im Kopf spürt er einen scharfen Schmerz, er tastet – da, die Hand der Mutter, er will den Verband abreißen, doch die Mutter besänftigt das panische Kind. Der Verband darf auf keinen Fall ab; auch wenn der fahle, rostfarbene Fleck darauf die Mutter vor Ekel fast erbrechen lässt. Mehrere Wochen lang wacht sie an Willems Seite, hilft ihm mit der Bettpfanne, wäscht und kleidet ihn, redet ihm gut zu und liest ihm vor. Er bekommt nur flüssige Nahrung. Zwei Monate liegt er blind im Bett. Wenn die Mutter sich für ein paar Stunden von einer der Schwestern vertreten lässt und er vergeblich nach ihrer Hand tastet, tobt er, bis sie wieder da ist.
Dann wird der Verband abgenommen; über dem operierten Auge liegt ein dünner Schleier trüber Flüssigkeit. Mit einer Pinzette entfernt der Arzt einige Schorfpartikel, der Junge weint. Das operierte Auge wird mit einem kleineren Verband bedeckt. Der kleine Wim muss eine schwarze Brille tragen. Tranquille, mon gars, sagt der Arzt, ganz ruhig, alles wird gut. Sein gesundes Auge gewöhnt sich allmählich wieder an das Licht. Der Arzt kommt anderntags zurück und nimmt den Verband ab, verdeckt das gesunde Auge mit der Hand und fragt: Was halte ich hoch? Das Kind hat vorher Weintrauben auf dem Tisch neben dem Arzt gesehen; Weintrauben, ruft es. Doch bedauerlicherweise ist es eine Schere. Das Auge ist noch immer blind, sagt der Arzt zur Mutter. Wir müssen das Ganze wiederholen. Das Kind reagiert panisch: Nein, nicht noch mal, schreit es. Nicht noch mal! Es strampelt mit den Beinen, wirft den Kopf hin und her, ist nicht zu halten. Die Mutter nimmt ihren Sohn auf den Schoß, ist ja gut, sagt sie, alles ist gut!
Der Eingriff wird nicht wiederholt; wie leicht verschiebt sich doch bei Müttern das Gleichgewicht zwischen Mitgefühl und Standhaftigkeit.
Ein Jahr später. Der erste Schultag; Willem ist eingeschüchtert, verläuft sich im Gebäude, öffnet die falsche Türe, gerät ins Zimmer des Hausmeisters, der ihm sogleich eine derart unselige Ohrfeige verpasst, dass dem Jungen das Blut aus dem Ohr tropft. Er rennt aus der Schule und wird von einem Gendarmen zurückgebracht. Schluchzend sitzt er auf der Schulbank und presst sich einen Pfropfen ans Ohr.
Blühende Rosskastanien, so schreibt er in seinen Memoiren, mochte ich besonders, auch die trudelnden Ahornhelikopter im Herbst, oder das Zischen der Gaslaternen im Nebel; ich habe dicke, gelbe Birnen aus Obstgärten gestohlen und meine Beute hinter dem Kaninchenstall versteckt.
Mit dem zehnten Lebensjahr fingen die Prügeleien in der Schule an. Die Lehranstalt bestand aus zwei Abteilungen, in der einen wurde Flämisch und Französisch, in der anderen nur Französisch gesprochen; um die Kampfhähne beider Lager auseinanderzuhalten, gab es zwei Pausenhöfe. Willem schreibt, dass die flämischen Kinder verächtlich behandelt und verspottet wurden. Die Bürgersöhnchen hänselten uns, riefen uns französische Schimpfwörter nach, die uns zum Dreck der Straße machten. Wir verstanden uns als Kinder der einfachen Leute und hauten wild drauflos, ich konnte die Demütigungen nicht ertragen. Er fügt hinzu, dass er schon immer Sympathien für Bauarbeiter, Straßenbahnschaffner und Pferdekutscher gehabt habe und dass er beim Schulschwänzen oft Bonbons geklaut habe, die er dann mit ihnen teilte. Voll beschönigender Ironie typisiert er sich selbst als »Schlawiner Will«, der niemals vernünftig geworden sei, dank seiner »heiligen Einfalt, die ihm doch unübersehbar ins Gesicht geschrieben stand«.
3
Der Diamantschleifer ist dem Alkohol verfallen und dämmert in seiner Werkstatt vor sich hin, die Mutter aber ist eine zupackende Frau. Durch den gewinnbringenden Kauf und Wiederverkauf kleinerer städtischer Liegenschaften erwirtschaftet sie sich ein bescheidenes Vermögen, auf das ihr Mann keinen Zugriff hat. Damit baut sie ein großes Haus, auf dessen Grundstück noch genug Platz bleibt für eine Diamantschleiferei und Carlos Tanzschule – zweiundneunzig Zimmer habe das Haus gehabt, schreibt Willem ein halbes Jahrhundert später und meint wohl neunundzwanzig. Aber spielt das eine Rolle? Spielt es eine Rolle, ob Carlos Schule ein Turn- oder Tanzsaal war? Willem darf den Bürgerstöchterchen in den Abendkursen beim Einüben der Tanzschritte helfen. Das Kind mit der Augenklappe wickelt alle um den Finger: Wie eine kleine Ballerina wirbelt es durch den Saal, stolpert immer wieder herzzerreißend, rappelt sich auf und tanzt weiter.
Die Prügeleien in der Schule werden dramatischer, die Kontrahenten gewaltbereiter. Es kommt vor, dass einer der Jungen einen abgebrochenen Flaschenhals oder einen Knüppel bei sich hat. Nicht selten muss die Ambulanz gerufen werden. Willem vermasselt die Algebra-Prüfung, weil er das Französisch des Mathematiklehrers nicht versteht; er wird bockig, überheblich, stellt sich vor die Klasse und verlangt lauthals Unterricht in flämischer Sprache. Der Löwe von Flandern!, ruft er. Als ein elegant gekleideter Franzosenjunge ihn auslacht, stürzt er sich auf ihn wie ein wildes Tier. Ihm droht ein Schulverweis. Seine Noten werden mit jedem Tag schlechter, die Zeugnisse schmeißt er in die Gosse, klaut leere Formulare aus dem Sekretariat und trägt sich gute Noten ein, bis sich der Vater über das Gekrakel des angeblich neuen Lehrers wundert und den Betrug entdeckt. Willem bekommt eine Tracht Prügel, an die er sich noch Jahrzehnte später erinnern wird.
Er schwänzt die Schule, treibt sich tagelang herum, durchstreunt Obstgärten und stiehlt mithilfe eines nagelbewehrten Stocks die hochhängenden Früchte. Er pflückt einen Strauß Feldblumen und stellt sich damit vor das Eingangstor der Mädchenschule, wird dann aber von einer Nonne am Ohr über die Straße gezogen, bis er anfängt zu weinen. Er versucht, den Mädchen unter die Röcke zu schauen – »Man hat mir erzählt, dass man davon blind werden kann, wie von einem Blitz …« Noch im Alter seufzt er, ach, Mariëtte, ach, Tilly, ach, Eveline, Französisch hätten sie gesprochen und ihre Schlüpfer seien spitzenbesetzt gewesen, das habe er mit seinem guten Auge sehen können.
Im Winter hilft er seinem Vater, morgens um halb sechs die Öfen der Diamantschleiferei und der Tanzschule einzuheizen; er kocht Kaffee für die Arbeiter, danach müssen alle Tanzschuhe geputzt werden. Die Schuhe eines besonders affektierten Tänzers schmiert er mit Kaninchenkötel ein, er liebt Streiche auf Kosten anderer. Er schreibt: Ich war der heilige Schlawiner, ich war gut darin, so zu tun, als könnte ich kein Wässerchen trüben. Ich hatte eine herrliche Kindheit.
Doch dann schlägt der Blitz tatsächlich ein. Er ist dreizehn, als die Mutter unerwartet stirbt. Die Umstände sind unklar; seine Kindheitserinnerungen bricht Willem abrupt mit ihrem Tod ab, ohne weitere Erklärung. »Voll Heimweh treibe ich mich zwischen den Gräbern herum«, beschließt er seine Aufzeichnungen, »und suche mein Leben.«
In den Besitz einer Kopie dieser merkwürdigen Bekenntnisse gelangte ich viele Jahrzehnte später, durch eines seiner Kinder; auf der Vorderseite des Hefts ist ein Sportler abgebildet, über dem in beiden Landessprachen die Maxime zu lesen ist: »Handle wie ein wahrer Sportler.«
Mein Auge fällt auf den Schatten des Läufers, er gleicht eher dem Schatten eines Boxers.
Am unteren Rand der Seite steht: Cahiers de Belgique. Was angesichts Willems problematischem Verhältnis zum Vaterland Belgien an Ironie grenzt.
4
Bauer will er werden, oder Gärtner, etwas in der Art, warum, weiß er selber nicht, aber alles ist besser als Diamantschleifer mit staubtrockener Kehle. Sein lebensüberdrüssiger Vater schickt ihn auf die Garten- und Landbauschule in Melle bei Gent. Doch von Studieren kann kaum die Rede sein. Der Erste Weltkrieg tobt, die Von-Bissing-Universität war gerade eröffnet worden: Moritz Ferdinand Freiherr von Bissing, Generalgouverneur des besetzten Belgien, Bewunderer von Rilke und Goethe, hatte den Auftrag zur Gründung einer Vlaamsche Hoogeschool erteilt und damit gegen belgisches Gesetz verstoßen. Das führte zu einer tiefen Spaltung der akademischen Welt Belgiens: Die Flamenpolitik der deutschen Besatzer war für die Anhänger des belgischen Einheitsstaates, die Patriotten, eine Provokation, während die Flaminganten endlich ihre Forderung nach einer Universität erfüllt sahen, in der die Lehrveranstaltungen in der eigenen Sprache stattfanden. Das wiederum trieb diejenigen flämischen Hochschullehrer, die sich weigerten, mit den Deutschen zu kollaborieren, zu Demonstrationen auf die Genter Straßen, bei denen sie französischsprachige Transparente mit sich führten. Mit Aufschriften wie L’université de Gand français! sprachen sie sich im Grunde gegen die eigene »verniederländischte« Universität aus. Die meisten von ihnen verließen die Hochschule und wurden durch Kollegen ersetzt, die bereit waren, zur Erreichung ihrer flämischen Ziele mit den deutschen Besatzern zu kollaborieren. Eine größere Kluft zwischen den beiden Lagern war kaum denkbar.
Der Sohn des Antwerpener Diamantschleifers treibt sich in den Straßen von Gent herum. Er besucht proflämische Studentenclubs und tritt der berüchtigten Groeningerwacht bei, einer rasch wachsenden aktivistischen Bewegung. Deren charismatischer Vorsitzender ist August Borms; am 11. Februar 1917 hält er vor seiner Organisation eine Rede. Schon damals beinhaltet ein Tagesordnungspunkt die Forderung, Flandern und Wallonien administrativ voneinander zu trennen und die frankofonen Wallonen aus dem Land zu »vertreiben«. Borms weiß seine Zuhörer zu fesseln: »Wir verlangen gemäß der in unseren Händen liegenden Macht die Elemente zu entfernen, die in flämischen Gebieten unerwünscht und allgemein-geistig und sittlich als ungesund zu bezeichnen sind. Raus mit den Franskiljons, raus mit den Franzosenfreunden, raus mit ihnen allen! … Wem das nicht passt, hopp, rüber, über die Grenze! Raus mit allen, die sich gegen unsre Sache stellen!«
Willem steht inmitten der aufgehetzten jungen Leute und brüllt mit. Bis spät in der Nacht sitzt er in der Kneipe, setzt den Mädchen nach, im Wunsch, vom Blitz unter den Röcken getroffen zu werden, den er doch so fürchtet.
An einem Frühlingstag besteigt Willem die Straßenbahn; die Deutschen führen ständig Kontrollen durch und gehen dabei äußerst brutal vor, die Gemüter sind angespannt, die Nerven liegen blank. Willem tritt auf die hintere Plattform, um dort zu rauchen. Im Knopfloch der Jacke trägt er ein Emblem, das bei der Flämischen Bewegung damals sehr beliebt ist: die belgische Kokarde mit dem flämischen Löwen in der Mitte. Plötzlich stürzt sich ein älterer Herr auf ihn, reißt ihm den Anstecker von der Jacke und schreit mit wutverzerrtem Gesicht: Maintenant c’est fini tout cela! Der arglose junge Mann ist zutiefst erschrocken über die Attacke des braven Bürgers, sofort stehen ihm wieder die Prügeleien auf dem Schulhof vor Augen, er hört die verächtlichen, höhnischen Bemerkungen, spürt den Adrenalinstoß in den Adern. Er will dem Mann eine reinhauen, verliert um ein Haar die Kontrolle über seine Fäuste, gerade noch rechtzeitig springt er aus der fahrenden Bahn und verstaucht sich auf dem unebenen Pflaster den Fuß.
Später wird er sagen, dass er in diesem Moment angefangen habe, den belgischen Staat zu hassen. Etwa zur gleichen Zeit erfährt er vom Tod seines älteren Bruders Edward, der an der Front gefallen ist, das alles ist für ihn weit weg. Wegen seines blinden Auges ist er für den Kriegsdienst untauglich. Einem Mädchen gegenüber, auf das er Eindruck machen will, scherzt er, dass die frankofonen Offiziere an der Yser mit einem flämischen Zyklopen wie ihm wohl kaum etwas anfangen könnten.
Er ist zu einem großen jungen Mann herangewachsen, misst über ein Meter achtzig, hat langes schwarzes Haar – auf dem einzigen noch existierenden, unscharfen Foto aus jener Zeit sieht er eher aus wie eine zu früh geborene Version von Neil Young als wie ein Flamingant des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Die Augenklappe verleiht ihm etwas Geheimnisvolles, wirkt anziehend auf etwas klügere Mädchen und einschüchternd auf seine Freunde. Wenn er eine Kneipe betritt, drehen sich alle nach ihm um. Das Kino fasziniert ihn; in einem kleinen Filmtheater sieht er eine knatternde Kopie von Alfred Machins Maudite soit la guerre; eine Woche später läuft dort ein deutscher Propagandafilm über die erhabene Pflicht zum Krieg, was ihm tüchtig zu denken gibt; der berüchtigte Film über die Schlacht an der Somme wird in Gent noch nicht gezeigt, aber er hört davon. Er weiß nur ungefähr, was in den flämischen und nordfranzösischen Schützengräben passiert, wenig dringt tatsächlich zu ihm durch, widersprüchliche Nachrichten allenthalben, nicht selten schallt es »Lügenpresse«. Nun, dann halt keine Zeitungen; die Weisheit liegt ohnehin auf der Straße.
Die Alliierten stecken genauso tief im blutigen Lehm fest wie die Besatzer, die Katastrophe von Passendale ist in vollem Gange. Ende August hört er in Gesprächen immer wieder den Namen Langemark. Warum Langemark, was ist 1914 in Langemark passiert, wo liegt das überhaupt, Langemark? Gibt’s denn auch ein Kurzemark, witzelt er. Du solltest nicht so viel trinken, sagt eine Freundin und legt ihm den Arm um die Schultern. In Gesellschaft von Studenten hält er sich anfangs meist zurück, ist fast schüchtern, doch wenn er sich einmal in Rage geredet hat, verliert er sich schnell in wirren Theorien und haut mit der Faust auf den Tisch. In der Zeitung stehen Artikel über die Oktoberrevolution, überall redet man von Menschewiki und Bolschewiki. Er bekommt Wind von den Plänen für eine »rein flämische Partei«, den Vlaamsche Blok, und erfährt, dass diese Pläne bis ins Jahr 1912 zurückreichen. Ein Student mit komischer Kopfbedeckung behauptet, dass die westliche Welt untergehe, der Bürgersohn Edmond Vandermeulen. Mit ihm zieht er ein paar alkoholselige Nächte durch die Kneipen, die Familien der beiden werden sich später befreunden, doch das kann er jetzt unmöglich wissen; als der Student am frühen Morgen Hou ende trou brüllt, den Wahlspruch des katholischen Genter Studentenkorps, und Vliegt de Blauwvoet! singt, das aus dem neunzehnten Jahrhundert stammende Kampflied der katholischen Studentenbewegung, stimmt er in das Gebrüll mit ein. Danach versackt er in einer schäbigen Kriegskneipe, wo man lausigen Schnaps aus verfaulten Kartoffelschalen und Futterrüben ausschenkt, ekliges Zeug, das tagelangen, dumpfen Kopfschmerz verursacht.
Bis tief in die Nacht diskutiert er mit den Kumpeln von der Groeningerwacht über die flämische Sache, und gelegentlich, wenn er verkatert ist, findet man ihn auch vor sich hin träumend im botanischen Garten. Infolge der Probleme an der niederländischsprachigen Universität gehen auch die Studentenzahlen an der Hochschule für Gartenbau zurück, die Dozenten bleiben weg, Unterricht findet nur noch unregelmäßig statt. Er verliert das Interesse, weiß nicht recht, was er tun soll. Für ein paar Wochen arbeitet er in einer Kneipe. Er sei ein Freund von August Borms, prahlt er. So was kann nicht schaden, wenn man auf der Suche nach Arbeit ist.
Aus einem Versammlungsraum klaut er ein signiertes Foto seines Helden; als ich später das Haus im Drongenhof ausräume, finde ich es – eingerissen und vergilbt, der dünne Rahmen und das Glas zerbrochen –, aber es interessiert mich noch nicht, und ich werfe es zum anderen Gerümpel in den Container, den ich vor dem Haus habe aufstellen lassen.
5
Als der Vater entdeckt, dass der Sohn seine Zeit in Gent nur verbummelt, soll er seine Ausbildung an der Gartenbauschule von Vilvoorde zu Ende bringen, Willem muss also umziehen; mitten im Krieg tauscht er die Geusenstadt Gent gegen den nördlichen Stadtrand von Brüssel ein. Bei einem Bäcker findet er ein Studentenzimmer unterm Dach. Vilvoorde ist zu jener Zeit noch ländlich geprägt, aber immerhin fährt eine Pferdetram direkt bis zur Gartenbauschule. Das Hoger Instituut voor Tuinbouw gibt es heute noch, nimmt man den Zug von Brüssel nach Antwerpen, kommt man an ihm vorbei: ein großes, architektonisch reizvolles Backsteingebäude mit weißen Fenstern, davor eine weite Rasenfläche, wodurch es fast aussieht wie eine englische public school. Willem fühlt sich wohl hier, der Druck, sich wilde Nächte um die Ohren schlagen zu müssen, ist verschwunden. Der Bäcker schenkt ihm jeden Morgen einen Viertellaib Brot, was nicht zu verachten ist in den Tagen der Armut und Lebensmittelrationierung. Wenn er von der Dachkammer herabsteigt, um das Haus durch den Seiteneingang zu verlassen, sieht er die Frau des Bäckers im Laden stehen. Er findet sie anziehend; er reiht sich unter die Hungernden vor der Suppenküche und bringt ihr eine Portion des dünnen, widerlich schmeckenden Gebräus mit, die sie dankbar annimmt. Er scherzt und unterhält sich mit ihr, will vieles von ihr wissen; eines Tages streift er mit dem Finger an der Innenseite ihres Arms entlang und fragt: Bis heute Nacht?
Elsa Meissner ist eine empfindsame Frau, sie langweilt sich in ihrem Leben mit dem Bäcker, der sie nachts im Bett alleine lässt und bis in den späten Nachmittag hinein schläft. Sie kann es nicht fassen, weiß nicht, wie ihr geschieht, und schleicht trotzdem in der Nacht zu Willems Kammer hinauf. Intimitäten, leise Seufzer, hastiges Zerren an den Kleidern, das alles in der Mansarde im dritten Stock, während der Bäcker drunten im Keller den mit minderwertigem Kartoffelmehl gestreckten Teig knetet. Elsa ist dreißig, Willem fast zwanzig. Sie ist deutsch-jüdischer Abkunft, groß und mager, hat dunkelrotes Haar und Sommersprossen auf den Armen. Mich friert, sagt sie, Willem nimmt sie in die Arme, haha, du hast Hummeltitten, kommentiert er ihre Gänsehaut; er gibt den Spaßvogel, denn ihr sanft-melancholisches Lachen findet er unwiderstehlich. Am Morgen schlüpft sie zurück ins eheliche Bett, innerlich glühend und etwas schwindlig im Kopf, kurz darauf poltert ihr Mann erschöpft die Treppe herauf. Es dämmert, die Stufen quietschen; der Bäcker liegt schnarchend neben seiner Frau. Willem taucht nackt in der Türöffnung auf, ob er den Verstand verloren habe, gibt sie ihm mit Zeichen zu verstehen, und dass er schleunigst in sein Zimmer zurücksolle.
Die Romanze ist mehr als nur eine vorübergehende Liebelei; ihr Sex wird mit der Zeit ruhiger, dafür aber intensiver, über Stunden reiben sie sich aneinander, bis sie wie Ertrinkende nach Atem schnappen. Wenn sie in seinen Armen liegt, erklärt er ihr mit leise brummender Stimme seine politischen Ideale, berichtet von geheimen Versammlungen in Brüssel und von seiner Freundschaft mit dem kaum sechzehnjährigen Hendrik Elias, den er in der hiesigen Abteilung der Groeningerwacht kennengelernt habe; immer seltener hält er mit seinen Sympathien für ein großgermanisches Reich unter deutscher Führung hinterm Berg. Als Deutschland schließlich kapituliert und der belgische Staat beginnt, Kollaborateure aufzuspüren, um sie vor Gericht zu stellen, gerät auch Willem ins Visier, weil er überall herumposaunt hat, dass er August Borms persönlich kenne, dass er radikaler Flandern-Aktivist sei und Belgien untergehen werde. Du und fliehen? Warum?, fragt Elsa und lacht. Nur weil du eine große Klappe hast? Er gesteht ihr, seit einiger Zeit Sekretär des flämischen Propagandabüros in Vilvoorde zu sein, weshalb er fürchte, verhaftet zu werden. Elsas Blick wird starr und leer.
Die Gerüchte über Verhaftungen und Gerichtsverfahren gegen Flandern-Aktivisten häufen sich. Der Dichter Wies Moens wird festgenommen und der Kollaboration und Volksverhetzung angeklagt. Das Netz um Willem zieht sich immer enger zusammen. Wir müssen weg, sagt er, wir müssen in die Niederlande, ich habe keine Lust, mich von den verfluchten Belgizisten verhaften zu lassen. Er ist nervös und reizbar: Nein, ihn sollen sie nicht kriegen! Noch bevor der Morgen anbricht, hat er seine Habseligkeiten gepackt. Als Elsa ihn so vor sich stehen sieht, holt sie tief Luft und sagt: Ich komme mit! Sie lässt ihren Vilvoorder Bäcker vor seiner eichenhölzernen Teigmolle stehen und tritt mit ihrem Liebhaber auf die menschenleere Straße hinaus. Ein paar hundert Meter weiter werden sie von einigen Genossen erwartet. Und da geht sie hin – die ehebrecherische jüdische Frau auf romantischer Flucht mit einem Grüppchen aufgeregter Flaminganten. Sie müssen so schnell wie möglich über die Grenze, in den Niederlanden sind sie sicher. Zunächst fahren sie mit Rädern nach Antwerpen, wo das Dutzend die Nacht im Tanzsaal von Willems Schwester Carlo verbringt. Eine andere Schwester, eine überzeugte Suffragette mit Sympathien für die flämische Sache, stattet die jungen Leute mit Proviant und zusätzlicher Kleidung aus. Zu Elsa sagt sie auf Deutsch: Ich hoffe, dass mein Bruder nun zur Ruhe kommt, sieh zu, dass er sich bei dir ein wenig die Hörner abstößt. Elsa lächelt etwas schwermütig und schweigt. Im Morgengrauen radeln sie weiter, dem Nordwind entgegen, bei den Wäldern von Kalmthout überqueren sie die Grenze und lassen sich erleichtert in den Straßengraben fallen. Willem ist aufgedreht, er tanzt und schreit: Voor Vlaanderen alles, voor ’t Belgikske nikske – Alles für Flandern und für Belgien nichts! Die anderen fragen sich sorgenvoll, was denn nun aus ihnen werden soll.
Wie und warum ist nicht klar, doch am Ende landen sie in Den Haag.
In Gent ist Willem zum Kinoliebhaber geworden. Stundenlang kann er über Filme reden, über Regisseure, über den möglichen Nutzen des Kinos für die Propaganda, die dazu dienen sollte, sein Land vom Joch der frankofonen Beherrscher zu befreien. Expressionismus!, ruft er. Jakob van Hoddis!, ruft er. Und an den Küsten steigt die Flut! Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut! Die Eisenbahnen fallen von den Brücken!
Die Den Haager Kneipengänger amüsieren sich köstlich über den sympathischen Clown.
Er hat eine flinke Zunge und macht sich schnell beliebt, zudem ist er unternehmungslustig und nicht auf den Kopf gefallen. Er lernt den Leiter eines kleinen Kriegskinos kennen und darf einmal pro Woche nicht nur einen Film eigener Wahl zeigen, sondern vor dem zahlenmäßig gering sich einfindenden Publikum auch noch eine Einführung dazu halten. Er spricht über Belgien, weil die Holländer dieses Land so wenig begreifen; ihr Niederländer hattet ja seit 1908 einen Nichtangriffspakt mit Kaiser Wilhelm, doch unsere frankofonen Mitbürger haben uns bitter bluten und büßen lassen. Ihr habt uns schmählich im Stich gelassen. Er zitiert den Anfang von Brederos Gedicht Spaansche Brabander, zum Beweis, dass schon ein niederländischer Barockdichter Antwerpen höher schätzte als Amsterdam. Nach diesen Vorträgen stecken einige der Zuhörer, manchmal unter Kopfschütteln, dem »unterhaltsamen Flamen« ein paar Gulden zu, wodurch Willem etwas Geld verdient, genug, um sich und Elsa gerade so über Wasser zu halten. Von ihm lernt sie rauchen und trinken, es gibt Tage, da tanzen sie in den Kaschemmen bis zum frühen Morgen, sie ist ganz vernarrt in seinen Schweißgeruch, lacht, wenn sie in seinen Armen liegt, und kann nachts nicht genug von ihm bekommen. In der Morgendämmerung steht sie vor dem Fenster ihres Hinterzimmers und sagt, dass sie erst durch ihn eine richtige Frau geworden sei, worauf er gesteht: Bevor ich dich kennengelernt habe, war ich kein Mann. Sie sind bis über beide Ohren ineinander verliebt.
Auf die Frage, ob er froh sei, dass sein Land befreit wurde, antwortet er, dass Flandern noch längst nicht befreit sei, wartet nur ab, unsere Zeit wird noch kommen. Worte, die die Freunde in Den Haag verstören und einen Streit mit Elsa nach sich ziehen, die meint, er solle endlich lernen, seine große Klappe zu halten.
Irgendwann im Lauf des Jahres 1919 lernt er den flämischen Aktivisten und Dichter Richard De Cneudt kennen. De Cneudt hat sich während des Kriegs für den niederländischsprachigen Unterricht in Flandern eingesetzt und gefordert, dass die bestehenden Sprachgesetze in den Brüsseler Schulen korrekt umgesetzt werden müssten, doch als er sah, wie arrogant man in der Hauptstadt über diese hinwegging, radikalisierte er sich und wurde zum prominenten Verfechter der Flamenpolitik der deutschen Besatzer. Als Mitglied des Raad van Vlaanderen, einer Organisation, die einseitig die Unabhängigkeit Flanderns ausrief, brach er das Gesetz und wurde in Abwesenheit wegen Kollaboration zum Tode verurteilt. Er flüchtete in die Niederlande, ließ sich in Rotterdam nieder, hielt Vorträge und wurde ein ausgezeichneter Französischlehrer. Der zweiundvierzigjährige flämische Kulturherold und der junge Kämpfer verstehen sich auf Anhieb, sie reden viel über Bücher und Filme.
Natürlich, De Cneudts Gedichte! Ach herrje. Beim Aufräumen des Drongenhofer Hauses habe ich sicher fünfzehn seiner Bücher in den Container geworfen. Stockfleckig geworden durch ein undichtes Dachfenster, zerfleddert und verzogen. Romantische Gedichte und Politpropaganda, aber Poesie trotz allem.
Graziös durchflatterst du mein Haus,
dem schönen Falter gleich, ein traumvoll leiser Laut,
ein wahres Maienflüstern,
dem ich, der scheu und voller Weh
vor zärtlichstem Liebestrieb vergeh,
lausche inniglich und lüstern …
Durch einen von Elsas Bekannten kommen sie in Kontakt mit einer Gruppe protestantischer Idealisten, die sich um die vielen belgischen Flüchtlinge in den Niederlanden kümmern, oft ohne die wahren Gründe für deren Flucht zu kennen. Damals ist ein aus England zurückgekehrter Pazifist und Anhänger des christlichen Idealismus namens Kees Boeke in aller Munde; dessen Überzeugungen teilt man auch in jenem Haus, in dem Willem und Elsa Obdach finden: im Haus von Pastor Hilbrandt Boschma. Dieser verfasst zahlreiche Broschüren, die monatlich unter dem Titel Licht en Liefde (Licht und Liebe) erscheinen.
Boschma spricht beispielsweise über die Gemeinsamkeiten von christlicher Botschaft und idealistischem Kommunismus, was Willem, der noch die verächtlichen Ausfälle seines Vaters gegen jegliche Art von Religion im Ohr hat, zunächst irritiert; eines Tages dann aber erklärt er unvermittelt, Protestant werden zu wollen. Und als er erstmals von der Walden-Kolonie des niederländischen Dichters Frederik van Eeden hört, will er wissen, ob es diese noch gibt und ob dort vielleicht Gärtner gesucht würden. Kees Boeke trifft er öfter, der Ältere ist fasziniert vom jungen Flamen, es kommt zu persönlichen Gesprächen. Willem prahlt weiterhin, dass er »Belgien in die Luft jagen« und »alle Franskiljons erschießen« wolle. Während einer turbulenten Diskussion ruft er plötzlich, dass er zwar christlich-anarchistisch-kommunistisch denke, trotzdem aber nicht von seinen republikanischen und flämisch-nationalistischen Überzeugungen lassen wolle. Ein Meinungscocktail, der zu heftigen Reaktionen bei den Mitgliedern der Gruppe Licht en Liefde führt.
Ach ja – auch dieses Foto fand ich beim Ausräumen auf dem Dachboden des alten Hauses: Ein befreundeter Bäcker, der zu Kees Boeke nach Hause kam, auf einem Motorrad, hinter ihm die junge Prinzessin Beatrix. Es stammt vermutlich aus dem Jahr 1946. Es trägt eine Widmung.
Wurde wohl Ende der Vierziger mit der Post verschickt.
»Für meinen fernen flämischen Freund.«
Er hatte ja keine Ahnung: Willem saß damals im Knast.
Wenige Monate später macht Willem Elsa einen Heiratsantrag. Die Hochzeit findet im engsten Kreis statt, ohne dass Elsas erste Ehe offiziell geschieden worden wäre. Nicht viel später, irgendwann im Jahr 1922, bekommt Elsa heftige Krämpfe und Fieber. Sie muss das Bett hüten, die Schmerzen werden immer stärker. Willem wacht an ihrem Bett und lässt einen Arzt kommen. Ihre Beschwerden sind unspezifisch, aber besorgniserregend, was Willem aus der nachdenklichen Miene des Arztes und dessen Schweigen schließt. An manchen Tagen fühlt sie sich besser, dann wieder verbringt sie mehrere Tage am Stück im Bett. Aufgrund der zusätzlichen Pflegekosten muss Willem sich nach einer Verdienstmöglichkeit umsehen. Während sich einige Mitglieder von Licht en Liefde um Elsa kümmern, radelt Willem die weitere Umgebung auf der Suche nach Arbeit ab. Auch in größerer Entfernung. Manchmal bleibt er mehrere Tage weg; und als er eines Tages von einer solchen Reise wiederkommt, findet er seine Frau stark abgemagert und bettlägerig vor.
Warum Willem sich dabei fast hundertzwanzig Kilometer von Den Haag entfernte, wissen wir nicht, jedenfalls lernte er eine Familie in Oud-Zevenaar unweit von Arnhem kennen. Mag sein, dass ihn Pastor Boschma zu einem seiner Kollegen geschickt hatte, zu Pastor Adriaan Johannes Wartena.
6
1925. In den Gesprächen und Diskussionen fällt nun immer häufiger ein neuer Name: Der Name des Mannes, der im November 1923 aus einem Münchner Bierkeller heraus versucht hat, die Weimarer Republik zu stürzen. Seine Milizen tragen eine Armbinde mit einem hinduistischen Zeichen. Sie recken den Arm zum Gruß; jemand behauptet, das sei der Gruß der antiken römischen Garde, ein anderer hält dagegen, dass es sich dabei um die Erfindung von Schauspielern handle, dass das Ganze schlechtes Theater sei und es auch bleiben werde. Wo sie auftauchen, herrscht blinde Gewalt und Einschüchterung, andererseits ist das alles auch ungeheuer spannend und neu. Expressionismus in Wort und Tat! Und an den Küsten steigt die Flut! Im Winde klirren die Fahnen!
Weil sich die Stimme des neuen Führers andauernd hysterisch überschlägt, versteht man von den Reden nur die Hälfte. Pure elektrische Energie schlägt aus den Lautsprechern der durch ihre Lämpchen gelb glühenden Radios. Der Schreihals kriegt für den Putsch fünf Jahre Gefängnis aufgebrummt, ist aber nach elf Monaten schon wieder draußen. Die Haft hat keinen mäßigenden Einfluss auf seine Unruhe, im Gegenteil. Er diktiert einem Mitgefangenen, was er seinen Kampf nennt.
Das Geschrei und Gebrüll geht nach der Gefangenschaft unvermindert weiter. Faszinierend ist der rasch entstehende politische Sturm schon, aber auch beängstigend; widersprüchliche Nachrichten, dramatische Aufmacher, überglückliche Zeitungsverkäufer, in den Kneipen wird geprügelt, auf den Theatertreppen der Aufstand geprobt. Pastor Boschma beruhigt, dass es so schlimm schon nicht kommen werde. Doch die Politik drängt sich ins Privatleben, und die intimsten Gespräche verweben sich eng mit den Nachrichten des Tages. Niemand ist gefeit vor dem allgegenwärtigen Gefühl, dass irgendwie alles mit allem zusammenhängt. Wenig später gehen in Deutschland die ersten Fenster zu Bruch, das hinduistische Symbol ist aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken, Prügeleien werden zu Razzien, Auseinandersetzungen zu Straßenschlachten, eine neue Ordnung kündigt sich an. Die Gesellschaft zerfällt zunehmend in Anhänger und Gegner, und wieder verrät in den Familien jeder jeden. In der Stube des Ehepaars Wartena im stillen, ländlichen Oud-Zevenaar richtet man in aller Eile ein Bett für die kranke Frau des sympathischen Wim, der sich mit dem Pastor immer so angeregt über den Sinn des Lebens und Religion unterhält. Er holt Elsa aus Den Haag. Weil die Fahrt mit der Eisenbahn zu teuer ist, leiht er sich in Arnhem bei der Familie der Pfarrersfrau einen Pferdewagen; die Reise quer durch die grüne Mitte der Niederlande strengt Elsa sehr an. Sie verbringen die Nacht in einer kleinen Herberge in Zeist, doch Elsa kann vor Schmerzen kaum schlafen. Am nächsten Tag macht Willem einen Umweg, weil er seiner kranken Frau die berühmte Pyramide im Wald bei Woudenberg zeigen möchte: Elsa, sieh doch, Austerlitz! Napoleon! Heldenmut und mährische Nächte! Aber sie ist zu schwach, um ihm zuzuhören, geschweige denn die Augen aufzuschlagen.
Adriaan Wartena ist Anfang fünfzig und seit mehr als zwanzig Jahren Pastor in Zevenaar. Vor einigen Jahren durfte er mit seiner Frau Maria ten Bosch die silberne Hochzeit feiern. Das Ehepaar übernimmt Elsas Pflege, unterstützt von einer jungen Nachbarin. Ein Arzt stellt fest, dass sie unter Gebärmutterhalskrebs leidet, was eine besondere Fürsorge erfordert, denn Elsa hat dramatisch starke Blutungen und innere Entzündungen, außerdem wohl bereits Metastasen. Die Schmerzen sind unerträglich, sie ist inkontinent, isst kaum noch etwas, verliert manchmal für Stunden das Bewusstsein. Man behandelt sie mit Procain und Jod, wodurch sie ein paar Stunden ohne Schmerzen schlafen kann. Nachts hören die Bewohner des Hauses sie stöhnen, meist wacht Willem bis zum frühen Morgen an ihrem Bett.
Pastor Wartena hat Willem eine Arbeitsstelle vermittelt, er wird Gärtner bei der Familie Von Gimborn, die in Zevenaar eine Tintenfabrik besitzt. Willem harkt Laub, schneidet Bäume und Sträucher, pflegt Rabatten, zerhackt und zersägt das anfallende Holz und verdient erbärmlich wenig. Er mietet sich ein kleines, feuchtes Zimmer, kaum groß genug für ein Feldbett und einen Stuhl. Elsa bleibt im Haus des Pastors. Die Nachbarin Harmina ist nun täglich mit der Pflege betraut. Sie ist die Tochter eines Großbauern, der auch Mitglied des Ältestenrats der Gemeinde ist. Wenn Willem Elsa besucht, sitzt die junge Frau oft am Krankenbett und betet. Hallo Harmina, sagt er schüchtern, und sie: Möge Gott Ihnen beistehen, Ihre Frau wird bald sterben. Er setzt sich neben sie, während sie einen Psalm rezitiert.
Und muss ich durch das finstre Tal,
dann fürchte ich kein Unglück;
denn Du bist überall
und führst mich in mein Heil zurück.
Sie streicht das zerknitterte Laken glatt, als Willem gerade dasselbe tun will, behutsam, um den Schlaf seiner fiebernden Frau nicht zu stören. Die Hände der beiden berühren sich; erschrocken zucken sie zurück, doch die kurze Berührung genügt, um Willem die Haut seiner Mutter spüren zu lassen, wie damals, als er monatelang blind das Bett hüten musste und nichts zum Festhalten hatte als einzig die mütterliche Hand. Einen irrwitzigen Moment lang sieht er auch jetzt nichts mehr; tastet sich zum Stuhl zurück, es wird nicht besser, er ringt nach Luft. Was ist los?, fragt die junge Frau, er murmelt etwas in seinem merkwürdigen Dialekt, zupft an der Augenklappe, seine Hand zittert heftig, die junge Frau springt auf.
Willem, um Himmels willen, was ist los?
Ich kann nichts mehr sehen.
Er sucht nach ihrer Hand.
Die junge Frau ergreift seine.
Er beruhigt sich, allmählich erkennt er verschwommene Umrisse, als kehrte er aus der Unterwelt zurück und müsste sich erst wieder an das dämmrige Licht der Stube gewöhnen. Da er nicht aufhört, schwer zu atmen, lässt sie seine Hand nicht los. Er wagt es nicht, ihr ins Gesicht zu blicken; sie ist verlegen angesichts der kindlichen Hilflosigkeit des Mannes. Draußen rattert ein Wagen über das Straßenpflaster; das Geräusch verstummt, die Frau im Bett röchelt in ihrem mühevollen Schlaf. Nachdem er wieder einigermaßen zu Atem gekommen ist, blickt er die Nachbarsfrau mit seinem seltsamen, ihm noch verbliebenen Auge an. Ist es eigentlich möglich, jemanden mit nur einem Auge ausdrucksvoll anzublicken? Er versucht zu lächeln, doch sie sieht nur eine Grimasse. Sie ist hin- und hergerissen zwischen Angst und Traum, ihr Blick wandert von ihm zu Elsa und zurück. Es ist spät, sagt sie, ich muss nach Hause. Er erhebt sich ebenfalls, bleibt mit dem Fuß am Bettpfosten hängen, stürzt um ein Haar auf seine kranke Frau. Harmina flüchtet aus dem Zimmer, er bleibt allein zurück, das Dämmerlicht ist längst vor der Formlosigkeit geflohen und vor dem Rasseln des schrecklichen Atmens im Bett.
7
Allmählich nimmt der Mann, den ich so gerne besser verstehen möchte, Konturen an.
Am Abend geht er durch das Dorf, ein mittelloser Eigenbrötler aus Belgien mit einer älteren, todkranken, jüdischen Frau. Das gibt Anlass zu Tratsch in Oud-Zevenaar. Eine Gardine wird beiseitegeschoben, eine Tür einen Spaltbreit geöffnet. Der hat mich so komisch angeschaut, wie der aussieht, hab gedacht, der sagt gleich was zu mir, bin lieber mal schnell auf die andere Straßenseite, was glaubst du denn, vor so einem kann man ja Angst kriegen. Die Tochter vom Bauer Wijers sollte vorsichtiger sein, sitzt ja den ganzen Tag am Krankenbett der Jüdin, muss die denn nicht auf dem Hof helfen? Pastor Wartena ist einfach zu gutgläubig, wie kann man sich mit so einem abgeben, hast du das tote Auge gesehen, dem Kerl würd ich keinen Zentimeter über den Weg trauen, sollen die doch drüben in ihrem flämischen Urwald bleiben, wir haben hier schon Sorgen genug, Gott wird’s schon richten, ach, sieh an, wenn man vom Teufel spricht, da kommt er ja, und die dumme Kuh Harmina neben ihm, halten ein Schwätzchen, was soll da draus nur werden, ich sag euch, das wird ein schlimmes Ende nehmen.
Harmina, die vor allem Mientje oder Mien genannt wird, bekommt das Bild des zitternden, stotternden, flehentlich nach ihrer Hand tastenden, für einen Moment erblindeten Willem nicht mehr aus dem Kopf. Sie ist verstört, die Zärtlichkeit, die sie für diesen komischen Vogel empfindet, ist ihr neu und fast lästig; bisher ist ihr noch kein Mann nähergekommen, mit Männern hat sie nichts am Hut. Und schon gar nicht mit verheirateten, das gehört sich nicht. Andererseits hat sie die Dreißig auch schon überschritten, eine kluge, empfindsame Frau mit einem starken Charakter. Zu Pastor Wartenas Silberhochzeit hat sie eine Rede gehalten, die alle in der reformierten Gemeinde bewunderten. Unter lautem Applaus überreichte sie dem Pfarrersehepaar ein Porzellanservice, ein gemeinsames Geschenk der Dorfvereine, wonach Pastor Wartena zu ihr sagte: Mientje, du würdest eine prächtige Pastorin abgeben.
Doch was soll’s, tagsüber muss sie mit aufs Feld, es gibt eine Menge zu tun. Und sonntags fährt man mit der Kutsche aus. Warum sollte sie ihr Leben vergeuden?
Sie nimmt heimlich Englischunterricht beim Dorflehrer und bewundert den idealistischen Wartena so sehr, dass sie tatsächlich seit Längerem mit dem Gedanken spielt, Pastorin zu werden. Ach nee, jetzt will sie auch noch Theologie studieren, hat nicht mal ’nen Freund, und das in ihrem Alter, was muss die auch immer so klug daherreden. Viel Zeit hat sie ja nicht mehr.
Nein, aber auch keine Lust auf das harte Landleben in der Liemers. Sie liest Broschüren über Frauenemanzipation und Suffragetten. Von den Bauernburschen, die ihr verdruckst hinterherschauen, will sie nichts wissen, doch was sie wirklich will, weiß sie auch nicht. Ihren Tagen verleiht sie dadurch Sinn, dass sie dem Pastor zur Hand geht, der sich immer irgendwo engagiert – entweder bei der Friedensbewegung Kerk en Leven, bei den protestantischen Abstinenzlern oder bei der Wohnungsbaugesellschaft, er organisiert Vorträge zur Förderung des protestantischen Unterrichts und hilft armen Teufeln in Not. Zudem absolviert sie ehrenamtliche Krankenbesuche, erledigt Einkäufe für hilfsbedürftige Senioren, läuft sich die Hacken schief, die Eltern beobachten es mit Kopfschütteln. Am Wochenende geht sie zum Gesangsunterricht, sie will lernen, Psalmen vorzusingen. Der alte Musiklehrer macht sie mit Bach, Buxtehude und Heinrich Schütz bekannt und zeigt ihr, wie man Partituren liest. Zuerst singt sie nur zögernd, dann mit wachsendem Vergnügen, bis die Wangen glühen, sie singt Arien und Lieder, begleitet vom Klavier. Der Musiklehrer schenkt ihr die Partitur von Händels Ombra mai fu-Arie aus der Oper Xerxes. Da platzt dem Vater der Kragen: Ob sie ernsthaft glaube, dass sie mit solchen Albernheiten ihren Lebensunterhalt bestreiten könne?
Was kann sie denn dafür, dass an dem Tag, als sie bei Von Gimborn einige Drucksachen abholt, Willem mit einer Harke in der Hand im Garten steht? Und dass er auch noch zufällig in ihre Richtung schaut; dass er zu ihr kommt und fragt, ob sie mit ihm heute Abend am Ooysedijk spazieren geht? Und sie kann auch nichts dafür, dass er ihr während des Spaziergangs den Arm um die Schultern legt und sie beide schweigen, zu erschrocken und zu schuldbewusst, um etwas zu sagen.
Elsa geht es sehr schlecht, würde sie hier in den Niederlanden sterben, wäre Willem mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Also bittet er die Schwestern um Hilfe. Carlo und Suzanne würden Elsa aufnehmen, aber es wäre besser, er würde sie gleich ins Antwerpener Krankenhaus bringen. Angeblich bestehe für ihn kein Risiko mehr, verhaftet zu werden – falls es überhaupt je ein Risiko gegeben hat. Am Abend vor der Abreise sieht er Mientje ein letztes Mal. Ihr Abschied ist unbeholfen, sie sind verwirrt, wortlos gehen sie auseinander, sie mit dem Gefühl tiefer Schuld, er mit dem Gefühl unerlaubter Erregung.
Jetzt sitzt er in Antwerpen an Elsas Sterbebett.
Er betrachtet die fiebernde, dahinsiechende Frau, die klauenförmige magere Hand, die sich an die verfilzte