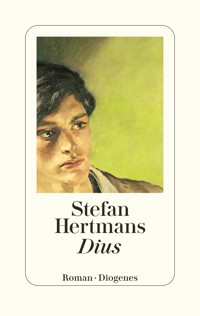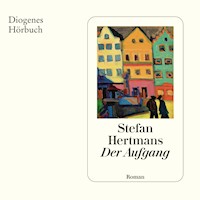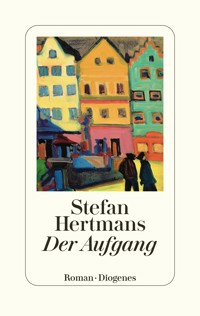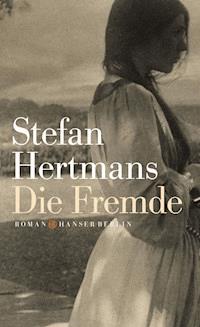Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Man kann alles, wenn man will!", sagt der alte Mann zu seinem Enkel und schwingt sich in den Kopfstand. Die wahre Willenskraft seines Großvaters begreift Stefan Hertmans jedoch erst, als er dessen Notizbücher liest, und beschließt, den Roman dieses Lebens zu schreiben. Eindringlich beschwört er eine bitterarme Kindheit in Belgien, zeigt den 13-Jährigen, wie er bei der Arbeit in der Eisengießerei davon träumt, Maler zu werden, und stattdessen im Ersten Weltkrieg an die Front nach Westflandern gerät. Dass der Mann, der dieses Grauen überlebt, fast am Tod seiner großen Liebe zugrunde geht, ist eines der Geheimnisse, denen der Enkel auf die Spur kommt. Mit seiner Hommage an den Großvater ist Hertmans ein grandioser Roman gelungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser Berlin E-Book
Stefan Hertmans
Der Himmel
meines Großvaters
Roman
Aus dem Niederländischen
von Ira Wilhelm
Hanser Berlin
Die niederländische Originalausgabe erschien 2013
unter dem Titel Oorlog en terpentijn bei De Bezige Bij in Amsterdam.
Die Übersetzung dieses Buches wurde gefördert
vom Flämischen Literaturfonds
ISBN 978-3-446-24693-5
© Stefan Hertmans 2013
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2014
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Motiv: John Constable, Cloud Study, 1821, © Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für meinen Vater
Die Tage stehen wie Engel in Gold und Blau
unfassbar über dem Ring der Vernichtung.
Jeder hier weiß, dass wir den Krieg verlieren.
E.M. Remarque
TEIL I
Die früheste Erinnerung an meinen Großvater führt mich an den Strand von Ostende – ein sechsundsechzigjähriger Mann im dunkelblauen Anzug macht es sich mit seiner Frau in einer flachen Mulde bequem, die er mit der blauen Strandschaufel seines Enkels ausgehoben hat. Hinten hat er den Rand etwas erhöht und rundgeklopft, so dass sie geschützt sind gegen den ablandigen Augustwind, der unter hohen Nebelschleiern über die sich zurückziehende Wellenlinie heranweht. Sie haben die Schuhe und Socken ausgezogen und genießen, sanft mit den Zehen spielend, die Kühle des tiefer liegenden, feuchten Sandes – für mich, das sechsjährige Kind, eine ungewohnte Hemmungslosigkeit des stets in Schwarz, Grau oder Dunkelblau gekleideten Paars. Selbst hier am Strand, ungeachtet der Hitze, hat mein Großvater den Borsalino auf dem fast kahlen Kopf, trägt ein blendend weißes Hemd und eine schwarze, ungewöhnlich große Schleifenkrawatte mit zwei langen herabhängenden Bändern. Von fern sieht es aus, als hätte er sich die Silhouette eines schwarzen, flügelspreizenden Engels um den Hals geknotet. Meine Mutter nähte ihm diese merkwürdigen Schleifen nach seinen Anweisungen, ich habe ihn nie anders gesehen als mit einer dieser frackschößigen Krawatten; er muss Dutzende davon besessen haben, eine liegt hier irgendwo zwischen meinen Büchern, ein Relikt aus einer fernen, verlorenen Zeit.
Nach einer halben Stunde zieht er dann doch sein Jackett aus, entfernt die goldenen Manschettenknöpfe und steckt sie in die Tasche, rollt die Hemdsärmel auf, besser gesagt, schlägt sie zweimal sorgfältig um, bis exakt unter die Ellenbogen, jeder Umschlag so breit wie die gestärkte Manschette, und er sitzt da, als posierte er, das ordentlich gefaltete Jackett mit dem im Mittagslicht glänzenden Seidenfutter über dem Arm, für ein impressionistisches Porträt. Sein Blick verliert sich im fernen Gewimmel der Menschen, der kreischenden, planschenden Kinder, der schreienden und lachenden Ausflügler, die Fangen spielen, als wären sie wieder jung. Die Szenerie gleicht einem Gemälde von James Ensor, nur in Bewegung, dabei kann er die Bilder des gotteslästerlichen Ostendener mit dem englischen Namen auf den Tod nicht ausstehen. Er hält Ensor für einen »Klakpotter«, und Klakpotter gehören wie die Klepsjiezen und das Kroelkesvolk zur so ziemlich schlimmsten Sorte Mensch, die mein Großvater kennt. Klakpotter sind alle modernen Maler; sie haben keine Ahnung von der Feinmalerei, von den Subtilitäten des edlen Malerhandwerks früherer Zeiten. Sie klecksen vor sich hin, achten die Gesetze der Anatomie nicht, wissen nicht, wie man eine Glasur aufbringt, mischen die Farben schon lange nicht mehr eigenhändig, benutzen Terpentin, als wäre es Wasser, haben keine Ahnung von den Geheimnissen eines selbstzerriebenen Pigments, vom feinen Leinöl oder der Mischung des Schlussfirnisses – kein Wunder, dass es keine großen Maler mehr gibt.
Der Wind frischt auf, mein Großvater nimmt die Manschettenknöpfe aus der Jackentasche, krempelt die Ärmel herunter, knöpft das Hemd zu, schlüpft in sein Jackett und hilft seiner Frau, sich die schwarze Spitzenmantille sorgfältig über die Schultern und den Knoten der dunkelgrauen Haare zu drapieren. »Komm, Gabrielle«, sagt er, und sie erheben sich, nehmen die Schuhe in die Hand und machen sich an den etwas mühsamen Aufstieg zur Promenade hinauf. Noch sind seine Hosenbeine bis zu einer Höhe von ungefähr fünfzehn Zentimetern aufgerollt, und ihre schwarzen Strümpfe stecken in den Schuhen, weshalb ich vier weiße Waden sehe, die sich unter den dunklen Torsi gleichmäßig und träge über dem Sand bewegen. Sie gehen auf die blaue Steintreppe zu, die zum Deich hinaufführt, wo sie sich auf die nächste Bank setzen, in aller Seelenruhe den Sand von den Füßen klopfen, die schwarzen Strümpfe über die alabasterweißen Füße streifen und die Schuhe mit etwas zuknoten, was damals »Nestelband« hieß und noch nicht Schnürsenkel.
Ich selber renne, als mein Tunnelsystem für die großen Steinmurmeln – meine geliebten bonketten – einstürzt, zitternd zu meiner Mutter. »Das Meer kommt zurück«, sagt sie, während sie mich warm rubbelt und über den Dünen hinter uns die ersten Quellwolken auftauchen. Der Wind scheuert über die Dünenköpfe, als wollte er das Dünenhaar zerzausen; es ist, als wappneten sich große, sandfarbene Tiere gegen die nahende Nacht.
Mein Großvater hat schon den Spazierstock aus lackiertem Ulmenholz in der Hand und wartet mit leichter Ungeduld darauf, dass wir endlich alle die Promenade erreicht haben. Dann geht er voraus; er ist nicht groß, ein Meter achtundsechzig, wie ich ihn oft sagen hörte, dennoch machen ihm die Menschen Platz. Den Kopf hoch erhoben, die schwarzschimmernden Stiefeletten tadellos, die Hose mit scharfer Bügelfalte versehen, auf der einen Seite seine schweigsame Frau am Arm und auf der anderen den Spazierstock in der Hand – so geht er vor uns her, dreht sich ab und zu nach uns um und ruft, dass wir noch den Zug verpassen werden, wenn wir weiter so trödeln. Sein Gang ist der eines aus der Armee entlassenen Soldaten, das heißt, er lässt nicht plump zuerst die Ferse aufs Pflaster knallen, sondern tritt mit dem Fußballen auf, wie es sich gehört, seit mehr als einem halben Jahrhundert. Dann verschwindet er aus meiner Erinnerung, und ich, überwältigt von der plötzlich aufleuchtenden Klarheit dieser längst vergangenen Szene, werde so müde, dass ich auf der Stelle einschlafen könnte.
Übergangslos rückt das nächste Bild meines Großvaters vor mein inneres Auge, das Bild eines schluchzenden Mannes – er sitzt an dem kleinen Tisch, an dem er malte und schrieb, bekleidet mit seinem grauen Kittel, auf dem Kopf den schwarzen Hut. Gelbes Morgenlicht fällt durch das kleine, weinumrankte Fenster; in den Händen hält er eine der vielen Reproduktionen, die er oft aus Kunstbüchern riss und die ihm als Vorlagen für seine Kopien dienten (er pinnte die Reproduktion auf ein Brett, das er mit zwei Wäscheklammern an der Malerpalette befestigte); ich kann nicht erkennen, was auf der Illustration in seiner Hand abgebildet ist, aber ich sehe Tränen über seine Wangen rollen und höre ihn leise murmeln. Ich war die drei Stufen zu seinem kleinen Malzimmer hinaufgesprungen, um ihm zu erzählen, dass ich gerade das Skelett einer Ratte ausgegraben hatte. Jetzt ziehe ich mich schnell zurück, schließe still die Tür zu seinem Zimmer, der Treppenbelag dämpft meine Schritte, schleiche mich aber, als er später auf einen Kaffee herunterkommt, wieder hinauf. Die Abbildung liegt auf dem Tisch und zeigt das Gemälde einer nackten Frau, die mit dem Rücken zum Betrachter vor einem roten Vorhang auf einem Sofa oder Bett liegt, eine schlanke Frau mit dunklen Haaren, ihr friedlich verträumtes Gesicht kann man im Spiegel sehen, den ihr ein Cupido mit einem blauen Band über der Schulter vorhält, besonders betont sind ihr schlanker, nackter Rücken und ihr runder Hintern. Mein Blick wandert zu den schönen Schultern, den gelockten, feinen Härchen im Nacken hinauf, und danach erneut zu dem fast obszön dem Betrachter zugekehrten Po; erschrocken lege ich die Abbildung zurück und renne hinunter in die Küche. Dort singt mein Großvater für meine Mutter ein französisches Lied, das er noch vom Krieg her kennt.
*
Meine Kindheit ist überwuchert von seinen Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg, immer und immer wieder dieser Krieg: irgendwelche Heldentaten auf schlammigen Feldern, Bombenhagel, Gewehrschüsse, schreiende Schemen im Dunkel und französisch gebrüllte Befehle, das alles schilderte er von seinem Schaukelstuhl aus mit einem unbeirrbaren Gespür für Effekte – der Stacheldraht war allgegenwärtig, Schrapnelle flogen uns um die Ohren, Maschinengewehre ratterten, Leuchtkugeln wanderten in hohem Bogen übers dunkle Firmament, Mörser und Haubitzen, Tausende von Bomben und Granaten wurden abgefeuert, während die Tanten in stupider Bewunderung nickten und am Tee nippten und mir von diesen Erzählungen nur die unbestimmte Ahnung blieb, mein Großvater müsse ein Held gewesen sein, und zwar in Zeiten, die mir so fern lagen wie das Mittelalter, über das ich auf der Schule einiges gelernt hatte. Dabei war er für mich sowieso schon ein Held, er gab mir Fechtunterricht, schliff meine Taschenmesser, brachte mir bei, wie man Wolken zeichnet, indem man sanft mit einem Radiergummi über eine Zeichnung reibt, die man mit einem Stück Kohle gemacht hat, oder wie man die unzähligen Blätter eines Baumes wiedergibt, ohne sie alle einzeln malen zu müssen – für ihn die wahren Geheimnisse der Kunst.
Geschichten werden erzählt, um vergessen zu werden, kehren sie doch immer wieder zurück, auch die merkwürdigsten Geschichten über Kunst und Künstler. So wusste ich zum Beispiel schon, dass der alte Beethoven deshalb so besessen an seiner Symphonie arbeitete, weil er taub war, doch eines Tages erfuhr ich zu meiner Bestürzung, dass er sich, wenn er in die Arbeit versunken war, nicht die Mühe machte, das Klosett aufzusuchen, sondern sich einfach neben seinem Klavier erleichterte. Und so sah ich jedes Mal, wenn an einem langweiligen, langen Sonntagnachmittag die Eltern und Großeltern mit schläfrig nickenden Köpfen auf dem braungeblümten Sofa saßen und im Radio etwa das wunderschöne Adagio aus der Pastorale ertönte, einen Berg Scheiße neben einem glänzend lackierten Spinett, während der Kuckuck zwischen den Holzbläsern und den Geigen aus dem Wienerwald herausrief und mein Großvater angestrengt die Augen geschlossen hielt, weil seine Ehrfurcht vor dem romantischen Genie es in solchen Momenten nicht duldete, die Banalität seiner Mitbewohner vor sich zu haben. Erst viele Jahre später begriff ich, dass er selbst ungefähr anderthalb Jahre buchstäblich neben der Scheiße gelebt hatte – in den entsetzlichen Schützengräben des Ersten Weltkriegs, wo jeder, der auch nur den Kopf über den Rand hinausstreckte, weil er sich draußen erleichtern wollte, mit einer Kugel durch den Schädel bestraft wurde. So kehrte alles, was er eigentlich vergessen wollte, in den Bruchstücken seiner Erzählungen wieder, in absurden Details, und egal, ob sich die Geschichten nun im Himmel oder in der Hölle abspielten, ich musste die Bruchstücke und Details wie bei einem Puzzle zusammensetzen, wollte ich auch nur annähernd begreifen, was das Wesen meines Großvaters maßgeblich bestimmte: der lebenslange Kampf zwischen dem Erhabenen, wonach ihn verlangte, und der Erinnerung an Tod und Verderben, die ihn nicht losließ.
Zu Hause trug mein Großvater über seinem weißen Hemd und der schwarzen Schleifenkrawatte stets die gleichen Kittel, die Kieltjes, und das mit einer gewissen Eleganz. Wie sehr meine Mutter und meine Großmutter die ehemals weißen oder hellgrauen kurzen Baumwollmäntel in der Länge eines altmodischen Schlafrocks auch wuschen und kochten, die Verschmutzungen waren nicht rauszukriegen: eine Komposition aus Flecken in allen Farben des Regenbogens, aus bunten, wirren Fingerabdrücken und achtlosen Pinselabstrichen: groteske Graffiti, Relikte wahrer Arbeit.
Diese wahre Arbeit, der er, im vorzeitigen Ruhestand aufgrund seiner Kriegsinvalidität, seit seinem fünfundvierzigsten Lebensjahr ungestört nachgehen konnte, war die Amateurmalerei. Das kleine Zimmer, in dem er Tag für Tag vor dem kleinen Fenster stand, roch nach Leinöl, Terpentin, Leinwand, Ölfarbe. Selbst der Geruch der großen, mit einem Messer zurechtgeschnittenen Radiergummistücke war in der unnachahmlichen Mischung dieser Atmosphäre deutlich auszumachen, in diesen glanzvollen, endlosen und stillen Stunden, die er mit dem unermüdlichen und fruchtlosen Nacheifern der alten Meister verbrachte. Er war ein virtuoser Kopist, der um die Geheimnisse der Materialien und Präparate, wie sie bereits die Renaissance-Künstler benutzt hatten, wusste. Obwohl er einer körperlich anstrengenden Arbeit nachging, belegte er nach dem Krieg Abendkurse im Zeichnen und Malen, was sein Vater, der Kirchenmaler, ihm zu Lebzeiten auszureden versucht hatte, und als er das heiratsfähige Alter erreichte, war er im Besitz einer Urkunde, die ihm Kenntnisse in Feinmalerei und im Anatomiezeichnen bescheinigte.
Aus seinem Fenster blickte er auf die Flusskrümmung der Nederschelde, auf Wiesen mit trägen Kühen, auf Binnenschiffe, die am Morgen tief im Wasser liegend vorbeituckerten und am Abend um ihre schwere Fracht erleichtert die Stadt in rascher Fahrt wieder verließen. Unendlich oft malte er diese Aussicht, in immer anderem Licht und anderen Farbtönen, zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, in den unterschiedlichsten Stimmungen. Jedes einzelne Blatt des roten Weins malte er nach der Natur, und wenn er ein Detail aus einem Gemälde von Tizian oder Rubens kopierte, dann konnte er sich auf seine Geduld verlassen, auf seine zeichnerische Fertigkeit mit Kohle- oder Graphitstift und seine Sicherheit in der Farbmischung und der Pigmentverdünnung. Vor allem aber kannte er eines der größten Geheimnisse der Kunst, nämlich das Wissen darum, wie lange man die erste Schicht trocknen lassen muss, bevor man die zweite aufbringt, die Transparenz und Tiefe schafft.
Seine große Leidenschaft waren Bäume, Wolken und Stofffalten. In diesen formlosen Formen konnte er sich ausleben, hineinträumen in eine Welt, bestehend aus Licht und Schatten, aus zu Ölfarben verkrusteten Wolken, aus dem chiaroscuro, eine Welt, die ihm die Menschen vom Leib hielt, ihm, in dessen Inneren etwas zerbrochen war – schwierig zu sagen was. In seine Herzlichkeit mischte sich Reserviertheit, als fürchtete er ständig, dass man ihm zu nahe käme, wenn er zu freundlich wäre. Gleichzeitig war er erfüllt von einer höheren, edleren Form zuvorkommender Arglosigkeit, und diese Naivität bildete den Kern seines heiteren Wesens. Seine Ehe mit Gabrielle war wolkenlos für den, der es nicht besser wusste. Miteinander verwachsen wie zwei alte Bäume, die sich im Kampf um das spärliche Licht viele Jahre lang gegenseitig durchs Geäst wuchsen, verlebten sie schlichte Tage, die nur unterbrochen wurden von der kecken Fröhlichkeit ihrer Tochter, des einzigen Kindes. Die Tage verschwanden in den Falten einer sich zerfleddernden Zeit. Er malte.
Sein Malzimmer diente gleichzeitig als Schlafzimmer; heute ist es kaum noch vorstellbar, mit wie wenig Raum man sich früher begnügte. An der Wand hinter seinem Arbeitstisch stand das schmale Bett seiner Frau. So konnte sie sich im Schlaf gegen die Wand lehnen, denn sie schlief fern von ihm. Falten und Wolken, Bäume und Wasser. Das Beste in seinen unverhohlen traditionellen Arbeiten bestand jedoch aus unförmigen Flecken, merkwürdig abstrakten Massen, die er für treue Abbilder der Natur hielt, für Nachahmungen des Modells, das Gott vor seinen Augen ausbreitete und das er Tag für Tag mit der akribischen Geduld des Kopisten ebenfalls entfalten musste. Es war seine treuergebene Art der Trauer, Tribut an seinen zu früh verstorbenen Vater, den bescheidenen Kirchenmaler Franciscus.
*
Die Hefte, in die er in einer unvergleichlichen Vorkriegshandschrift seine Erinnerungen niedergeschrieben hatte, befanden sich bereits mehr als dreißig Jahre lang in meinem Besitz, bevor ich den Mut aufbrachte, sie zu öffnen. Er gab sie mir einige Monate vor seinem Tod1981, er war damals neunzig Jahre alt. Geboren wurde er 1891. Zunächst scheint sein Leben nicht mehr zu sein als die Rochade zweier Ziffern in einer Jahreszahl. Doch zwischen diese beiden Daten drängen sich zwei Kriege, unvorstellbare Massaker, das rücksichtsloseste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte, Aufstieg und Verfall der modernen Kunst, die weltweite Expansion der Motorindustrie, der Kalte Krieg, Bildung und Zerfall großer Ideologien, die Erfindung des Bakelits, die Verbreitung von Telefon und Saxophon, die Industrialisierung, das Aufblühen der Filmindustrie, der Siegeszug des Plastiks, der Jazz, die Flugzeugindustrie, die Mondlandung, das Aussterben zahlloser Tierarten, die ersten großen ökologischen Katastrophen, die Entwicklung des Penicillins und des Antibiotikums, der Mai 68, der erste Bericht des Club of Rome, die Popmusik, die Erfindung der Pille, die Frauenemanzipation, das Aufkommen des Fernsehens, der ersten Computer – und sein eigenes langes Leben als vergessener Kriegsheld. Es ist das Leben, von dem er wollte, dass ich es beschrieb, warum sonst hätte er mir die Hefte anvertraut? Ein Leben, das fast ein ganzes Jahrhundert umfasst und auf einem anderen Planeten begann. Einem Planeten mit Dörfern, Feldwegen, Pferdekutschen, Gaslampen, Waschzubern, Andachtsbildchen, alten Wandschränken, einem Planeten, auf dem Frauen mit vierzig alt waren, aufmüpfige Bürgertöchter in Nonnenklöstern verschwanden, Priester nach Zigarren und schmutziger Unterwäsche rochen und allmächtig waren, Großseminare, bischöfliche und kaiserliche Verordnungen herrschten und dessen langer Todeskampf an dem Tag des Jahres 1914 begann, an dem der kleine, schmierige Serbe Gavrilo Princip mit einem nicht einmal gutgezielten Schuss die schöne Illusion des alten Europa in Fetzen schoss und damit den Auftakt gab zu einer Katastrophe, die auch das Leben meines kleinen, blauäugigen Großvaters bis in die Grundfesten erschütterte.
*
Ich hatte mir vorgenommen, seine Erinnerungen erst zu lesen, wenn ich genügend Zeit dafür hätte, denn ich ahnte, dass ich mich unter dem Eindruck seiner Lebensgeschichte sofort hinsetzen würde, um sie aufzuschreiben, mit anderen Worten: Ich wollte frei und ohne Verpflichtungen sein, damit ich ihm uneingeschränkt zu Diensten stehen konnte. So ließ ich Jahre verstreichen, tat dieses und jenes und machte einen Bogen um die geduldig schweigenden Hefte, in denen die in gewissenhafter, zierlicher Handschrift verfassten Aufzeichnungen meines Großvaters ruhten wie in einem kleinen Schrein.
*
In diesen Jahren des Aufschiebens und des verdrängten Schuldgefühls kam etwas ans Licht, was die Geschichte meines Großvaters wieder in die Gegenwart zurückholte. Eines Tages tauschte mein Vater mit Unterstützung eines Onkels in der kleinen, 1930 errichteten Villa meines Großvaters einige morsche Dielen des Wohnzimmerparketts aus, und sie fanden im Schein einer Taschenlampe im Kriechkeller unter dem Salon, ganz hinten in einer staubigen Ecke, einen Grabstein: Den Grabstein der Mutter meines Großvaters. »Verdammt nochmal, hier haben sie ihn versteckt«, höre ich meinen Vater noch heute sagen. Die beiden Männer zerrten den Stein bis zum Einstiegsloch und hoben ihn heraus. Mein Großvater war damals schon einige Jahre tot, und mir war schleierhaft, warum jemand einen Grabstein derart tief in einem Keller versteckte, offenbar mit dem Ziel, ihn nie mehr ans Tageslicht gelangen zu lassen. Es sollte nochmals mehrere Jahre dauern, bevor ich den Stein wiederentdeckte, den mein Vater mit Metallklammern an der inzwischen efeuüberwucherten Gartenmauer hinter der Garage aufgehängt hatte, ungefähr einen Meter über dem Erdboden. Erst jetzt entzifferte ich die Inschrift:
Betet für die Seele von
Celina Andries
geb. 9.8.1868
gest. 20.9.1931
Witwe von
Franciscus Martien
Ehefrau von
Henri De Pauw
Vor mir liegen zwei Hefte. Das erste Heft ist klein und dick, mit rotem Farbschnitt und einem Umschlag aus hellgrauem Leinen, als hätte man ihm ein Jäckchen aus Vorkriegstweed angepasst. Das zweite ist größer, fast DIN-A4-Format, und in altmodisch marmorierten Karton eingeschlagen. Das Muster ähnelt jenem faux marbre, das mein Großvater so gerne auf Wände aufbrachte. Das erste Heft umfasst die Erinnerungen an seine von Armut geprägte Kindheit in Gent vor der Jahrhundertwende, aber auch einen Teil seiner Erfahrungen im Ersten Weltkrieg.
Er war zweiundsiebzig, als er das erste Heft begann – das genaue Datum lautet: 20. Mai 1963. Ich vermute, er wollte, dass auch andere Menschen erfuhren, was sein Leben so verunstaltet hatte, denn die Familienmitglieder waren seiner Geschichten gehörig überdrüssig und fuhren ihm manchmal mit einem »Das-hast-du-schon-mal-erzählt« über den Mund, mit einem »Ich-bin-müde-ich-geh-schlafen« oder mit einem »Ich-muss-ganz-dringend-weg«. Als er sich zur Niederschrift seiner Erinnerungen entschloss, war seine Frau Gabrielle bereits seit fünf Jahren tot, und er scheint mit diesem Entschluss die Trauerzeit bewusst beenden zu wollen. In einer gleichmäßigen, festen Handschrift und mit vorwiegend blauer Tinte schreibt er seine Erinnerungen an Kindheit und Krieg nieder – ich sehe seinen Waterman-Füllfederhalter noch vor mir. Er liegt auf dem kleinen, mehr als hundert Jahre alten Frisiertisch, den er mit einer Maserung bemalt hatte, in der Hoffnung, dass er auf diese Weise einer echten Antiquität ähnlicher würde. Die Originalmarmorplatte war wohl irgendwann zerbrochen; die Ersatzplatte aus Holz war etwas zu klein und äußerst ungeschickt angebracht. Der Tisch war außerdem zu hoch und dadurch unbequem, was meinen Großvater nicht davon abhielt, an ihm zu schreiben. Er steht jetzt mit seiner Schublade voller Ölfarbenflecke hinter mir in meinem Arbeitszimmer; ich bewahre darin die beiden Hefte auf. Warum er ein zweites Heft begann, erklärt er mit folgenden Worten: In meinem ersten Tagebuch über den Krieg 1914–1918 stehen zu viele langweilige Geschichten aus meiner Kindheit, und viele Seiten sind unwichtig. In diesem Heft will ich nur noch über den Krieg schreiben, nicht zu dessen Ruhm und Ehre, sondern offen und ehrlich. Gott sei mir gnädig. Nur was ich selbst erlebt habe. Meine ganz persönliche Qual.
Und so erzählt er in diesem zweiten Heft von seinen grauenhaften Erlebnissen bei der Schlacht an der Yser, von seinen Verwundungen, den Lazarettaufenthalten in England und von der für ihn so wichtigen Entdeckung des Freskos in Liverpool. Nach1916, dem Jahr, in dem er zum zweiten Mal niedergeschossen wurde, fasst er sich kürzer, offenbar weil man die entsetzlichen Details aus dem Leben in den Schützengräben nicht immer und immer wieder beschreiben kann, nicht, wie sie die Ratten mit bloßer Hand töteten, bevor sie sie auf einem kleinen Feuer in der Nacht brieten, nicht, wie die verstümmelten Kameraden schrien, nicht, wie sie mit blutigen Händen die Stacheldrahtrollen im Schlamm entrollten, nicht, wie die Maschinengewehre ratterten, die Granatkartätschen knatterten und ihnen die Erde und die zerfetzten Gliedmaßen ihrer Kameraden um die Ohren flogen. Auf den letzten Seiten berichtet er allerdings noch von den dramatischen Ereignissen des ersten Nachkriegsjahres während der Spanischen Grippe 1919. Obwohl er auffällig distanziert berichtet, zerfällt seine Handschrift, scheint ihn die Disziplin zu verlassen, gleiten die Zeilen quer über das Blatt ab; an manchen Stellen kehrt seine alte, regelmäßige Handschrift zurück, meist jedoch schlingert alles wild hin und her. Als er mühsam die letzten Zeilen des Heftes kritzelte, war er weit über achtzig, schrieb nicht mehr mit Füller, sondern mit verschiedenfarbigen Filzstiften und mit erkennbar schlechteren Augen; soweit ich mich erinnere, trug er in all den Jahren, die ich ihn kannte, immer dieselbe Brille, möglich, dass er kaum noch etwas entziffern konnte auf dem Papier, über das er sich so qualvoll beugte. Für die insgesamt sechshundert handschriftlichen Seiten brauchte er geschlagene siebzehn Jahre. Doch sein Gedächtnis ließ ihn keinen Augenblick lang im Stich, er erinnerte sich an alle Einzelheiten, wofür ich keine andere Erklärung habe, als dass es sich dabei um eine Form traumatischer Klarheit handelte. Legt man zum Vergleich das zweite Heft neben das erste, zeigt sich, dass er immer tiefer in die Schützengräben seiner Erinnerung eindrang. Sein ganzes Leben lang kam er nicht los von diesen Einzelheiten, vergaß nicht das herabtrudelnde Blatt in der Abenddämmerung, bevor er dem Tod zum soundsovielten Male ins Angesicht sah, nicht den Anblick seiner toten Kameraden, nicht den Schlammgeruch, den lauwarmen Frühlingswind über dem zerschossenen Land oder das zerfetzte Pferd in einer Hecke. Auf dem letzten Blatt scheint er etwas verschüttet zu haben; dort ist auch ein Loch im Papier, links davon steht »abends« und rechts »Panik«.
*
Ich ließ die Lektüre eine Weile auf mich wirken. Danach nummerierte ich zuerst die Seiten, bevor ich markierte, welche Geschichten in beiden Heften auftauchten. Das Abtippen der Aufzeichnungen dauerte fast ein ganzes Jahr, während dessen ich mir klar darüber werden konnte, wie sich die verschwiegenen, nicht erzählten Geschichten zu den tatsächlichen Ereignissen verhielten. Die Arbeit ging mir nur schwer von der Hand, weil ich ständig das Gefühl hatte, ihm nicht gerecht zu werden: Zum einen war es mir unmöglich, seine stilistische Mischung aus altmodischer Eleganz, Unbeholfenheit und Authentizität wiederzugeben, ohne manieriert zu wirken, zum anderen war es mir, als verriete ich ihn, wenn ich seine umständliche Erzählweise der heutigen Redeweise anpasste. Schon beim Korrigieren seiner oft anrührenden Schreibfehler hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich verfluchte meinen mittelmäßigen Stil, der aus dem schizophrenen Versuch resultierte, meinem Großvater treu zu bleiben und gleichzeitig seine Geschichte in die eigene Erfahrung zu übersetzen. Die Aufzeichnungen konfrontierten mich mit der schmerzhaften Wahrheit jedes literarischen Werks, dem eine authentische Geschichte zugrunde liegt: Man muss sich erst davon kurieren, muss von ihr ablassen, um sie auf ganz eigene Art wiederentdecken zu können. Doch die Zeit drängte, denn ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, meine Arbeit, meinen Kampf mit seiner Erinnerung zu beenden, bevor die Jahrhundertfeierlichkeiten zum Großen Krieg beginnen, seinem Krieg.
Wie ein Buchhalter kämpfte ich mich durch die aberhundert handgeschriebenen Seiten, legte ein Verzeichnis von Szenen und Schlüsselwörtern an, notierte die Orte, die ich besuchen müsste, und ließ die Hefte kopieren, aus Furcht, sie könnten verloren gehen, wonach ich sie in einem feuerfesten Bankschließfach deponierte. Ich sprach mit den wenigen noch lebenden Zeitzeugen, die mir allerdings nur mit einzelnen und vielfach zweifelnd geäußerten Details aushelfen konnten. Meinen Vater, seinen Schwiegersohn, den letzten Bewohner des Hauses am Flussufer, bat ich darum, alles aufzuschreiben, an was er sich erinnern konnte; auf diese Weise lieferte er mir, kräftig und klar, wie er auch mit neunzig noch war, den notwendigen Kitt, mit dem ich die Bruchstücke zusammenfügen konnte, half mir, die apokryphen, von meinem Großvater immer wieder munter erzählten Geschichten mit ihren schriftlichen Versionen in den Heften zu vergleichen, und versetzte mich dadurch in die Lage, die wahren Dimensionen der Dinge zu erfassen.
*
Immer wenn mein Blick auf den alten Frisiertisch fällt, sehe ich ihn dort sitzen: eine kleine, gedrungene Gestalt, von der eine ungeheure Intensität ausgeht. Hellblaue, glänzende Augen, schütteres, weißes Haar um einen kahlen Schädel, ähnlich wie beim alten Schopenhauer: Beide waren sie zähe, große Persönlichkeiten, von denen wir behaupten, dass es sie heute nicht mehr gibt, weil das Leben die für das Reifen und Gedeihen solcher Charaktere notwendige spartanische Nüchternheit verloren hat. Noch habe ich sein Erzählen im Ohr, höre, wie er ruft, wie sich auf ansteckende Weise seine Stimme überschlägt, erkenne ihren Oktavumfang, doch einzelne Worte oder Sätze kann ich mir nicht mehr in Erinnerung rufen. Ich nehme die Gerüche wahr, die ich mit ihm verbinde: den Geruch eines Malers aus alter Zeit und etwas Unbestimmtes, den höchst eigenen Geruch seiner ehemals körperlichen Existenz, fern der Zeit, in der ich dies schreibe. Wie eine Gestalt aus alten Mythen und Erzählungen taucht mein Großvater aus der Vergangenheit auf, jedoch auf eine besondere Art und Weise, nämlich als histoire intime.
Auf der Suche nach den Spuren seines Lebens frage ich mich, warum wir uns oft besser mit unseren Großeltern verstehen als mit unseren Eltern. Liegt es daran, dass wir mit ihnen nicht den Generationenstreit auszutragen brauchen wie mit unseren Eltern? Der große Altersunterschied schafft einen Freiraum, in dem wir unsere vermeintliche Identität erproben können, und lässt uns glauben, die ferne Vergangenheit der Großeltern berge mehr Wahrheiten als alles, was wir über unsere Eltern wissen. Und dieser naive Glaube macht uns neugierig.
*
Ich bin überrascht, als während der Arbeit an seinen Aufzeichnungen mehrere Gegenstände meiner Welt ihr historisches Geheimnis preisgeben: eine goldene Taschenuhr, die auf einem Fliesenboden in tausend Stücke zerspringt; eine im Alter von fünfzehn Jahren heimlich gerauchte Zigarette aus einem Silberetui, wonach mir schlecht wurde; ein zerschlissener braunroter Schal auf einem der ausrangierten Schränke im verfallenen Wintergarten, besudelt vom dünnen Schiss von Vögeln, die sich in das Glashaus verirrt hatten und in Panik geraten gegen die Fenster geflattert waren, bis sie durch Zufall wieder durch die offen stehende Luke hinausfanden; ein Döschen mit altmodischem, silberfarbenem Rasierzeug, aus dem ein durchdringender Geruch von Alaunstein und altmodischer Seife drang; ein Stadtplan von Liverpool, der so oft auseinander- und wieder zusammengefaltet worden war, dass er am Falz auseinanderfiel; die Blechbüchse mit den Orden und Medaillen, die ich erst viele Jahre nach seinem Tod fand; die riesige, wöchentlich polierte, kupferne Granathülse auf dem Treppenpfosten – die er den »Obus« nannte und die ich als Kind immer für eine unförmige Blumenvase gehalten habe.
Nach und nach enthüllte sich mir das Geheimnis meines Großvaters – eines langen Lebens, das zum größten Teil nur ein Epilog war zu einer fast noch mittelalterlich anmutenden Kindheit, einem von Grausamkeiten erfüllten Jungmännerleben, einer nach dem Krieg gefundenen und wieder verlorenen großen Liebe, eines langen Lebens, das die Geschichte erzählt von unerschöpflicher Ergebenheit, von schmerzlicher Enthaltsamkeit, kindlichem Mut, inneren Kämpfen zwischen Frömmigkeit und Verlangen, von endlosen Gebeten in schattigen Kirchen, den Hut neben sich auf die Kirchenbank gelegt und das Haupt gebeugt vor den zahllosen Heiligenbildern und den flackernden Kerzen – dieses Geheimnis lag in einem leidenschaftlichen Lebenseifer, den man von außen seiner unaufgeregten Welt keineswegs ansah.
*
Ich flaniere durch die Straßen meiner Geburtsstadt und sehe sie mit ganz anderen Augen als noch vor gut zehn Jahren, als ich sie verließ. Es herrscht kühles Frühlingswetter, Wolken am Himmel, wie er sie gerne zeichnete. Die alte Fassade des Fahrradladens, wo ich mein erstes, rotes Fahrrad bekam, existiert noch, doch die Aufschrift darauf ist verblasst. Die Bürgerhäuser stehen verwaist an der Asphaltstraße, die nur noch wenig erinnert an das gemütliche Leben, für das die Häuser vor ungefähr einem Jahrhundert entworfen und gebaut worden waren. Es fängt an zu nieseln, die Autos schieben sich in trägen Kolonnen über die Heirnislaan, hinter der irgendwo zwischen dem Rangierbahnhof und dem Kanal die dunkle Gasse gewesen sein musste, in der mein Großvater seine ersten Lebensjahre verbrachte. Heute ist die Heirnislaan Teil des städtischen Schnellstraßenrings; damals war es eine hübsche Allee mit hohen Bäumen, unter denen an sommerlichen Sonntagnachmittagen die »herrschaftlichen, jungen Damen«, wie er sie voller Ehrfurcht nannte, durch die Fenster ihrer leichten Kutschen kichernd die aschfahlen Rotzjungen beobachteten, die einen Blick auf die Mädchen zu erhaschen versuchten. Diese Heirnislaan überquerte er an einem nebligen Wintermorgen wie ein kleiner Held aus einem Dickens-Roman, an den Füßen Holzschuhe und in der Hand einen großen Eimer. Er wollte zu den schwarzen Männern, die hinter dem Dampoort die Tender der Lokomotiven beluden, um ihnen Steinkohle abzubetteln. Zu Hause stellte er den schweren Eimer hinter den Löwener Ofen, damit sich seine Mutter, wenn sie müde von ihrer Arbeit zurückkehren würde, darüber freuen konnte, dass sie an diesem Abend nicht frieren und sogar warm essen würden. Danach rannte er sofort zur Schule und bekam einen Anschiss, weil er zu spät kam. Seine große Schwester lachte ihn aus, weil er in den Sprachen und im Rechnen nicht gut mitkam. Einmal hatte er am mit Schmetterlingsflieder und Holunder bewachsenen Bahndamm ein Maiskorn gepflanzt und die enorm schnell wachsende Pflanze jeden Tag mit Hilfe eines verbeulten Schälchens gegossen, bis er sie eines Morgens geknickt und abgerissen fand – was ein Zeichen für den Umstand war, den mein Großvater so umschreibt: »Unsere Familie war in der Straße immer weniger gelitten.«
*
Ich gehe an architektonisch einfallslosen Wohngebäuden vorbei, die auf dem Gelände des ehemaligen Genter Tiermarkts errichtet wurden; die Erinnerung daran ruft eine starke Geruchsempfindung bei mir hervor. Der alte Viehmarkt war eine überdachte, offene Halle gewesen, in der die an den Säulen festgebundenen Tiere mit blutunterlaufenen Augen und schleimtropfenden Mäulern stampfend an den Ketten zerrten. Wässriges Blut floss in die zertretene Streu unter den Schlachttischen, unförmige, hellrote Berge von gestapelten Lungen schienen in ihrer glibberigen Materialität noch zu leben, herausgetrennte Herzen lagen neben Zungen, Schädel wurden kiloweise verkauft, und aus einer Kupferschüssel starrten mich Augen an, als dächte man hier tief nach über den allenthalben anwesenden Tod, einen Tod, der dem Leben näher stand als alles, was ich, der nie einen Krieg erlebt habe, je gesehen habe. Ich kann mir vorstellen, dass mein Großvater beim Anblick der Massaker bei der Schlacht an der Yser unwillkürlich und voller Widerwillen an den alten Tiermarkt denken musste, dann, wenn die herausquellenden Eingeweide seiner Kameraden mit äußerster Brutalität vor Augen führte, dass nun endgültig eine Grenze überschritten worden war – und zwar jene Grenze, die das Leben bewahren sollte vor den raffgierigen Klauen des Todes. Die fröhlichen Viehhändler der Provinzstadt um 1900 waren gleichgültig gegenüber dem Ausdruck der Gelassenheit und Panik in den Augen der Schafe, die darauf warteten, geschlachtet zu werden. Die damaligen Zeiten waren ruhig, alles hatte seinen Platz, der schmutzige Dreikäsehoch schlenderte an den Tischen vorbei, er wusste, er bräuchte mit seinen blauen Kinderaugen nur ein wenig untröstlich zu blicken und einer der Händler würde ihm etwas zuschmeißen: etwas blutigen Pansen, ein schlecht entbeintes Rippenstück, aus dem man noch eine Suppe kochen konnte, ein Stück zähes Fleisch für eine Brühe. Jedes Mal, wenn wir uns gemeinsam Reproduktionen ansahen und auf Rembrandts berühmten geschlachteten Ochsen stießen, sagte er: »Das ist so gut gemalt, dass man den Viehmarkt förmlich riechen kann.«
Seine Mutter, Céline Andries, »durfte« studieren, wie mein Großvater schreibt – ihre Eltern waren Getreide- und Kartoffelhändler gewesen, ebenso wie seine späteren Schwiegereltern. Die Kaufmannstochter besuchte das Mädchenpensionat Piers de Raveschoot, das im neunzehnten Jahrhundert nur begüterten Familien offenstand. Sie sprach Französisch und Englisch, konnte Gedichte von Prudens van Duyse auswendig, las Hendrik Conscience’ De Leeuw van Vlaanderen (Der Löwe von Flandern), was sie für die Sache der Flamenpolitik einnahm. Nach ihrer Ausbildung »diente« sie bei einer adligen Familie in Antwerpen – »dienen«, so nannte man das damals –, und zwar bei der Familie Potter de Veldewijk in Ekeren, wo sie den Lebensstil des Großbürgertums kennenlernte. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie ihr ganzes Leben lang eine vornehme Reserviertheit ausstrahlte. Sie muss eine bemerkenswert starke Persönlichkeit gewesen sein. Die Bewunderung meines Großvaters für sie war grenzenlos, und er spricht in seinen Erinnerungen nie anders als mit einer Mischung aus distanzierter Liebe und intimer Zuneigung von ihr.
Sein Vater, der Kirchenmaler Franciscus Martien, war ein talentierter junger Bursche aus einfachen Verhältnissen. Céline und er lernten sich kennen, als sie beim Betreten der Gemeindekirche gegen seine Malerleiter stieß. Franciscus Martien restaurierte gerade die vierte Station des Kreuzwegs und wäre fast von der Leiter gefallen. Die Geschichte, wie meine Urgroßeltern sich kennenlernten, blieb für mich stets ein Mysterium, jedes Mal, wenn sie erzählt werden sollte, winkte mein Großvater lächelnd ab, doch in seinen Erinnerungen schrieb er sie liebevoll nieder, wodurch ich die Geschichte dann doch in allen Einzelheiten erfuhr. Sie stieß also gegen seine Leiter, worauf von oben etwas herabfiel – ein Pinsel, ein Palettmesser oder ein anderes der Werkzeuge, die an seinem Gürtel hingen. Um ein Haar hätte sie der Gegenstand getroffen, doch er fiel klatschend auf den Steinfußboden der leeren Kirche. Die junge Frau blickte nach oben, und der junge Maler verlor vor Schreck das Gleichgewicht; die Leiter löste sich von der Mauer, und er konnte einen Sturz nur verhindern, indem er sich blitzschnell gegen die Leiter warf. Ein Lächeln huschte über ihr strenges Gesicht, sie ging weiter und setzte sich bei den zwei brennenden Kerzen vor der Heiligen Jungfrau Maria ins Gestühl, um zu beten. Später erzählte sie immer, dass sie in den zwei kleinen, still vor sich hin brennenden Flämmchen ihre beiden Seelen sah. Damals konnten junge Leute nicht zusammen sein, ohne dass eine dritte Person anwesend war; ein ärmlich gekleideter junger Mann und eine elegante junge Frau in einer leeren, stillen Kirche allein: Das gehörte sich nicht. Er schaute hinunter, sah die schwarze Spitzenmantille um ihre hohen, geraden Schultern, stieg die Leiter herab und wartete vor dem Kirchentor verlegen darauf, dass sie herauskäme. Sie aber ging schnurstracks an ihm vorbei, warf ihm nur einen kurzen Blick zu: Sie hatte spöttische, hellgraue Augen, und ihm war, als schütteten sie klares, kaltes Wasser über seine Seele aus. Hellgraue Augen, dazu schwarze Haare, so etwas musste ihm als Maler auffallen. Mein Großvater erklärte mir später, dass das nicht sehr oft vorkomme, es handele sich dabei um einen ganz bestimmten Schönheitstypus – er wusste, wovon er sprach.
Es hatte Franciscus gepackt – wochenlang wartete er darauf, dass die dunkle Erscheinung wieder in die Kirche käme. Sie ließ jedoch auf sich warten, es machte ihn närrisch, er bekam Fieber und wurde krank. Er blieb zu Hause, bis der Kaplan die Eltern davor warnte, dass Franciscus die Arbeit verliere, wenn er nicht zurückkomme. Als Céline dann an einem ganz normalen Werktag, wenn die meisten Leute keine Zeit für einen Kirchenbesuch haben, wieder auftauchte, wusste er, dass sie seinetwegen kam. In ihrer Familie entstand große Aufregung, den Eltern passte es nicht, dass die wohlerzogene Tochter mit einem Habenichts anbändelte; aber die Seele der stolzen jungen Frau war dem zerstreuten, romantischen Künstler verfallen, seinem El-Greco-haften, mageren Gesicht, den knochigen, farbfleckigen Händen mit den zaudernden, schlanken Fingern, seinem feingliedrigen, jungenhaften Gang. Ungewollt geschah in der reichen Kaufmannsfamilie, was sich in vergangenen Zeiten tausendfach wiederholte: Ein Bauer kommt zu Reichtum, lässt seine Kinder bürgerlich erziehen und bringt sie mit Kultur in Kontakt, wodurch sich die Kinder jedoch von seiner Konzentration auf das rein Materielle abkehren und ihr Glück in Höherem suchen. Céline erduldete Monate des häuslichen Streits, drohte damit, von zu Hause auszureißen und in ein Kloster zu gehen, wegzulaufen Gott-weiß-wohin, schloss sich in ihr Zimmer ein, machte sich unmöglich und sagte sich immer wieder im Stillen: »Ich will ihn, meinen Kirchenmaler mit den blauen Augen, ich will ihn und ich werde ihn kriegen!« Die Vorstellung, seine schöne Tochter könnte in einem Kloster ihr restliches Leben fristen, war sogar dem frommen Kartoffelbauern zu viel. Also gaben die Eltern nach; und die wohlerzogene und stolze Céline bekam ihren armen Maler.
Und sie bekam den ganzen Rattenschwanz dazu: ein kärgliches Leben, Geldsorgen, Franciscus’ schwache Gesundheit, seine nächtlichen Husten- und Asthmaanfälle, eine feuchte, schäbige Wohnung, Hunger und das endlose Geschrei und Gewimmer von fünf Kindern. Sie kümmerte sich um ihren Mann wie um ihr sechstes Kind. »Ach, mein kleiner, armer Maler«, sagte sie kopfschüttelnd, wenn sie ihn necken wollte. Und er betete sie an – den Knoten ihres glänzenden Haars, ihren Hals, ihre geraden Schultern, die zierlichen Knubbel ihrer Handgelenke, ihre perfekt geformten Fingernägel, den bleichen, merkwürdigen Glanz, der beim Sprechen von ihr ausging.
*
In ihrem Eheleben voll Plackerei und schier unlösbaren Problemen trug Céline stets Schwarz und, wie Mann und Kinder auch, Holzschuhe – holleblokken –, denn die eleganten Stiefelchen, die sie von zu Hause mitgebracht hatte, passten weder zu ihrer eigenen Familie noch zu den anderen Familien in der Nachbarschaft, also verbarg sie sie tief im Wandschrank. Um Geld zu verdienen, nahm sie unterschiedliche Arbeiten an. Sie flickte die Kleider der besseren Familien, bis ihre alte Nähmaschine den Geist aufgab. Für die Anschaffung einer neuen war kein Geld da. Sie schrieb Briefe für die, die weder schreiben noch lesen konnten, Briefe an Familienmitglieder oder offizielle Schreiben, Hilfeersuchen an den Rechtsanwalt – Briefe, die damals auf Französisch verfasst werden mussten. Sie half den wohltätigen Nonnen, damit diese ihrem Mann, wenn er andernorts einen Auftrag angenommen hatte, wohlgesinnt blieben und ihm weiterhin Arbeit gaben; sie erzog ihre fünf Kinder so gut und ordentlich, wie sie es vermochte. Nach meinem Großvater, dem Zweitgeborenen, gebar sie noch zwei Jungen und ein Mädchen. Eine Zeitlang putzte sie bei einer französischsprachigen Familie im Stadtzentrum. Doch das bisschen Geld, das sie verdiente, zerrann ihr zwischen den Fingern. Mit der Zeit wurde die Wohnung zu klein, und nachdem ihr kurzatmiger Mann eines Frühlings wieder etwas zu Kräften gekommen war, suchte sich die Familie eine größere Wohnung, eine nicht besonders gute, denn viel Miete konnten sie nicht bezahlen. Franciscus bekam vom Kloster der Broeders van Liefde, einer Genter Ordensgemeinschaft aus Laienbrüdern, den Auftrag, das Refektorium auszumalen, für einen Hungerlohn, was man kaum einen Akt der Liebe nennen konnte. Dennoch blieb die Familie fromm und gottesfürchtig; der Pfarrer besuchte sie regelmäßig, hörte sich Célines Klagen an und schickte tags darauf einen Seminaristen mit ein paar Resten seines üppigen Mittagsmahls.
Franciscus reparierte das alte, feuchte Haus so gut wie möglich, besserte die Fenster aus, ersetzte Kitt und Nuten, verstärkte verrottende Balken und tauschte die morschen Stufen der Kellertreppe aus. Die neue Gegend bei der Oostakkerstraat in Sint-Amandsberg gefiel der Familie besser, hinter der niedrigen Gartenmauer erstreckten sich Felder, neben dem Kanal gab es eine wildblühende Böschung, auf der sie eine Ziege weiden lassen konnten. Auf diese Weise hatten sie Milch für die Kinder und um Käse zu machen. Nachts, in seinem schmalen Bett im überfüllten Kinderzimmer, hörte mein Großvater, wie sich die Eltern in der Küche miteinander unterhielten. Die tiefere Stimme seines Vaters und die leisen Antworten seiner Mutter bildeten den Wechselgesang einer großen Brummfliege und einer Turteltaube, der ihn friedlich in den Schlaf wiegte. Es war eine Ehe, so schreibt mein Großvater, »die geprägt war von tiefer und aufrichtiger Liebe, und wenn meine Mutter meinem hustenden Vater die eingefallenen Wangen streichelte, seufzte sie manchmal ›Ach, mein Herzkleckser‹, und ihre hellgrauen Augen wurden feucht«.
*
Urbain Martien – er hieß so, weil sein Großvater mütterlicherseits so hieß – war ein einnehmender Junge, stämmig, mit langen Locken, kräftigen Fäusten und arglosen, blauen Augen. Er trottete hinter seiner würdevollen Mutter her, brachte sie mit seinen verrückten Einfällen zum Lachen, mit seinem unstillbaren Drang nach Zärtlichkeit und Unfug, er tanzte in seinen Holzschuhen herum und trank auf dem Waschplatz aus seinem Zinnbecher heimlich von der Seifenlauge, in der gerade seine schmutzige Wäsche weichte. Während der Sonntagsausflüge sechzig Jahre später konnte er trotz seines hohen Alters froh wie ein Kind in die Luft starren und angesichts einer Boeing, die gerade elegant den Himmel durchschnitt, ausrufen, wie schön doch die Welt sei. Seine Lebensfreude wurzelte in den dunkelsten Abgründen – jenen Abgründen, mit denen er Seite auf Seite seiner Aufzeichnungen füllte. Urbain Martien, mit dem Talent für alles und für nichts, wie seine Mutter lachend zu sagen pflegte, war ein überaus zäher Bursche und dennoch sensibel und empfindsam. So stand er als siebzigjähriger Mann am Ostersonntag im von der Morgensonne beschienenen Garten, die Augen voller Tränen, und gestand, dass ihm die Farbkombination des unergründlich tiefen Blaus der Irisblätter und des grellen Gelbs im Blüteninneren Herzklopfen bereite und dass es eine Sünde sei, wenn ein Mensch sterben müsse, ohne von der Macht der Farben etwas verstanden zu haben.
Als dem siebenjährigen Urbain im Katechismusunterricht erklärt wurde, dass man Gott auch im wolkenlosen Himmel nicht sehen könne, weil Gott nun einmal unsichtbar sei, und dass es vergebliche Mühe sei, in klaren Nächten bis hinter die Sterne blicken zu wollen, um IHN dort zu entdecken, und dass man Glauben nicht an der Wahrheit messen solle, weil es sonst kein Glaube mehr sei, sagte er plötzlich: »Aber, Hochwürden, dann könnte man ja auch behaupten, dass Millionen unsichtbarer Seepferdchen im Himmel herumschwimmen, wenn sie ja doch keiner sieht.«
Dem Pfarrer fiel vor lauter Verblüffung die Kinnlade herunter, als wäre ein Scharnier zerbrochen. Das Bild von den Seepferdchen, die Lichtjahre voneinander entfernt still zwischen den Sternen hindurch im dunklen Weltall schweben, ging mir nie mehr aus dem Sinn, und jedes Mal, wenn die Frage auftauchte, ob man die Existenz Gottes beweisen könne, sah ich sie vor mir, die Seepferdchen, endlos viele, in erhabener Stille. Dennoch war Urbain Martien ein gläubiger Mensch, mehr noch, er wurde, nachdem er aus dem Großen Krieg zurückgekehrt war, frommer als eine Betschwester. Zwei Mal pro Woche stand er um halb sechs auf, um die Frühmesse zu besuchen, tastete sich in tiefster Finsternis in seinen makellos polierten Halbstiefeln zur Kirche, selbst bei Eis und Schnee, wenn sogar der Pfarrer zu Hause blieb, und saß im Sommer oft in der kühlen Stille der Kirche, lateinische Gebete leiernd und die Perlen des Rosenkranzes zwischen den Fingern. Er entzündete Kerzen für Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smarten, für Unsere-liebe-Frau-von-den-sieben-Schmerzen, und ging wöchentlich zur Beichte, neigte demütig das Haupt, er, der in seiner Bravheit unfähig war zu jeder Sünde, und sei sie noch so lässlich.
*
Die Welt seiner Kindheit kurz vor der Jahrhundertwende war eine Welt voller Gerüche. Die meisten gehören der Vergangenheit an: Die selbst zarte Septemberluft verpestenden Geruchsschwaden einer Gerberei, der Geruch roher Steinkohle von den Kohlewaggons, die durch die dunklen Wintermonate ratterten, der Gestank der Pferdeäpfel auf der Straße, der am frühen Morgen einen schlaftrunkenen Jungen wie meinen Großvater glauben lassen konnte, auf dem Land zu sein, wozu übrigens auch der überall in der Stadt vernehmbare Duft von Heu, Kräutern und Gras beitrug. In den schummrigen Geschäften herrschte der durchdringende Geruch von altem Holz und feuchter Jute. Dort wog man Salz, Zucker, Mehl und Bohnen noch per Scheffel ab und schüttete die Ware – en vrac, wie man sagte, das heißt ohne Verpackung – in die mitgebrachten Taschen und Behälter der Kunden. Auf den Innenhöfen roch es nach Rosenkohl, nach Pferdemist und nach Tabak, den man zum Trocknen aufgehängt hatte. Mein Großvater erzählte immer, dass der schwarze Schurz seiner Großmutter, die im ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts geboren wurde, nach Kaninchenblutwurst gerochen habe.
Als Greis saß er oft im Kreis der Familienmitglieder, die ihn bewundernd anstarrten, und konnte sich stundenlang auslassen über seine Kinderjahre in den Schwefeldämpfen der neuen Industrien, über die Rufe der Straßenverkäufer, darüber, wie es klang, wenn man die dünne Holztür der öffentlichen Toilette hinter der Gasse bei der efeubewachsenen Mauer zuschlug, in der es nach Urin und Brennnesseln roch. In seinem Denken herrschte das Alltagsgrau der ersten Welle der Industrialisierung vor, obwohl er schon früh von den Farben eines Tintoretto und eines van Dyck zu träumen begann, die er in den Kunstbüchern seines Vaters entdeckt hatte.
*
Es ist Frühling 2012. Ich besuche mit meinem Sohn für ein paar Tage London, nicht nur um ihm das städtische Vorbild für sein geliebtes New York zu zeigen, sondern auch wegen des male bonding. Jeder Vater sollte gelegentlich das Band zu seinem fünfzehnjährigen Sohn erneuern, um erzieherische Konflikte aus der Welt zu schaffen. Ich will ihn nicht mit Kultur erschlagen, also schlendern wir durch Covent Garden, essen bei Carluccio’s, trinken in einer Eckkneipe pints of bitter und tragen unsere Meinungsverschiedenheiten versöhnlich aus, unternehmen Nachtspaziergänge durch Southbank, wechseln im Sprung die Metrolinien und lassen es uns gutgehen.
Und doch zeige ich ihm, vorsichtig, um nicht seinen Widerstand zu wecken, am nächsten Tag ein Museum, denn ich weiß, dass er trotz seiner High-brow-Skepsis, zu der ihn sein ständig flackerndes i-Phone veranlasst, für Malerei empfänglich ist. Mit gerade mal acht Jahren setzte er sich in Venedig vor das Porträt eines jungen Mannes aus dem sechzehnten Jahrhundert und sagte: »Papa, komm, setz dich neben mich, das Bild ist so schön!« Und so schlendern wir ganz unverbindlich durch die großen Säle der National Gallery, allerdings sorge ich dafür, dass wir plötzlich scheinbar zufällig vor der spektakulären Anamorphose von Holbeins Ambassadors stehen. Ich erkläre ihm, dass man mit Hilfe eines Spiegels einen perfekt geformten Totenschädel darin entdecken kann, und er wundert sich, dass der Maler sich so viel Mühe gab, den Tod zu verstecken. Vielleicht tat er es, so antworte ich, weil man dem Tod nicht gerade in die Augen schauen kann. Das scheint ihn nicht recht zu überzeugen. Danach zeige ich ihm The four elements, die berühmten Marktszenen des flämischen Malers Joachim Beuckelaer, einst der Stolz des Genter Museum voor schone kunsten, und erkläre ihm, dass es sich bei den vier Gemälden, trotz der religiösen Szenen im Hintergrund, die übrigens so klein sind, dass sie kaum von Belang sind, um recht unverhohlene erotische Darstellungen handelt. Ich erkläre ihm die damals für jeden Betrachter verständlichen Symbole, weise ihn auf Parallelen innerhalb der Bilder hin, auf all die Anspielungen. Seine Aufmerksamkeit macht einer Nachdenklichkeit Platz, bei der er sich zu fragen scheint, ob der Intellektualismus seines Vaters jetzt so sehr überhandgenommen hat, dass er in jedem Markthändler einen Zuhälter, in jeder Fischverkäuferin eine Hure und in jeder Möhre und in jedem Fisch einen Phallus sieht, ganz zu schweigen von den Vaginas in jedem Butterfässchen und den halb aufgeschlitzten Erbsenschalen. Wir schlendern weiter, und da hängt sie plötzlich vor mir, schlägt in mein unvorbereitetes Bewusstsein ein wie eine Granate.
Da hängt sie, nackt und unnahbar: Velázquez’ Venus vor dem Spiegel, bekannt als Rokeby-Venus. Ich erinnere mich daran, dass mein Großvater einst eine Kopie dieses Bildes gemalt hatte, und wenn ich mich nicht täusche – ich habe das Bild damals nur flüchtig gesehen –, ist das Original hier größer und die Venus hat helleres Haar, auf dem Bild meines Großvaters, der sonst ein gewissenhafter Kopist war, war es fast schwarz. Ich werde in die Vergangenheit zurückkatapultiert, springe die drei Stufen zum Malzimmer hoch und sehe meinen Großvater am Tisch sitzen, er weint und hat eine Reproduktion genau dieses Gemäldes in den Händen. Lange bleibe ich vor dem Meisterwerk stehen, gebannt von meiner Erinnerung. Mein Sohn steht abseits, fummelt an seinem i-Phone herum und fragt: »Kommst du jetzt? Ziemlich peinlich, dass so ein alter Mann wie du so lange eine nackte Frau anstarrt!« Da es zu lange dauern würde, ihm den wahren Grund für mein Verhalten darzulegen, nicke ich nur und reiße mich los von dem Bild, das ich am liebsten noch länger betrachtet hätte, verlasse den Saal, nicht ohne mich noch einmal danach umzudrehen. Ich muss mir die Kopie im Hause meines Vaters unbedingt noch einmal genauer ansehen. Jetzt fällt mir auch ein, was er mir öfter erzählt hatte: »Dein Großvater hat seine Frau nur ein einziges Mal nackt gesehen. Und das war ein Versehen. Deine Großmutter hat sich immer am Samstagnachmittag gewaschen, doch erst, nachdem sie ihn weggeschickt hatte. Aber eines Tages kommt er etwas früher nach Hause und überrascht sie, worauf sie ihm eine ordentliche Strafpredigt hält, heult und sich bei seiner Mutter über die Schamlosigkeit beklagt. Er musste sich entschuldigen.« Die Nacktheit dieser Venus war von solcher Selbstverständlichkeit, solcher Wärme, solcher Ruhe, und das in einem derart müßig hingestreckten, fürstlichen Körper, wie sie nur in einem Gemälde dargestellt und einzig und allein dem Trost der Malerei überantwortet werden konnten. An diesem Frühlingstag in der National Gallery ging mir zum ersten Mal auf, wie tief dieser bittere Trost den Betrachter treffen konnte. Und seither denke ich darüber nach, wie Kopien die Originale bereichern können, und vermute, dass sich auch in jenen Kopien meines Großvaters, die ich für unbeholfen gehalten habe, noch Geheimnisse verbergen. Wieder sehe ich sein tränennasses Gesicht vor mir. Es ist so lange her. Auf dem Trafalgar Square bricht die Sonne durch, und das Brunnenwasser perlt in einem Farbprisma von Rubensrot bis Bleiweiß mit einem Hauch Kobalt darin, allerdings bin ich mir hinsichtlich der Farben nicht so sicher und würde am liebsten meinen Großvater in dieser Sache befragen. Nelson steht hoch und unerreichbar wie ein dunkler Engel auf seiner lichtumflorten Säule; ein Mädchen sitzt auf den Stufen von Saint-Martin-in-the-Fields und spielt eine Partita von Bach. »Mensch, natürlich!«, rufe ich meinem Sohn zu. »Saint-Martin: Das ist die Kirche für den Schutzpatron meines Großvaters. Er hieß ja Martien.« »Und das fällt dir erst jetzt auf?«, wundert sich mein Sohn, während er interessiert die lässigen Breakdancer vor der National Gallery betrachtet. Und auf einmal schmerzt es mich, dass sie sich nie kennengelernt haben: mein Vorfahr und mein Nachfahr. Ich sehe meinen Sohn an, unterdrücke den Wunsch, ihm die Hand auf die Schulter zu legen, und frage ihn: »Na, was sollen wir heute Abend unternehmen?«
*
Wir sausen im bequemen Eurostar tief unter dem Meeresgrund nach Brüssel zurück. Ich erzähle meinem Sohn, wie lange eine Überfahrt nach England in meiner Jugend dauerte. Damals stampfte die Nachtfähre von Ostende nach Dover unendlich träge durch die Wellen. Plötzlich fällt mir die katastrophale Überfahrt meines Großvaters im Kriegsjahr 1915 ein. Nachdem er an der Yserfront zum zweiten Mal verwundet worden war, kam er zur Rekonvaleszenz nach Nordfrankreich. Von dort fuhr er mit dem Schiff nach Southampton, um in Swansea seinen Stiefbruder zu besuchen. Kaum auf hoher See, brach ein heftiger Sturm los, der anderthalb Tage dauerte. Er nannte die Überfahrt eine seiner schlimmsten Kriegserlebnisse. Ich selber kann mich noch lebhaft an meine Kanalüberquerung erinnern, an die grölenden Saufkumpane an Deck, die harten Bänke, auf denen wir die Nacht verbrachten, an die im Morgenlicht aufleuchtenden Kreidefelsen, an die Erleichterung, ohne Sturm angekommen zu sein. Die einen halben Tag und eine ganze Nacht dauernde Reise hatte etwas Symbolisches, und eine England-Reise war etwas Exotisches. Ich erinnere mich an ein sonniges Zimmer in Kensington Gardens, wo ich Yeats’ Gedichte las. Mein Sohn hört sich die in seinen Ohren nostalgisch klingenden Geschichten an, überlegt kurz und sagt dann: »Komisch, früher habe ich mir immer vorgestellt, der Tunnel unter dem Kanal ist aus Glas, und man kann die Seepferdchen schwimmen sehen, und jetzt habe ich nicht mal das Gefühl, dass wir ein Meer überqueren.«
*
Wie oft hat mir mein Großvater erzählt, wie seine Liebe zur Malerei entstand. Doch erst bei der Lektüre seiner Erinnerungen wird mir klar, wie sehr diese Kunst bereits Teil seiner Kinderseele war. Er beschreibt präzise, wie sein Vater – gebeugt auf einem Holzschemel sitzend, Pinsel und Malstab in den Händen, die Palette mit den aufgereihten Farbklecksen neben sich, das Auge zugekniffen – die Fingernägel des Verkündigungsengels in der Kapelle der Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smarten retuschiert, bevor er sich daranmachen wird, die Farben einer unbeholfen gemalten Dattelpalme in der sechsten Kreuzwegstation aufzufrischen. Er lehnt sich zurück, prüft das Ergebnis und bittet seinen Sohn um einen feinen Pinsel, weil er noch einen Umriss nachziehen möchte. Die Farben mischt er meist selbst, Tubenfarben sind teuer. In der offenen Kiste aus Birnbaumholz liegen Pigmentklümpchen, giftiges Kobaltpulver, süß riechendes Siena, Sepia und Sinopia; Fläschchen mit feinem Leinöl, Terpentin, Spiritus und Sikkativ; dünne Messer und Paletten, alte Pinsel aus kostbarem Eichhornhaar; runde Pinsel, Flachpinsel aus Schweineborsten, zwei feine Pinsel aus Marderhaar, wofür er sehr lange sparen musste; eine Menge Stofffetzen, grobe und weiche; Bleistifte, Holzkohle und Bitumen – die Ingredienzien der endlos stillen Stunden, die Urbain bei seinem Vater verbrachte. Brav sitzt er nachmittagelang auf einem Kirchenstuhl und beobachtet seinen Vater, wie dieser auf einer Leiter stehend halsbrecherische Verrenkungen vollführt, um oberhalb des Seitenaltars eine schwer erreichbare Wolke mit der Jungfrau Maria vom Kerzenruß zu befreien, dann die Narbe einer Pestbeule auf dem Oberschenkel des heiligen Rochus mit einem Strich braunroter Farbe hervorhebt, auf dem altmodischen Schuh des heiligen Crispinus die Schnürösen akzentuiert, die verblasste smaragdfarbene Jacke des heiligen Eligius wieder leuchten lässt und schließlich die drei Lilien im Wüstensand zu Füßen des heiligen Ägidius mit einer Schicht giftigen Bleiweißes erneut zum Strahlen bringt.