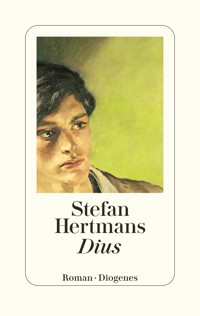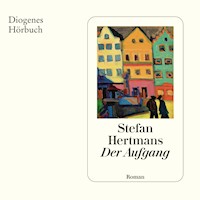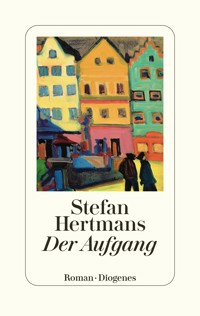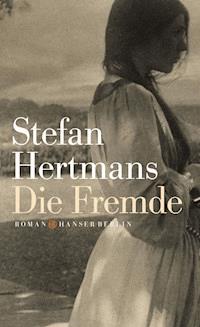
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Stefan Hertmans erfährt, dass seine zweite Heimat, der Ort Monieux in Frankreich, vor tausend Jahren Schauplatz eines Pogroms durch die Kreuzritter war, begibt er sich auf Spurensuche. Unter den Überlebenden soll eine junge Frau christlicher Herkunft gewesen sein. Diese historisch verbürgte Figur lässt ihn nicht mehr los, er tastet sich erzählend an ihr Leben heran. Vigdis nennt er die Frau, die für die Liebe zum Sohn des Rabbi ihre Existenz aufs Spiel setzt und zu Hamutal wird, die alles verliert und ganz allein nach Jerusalem aufbricht. Mit seiner grandiosen literarischen Rekonstruktion dieser Geschichte von Liebe, Gewalt und religiöser Verfolgung ist Hertmans ein erschreckend gegenwärtiger Roman gelungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Monieux, nördlich des Mont Ventoux gelegen, ist schon lange seine zweite Heimat, als Stefan Hertmans erfährt, dass sein lavendelduftendes Paradies vor tausend Jahren Schauplatz eines Pogroms durch die ersten Kreuzritter war. Unter den Überlebenden, das bezeugt ein in Kairo gefundenes Dokument, war eine junge Frau christlicher Herkunft. Diese Figur lässt Hertmans nicht mehr los. Er begibt sich auf Spurensuche, tastet sich als reflektierender und plastisch ausmalender Erzähler an dieses Leben heran. Vigdis heißt bei ihm die Frau, die für die Liebe zum Sohn des Rabbi ihre Existenz aufs Spiel setzt und zu Hamutal wird, die alles verliert und ganz allein nach Jerusalem aufbricht. Mit seiner grandiosen literarischen Rekonstruktion dieser Geschichte von Liebe, Gewalt und religiöser Verfolgung ist Stefan Hertmans ein erschreckend gegenwärtiger Roman gelungen.
Hanser Berlin E-Book
Stefan Hertmans
Die Fremde
Roman
Aus dem Niederländischen von Ira Wilhelm
Hanser Berlin
Der Frau, die ein Haus küsste
»… aber die Form der Zeitlosigkeit ist das Jetzt und Hier.«
Thomas Mann, Joseph und seine Brüder
I Der Berg des Jupiter
II Rouen
III Die Flucht
IV Narbonne
V Moniou
VI Die Überfahrt
VII Kairo
VIII Nájera
IX Cambridge
X Der Schatz von Monieux
I Der Berg des Jupiter
1
Es ist früher Morgen, die ersten Sonnenstrahlen züngeln über den Hügel.
Am Fenster sitzend schaue ich über das Tal und sehe, wie sich von weitem zwei Menschen nähern. Vermutlich sind sie den Saint-Hubert herabgestiegen, von dem aus man sowohl den Mont Ventoux als auch das Tal von Monieux sehen kann, und haben den kargen Eichenwald auf der Hochebene durchquert, wo die Wölfe lungern.
Der berühmte Rocher du Cire – der steile, monumentale Felsen, um den hoch und fern die Bienen schwärmen und von dessen glänzendem Felsen buchstäblich der Honig tropft – ragt unzugänglich und öde aus den Morgennebeln heraus. Das alles haben die beiden gesehen und sind schweigend daran vorübergegangen.
Das Licht fällt seitlich auf die noch winzigen Gestalten. Mühsam steigen sie von der Stelle herab, wo heute das Landgut La Plane wie ein Wachhund über das Tal blickt, vorbei am Serpentinenweg, der zum linken Ufer des Flusses führt – für sie ist es das rechte Ufer, denn sie gehen flussaufwärts. Immer wieder verschwinden sie hinter den Bäumen und tauchen wieder aus ihnen hervor. Schließlich erreichen sie die abschüssigen Weiden, jetzt kommen sie schneller voran. Sie können bereits den halbfertigen Turm auf dem hohen Felsen sehen, er gleicht einer vertrauenerweckenden Landmarke. Als die Sonne etwas höher gestiegen ist und das tiefer gelegene Tal erreicht hat, sehen sie das Dorf aufleuchten. Da die Häuser aus Naturstein errichtet und im Dämmerlicht kaum zu erkennen sind, scheint sich das Dorf wundersam aus der Felswand zu lösen und jetzt erst, im Licht, Gestalt anzunehmen. Als zöge jemand einen riesigen Vorhang zur Seite und gäbe den Blick frei auf eine schlafende Landschaft.
Das dämmrige Blau verflüchtigt sich schnell. Gelbgraue Töne herrschen nun vor. Die letzten Wolken formen sich von der Wärme wie mit einem Föhn angeblasen zu riesigen, fast durchsichtigen Felsbrocken; über dem Flusslauf liegt ein weißer Schleier, der zusehends verdampft. Ein Schwarm Bienenfresser kreist bereits über den Dächern.
Nachdem die beiden sich nochmals mehrere hundert Meter genähert haben, kann ich erkennen, dass sich der Mann auf einen derben Stock stützt. Die Frau hinkt, das Gehen fällt ihr deutlich schwer. Beide sehen erschöpft aus. Hat sich die Frau auf den holprigen Wegen der Hochebene den Knöchel verstaucht oder tun ihr einfach die Füße weh, weil die Schuhe sie drücken oder wegen der langen und beschwerlichen Tagesmärsche? Ich justiere mein Fernglas und kann nun erkennen, dass sie hochschwanger ist. Der Mann trägt einen weiten Kittel und auf dem Kopf einen einfachen Hut. Immer wieder hilft er der Frau über ein Hindernis und stützt sie dabei am Ellbogen. Hinter ihnen wird ein zweiter Mann sichtbar, auf seinem Rücken trägt er einen großen Sack. Er führt einen Maulesel am Zügel.
Wie früh mögen sie aufgestanden sein? Hat die Kälte die unter einem Baum Liegenden geweckt? Erwachten sie in einer Herberge? In der weiten Stille des Frühlingsmorgens singen im Wäldchen beim Fluss noch die Nachtigallen. Man kann sie bis hierher hören; sie stoßen melodiöse, irrwitzige Schreie aus. Als die Sonne ganz über dem Hügel steht, segelt eine Eule geräuschlos über die krummen Eichen, um bis zum Einbruch der Nacht zu verschwinden. Zeitlose Stille; das ferne Jaulen eines Wolfshundes; von den einsamen Wäldern bei Saint-Jean dringt monoton der Ruf eines Kuckucks herüber. So früh am Morgen liegt ein herrlicher Duft über der Landschaft, alles atmet den Hauch einer überirdischen Schönheit. Die Iris haben sich schon geöffnet, die wilde Kirsche blüht, der Rosmarin ist übersät mit hellen kleinen Blüten, das Aroma des Thymians entfaltet sich mit der Wärme des Taus. Wärme des Taus, Hamutal: der jüdische Rufname der Frau fällt mir plötzlich ein.
Ich weiß, wer die beiden sind. Ich weiß auch, vor wem sie auf der Flucht sind.
Wie gerne würde ich sie in meinem Haus willkommen heißen und ihnen etwas Wärmendes anbieten, etwas, was sie noch nicht kennen, eine Tasse Kaffee zum Beispiel. Wo wollen sie denn hin? Ihr Haus steht schon seit einem Jahrtausend nicht mehr, und der mittelalterliche Teil des Dorfs ist unter Gras und Gestrüpp verschwunden. Beim Anblick des ersten Autos würden die beiden vor Schreck einen Herzschlag bekommen, die junge Frau könnte sogar eine Frühgeburt erleiden.
Jetzt stolpert das Paar in mein Dorf.
Ich schrecke aus meinen Tagträumen auf. Ich schließe das Fenster und entfache ein Feuer im Kamin, um die Morgenkälte zu vertreiben, koche Kaffee. Ab und zu gebe ich dem törichten Drang nach, ans Fenster zu treten und hinauszublicken. Sonnenflecken wandern über die alten Bodenfliesen; es ist ein leerer, stiller Tag.
*
Dieses Dorf hieß früher Mons Jovis, der Berg des Jupiter. Lange vor Beginn der Zeitrechnung, unmittelbar nachdem im Neolithikum die nicht weit entfernt liegenden Grotten besiedelt worden waren, schichtete man bereits die ersten grob behauenen Steine aufeinander. Das alles verliert sich im Dunkel der Zeiten, doch vieles davon ist noch in den ältesten Häusern des zu Schutt verfallenen oberen Dorfs zu spüren. In einer alten Kapelle am Rand der Schlucht fand man eines Tages einen Stein mit lateinischen Inschriften. Er war dem Mars Nabelcus geweiht, dem Gott, den die Römer in dieser Gegend verehrten.
Im Mittelalter lagen die einfachen Häuser verstreut zwischen jungen Eichen in unwegsamem Gelände unter einer Felswand, einer natürlichen Mauer von fast hundert Metern Höhe. Auch heute noch stößt man im trocknen Gras, zwischen Unterholz und thymianbewucherten Felsbrocken immer wieder auf alte Keller. Aus den dunklen Öffnungen dringt der Geruch von Schimmel und Erde, selbst an heißen Tagen. An diesem verwilderten Ort voller Brombeeren und vertrockneter Wicken, wo ich tagsüber oft sitze und vor mich hin träume, befand sich einst das Zimmer, in dem geboren und gestorben wurde.
Im zehnten Jahrhundert wurden zahlreiche Fehden um die Wasserquellen tief unter den Kellern ausgetragen. Während der langen Hitzeperioden – den berüchtigten canicule – verwandelte sich das Wasser in eine brackige Giftbrühe. Man gab den Landstreichern die Schuld, nahm sie gefangen und folterte sie, vielleicht, weil man weiterhin an die Sinnfälligkeit der Opferung glauben wollte. Umtost von den rafales, Mistral und Tramontane, kauerten die verfallenen Bauten mit den fensterlosen Rückseiten zum Wind und hielten den Jahrhunderten stand. Sie ähnelten den bories, den einfachen Steinkonstruktionen, die die Schäfer in den trockenen Ebenen oder den Eichenwäldern errichteten. Sie sparten im Stein einfach ein Guckloch aus, das im Winter mit der Haut eines Wolfs oder eines Fuchses verschlossen wurde, manchmal auch mit einer straff gespannten Schweinsblase.
Die mittelalterlichen Häuser standen auf schmalen Parzellen mit nachgiebigem Boden. Im Laufe der Jahrhunderte baute man immer höher, ohne dass das technische Wissen sich nennenswert mitentwickelte, weshalb seit Ende des 18. Jahrhunderts viele Häuser einstürzten. Die Ruinen verfielen zu pittoresken Steinhaufen, auf denen wilder, im Oktober sich blutrot färbender Wein wuchs. Die verbliebenen Häuser lehnen auf ihren schmalen, wuchtigen Fassaden wie Greise auf ihren Stöcken. Durch ständige Ausbesserungen überstanden sie die Jahrhunderte: Man ersetzte den zu Staub zerfallenden Mörtel aus Lehm und Sand durch Zement, verstärkte die alten Eichenholzbalken und behelfsmäßigen Stützpfeiler mit Beton und hielt die alten Häuser mit Stahlstangen zusammen, die mitten durch die Mauern geschoben, verschraubt und mit dem zierlichen Schmiedewerk von Unterlegscheiben fixiert wurden, die manchmal aussehen wie die Scheren eines Skorpions.
*
Man kann verstehen, dass die beiden Verliebten hierher kamen. Das Dorf war schon immer ein Zufluchtsort für Reisende und Verfolgte. Juden im elften Jahrhundert, Hugenotten im siebzehnten. Sobald ein Ort den Ruf hatte, tolerant zu sein, verbreitete sich sein Name unter dem ziellos umherirrenden Volk. Im achtzehnten Jahrhundert, als der Ort in den Annalen noch Monilis hieß, zählte die Gemeinde fast tausend Einwohner. Die engen Gassen waren belebt, licht- und trostlos während der harten Wintermonate in siebenhundert Metern Höhe, dafür kühl in den langen, heißen Sommern. In den Gräben moderte der Dreck, von dem sich die Ratten ernährten. Von den Ratten ernährten sich die Läuse, und von diesen wiederum die Pest. Im vierzehnten Jahrhundert traten die ersten Pestfälle auf, vier Jahrhunderte später, während der großen Epidemie, die von Marseille ausging, errichtete man Pestmauern, schwer bewachte, dicke, aus Schiefersteinen geschichtete Mauern, vor denen erschlagen wurde, wer sich an den Wächtern vorbeischleichen wollte. Leichenfledderer zogen durch die Lande und beraubten die überall liegenden Toten ihrer letzten Habseligkeiten. Sie rieben sich mit einer Mischung aus Thymian, Rosmarin, Lavendel und Salbei ein. Der Aberglaube erledigte den Rest: Offensichtlich bewahrte das Mittel die Räuber vor Ansteckung. Ich hörte einmal, wie eine alte Frau dieses klassisch gewordene Kräutergemisch als les quatres bandits bezeichnete. Die Pestmauer befindet sich nur wenige Kilometer von hier entfernt, überwuchert von Gras und Kräutern.
Die raue Gegend war stolz und widersetzte sich jahrhundertelang der Pariser Zentralregierung. Die Bevölkerung vermischte sich. Spanier, Marokkaner, Italiener und ein paar Matrosen aus Marseille verirrten sich hierher und zeugten Kinder mit den Schönheiten aus den trockenen, einsamen Hügeln. Der Frühlingswind ließ die Augen der armen Leute tränen, die hier zwischen wilder Iris, Klatschmohn und spärlich gesätem Dinkel lebten. Ihre Kinder hatten gewölbte, grobe Füße, einen hellen Blick und schrundige Haut. Gelegentlich zog eine marodierende Bande vorbei, knallte den Schädel eines Schäfers an die Felswand, vergewaltigte die Frauen und plünderte das in Schreckstarre verharrende Dorf, verschwand hinter den Hügeln und überließ den Rest dem Wind, der Sonne, der Stille, der Angst und den Gebeten.
Wie ein Vagabund aus alten Zeiten stolpert das Dorf ins einundzwanzigste Jahrhundert. Viel hat sich nicht geändert, noch immer ziehen im Herbst in den frühen Morgenstunden Schäfer mit warmdampfenden Herden durch die Hauptstraße, die zarten Hufe und die leisen, verschiedentönig läutenden Glocken klingen heute kaum anders als zu den Zeiten des Dichters Vergil. Die Tiere drängen sich eng aneinander, die Lämmer machen Bocksprünge, und auf dem Asphalt bleibt eine Spur aus Kot und Wollflusen zurück. Der Postbeamte wartet in seinem kleinen Lieferwagen geduldig ab, bis die Herde durch das Dorf gezogen ist, und raucht derweil eine Zigarette. In der alten romanischen Kirche wird am Sonntag die Messe gelesen. Die Gläubigen singen falsch, so wie fromme Leute dies nun mal tun.
Im Winter ist das Dorf manchmal eingeschneit und tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Dann leben die Bewohner von den Vorräten aus den Kellern und Tiefkühltruhen. In den langen, heißen Sommern ist die Natur unerbittlich und überwältigend, die Trockenheit zehrt die Böden aus, der Lavendel wird geerntet, und über die Hochebene zieht Brandgeruch, während man das kostbare Öl aus den Pflanzen presst. Der Wechsel der Jahreszeiten ist immer am schönsten; dann atmet das Land auf, und im Wein summen die wilden Bienen. Schon früh war erwogen worden, mitten durch den prähistorisch aussehenden Graben, dem mäandernden Flussbett folgend, eine Zugtrasse zu verlegen, damit das Dorf leichter erreichbar sein würde; doch distanzierte man sich rasch von dem Vorhaben, als den Beteiligten aufging, dass man sich ja schon zu Pferd kaum einen Weg bahnen konnte. Erst in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde die Hochebene mit Hilfe einer Straße über den tausend Meter hohen Kamm von Les Abeilles für den Verkehr zugänglich.
Die Tage kennen keine Stunden. Man könnte den Sonnenfleck beobachten, wie er sich über den groben Fußboden schiebt, ein weißes, leicht zitterndes Licht, das am späten Nachmittag an der Wand hochklettert, bevor es verschwindet. Das einzige Geschehen besteht darin, dass nichts geschieht – ohne dass man sich dem entziehen könnte. Die Zeit hat ihre eigenen Gesetze.
2
In Wahrheit ist es der Rabbi des Dorfes, Joshua Obadja, der an dem Frühjahrsmorgen des Jahres 1091 von der Synagoge aus die Flüchtlinge den Hügel herabkommen sieht. Vermutlich hat ihn bereits vor Tagen ein berittener Bote von der bevorstehenden Ankunft der beiden in Kenntnis gesetzt. Er macht sich Sorgen um die jungen Leute – nicht nur, weil sie aufgrund ihrer Mischehe des besonderen Schutzes bedürfen, sondern auch, weil er weiß, dass die Frau in den nächsten Tagen niederkommen soll, und er Wochen braucht, um eine Wohnung für das Paar herzurichten. Er wird sie erst einmal bei sich aufnehmen. Warum sie nicht zu Pferd unterwegs sind, kann er nur vermuten: Wurden sie von Strauchdieben überfallen? Haben sie sich als einfache Leute verkleidet, um der Aufmerksamkeit ihrer Verfolger zu entgehen? Voller Ungeduld wartet er, bis sie den Festungswall überwunden haben, dann schickt er seine Frau los, damit sie die beiden am südlichen Tor willkommen heißt, beim Portail Meunier, das auch heute noch so heißt. Schließlich erreichen sie strauchelnd sein Haus – es liegt nicht weit von der Stelle entfernt, wo ich tausend Jahre später oft ahnungslos saß und las und glücklicher war als sonst an einem Ort der Welt.
Hamutal hat eine tiefe Schürfwunde an ihrem rechten Fuß; sie hat sich den Knöchel verstaucht, die Bänder sind gerissen. Der Fuß ist rot geschwollen, Blut hat sich in schwarzen Flecken unter der Haut gestaut, er droht sich zu entzünden. Die Frau des Rabbiners betupft ihn mit einer Mischung aus Lavendelöl, Brennnessel und lauwarmem Wasser. Hamutals Ehemann, David Todros aus Narbonne, berichtet Joshua Obadja die neuesten Nachrichten.
Der Rabbi nickt nachdenklich und zupft an seinem Bart; er wendet sich an die junge Frau: »Wie lautet dein wahrer Name?«
Sie zögert; fragte er sie nach ihrem früheren, christlichen Namen?
David kommt ihr zuvor. »Sarah«, antwortet er. »Der Name meiner Frau lautet Sarah. Den Kosenamen Hamutal habe ich ihr gegeben.« Er ergreift ihre Hand.
Die Gesellschaft sitzt schweigend beisammen.
*
Es sind schwierige Zeiten. Der einst von Karl dem Großen gestiftete religiöse Friede zerbricht, die politische Lage ist unsicher. Feudale Kriegsherren reißen die Macht an sich, üben die Alleinherrschaft über ihre Gebiete aus; die Zentralregierung verliert zunehmend an Macht, man hört von Missständen, die Gesetze werden immer willkürlicher angewendet. Nachdem Juden und Christen mehrere Jahrhunderte lang recht einvernehmlich miteinander gelebt haben, hört man nun immer öfter von brutalen Überfällen auf jüdische Gemeinden. Außerdem sind in den letzten Monaten viele Juden aus Spanien in den Süden der Provence geflüchtet, vor allem nach Narbonne. Die kleine Stadt wird von Heimatlosen überschwemmt, die auf der Suche nach dem Glück sind oder einfach nur nach Sicherheit.
Davids Vater, der große Rabbiner von Narbonne, den alle Roi aux Juifs nennen, weil sein Geschlecht angeblich direkt von König David abstammt, hat die beiden an diesen entlegenen Ort in der Vaucluse geschickt, damit sie hier den Fängen der christlichen Ritter entgehen, die der normannische Vater des Mädchens aus Rouen auf die beiden gehetzt hat. Eine Flucht nach Spanien wäre zu riskant gewesen, denn der Weg nach Santiago de Compostela ist immer voller christlicher Pilger. Das Gebiet um Toulouse und Albi ist zu unsicher, da dort die Manichäer und die ersten Ketzerbewegungen bekämpft werden. Überall gibt es Scharmützel und Hinrichtungen. Auch die großen Städte waren ihnen verwehrt: Dort werden die jungen Männer für die Heerzüge in den Nahen Osten rekrutiert, wilde Trupps machen die Wege unsicher und verwickeln die Reisenden ständig in Händel.
Rabbi Todros wählte eine Route, auf der der erboste Vater das Paar schwerlich vermuten konnte: an Arles vorbei, dann entlang der Rhône zur Festungsstadt Avignon – wo die berühmte Brücke erst noch gebaut werden musste – und von dort nach Carpentras, ins großenteils unbewohnte voralpine Gebirge und schließlich nach Sisteron, südöstlich des Mons Ventosus. Nicht weit von dort, so wusste der Rabbiner, gab es das Bergdorf Moniou, das eine kleine jüdische Gemeinde besaß. Dort lebte Rabbi Joshua Obadja, der dem jungen Ehepaar zweifellos Schutz und Obdach gewähren würde. Obadja stammte aus dem spanischen Burgos und war auf der jüdischen Thoraschule von Narbonne Rabbi Todros’ Freund gewesen. Die einsame Berggegend um Moniou war 1032 in das Heilige Römische Reich eingegliedert worden und somit Ausland für die gallischen Ritter, die die Frau verfolgten. Außerdem galt die Vaucluse als ein Ort des friedlichen Zusammenlebens von Juden und Christen.
Obadja nickt dem jungen Todros wohlwollend zu und sagt, dass sein Vater eine weise Entscheidung getroffen habe.
*
Nachmittags streune ich durch die mittelalterlichen Ruinen des untergegangenen Dorfs. Der Bürgermeister hat sie unlängst nach der hoch über dem Dorf am Rand der Schlucht stehenden Kapellenruine »Le Jardin de Saint-André« getauft. Hier und da ragt das Bruchstück eines romanischen Bogens aus dem Gras. Ich folge dem steilen Weg. Die alten Mauern werden restauriert, romantische Rekonstruktionsbemühungen von Freiwilligen, zumeist jungen Leuten, die die Sommer hier verbringen und tagsüber Steine schleppen und den Pickel schwingen, bevor sie abends in ihr Sommerlager zurückkehren. Sie errichten Bauten, die aufs Haar den alte Behausungen gleichen, ebnen nach Gutdünken Gelände, unter dessen Oberfläche sich noch Ruinen befinden, und lassen Ulmen und Eichen auf ihnen sprießen. Keiner überlegt sich, ob dadurch vielleicht die Geschichte des Ortes in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Im Augenblick ähnelt der Ort einer grünen Oase, einem Terrassengelände mit wilden Blumen, einem Garten mit gestaffelten Mäuerchen, die man aus dem Bauschutt des Mittelalters aufgeschichtet hat. Als hätte es hier schon immer so ausgesehen. Dabei befand sich früher an dieser Stelle der am dichtesten bevölkerte Teil des Dorfes, mit engen Gassen und hohen, finstern, nah beieinanderstehenden Häusern. Es war laut, es stank, es herrschte das alltägliche, intensive, enge, bunte Durcheinander einer mittelalterlichen Gemeinschaft. Hier platzte das Leben aus allen Nähten. Hier lebte man, starb, schlief, arbeitete und fluchte, liebte sich und gebar unter primitivsten Bedingungen Kinder. Eine Feldschlange flüchtet sich vor mir unter dürre Zweige. Ein paar Ziegen sind durch Zaunlöcher entwischt und klettern jetzt über mir auf dem Felsen. Sie springen herum, fressen, sehen mich mit ihren gelben Teufelsaugen an, bevor sie himmelwärts hinter dem Hügelrücken entschwinden. Über dem Felsen kreist träge ein Bussard. Die Stille hat etwas Unheilvolles. Mir ist, als hörte ich tief unter der Erde das Summen der Zeit.
*
Das Wohnhaus von David Todros stand vermutlich nicht weit von der Synagoge und keine zweihundert Meter von dem Haus entfernt, wo ich dies schreibe. Weiter entfernt ist nicht möglich, denn dann hätte es sich jenseits des Dorfwalls befunden. Die Grundstücke der Häuser auf der Südseite waren auffallend klein. Das bedeutet, dass hier das jüdische Viertel gelegen haben muss, denn Juden bekamen grundsätzlich kleine Baugrundstücke zugewiesen. Auf diese Weise wollte man ihren Einfluss und ihren Reichtum einschränken. Weil auf napoleonischen Kopien von mittelalterlichen Karten genau dieselben spitz zulaufenden Parzellen zu sehen sind, von denen ich eine bewohne, weiß ich, dass hier einmal ähnliche Häuser gestanden haben müssen. Die beiden Geflüchteten müssen oft durch die engen Gassen gegangen sein. In der Stille spüre ich ihre Nähe. Ich steige wieder zum heutigen Dorf hinunter – als bedürfte es nur weniger Schritte, um aus der fernen verlorenen Zeit in die heutige zurückzukehren.
Ich setze mich an meinen Schreibtisch und blättere noch einmal den wissenschaftlichen Artikel durch, den mir vor ungefähr zehn Sommern ein greiser Nachbar aus Süddeutschland gegeben hat. Er bewohnt hier seit Jahrzehnten ein altes, idyllisches Haus. »Das solltest du mal lesen, wenn du Zeit hast«, hat er zu mir gesagt. Ich habe mir den Artikel kopiert und ihn in die Schublade des kleinen Schreibtischs meines Großvaters gelegt, neben die Hefte, die er mir einmal geschenkt hatte.
Der Artikel trägt den schlichten Titel »Monieux«. Er wurde 1969 veröffentlicht und stammt von Norman Golb, einem berühmten Spezialisten für alte hebräische Geschichte.
3
Erst jetzt, der verstauchte Fuß der jungen Frau ruht in einer Schüssel Lavendelöl, sieht ihr Mann, wie erschöpft sie ist. Die Schwellung ihres Fußes geht nicht zurück, durch die schwarz-gelben Blutergüsse sieht er sehr hässlich aus. Das Kind in ihrem Bauch bewegt sich heftig, der Rabbiner befürchtet, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht. Man bettet die Frau auf eine kurze Liegestatt aus Eichenholz. Weil sie nicht aufhört zu zittern, wird ein Feuer entfacht. In der ersten Wärme des Kamins schläft sie sofort ein. Sonnenflecke wandern über die alten Bodenfliesen.
Es ist ein stiller, milder Tag. Ein Bussard rüttelt über der Felswand droben bei der Turmbaustelle, von der aus leise ein Hämmern herüber dringt. Der Rabbi überlegt, wie er den argwöhnischen Pfarrer der christlichen Kirche im Dorf davon überzeugen soll, dass die neu angekommene hellblonde Frau mit den blauen Augen eine sephardische Jüdin ist.
Gegen sechs Uhr versinkt die Sonne hinter dem hohen Fels. Das Licht wird von einem Moment auf den anderen bläulich durchscheinend, während auf der anderen Seite des Tals die Wälder in einer rötlichen Glut aufflimmern. Eine Windbö jagt über die Ebene. Ein Rauschen durchfährt die Bäume und Sträucher am Flussufer. Danach herrscht wieder die endlose Stille der einsamen Hochebene.
Die junge Frau schreckt aus dem Schlaf hoch. Es ist schon Nacht. Einen Moment lang weiß sie nicht, wo sie ist, und gerät in Panik. Dann erkennt sie nach und nach die Umrisse eines Wandschranks, einer Truhe, eines Stuhls. Sie spürt einen stechenden Schmerz in der Seite, der ihr den Atem raubt. Sie unterdrückt einen Schrei. Eine Tür öffnet sich, der fahle Schein einer Flamme flackert die Wand herauf. Eine alte Frau kommt herein, sie trägt eine Schüssel mit Wasser und einen Stapel Tücher. Sie setzt sich neben das Bett, beugt den Kopf, faltet die Hände, wacht neben der Frau, die sich schweißnass im Bett hin und her wälzt, und betet leise. Die Wehen werden immer heftiger, nach einer Stunde fällt die Gebärende erneut in einen tiefen Schlaf. Mitten in der Nacht erwacht sie, ihr Herz schlägt heftig, der Schmerz ist so stark, dass sie sich fast übergeben muss. Die alte Frau ist verschwunden. Ein unglaublich großer Mond ist hinter dem östlichen Hügel aufgegangen. Sein Licht scheint durch die kleine Fensteröffnung herein, als wäre es ein lebendiges Wesen. Sie muss sich erleichtern; noch halb im Schlafe wälzt sie sich aus dem Bett, tastet nach den Schuhen, stolpert aus dem Haus. Der Schmerz einer Wehe durchzuckt ihren Leib. Verwirrt und schwer atmend steht sie auf der Gasse, sie weiß nicht, wo sie ist. Sie wankt weiter und kauert sich schließlich zwischen einigen großen Steinen ins niedrige Gebüsch. Ihr schwindelt vor Schmerz. Sie glaubt zu urinieren, aber es ist das Wasser der geplatzten Fruchtblase.
Die Geburt setzt ein. In einer Woge des Schmerzes ist ihr, als werde ihr Unterleib in zwei Teile zerrissen. Sie stöhnt wie ein sterbendes Tier, heult, schluchzt, fällt rücklings zu Boden, verletzt sich dabei am Steiß. Sie keucht wie eine Besessene, presst und ächzt, krallt die Finger in die trockene Erde, drückt die Hände dann wieder hilflos auf den Bauch, greift sich zwischen die Beine, spürt das Blut rinnen, zittert vor Angst und Pein. Der Mond scheint noch heller zu strahlen; dann dringt auf einmal die Kühle der Nacht in ihren Unterleib. Als etwas zwischen ihren Beinen heraus auf die Erde gleitet, verliert sie für einen Moment das Bewusstsein. Dann erklingen Schritte und Rufe auf der Gasse, Türen werden zugeschlagen, jemand stützt die junge Frau, mit einem dicken Schwall Blut gleitet der Mutterkuchen aus ihr heraus. Gnadenlos grell scheint der Mond der Frau in die Augen, sie schreit auf, ruft nach ihrer Mutter. Mit einem groben Messer durchtrennt die alte Frau die Nabelschnur, betupft das Gesicht der Frau mit Wasser, dann hebt sie das bleiche Neugeborene an den Füßen hoch, schüttelt es, gibt ihm Klapse, bis es ein leises Wimmern ausstößt, einen Seufzer, der in Kreischen und Schreien übergeht. Während mehrere Frauen die bewusstlose junge Frau aufheben, um sie ins Haus zurückzutragen, deutet die alte Frau auf die Stelle, wo das Neugeborene gelegen hat: Direkt daneben ringelt eine große, durch die Kälte der Nacht träge Schlange traumartig langsam zwischen den Steinen davon. Als der Morgen graut, setzt sich David Todros neben das Bett der jungen Mutter und spricht leise die uralten Worte: »Baruch atta adonai elohenu, melech ha-olam …«
*
In den ersten Tagen nach der Geburt sitzt dem jungen Paar die Angst noch in den Knochen. In Narbonne haben die beiden in einer Gasse die Schatten von Reitern gesehen. An keinem Tag, der seither vergangen ist, haben sie die Bedrohung vergessen. Weil jedoch nichts geschieht, weil die unwandelbaren Hügel Ruhe ausstrahlen und weil das Alltagsleben in diesem abgelegenen Dorf ihnen Schutz zu gewähren scheint, beruhigen sie sich allmählich. Die Abende verbringt David neben dem Bett seiner Frau, am Tage hilft er Rabbi Obadja in der Schule der Synagoge.
Am achten Tag nach der Geburt wird das Kind beschnitten. Der Überlieferung nach wird es Yaakov genannt. Hamutal bleibt im Bett, hört aber zwischen dem Gemurmel der Gebete das Wimmern und Schreien des Kindes, danach lautes Reden und Lachen und das Klirren von Gläsern, mit denen angestoßen wird. Sie schläft ein, ihre Brüste spannen und schmerzen.
Wie es die Tradition fordert, wird der erstgeborene Sohn freigekauft. Dazu trägt man den Säugling auf einer Schale in einen Raum. Neben dem Kind liegen einige Knoblauchzehen. Jeder der anwesenden Männer nimmt sich eine und knabbert daran, das soll die bösen Geister vertreiben. Rabbi Obadja ist der Kohen der Zeremonie. David händigt ihm die rituelle Kaufsumme aus und nimmt seinen Sohn in Empfang. Danach setzt man sich für eine einfache Mahlzeit zu Tisch. Es ist ein heißer Tag, die Sonne brennt, das Flussbett ist fast ausgetrocknet. Zwischen wildem Wein und Efeu huschen die Eidechsen über die Steine des Hauses. Wilder Dinkel und Klatschmohn wiegen sich im warmen Wind. Bei der kleinen Kirche unter dem Felsvorsprung, kaum einen Kilometer entfernt, betet ein Einsiedler zum Herrn der Christenheit, da greift ihn ein Bär von hinten an und bricht ihm mit einem achtlosen Wedeln der linken Pranke das Genick.
Am Abend durchquert ein Reitertrupp, angeführt von dem berüchtigten Raimund von Toulouse, die grasbewachsene Ebene. Raimund ist ein ruhmsüchtiger Edelmann von fast fünfzig Jahren. Er erblickt das Dorf, dreht sich auf seinem Pferd nach einem seiner Männer um und ruft ihm zu: »Wie lautet der Name von jenem Adlernest dort oben auf dem Fels?« Der angesprochene Ritter hebt die Achseln. Die Reiter befinden sich auf einer Pilgerreise gen Osten, die ein Jahr dauern und auf der der Raufbold Raimund, später ein berühmter Kreuzritter, ein Auge verlieren wird. Raimund weiß nicht nur, dass eine vornehme junge Frau auf der Flucht ist und gesucht wird, er kennt sogar die Höhe der Belohnung, die der Vater ausgesetzt hat. Es kommt oft vor, dass normannische Ritter auf dem Weg zu den eroberten Gebieten in Sizilien in der Provence bei hochgestellten Persönlichkeiten übernachten. Der Gedanke, dass er in diesem Dorf fündig werden könnte, kommt Raimund jedoch nicht. Die Wöchnerin ist jetzt zwanzig Jahre alt; sie hat keine Ahnung, wie nah die Gefahr ist. David aber hat die Ritter in der Ebene gesehen, mit klopfendem Herzen, von einer tödlichen Angst ergriffen läuft er nach Hause. Er findet die Wöchnerin vor dem Bett kniend. »Was machst du da?«, fragt er erschrocken. »Hast du mir nicht versprochen, keine christlichen Gebete mehr aufzusagen?« Mit Mühe erhebt sich seine Frau, presst die Hand gegen den Unterleib und antwortet schuldbewusst: »Ach ja, ich weiß.«
Sie legt sich wieder zu Bett und schließt die Augen. In ihrer Erinnerung kräuselt sich Weihrauch vor einem Kirchenfenster, hinter dem das Meer liegt.
4
Die Linden und die Ulmen werden gelb und rot, die Morgen kälter und klarer. Die Männer tragen erlegtes Wild, Eber, Hirsche und Hasen ins Dorf. Beim Absengen der Schweinshaut breitet sich ein bitterer, scharfer Geruch aus, von dem der jungen Mutter übel wird. Über den Dächern kräuselt sich der Rauch des Eichenholzes. Regnerisches Wetter setzt ein. Die fruchtbare Hochebene verwandelt sich in eine trostlose graue Senke, durch die der scharfe Westwind pfeift.
Sie kann sich nur schwer an das einfache, harte Dorfleben gewöhnen, das sie bisher nicht kannte. Die tristen Hügel und Felsen kommen ihr manchmal so unwirklich vor, als wäre alles nur ein Traum.
An einem verregneten Abend entdeckt sie die stille Anwesenheit zahlreicher Schnecken und Kröten auf der Gasse. Die Kröten stoßen einen pfeifenden Laut aus, fast dem der Eule gleich, nur dünner, feiner. Kommt man an den trägen Tieren vorbei, versuchen sie an den Häuserwänden hinaufzuspringen. Hilflos und fast menschlich recken sie die Vorderbeine, als wollten sie den Himmel um Beistand ersuchen. Nachdem Hamutals Schritt erstorben ist, sinken sie wieder in ihren apathischen Zustand zurück.
Nicht so die Schnecken. Ohne ein Gespür für drohendes Unheil kriechen sie nach dem abendlichen Regenguss auf die Gassen, um sich dort zu paaren. Oft zermalmt unter den Schritten eines späten Fußgängers – die feinen Schalen zerbrechen, Schleim tritt aus, was Form und Substanz war, wird wieder zu Materie, tot und befreit von der feinen Struktur. Mancher Dorfbewohner klaubt die Schnecken mitten im Liebesspiel von den Pflastersteinen, wirft sie in einen Kupfertopf, kocht sie lebendigen Leibes und verspeist sie sofort.
Dinge wie diese bringen Hamutal aus der Fassung.
Von klein auf hat man sie gelehrt, die Natur unterstehe Gott. Dies ist bei dem jüdischen Gott, dessen Name sie nicht aussprechen darf, nicht anders. Der Anblick einer Wespe, die im Honigtopf unter dem lauten Summen der Todesangst verendet, oder auch der eines kleinen schwarzen Skorpions, der von einem Fuß zerquetscht wird, genügt, und sie wendet ihr Gesicht ab, quält sich mit der Frage, welcher Gott auf dieses Leid eine befriedigende Antwort zu geben weiß. Oft, wenn sie ihren wenige Monate alten Säugling, den kleinen Yaakov, an die Brust legt, wird sie von Beklemmungen und einer gegenstandslosen Angst erfasst. Wo ist nur ihre behütete Kindheit im schönen Elternhaus des Nordens geblieben? Welchen Zwecken dient dies raue Leben, das sie jetzt umgibt? Erschöpft es sich einzig in einem erschrecklichen Kreislauf mit dem Tod? Die Theologen schweigen sich aus über solcherlei, als wäre für sie alles mit einem Sinn erfüllt. Gelegentlich ist ihr, als wäre sie durch das Abschwören des elterlichen Glaubens in einem Raum der Leere gelandet. Sie mag von David noch so viel über die Thora und die alte Geschichte des jüdischen Volkes lernen, doch sie hat ihre Gewissheiten verloren, und es gibt niemanden, mit dem sie darüber sprechen könnte. Christen würden sie sofort als Hexe verurteilen und auf den Scheiterhaufen zerren, Juden würden sie spüren lassen, dass ihre Zweifel die einer Proselytin seien und sie unwürdig, in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Also reagiert sie, wie jede gebildete Frau jener Zeit reagieren würde: Sie schweigt, neigt das Haupt und betet still. Doch zu wem sie beten soll, weiß sie eigentlich nicht. Zur inneren Stimme vielleicht oder zu dem verlorenen Engel, der sich manchmal auf ihrer Schulter niederzulassen scheint, worauf sie erschaudert und sich mit leise gemurmelten Beschwörungen selbst besänftigen muss.
Trotz ihrer Bemühungen, sich in die kleine Gemeinschaft einzufügen, indem sie jedem auf der Straße mit freundlichen Worten begegnet, die kaum einer erwidert – die meisten Dorfbewohner gehen gleichgültig an ihr vorüber. So etwas ist sie weder als vornehme normannische Frau gewöhnt noch als die privilegierte Jüdin, die sie in Narbonne gewesen war.
Als ihr allmählich klar wird, dass sie niemals ganz zur Gemeinschaft gehören wird, stellt sie ihre Versuche, freundlich zu sein, ein. Von dem Moment an, wo sie sich mit ihrer Rolle als Außenseiterin abfindet, wird sie mehr oder weniger stillschweigend akzeptiert. Nach einer Weile nicken ihr die christlichen Honoratioren höflich zu. Freundlich leuchten die Fragen in ihren Augen nicht gerade, aber es ist ihr gleichgültig, denn hier ist sie vorerst sicher, und außerdem ist David gut Freund mit Rabbi Obadja. Niemand fragt sie, was sie hier eigentlich zu suchen hat. Doch es spricht Bände, dass es still um sie wird, wenn sie unter den übrigen Bewohnern auf dem Dorfplatz steht. Man sieht die Leute denken: Eine blonde Jüdin mit eisblauen Augen, da stimmt doch etwas nicht! Doch sie verziehen keine Miene. Eines Tages aber werfen ihr Kinder kleine Steine hinterher und singen: Mouri, Jusiou, mouri – stirb, Jude, stirb.
Das geht ihr durch den Kopf, als sie mit ihrem immer noch schmerzhaft geschwollenen, einfach nicht heilen wollenden Fuß in der Dämmerung nach Hause hinkt. Sie biegt in die Grande Rue ein – damals lediglich eine etwas breitere Gasse, heute Teil eines Wanderwegs – und versucht dabei, auf dem unebenen Pflaster nicht auf die im trägen, träumerisch verlangsamten Liebesspiel miteinander verschlungenen Schnecken zu treten, aus deren Häusern überwältigend und obszön die weiche, pulsierende Masse durchsichtiger Wollust quillt.
5
Der Winter bricht mit unerwarteter Härte herein. Wochenlang liegt das Dorf unter einer dicken Schicht gefrorenen Schnees. An klaren Tagen saust eiskalt der Mistral durchs Tal. Das Leben verharrt im gleißenden Schimmer aus Weiß und Blau. In den dunklen Häusern drängen sich die Menschen um die Öfen, in denen sie das Eichenholz verbrennen, das sie im Herbst sorgfältig hinter dem Haus gestapelt haben, in den Zimmern drängen sich die Rauchschwaden. Die Dorfbewohner ernähren sich von dem, was sich noch in den feuchten Kellern und auf den Dachböden findet: Rüben und Knollen, hartgewordener Dinkel, der sich nur mit Mühe zu einem klebrigen Mehl vermahlen lässt, etwas Salzfleisch, das man entweder in Wasser kocht oder in der Asche brät. Es droht eine Hungersnot. Im Schnee steifgefrorene Hunde, an deren Nase ein Blutstropfen hängt, werden gehäutet, ausgenommen und mit ein paar Kräutern gekocht. Das Fleisch schmeckt widerlich und fade. Gegen das Brennen in der Lunge hilft ein Gebräu aus in Wasser gekochten getrockneten Thymianzweigen, vermengt mit Resten Honig. Das Stroh der Bettsäcke ist klamm, die Kinder sind mager und zittern. In den Kellern fiepen die Ratten. Dann wieder herrscht tagelang eine mörderische Weiß- und Klarheit, in der sich nichts regt als der Wind, der kurz nach Mittag mit einem leisen, dumpfen Schlag gegen die Hausmauern fährt, wenn warme und kalte Böen sich im Tal abwechseln. Schuuuff, klingt es, schuuuff, gefolgt von einem grellen Pfeifen durch die Ritzen, bevor es wieder endlos still wird. David liest in der Synagoge. Die Monotonie der Stimmen ist tröstlich. Eiszapfen hängen von den niedrigen Dächern, vor den Türen der größeren Häuser verweht der Schnee. Flehen, Verwünschung, Heimsuchung, Gebet, Warten, Schlafen. Auf der bläulichen Gasse das Knirschen von Schritten. Türangeln quietschen. Es ist der Monat Tewet des jüdischen Jahrs 4852. Die Christen schreiben das Jahr 1092. Es ist Januar, und es schneit schon wieder. Um halb vier ist es bereits dunkel, ein paar Krähen torkeln durch das Schneegestöber. Schaut man nach oben, sehen die Flocken aus, als wären sie schwarz und nicht weiß, sie sausen die Felswand hoch wie eine Horde winziger Aufklärer auf Erkundungsflug, haften sich an Bärenhöhlen, Wachtürme und Wimpern. Alles zittert und betet. Ein Bußprediger stapft mit einer Ratsche durch den Schnee und verkündet das Ende der Zeiten.
In Fontaine-lès-Dijon herzt Mutter Aleth ihren Sohn, der so alt ist wie Yaakov, und wickelt ihn in wollene Tücher. Er heißt Bernardus und wird als Erwachsener, wenn Hamutals Gebeine längst verblichen sein werden, nach der Gegend benannt, in der er ein Zisterzienserkloster errichtet, nach dem hellen Tal – Clairvaux.
In der Felswand plötzlich ein lautes Krachen. Der strenge Frost hat ein mehrere hundert Tonnen schweres Bruchstück vom Fels abgesprengt. Fünfzig Meter über der Synagoge klafft ein meterlanger Riss im Gestein. Das Ungetüm wäre, stürzte es herab, groß genug, um auf seinem Weg hinab die Hälfte des Dorfs zu zermalmen. Die Spur würde quer durchs jüdische Viertel führen. Doch der Koloss bleibt, wo er ist, sackt ein Stück ab und sitzt auf den obersten Steinen des Dorfwalls auf. Dort liegt er auch noch nach tausend Jahren. Ich kann ihn sehen, wenn ich aus der Hintertür meines Hauses trete. Unverändert pfeift der Mistral um den Felsen herum. Die Dorfbewohner schlagen Kreuze und bitten Gott, er möge sie verschonen. Die junge Frau träumt, wie ihr Vater die Hand gegen sie erhebt. Sie fährt zitternd aus dem Schlaf auf. In dieser Nacht setzt das Tauen ein.
6
Die Zeit verstreicht. Ein paar Jahre sind vergangen. In Hamutals Leben hat sich nur wenig geändert, sieht man einmal davon ab, dass ihre Haut rau geworden, ihr Gesicht braungebrannt und ihr früheres Leben verblasst ist.
Der kleine Yaakov spielt meistens allein. Manchmal wagt er sich bis zur Place de Bœufs in der Nähe des unteren Festungstors, wo die Ochsen geschlachtet werden, wo der auch als Gefängnis dienende Wachturm steht und wo die Dorfkinder den ganzen Tag kreischen und spielen. Er kommt stets allein zurück.
Obwohl David Hamutal Provenzalisch, die lokale Variante der Langue d’Oc, beizubringen versucht, hat sie noch immer Schwierigkeiten, die Dorfbewohner zu verstehen. Diese wiederum reagieren mit Schadenfreude, wenn sie verlegen und stotternd etwas in der Sprache des Nordens zu erklären versucht. Während David mit Obadja in der Synagoge liest oder sich über Thorarollen beugt, schweift sie mit ihrem Söhnchen auf dem Rücken in stets weiteren Kreisen durchs Tal. Oft sammelt sie in Begleitung anderer jüdischer Frauen Kräuter und essbare Knollen, bindet kleine Blumensträuße, setzt sich ins Gras und betrachtet die Landschaft. Und während es im Rest der westlichen Welt tost und tobt und die politischen Spannungen wachsen, die Christen sich streiten, der römische Papst einen aussichtslosen Machtkampf gegen den deutschen Kaiser führt, weiden hier in zeitlosem Frieden die Schafe. In den Städten erhebt sich das Volk. Man berichtet von Ketzerei, Raub, Mord, Rache, Tumult und falschen Propheten. Von allen Seiten wird das Gerücht herangetragen, der Antichrist sei auf Erden erschienen. Die Apokalypse habe das Ungeheuer der tausendjährigen Endzeit ja vorhergesagt, jetzt sei es unter uns, doch niemand erkenne es, der Teufel habe sich verkleidet, gebt acht! Der alte Krüppel dort drüben könnte genauso gut der teuflische Simon mit dem ausgestochenen Auge sein und der Bettler, der den Klumpfuß hinter sich herzieht, eine gewitzte Vermummung des Satans. Alles und jeder wird verdächtigt, Ursache eines Unheils zu sein oder Träger einer ansteckenden Krankheit. Gefahr droht allenthalben. Angst regiert die Phantasie. Vielleicht sind ja doch die Juden an allem schuld. Man redet so viel. Von Tag zu Tag wird das Leben der Juden in den engen Gassen der Städte und Dörfer beschwerlicher.
Das alles dringt nur allmählich zu Hamutal durch. Bei den Gebeten auf der Frauenempore der Synagoge erinnert sie sich gelegentlich an ihr prächtiges Leben, das sie vier Jahre vorher Hals über Kopf verlassen und gegen ein Leben auf dieser abgelegenen Hochebene eingetauscht hat, aus Liebe zu David, den sie ungewollt mit in die Verbannung gezwungen hat. Wenn sich die finsteren Nächte dem Ende zuneigen, sieht sie oft ihre Eltern in Rouen vor sich: die Mutter, die ihr ganzes Leben lang trauern wird, sitzend im großen Zimmer des Hauses weit im Norden; den Vater, dessen Augapfel sie einst gewesen ist und der in seiner Wut die Ritter auf sie gehetzt hat, so dass sie nun seine Rache fürchtet und schweißnass aus dem Schlaf schreckt mitten in der tiefen Stille des schlafenden Dorfes unter dem Felsen.
Sie weiß, dass sie wieder ein Kind in ihrem erschöpften Körper trägt.
II Rouen
1
An einem klaren Herbsttag des Jahres 1070 wird in der normannischen Hafenstadt Rouen ein Mädchen geboren. An diesem Tag sind die Straßen erfüllt vom Geschrei sich geißelnder Soldaten, von monotonem Singsang und Gebeten, vom Klatschen der Peitschen auf nackte Rücken, vom Singsang der Psalmen, von Frauenrufen, vom Klirren und Klackern der Ketten auf dem Straßenpflaster, vom traurigen Schlag der großen Trommel, dem keuchenden Klagen der wirr durcheinanderstolpernden Büßenden. Es ist die trübselige, erbärmliche Prozession der einst so gnadenlosen Krieger von Wilhelm dem Eroberer, der berüchtigten Nachfahren der Wikinger. Sie wurden von den Bischöfen dazu genötigt, Buße zu tun für die barbarischen Gräueltaten, die sie vier Jahre zuvor bei der Schlacht von Hastings begangen hatten. Der Vater des Mädchens stammt von diesen Normannen ab, die anderthalb Jahrhunderte zuvor den Landstrich durch Raubzüge, Plünderungen und Brandstiftungen in Besitz genommen hatten, um sich danach in den dichten Wäldern an den Ufern der sich schlängelnden Seine niederzulassen.
Ungeachtet der Tatsache, dass die Normannen sich Grund und Boden gewaltsam angeeignet haben, leben sie nach den ersten Schreckensjahren in Frieden mit allen und integrieren sich innerhalb weniger Generationen. Die einheimische Bevölkerung ist zunächst beeindruckt von den Eindringlingen: Sie kennen schon so etwas wie Körperpflege, und die ersten Männer rasieren sich noch die Augenbrauen, schminken die Augen mit Kohle und binden das Haar streng zu einem Zopf, was so gar nicht zu ihrer brutalen Art und ihrer Kampfeslust passen will. Man fürchtet die Männer und ergibt sich ihnen. Trotz der Tatsache, dass viele von ihnen sich die Frauen gewaltsam nehmen, entstehen auch zarte Bande, wodurch sich die materiellen Interessen ganzer Familien miteinander verquicken. Man sucht nach einer Möglichkeit, den einstigen Gottesfrieden wiederherzustellen, und findet sie darin, den Eroberern, gegen die ohnehin kein Kraut gewachsen ist, das Erbrecht auf ihren Besitz zu verleihen, wenn diese sich im Gegenzug bereit erklären, den christlichen Glauben anzunehmen. Von nun an heißen sie Normannen. Ein Jahrhundert später gehört so mancher Urenkel der ersten Normannen bereits zu den einflussreichen Bürgern der prosperierenden Stadt. Einer von ihnen ist Gudbrandr, der Vater des Mädchens. Die Mutter entstammt einer wohlhabenden Familie aus Arras und ist eine entfernte Verwandte der Grafen von Flandern, die früher über die Stadt geherrscht haben.
Das Kind, das an jenem Herbsttag in einer Patrizierwohnung geboren wird, bekommt den Namen Vigdis, ein alter nordischer Name. Er bedeutet »Göttin des Kampfes«. Da der heidnische Name auf keinem christlichen Heiligenkalender verzeichnet ist, erkundigt sich der Priester bei der Taufe, ob man sich vielleicht nicht doch für einen anderen Namen entscheiden wolle. Der Vater verneint; selbst ein zum Christentum bekehrter Normanne hat seinen Stolz. Man einigt sich darauf, das Kind zusätzlich auf den Namen seiner flämischen Großmutter zu taufen: Adelaïs. Der Großvater mütterlicherseits war Franke, wodurch Vigdis Adelaïs’ Schutzengel zweifacher Abkunft ist. So etwas war ein Grund für so manchen Albtraum: Einem Mönch träumte von zwei Raubvögeln im drohend dunklen Himmel der Normandie. Einer kam aus Franken, der andere aus dem Norden. Sie flogen dicht aneinander vorbei, beide hatten sie blutgetränkte Flügel.
Vigdis Adelaïs hat blondes Haar und blaue Augen mit einem leichten Silberblick. Sie wächst in der behüteten Umgebung der wohlhabenden Stadt auf, in deren Hafen große Schiffe mit kostbaren Stoffen, Gewürzen, Holz und Kupferzeug neben stinkenden Fischerbooten anlegen. Das Mädchen spielt oft mit anderen Kindern am Ufer der Seine. Den Bug so manchen großen Schiffs aus England ziert ein Drachenkopf.
Zu Anfang des elften Jahrhunderts wird der Ackerbau ertragreicher. Das Klima wird angenehmer, die Ernten üppiger; das Vieh ist gesünder und wird schwerer, die Hungersnöte gehören der Vergangenheit an, die Nahrung ist abwechslungsreicher. Die Ausschreitungen der Jahrtausendwende sind nun fast ein Jahrhundert her, Überfälle und Plünderungen sind selten geworden, das normale Leben scheint sich einzustellen. In diesen hundert Jahren nahm die Durchschnittsgröße der Frauen um mehrere Zentimeter zu. Rachitiserkrankungen werden weniger, die Lebenserwartung ist von kaum dreißig auf sechsunddreißig Jahre gestiegen. Vigdis kann damit rechnen, etwas länger zu leben als ihre Vorfahren. Nichts deutet auf die Katastrophen hin, die sich nur wenige Jahre später ereignen werden.
*
Man lässt Vigdis Adelaïs eine gute Erziehung angedeihen. Ihre Eltern sind wohlhabend und gebildet. Es fehlt ihr an nichts, sie wird umsorgt. Ein Priester lehrt sie lesen und schreiben. Nicht um eine fromme Erziehung war es dem Vater zu tun, in den höheren Schichten war die Bildung der Mädchen vor allem ein Statussymbol. Je eleganter, gebildeter und gesitteter ein Mädchen, desto begehrenswerter war es als Heiratspartie. Nach ihrem zehnten Geburtstag wird Vigdis’ Handlungsraum eingeschränkt. Sie darf jetzt nur noch innerhalb des Hauses spielen und auch nur noch in den wenigen freien Nachmittagsstunden, bevor die Vesper beginnt. Von nun an muss sie schweigen, wenn sie nicht ausdrücklich zum Sprechen aufgefordert wird. Sie soll außerhalb des Hauses stets den Blick senken, niemandem ins Gesicht starren und mit kleinen Schritten gehen. Ihr aufblühender Körper wird in kostbare Kleidung gehüllt.
Eines Abends belauscht sie nach Tisch eine Unterhaltung ihrer Eltern. Sie hat sich zurück ins Esszimmer geschlichen und unbemerkt auf eine Bank gesetzt.