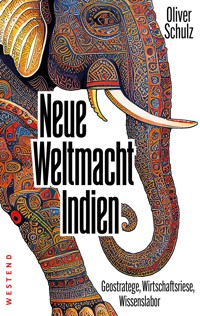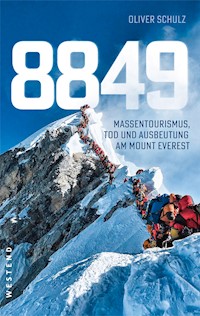Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Jugend in den 80er - Jahren: Marc Bronsig, der zungengewandte Held ohne besonderen Eigentumsrespekt, ist normal faul, Ich-bezogen und wahrlich nicht dem Dogma der Wahrheit verpflichtet, sobald es ihm in den Kram passt. Aufgrund seiner unseligen Begabung, sich bei allen kleinen und großen Verfehlungen im Leben erwischen zu lassen, wird Marc zu einem Sozialdienst im Altenheim verurteilt, wo er sich in die Krankenpflegerin Maida verliebt. Der Leser folgt den skurrilen Helden der Geschichte bei einem Schimpansenausbruch aus dem hiesigen Zoo, einer Beerdigung mit Schlagermusik und Wodka, der Rettung des Ferkels Trudi vor dem Schicksal als Spanferkel und auf der Jagd nach einer Tasche mit Kokain. Dabei wird Marc Bronsig quasselnd erquickliche Weisheiten gewinnen und von sich geben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Schulz
Der bekiffte Boxer beim Erstrundengong
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Impressum neobooks
1
Nach alter Erfahrung will der eitle Mensch lieber für schlimm, glücklich und kurzweilig als für brav, aber unbeholfen und einfältig gelten!
Gottfried Keller
Der Spruch steckte in einem kleinen schwarzen Rahmen und hing über dem Wohnzimmersofa, welches der erklärte und unumstrittene Lieblingsplatz und Lebensmittelpunkt seines Vaters, Gerd Bronsig, gewesen war.
„Marc besitzt die selbe Schlauheit, die seinen Vater bereits ins Grab gebracht hat,“ behauptete seine Großmutter. Er halte Geist, Talent und Witz für ausreichend, um bequem durchs Leben zu geraten. Und das reiche im Leben nun einmal nicht aus, schimpfte sie.
Marcs Vater war ohne festen Beruf gewesen, hatte sich hier und da sein Geld als Gelegenheitsarbeiter verdient. Dann hatte er Charlotte Bott kennengelernt, sie ungewollt geschwängert und Marc war mit der Zange des Arztes in die Welt geraten. Zehn tapfere Jahre verteidigte der Vater seinen Ruf als Lebenskünstler erfolgreich und Marcs Erinnerungen an diese Jahre waren die allerschönsten!
„Arbeit verdirbt die beste Laune,“ pflegte sein Erzeuger lachend zu sagen, wenn sie darauf warteten, dass die Mutter aus dem Krankenhaus kam, um das Essen zuzubereiten. Tagsüber verbrachten Vater und Sohn die Zeit mit Fußball spielen im Park, Ausflügen und Fernsehen. Marc erinnerte sich an seinen Vater in jenen Jahren als stets freundlich und ausgeglichen.
„Mein Leben verlief glücklich ohne Dienst – was sollte ich mich da in einen anstrengenden Wirkungskreis hineinwerfen und anderen Menschen die Arbeit wegnehmen,“ antwortete er Marc einmal auf die Frage, warum die anderen Väter allesamt in Brot und Lohn standen und nur er seine Zeit einzig mit Sohn und Sofa teilte. Marc gab sich mit der Antwort zufrieden, erlebte bisweilen sogar sakrale Erklärungen der chronischen Arbeitsunlust seines Vaters:
„Wenn Gott gewollt hätte, daß ich körperlich arbeite, dann hätte er mir eine rechte Hand und einen anderen Verstand mit auf den Weg gegeben.“
So sprach er und dieser morbide Ehrgeiz kostete Energie, Geld und die Nerven derjenigen, die ihm wirklich nahestanden. Wie stark sich nämlich auch Charlotte Bott mit Geduld, Nachsicht und Toleranz gegenüber ihrem Mann wappnete, so erlag sie doch immer wieder dem hoffnungslosen Versuch, sein Phlegma zu bekämpfen.
„Erheb dich von deiner Couch, geh einkaufen, mach irgendwas,“ forderte sie ihn zu Tätigkeiten auf.
„Wer müde ist, der soll schlafen. Das liegt in der Ordnung der Dinge,“ behauptete Marcs Vater und beschimpfte im selben Atemzug dann noch die Familie Bott und speziell seine Schwiegermutter, die in einem allgemeinen Komplott gegen ihn und seine Gelassenheit die Welt an den Rande des Wahnsinns treiben würden. Solche Reden wirkten zunehmend als Treibmittel für die kalte Wut von Marcs Mutter, die sich sichtbar genervt der Gegenwart ihres Lebenspartners durch Flucht an das Telefon entzog.
„So lang der Arsch noch in die Hose passt, wird keine Arbeit angefasst,“ flüsterte Gerd Bronsig seinem Sohn ein paar Mal zu
und zwinkerte mit den Augen, sobald Marcs Mutter das Wohnzimmer verlassen hatte.
Marc erinnerte sich, daß der Vater sich zuweilen wirklich um Beschäftigung bemüht zeigte, denn er hasste Streit und ging ihm nach Möglichkeit aus dem Weg. Gleichzeitig wirkte Gerd Bronsig aber auch jedes Mal entschieden erleichtert, wenn sich die Aussicht auf einen akkuraten Job zerschlug.
Wenn Marc etwas von seinem Vater mit auf den Weg bekam, so waren es nicht die Tugenden wie Arbeitsfreude und Fleiß, wohl aber zotige Sprüche und der Humor, über sich selbst lachen zu können. Als kleiner Junge hatte Marc seinen Vater einmal auf der Autobahn gefragt, warum der große Wagen mit dem weiß-blauen Zeichen vorne auf dem Kühler, der gerade auf der Überholspur an ihnen vorbeischoss, so viel schneller war, als der von Freunden geliehene Käfer, den die Familie Bronsig zuweilen im Besitz hatte und der nur mühsam die Siege in den Duellen mit den Lkws davontrug. Marc hasste es nämlich, überholt zu werden. Er wollte überholen und schneller als die anderen sein. Am Ende einer Fahrt war es wichtig, dass sein Vater und er mehr Autos überholt hatten, als selber überholt worden zu sein. Die BMWs, die regelmäßig an ihnen vorbeifuhren, waren schneller und größer als der geliehene Käfer von Marcs Vater. Deshalb verachtete Marc BMW und beschwerte sich einmal bei seinem Vater darüber. Der begutachtete nur kurz den fetten Straßenkreuzer, der schon längst aus dem Windschatten des Käfers heraus gerast war, schaute zu seinem Sohn und zuckte mit den Schultern.
„Der Teufel scheißt immer auf einen großen Haufen.“ Dann hatte er über seinen eigenen Spruch gelacht und die Verfolgung eines Kastenwagens aufgenommen, um Marcs Rennfieber auf dem Rücksitz hinten zu befriedigen.
In jenen Tagen, als Marcs Schullaufbahn ins dritte Jahr ging, besuchte eine Tante Gaby wiederholt die Familie, sobald die Mutter das Haus verlassen hatte. Sie war blond, hatte kirschrot bemalte Lippen, einen üppigen Busen und war keinesfalls mit irgend jemandem aus der Familie verwandt. Es galt zwischen Marc und seinem Vater als abgemacht, daß Marc die Besuche der fröhlichen jungen Frau gegenüber der Mutter unerwähnt ließ, was sich auszahlte: Er durfte an den Samstagen, wenn die Mutter ihren Dienst im Krankenhaus tat, bis Mitternacht vor dem Fernseher sitzen, bekam zuweilen Geld für Kino, Eis und Popcorn und kannte so im zarten Alter von neun Jahren sämtliche Bud-Spencer-Filme und den Preis für Bestechlichkeit.
Marc mochte Gaby, denn sie lachte viel, warf ihn in der Luft herum und küsste ihn mehrfach, weil er so ein süßer Junge sei. Gern tobte Marc mit Gaby und seinem Vater durch das Haus herum, war allerdings auch häufiger beleidigt, wenn Gerd und Gaby sich ohne ihn ins elterliche Schlafzimmer zurückzogen, um alleine zu spielen. Zu diesem Zweck verriegelten sie die Tür und ließen Marc einfach so draußen allein. Er fand das gemein. Er hörte doch, wie sie sich drinnen vergnügten, lachten und stöhnten. Er wollte mittoben, auch wenn er die Geräusche gegen Ende der Turnstunde immer sehr merkwürdig fand. Einmal vergaßen die beiden die Schlafzimmertür abzuriegeln, nachdem sie Marc mit einem neuen Legokasten auf sein Zimmer geschickt hatten. Marc gluckste vor Freude, innerer Aufregung und geheimster Anspannung, als er so leise wie es irgendeinem Indianer möglich die Schlafzimmertür aufschob, sich am Boden kriechend dem Bett näherte und atemlos dem Spiel der Erwachsenen lauschte. Allerdings klang deren Spiel heute wieder eher seltsam. Marc lag am Fußende des Bettes auf dem Boden und wagte sich kaum zu rühren. Befremdlich keuchten Gaby und sein Vater um die Wette und das klang gar nicht mehr wie ein Spiel. Waren sie krank oder verletzt? Marc sorgte sich mit einem Mal sehr, fühlte sich unbehaglich und bereitete dieser eigenartigen Situation ein Ende, indem er aufsprang und lauthals „Kuckuck“ rief. Gaby kreischte, der Papa stöhnte „Scheiße“ und keiner der beiden schien übertrieben erfreut, Marc hier zu sehen. Allerdings boten die beiden auch einen komischen Anblick, wie sie da so nackt miteinander tobten. Marc spürte, dass er bei diesem Spiel unerwünscht sei, er verstand die Regeln nicht, kehrte verwirrt in sein Zimmer zurück und wunderte sich sehr. Später kamen der Vater und Gaby zu ihm ins Zimmer, taten so, als wäre nichts geschehen und versuchten sich ungezwungen zu geben. Marc aber spürte, dass da irgendetwas nicht in Ordnung war. Warum erklärten sie ihm ihr Spiel nicht und versuchten stattdessen ihn auszuschließen? Die Welt der Erwachsenen zeigte sich zugemauert und verschlossen. Verwunderlich war es, was hinter dieser Mauer passierte. Marc begann die Mauer abzuklopfen und durch endlos viele Fragen kleine Schlupf- und Gucklöcher in die andere Welt zu bekommen, doch sein Vater konnte oder wollte ihm nicht mehr erklären und viele Dinge auf der Seite der Erwachsenenwelt blieben rätselhaft.
Das beschauliche Leben von Gerd Bronsig und Gabys Besuche endeten mit dem Tod des Großvaters der Familie Bott. Marcs Oma zog trotz erheblichen Widerstandes des Vaters in das Esszimmer, übernahm das Kommando im Haushalt und brachte so die vertraute Hierarchie der kleinen Familie durcheinander.
Statt Kino hatte Marc sich nun der intensiven Erledigung seiner Schulaufgaben zu widmen und Gerd Bronsig keine ruhige Minute auf dem Sofa mehr. Marc schlüpfte dank Omas Drill auf das Gymnasium, aber die Moral seines Vaters war gekippt, im Alter von vierzig Jahren sein Leben aus den Fugen geraten. Gerd Bronsig flüchtete vor dem Terror seiner Schwiegermutter in die geregelte Arbeit.
Asbest war der Baustoff der siebziger und frühen achtziger Jahre. Billig, praktisch und gut dämmte er einen Großteil der Wohn- und Bürohäuser und die leisen Stimmen der Experten, die vor einer Krebsgefährdung im Zusammenhang mit Asbest warnten, verhallten ungehört. Marcs Vater und die verschiedensten ausländischen Kollegen schnitten die tödlichen Platten zu und dabei störte der Mundschutz ungemein.
Man könne nicht arbeiten mit Mundschutz, das Atmen fiele schwer, behaupteten sie und so schnitten die Männer mit tiefen schnaufenden Atemzügen die Platten und inhalierten die kleinen giftigen Partikel, die sich in der Lunge festsetzten und zu bösartigen Krebsgeschwüren zu wuchern begannen. Als das Gefährdungspotential erkannt und die Arbeitsschutzbestimmungen strenger wurden, war es für Gerd Bronsig und ein paar andere bereits zu spät. Die Arbeit in der Fabrik hatte ihm nacheinander Spaß, Lebensmut, Lunge und Gesundheit geraubt.
Zuerst war da nur sein beständiger Husten und die Nörgelei der Oma gewesen, er werde sich an harte Arbeit schon noch gewöhnen. Dann kam das Fieber und das Tempo seines Verfalls wuchs rapide. Kurz vor seiner Einweisung ins Spital rief er Marc alleine in sein Zimmer. Gerd Bronsig schwitzte und fiebrig rot glänzte seine Stirn. Er fasste Marc am Arm, zog ihn zu sich ans Bett und flüsterte:
„ Weißt du Marc, was ich nie begriffen habe: Warum bleiben Menschen vor einer roten Fußgängerampel stehen, wenn nirgendwo ein Auto kommt. Ich verstehe das nicht. Der liebe Gott hat uns doch einen eigenen Verstand mitgegeben. Also warum gehen wir nicht, wenn die Fahrbahn frei ist?“
Marc schüttelte den Kopf und verstand nicht, worauf sein Vater hinauswollte.
„Den einzigen Rat, den ich dir für dein Leben mitgeben kann: Benutze deinen eigenen Verstand und vertraue auf deine Vernunft. Das reicht völlig aus,“ wisperte er mir ins Ohr. „Auch wenn du dir Feinde machst und die anderen wütend und neidisch werden: Geh bei rot, wenn keiner kommt. Aber lass dich dabei vor allem nicht erwischen, denn die, die warten, fühlen sich immer gestört!“
Gerd Bronsig verstummte und streichelte Marc mit zittriger Hand über die Wange.
„Vergiss nie...Engel beschützen Menschen wie uns. Uns kann nichts passieren.“
Marc nickte wortlos. Der Vater lächelte ein weiteres Mal.
„Weißt du Marc, das Leben ist kein Kindergeburtstag, aber ich habe immer versucht, es zu meiner Geburtstagsparty zu machen. Das ist alles, was ich im Leben versucht habe.“
Mit diesen Worten entließ Gerd Bronsig seinen Sohn ins Leben. Marc sah ihn nie wieder. Tage später verstarb der Vater im Krankenhaus still. Marc war dreizehn Jahre alt und kannte von da an keine roten Ampeln mehr.
2
Gerd Bronsigs Vermächtnis waren Schulden. Die Familie Bott schlug das Erbe aus und Marc blieb nichts Handgreiflicheres von seinem Vater als die Bekleidungstruhe mit seinen Mänteln und Jacken.
Seit des Vaters Tod wirkte Marcs Mutter ausgeglichener. Die finanzielle Situation der Familie hatte sich durch sein frühes Dahinscheiden gebessert und Charlotte Bott erschien das Leben überschaubarer ohne ihn. Sie brauchte keinen Mann, jedenfalls keinen wie Gerd Bronsig, suchte nach Überblick und Ordnung. Die Mutter an ihrer Seite gab Charlotte zusätzlichen Halt und sichtbare Zufriedenheit. Sie ließ es zu, dass die Großmutter endgültig die Geschicke der Restfamilie okkupierte und den Tagesablauf bestimmte. Marcs Mutter arbeitete weiterhin im Krankenhaus, wurde bekocht und begab sich nach dem Abendessen vor den Fernseher. Die Nacht wurde geflimmert, die Oma bestimmte das Programm. Charlotte Bott verlangte nicht nach mehr und niemand fragte Marc, was er wolle.
Obwohl Marc anerkannt hatte, dass ihn seine Mutter aufrichtig liebte, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles für ihn gab und sich wirklich bemühte, fühlte er sich im Gegensatz zu ihr zu den Lebensmaximen des Vaters hingezogen, meinte eine geistige Verwandtschaft mit ihm zu erkennen. Aber die Oma und seine Mutter meldeten vehement den Anspruch an, Marcs Geschicke zu bestimmen.
„Dein Vater war keinesfalls unnütz und schon gar kein schlechter Mensch. Ihm fehlte nur jeglicher Fleiß. Er war zum Vater besser geschaffen als zum Arbeiter.“
Charlotte Bott sprach nach dem Tod des Vaters in Marcs Gegenwart nur in besten Worten von ihm, obwohl es ihr an Gründen für manche Klage nicht gefehlt hätte. Die Oma war anders.
„Dein Vater war der faulste Hund auf Erden. Sieh zu, daß du nicht wirst wie er,“ zeterte sie noch Jahre nach seinem Tod und ahnte wohl bereits, wessen Vorbild Marc nacheiferte. Marc hasste seine Oma, obwohl sie vortrefflich kochte. Für ihn hatte die Oma durch ihre ständige Nörgelei den Vater in die Arbeit und somit den Tod getrieben. Mit vierzehn Jahren und den Waffen eines Pubertierenden nahm er den Kampf gegen sie auf.
Marc fischte einen verbeulten Hut und den alten, zerschlissenen Lieblingstrenchcoat seines Vaters aus der Truhe, sah im Kino „Quadrophenia“, hörte „Madness“ mit gewaltiger Lautstärke und tanzte bei verschlossener Tür den „Gangsterbeat“ der „Specials“. Die Oma hämmerte vergeblich gegen die Wände. Sie saß jetzt abwechselnd in der Küche oder im Wohnzimmer und moserte, wenn sie Marc sah:
„In deinem Alter solltest du mitverdienen. Übernimm einen Ferienjob!“
Marc blieb sechs lange Wochen Sommerferien bis zum Mittag im Bett, attackierte ihre und seine Ohren mit den „Sex Pistols“ und „The Police“.
„God save the queen and her fascist regime,“ brüllte er durch die vergipsten Wände bis seine Großmutter die Nerven verlor, die Wohnung verließ und sein Mittagessen an die Hinterhofkatzen verfütterte.
“The Police“ war mehr den gefühlvolleren und einsamen Momenten vorbehalten. Sting sang von einer „Message in a bottle“ und Marcs Wut und Unzufriedenheit verbargen sich hinter mürrischer Verweigerung und diversen pubertären Selbstzweifeln. Er fühlte sich unsicher und hässlich und dabei kamen doch nun gerade die Mädchen ins Spiel.
Marcs schlechte Noten des Vorjahres etablierten sich, der Sprung in die Oberstufe war gefährdet. Die Lehrer bescheinigten Marc sowohl ein Grundmaß an Intelligenz, wie auch eine bedenklich träge und rebellische Haltung. Marc war ehrlich zu sich: Er wusste, dass er eigentlich nicht intelligent genug war, um sich seine desinteressierte Faulheit leisten zu können, aber er mogelte sich so eben überall durch und kam knapp über die Klippen hinüber. Das klappte erfreulich oft, aber halt auch nicht immer. Mutter und Großmutter sorgten sich im Chor.
„Du musst dich mehr anstrengen, auch wenn du das Abitur nicht schaffen solltest. Mit deinem nächsten Zeugnis musst du dich bewerben – Lehrstellen sind knapp heutzutage.“
Mit solchen Reden verdarben Oma und Mutter Marc das Abendessen.
„Wer will denn hier malochen bitte?! Ich werde jedenfalls keine ehrliche Arbeit annehmen und schon gar keine dusselige Lehre machen! Ich will mein Leben nicht verschwenden,“ verkündete er in provozierender Manier lauter und öfter, als es für ihn gut war. Seine forsche Berufsvorstellung hatte die Streichung des Taschengeldes zur Folge. Aus pädagogischen Gründen. Doch Marc blieb stur. Zwei Wochen widerstand er tapfer den Versuchungen der westlichen Einkaufswelt, ließ die Verlockungen des Kapitalismus an sich abprallen. Schrittweise aber stetig steigerte sich dann aber seine Begierde an Besitz und ihm kam die seit Menschengedenken erprobte und zuhauf für gut befundene Problemlösungsstrategie des Shoppings ohne Geld in den Sinn: Marc klaute!
Zuerst erprobte er sein Geschick in der Süßigkeitenabteilung eines großen Kaufhauses, erachtete seine Beute dann aber als zu gering und des Aufwandes nicht wert, arbeitete sich weiter zu den Zeitungsständen vor, wodurch seine „Asterix-„ und „Lucky Luke-Sammlung“ im Laufe der Wochen komplettiert wurde, und suchte seinen Meister schließlich in der Herrenmodenabteilung, wo eine schwarze Lederjacke sein ganzes Begehren entfachte. Wild, schwarz, düster, frei und gefährlich - es war die beste Jacke, die Marc sich für sich vorstellen konnte und ihr Preis sprengte sämtliche Rahmen.
Zwei Tage schlich Marc im Herrendistrikt herum, beobachtete die Umgebung, probierte zwecks der Unauffälligkeit mehrere Hosen in der Wechselkabine und hielt seine Zeit schließlich mit dem einfachsten aller Tricks für gekommen. Er stopfte die Lederjacke in einem unbeobachteten Moment zwischen mehrere Hosen und verdrückte sich in die Umkleidekabine. Dort prüfte er den Schnitt der Jacke kritisch im Spiegel und stellte mit großer Sehnsucht fest, dass sie ihn zu seinem besten Vorteil kleidete: Er musste sie einfach besitzen!
Marc atmete tief ein, stopfte sich den unteren Teil der Jacke in die Hose hinein, atmete mühevoll aus und zog dann in der bedrückenden Enge des Umziehkäfigs Pullover und den weiten Trenchcoat seines Vaters über das heißbegehrte Kleidungsstück an seinem Körper. Sofort begann Marc fürchterlich zu schwitzen. Ein Blick in den Spiegel verriet ihm das Ausmaß seiner Idee und noch einmal zweifelte er. Zwar war das Objekt seiner Begierde unter dem Mantel verborgen, aber Marcs Oberkörper ähnelte nun stark einem aufgeblasenen Schwimmreifen; seine wuchtige Schulterpartie erinnerte an düsterste Barbarenfilme.
Marc schob jedoch alle Bedenken beiseite, entschied sich zum Angriff, riss den Vorhang zur Seite und betrat den Verkaufsraum. Kleine, salzige Perlen sammelten sich auf seiner Stirn, doch er zwang sich zur Ruhe und versuchte kontrolliert dem Ausgang zuzustreben. Es gab nun kein zurück mehr.
„Nur nicht in Panik verfallen,“ dachte er, während Sekunden später sein unproportional aufgeblähter Körper einen Warentisch mit Geschirrangeboten streifte. Erschreckt blickten die Menschen auf, als mehrere Teller klirrend zu Boden gingen. Wie gelähmt sah Marc die unvermeidliche Verkäuferin nahen.
„Es tut mir ...leid,“ stammelte er schwitzend, während sie schimpfend zu seinen Füßen die Scherben auflas.
„Nun fass wenigstens mit an,“ beschwerte sich die Kaufhausangestellte, aber Marc konnte sich nicht bücken. Er wäre geplatzt, so sehr drückte die Lederjacke in seiner Hose.
„Ich hab es mit dem Rücken,“ flüsterte er mit hochrotem Kopf, während seine Schweißtropfen neben die Scherben plierten.
„In deinem Alter,“ duzte sie Marc böse und betrachtete ihn eingehender. Hilflos zuckte Marc nur mit den Schultern.
„Verschwinde,“ knurrte sie und Marc stolperte blitzschnell dem Ausgang entgegen. Ihm war, als seien sämtliche Augenpaare des Kaufhauses auf ihn gerichtet. Und so lauerte Marc insgeheim voller Panik auf den Griff an seinen ausufernden Mantel: “Kommen sie doch mal bitte mit!“
Er durchbrach die Ausgangspforte, betrat die Straße und wurde immer schneller. Der warme Hauch von Triumph, Gelingen und
Erfolg durchströmte ihn und beschwingt strebte Marc der nächsten öffentlichen Bedürfnisanstalt entgegen, um die ersehnte Jacke dort ihrer Bestimmung zu übergeben.
„ Hey! Hey, sie da,“ rief eine Stimme hinter Marc mit einem Mal. Er blickte sich um und registrierte erleichtert, wie der Mann hinter ihm eine blonde, offensichtliche Schönheit zu Marcs Rechten anrief. Leider hatte der Kaufhausdetektiv aber doch Marc gemeint und im eisernen Griff des kräftigeren Detektivs ließ sich Marc zurück ins Kaufhaus zerren.
Im Büro des Detektivs, wo Marc auf die Polizei und seine Mutter wartete, entschied er, sich ein für allemal vom plumpen Diebstahl loszusagen und allen Vorwürfen in Form von sozialistischer Selbstkritik den Saft zu entziehen. Sein Vater hatte ihn gewarnt: Er würde sich nie wieder erwischen lassen und der Schlüssel zum Erfolg, so ahnte er, waren Sorgfalt, Kreativität und Geschick. Er war einfach zu gierig und unüberlegt gewesen.
3
Pete war Marcs bester Freund. Sie verbrachten die Pausen in der Schule und ihre Freizeit miteinander, tranken billiges Dosenbier, gafften Mädchen hinterher, redeten stundenlang über Musik und tauschten Penthousemagazine. Pete behauptete zudem, politisch interessiert zu sein: Er fand nicht nur seine sozialdemokratischen Eltern Scheiße, sondern auch gleich die ganze spießige Gesellschaft. Der Sozialismus an sich, argumentierte Pete, sei eine bemerkenswert gute Idee mit völlig vernünftigen Zukunftsprognosen. Die Bundesrepublik war ihm nur ein diktaturenfreundlicher Sammelplatz von Altnazis, Kapitalisten und langweiligen Spießern.
Petes Protest gegen System und Regime bestand in erster Linie darin, sich im Hause seiner Eltern mit Joints zuzurauchen. Marc fand an diesem Protestgebahren schnell Gefallen, was die beiden Freunde noch inniger verband und ihnen zudem die Sympathie von zwei jungen Studentinnen einbrachte, die Pete bei einer Party kennengelernt hatte. Nadja rauchte und vögelte gleichermaßen gern und war mit Pete liiert. Sie sah nicht so dolle aus, lachte zu laut und an den falschen Stellen, aber ihre Figur war tadellos, fand Marc und beneidete Pete herzlich wenig um sein Los, zumal er sich in Nadjas Freundin Anna verguckt hatte.
Anna rauchte, um sich zu betäuben und Marc rauchte mit, um sich zu unterhalten. Die spröde und abweisend wirkende blonde Frau mit dem schön geschwungenen Mund reizte Marc; ihre desinteressierte Kühlheit schreckte ihn jedoch gleichzeitig ab, so dass er sich damit zufrieden gab, dass Anna in sich gekehrt ihre Einsamkeit mit ihm und den gemeinsamen Joints teilte. Pete und Nadja verzogen sich häufiger bereits in die Nebenräume, während Marc mit Anna einfach da saß, Joint um Joint baute und rauchte und um eine Unterhaltung focht. Anna wirkte stets unnahbar und unangreifbar, so sehr sich Marc auch um Witz, Charme und geistreiche Konversation bemühte.
Es war leichter, wenn sie zu viert waren, denn in der Gegenwart von Nadja wirkte Anna entspannter. Trotzdem war sich Marc sicher, dass Anna ihn mochte, und er gelobte Geduld, um diese scheue Schönheit zu wecken. Pete verstand das alles nicht.
„Warum hast du nicht wenigstens versucht mit ihr zu knutschen,“ fragte er, als Marc ihm seine heimliche Zuneigung gestand.
„Ich weiß nicht, ob sie mich ernst nimmt. Ich bin ja jünger. Und irgendwie wäre es auch nicht angemessen gewesen,“ behauptete Marc. „Es entwickelt sich noch.“
„Hättest du es versucht, wüsstest du was Sache ist,“ entgegnete Pete und so ließen die Freunde das Thema erst einmal ruhen. Weil alles gesagt war.
Ohne Anna wäre Marc der Kundgebung sicherlich ferngeblieben, doch als er hörte, dass Nadja und Pete nicht alleine zum Opernplatz zogen, war ihm die Teilnahme an der Protestveranstaltung selbstverständliche Pflicht. Dabei interessierten Marc die Studentenproteste herzlich wenig. Auch kannte er den zuständigen Kultusminister, der sein Kommen versprochen hatte, nicht einmal dem Namen nach. Ihm ging es darum, Anna zu beeindrucken und deswegen hatte er die Eier eingesteckt.
„Wir können keine Drachen mehr besiegen, um Prinzessinnen zu erobern, also werden wir anders glänzen,“ hatte Marc Pete erklärt und auch diesem zwei Eier zugesteckt.
Marc fand, dass die meisten Studenten eher harmlos bis verblödet wirkten. Es schien ihm, als liefen alle nur in dem Zug mit, weil sie irgendjemanden kannten, aber nicht, weil sie irgendetwas wollten. Trotzdem hatten sich zwei Mannschaftswagen mit vielleicht zwanzig Polizisten für den Demonstrationszug interessiert und standen nun vor den Abstellgittern am Platz der Kundgebung. Ein paar mit Funkgeräten ausgestattete Personenschützer in Zivil liefen mit geschäftiger Miene und staatstragendem Gehabe durch die Gegend.
Als der Kultusminister im Anschluss an die Studentenreden das Podium bestieg, kam doch noch einmal etwas wie Bewegung in die Menge. Mechanisch erhob sich ein Pfeifkonzert und es war schwer, sein eigenes Wort zu verstehen. Aus dem Geheul und Gelächter heraus flogen die ersten Eier von Marc und Pete recht präzise und klatschten den starr stehenden Sicherheitsbeauftragten vor die Füße. Wild schimpfte der Minister über die Unfähigkeit der Anwesenden zum politischen Diskurs. Die beiden nächsten Eier waren noch besser lanciert und vor dem Körper des Kultusministers entfalteten sich Regenschirme. Trotzdem zerplatzte ein Ei unter dem großen Jubel der Menge in einem ungeschützten Moment am Sakko des Politikers.
Marc und Pete freuten sich wie kleine Kinder, Nadja und Anna lachten übermütig und alles hätte gut sein können, wenn die beiden Freunde nicht die Einsatzmöglichkeiten der Polizei unterschätzt hätten. Ohnehin war die Kundgebung überschaubar gewesen und die Teilnehmer friedlich, so dass die beiden Polizisten in Kampfanzügen locker über die Absperrung hüpften und problemlos ihren Weg durch die Menge zu Marc fanden. Der lachte noch bis zu dem Moment, als einer von beiden ihn überwältigte und im Polizeigriff hinter die Absperrung führte. Pete und die Mädchen hatten das Geschehen besser beobachtet und waren Augenblicke zuvor blitzschnell in der Menge abgetaucht.
Marc blieb der einzige Märtyrer für eine Sache, die ihn nicht interessierte. Er hatte Spaß gesucht und wollte ein Mädchen beeindrucken. Nun saß er als einziger Gefangener im Bus zwischen acht scherzenden und gut gelaunten Kollegen der Bereitschaftspolizei in Erwartung neuen Ärgers. Der Diensthabende formulierte die Anzeige später auf „Landfriedensbruch in Tateinheit mit Beleidigung“, dann durfte Marc die Wache verlassen.
Es blieb Marcs letzter politischer Widerstand und er hoffte, dass wenigstens Anna ihn für seinen Mut und seine Tatkraft ein wenig bewunderte. Ansonsten erinnerte er sich auf dem Heimweg durch die dunklen Gassen einmal mehr an die Ratschläge seines Vaters. „Geh bei rot, wenn keiner kommt und lass dich nicht dabei erwischen,“ hatte der ihm geraten. Statt dessen hatte Marc nun bereits die zweite Anzeige am Hals.
„Nicht das Ei ist verkehrt gewesen. Das war für eine gute Sache, für Anna. Mein eigentliches Problem ist, dass ich mich erwischen lasse,“ befand Marc in jener Nacht und entschied, aufmerksam zu bleiben und nie wieder seine Gegner zu unterschätzen.
Pete verkaufte die Geschichte in der Schule so, als hätten die beiden Freunde den Staat in seinen Grundfesten erschüttert und wären die einzigen politischen Krieger der Oberstufe. Allerdings interessierte das quasi niemanden, denn die schriftlichen Abiturarbeiten standen vor der Tür und boten gewichtigeren Gesprächsstoff. Politische Ansichten waren unpopulär geworden.