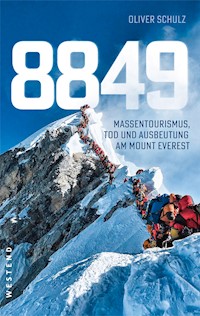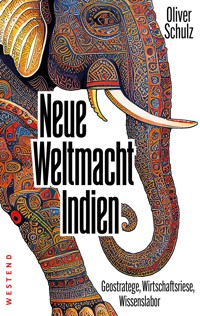
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Sprache: Deutsch
An Indien scheiden sich die Geister. Obwohl oder gerade weil kaum jemand im Westen dieses widersprüchliche Land versteht. Zwischen Slums und Prunk, zwischen Yoga und Hightech, zwischen Bollywoodkultur und Kastenwesen ist uns das Land, dessen Bedeutung für die Weltgemeinschaft immer größer wird, ein Rätsel geblieben. Oliver Schulz liefert einen tiefen Einblick in die verschiedenen Facetten der indischen Gesellschaft und Kultur und gibt uns einen Überblick über die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsperspektiven der neuen Supermacht, die immer deutlicher ihre Ansprüche auf eine Führungsrolle in der Welt erhebt. Wie tickt dieses Land wirklich? Was hält es zusammen? Wie verlässlich ist es als Partner? Und wie bedrohlich könnte sein Aufstieg für die Weltgemeinschaft werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ebook Edition
Inhalt
Titel
Vorwort
I Interne Entwicklungen
Ein eigenwilliges Land
Gandhi
Godhra
Modi
Größte Minderheit
Ewiger Aufstand
Heilige Ungleichheit
Die Dalits
Dr. Ambedkar
Der große Graben
Verklemmtes Patriarchat
Indien brutal
II Internationale Beziehungen
Westliche Verklärung
Der Architekt der Nation
Erzfeind Pakistan
Konkurrent China
Strategische Neuausrichtung
Globale Wirtschaftsmacht
Partner für den Westen?
Anmerkungen
Orientierungspunkge
Titel
Inhaltsverzeichnis
Oliver Schulz
Neue Weltmacht Indien
Geostratege, Wirtschaftsriese, Wissenslabor
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 9-783-98791-022-7
1. Auflage 2023
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2023
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Dreieich
Vorwort
Der Aufschrei verhallte schnell. Nachdem Russland Anfang 2022 den Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte, wurde in der UNO eine Resolution vorgelegt, in der die Mitglieder die »Aggression« gegen das osteuropäische Land »auf das Schärfste verurteilen« sollten. Russland stimmte dagegen. China und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich. Ebenso Indien. Kurz darauf besuchte eine Abordnung russischer Minister Neu-Delhi, um über die Lieferung von Öl zu verhandeln. Die USA warnten, wenn auch dezent: Es werde Konsequenzen für Indien haben, wenn die US-Sanktionen gegen Russland unterlaufen würden. Doch Neu-Delhi signalisierte, dass es sich keinem Druck beugen werde – und die Kritik aus dem Westen verstummte bald.
Denn Indien ist militärisch abhängig von Moskau. U-Boote, Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Boden-Luft-Raketen: 70 Prozent der Waffen in dem südasiatischen Land stammen aus russischer Produktion. So hat der indische Premier Narendra Modi später zwar durchaus kritische Worte gegenüber Putins Ukraine-Krieg verloren. Aber faktisch versucht Neu-Delhi weiter, es beiden Seiten recht zu machen. Indien, gegründet als blockfreies Land, ursprünglich von sozialistischen Ideen geprägt und wirtschaftlich erst seit den Neunzigern für den Welthandel geöffnet, will einerseits den alten Verbündeten Russland nicht verärgern. Andererseits will es aber auch die Beziehungen zum Westen weiter ausbauen.
Und die sind im 21. Jahrhundert immer intensiver geworden, angetrieben von gegenseitigen Interessen. So hat sich Washington seit dem Ende des Afghanistan-Einsatzes fast vollständig von Indiens Erzfeind Pakistan gelöst. Stattdessen setzen die USA jetzt auf Neu-Delhi als strategischen Partner in der Region. Die Beziehungen wurden zuletzt auch durch die erklärte Männerfreundschaft zwischen Donald Trump und Indiens hindunationalistischem Premier Modi vertieft.
Zudem rüstet Neu-Delhi seine Marine auf, um sich als Seemacht in der asiatischen Region zu behaupten. Dasselbe gilt für seine Luftwaffe. Ziel ist es, ein Gegengewicht zu China zu bilden. Als Bollwerk gegen Chinas Machtinteressen in der Region wurde auch die Quad-Gruppe wiederbelebt, zu der neben Indien, den USA und Japan auch Australien gehört.
Denn während Russland für die indische Regierung ein wichtiger Partner bleibt – wird die Volksrepublik China mittlerweile als direkte Bedrohung wahrgenommen. Nicht nur durch Beijings wirtschaftliches Engagement in der Region fühlt sich Indien zusehends bedrängt. Vor allem durch das Projekt Neue Seidenstraße, zu dem milliardenschwere Infrastrukturinvestitionen in Sri Lanka, Pakistan und Myanmar gehören. Zudem unterstützt die Volksrepublik seit Jahrzehnten mit ihrer direkten Grenze zu Pakistan Indiens verhassten Nachbarn im Westen. Und damit indirekt auch die Unruhe-Region Kaschmir, die seit der Unabhängigkeit zwischen Pakistan und Indien umstritten ist. Im Himalaja ist es nach jahrzehntelangem Frieden in den vergangenen Jahren wieder zu direkten Zusammenstößen zwischen Indien und China gekommen. Seither hat sich der Ton zwischen Neu-Delhi und Beijing weiter verschärft. Indische Hardliner riefen zum Krieg gegen das Nachbarland auf.
Auf der internationalen Bühne hat sich das südasiatische Land ohnehin längst vom einstigen Dritte-Welt-Staat zum ernst zu nehmenden Partner entwickelt. Indien, Atommacht seit vier Jahrzehnten, ist G-20-Mitglied und gehört zu den BRICS-Staaten. Schon lange fordert Neu-Delhi auch einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat.
Doch jetzt sortiert sich die Weltordnung neu. Immer deutlicher wird der Konflikt zwischen Beijing und dem Westen. China gilt als der eigentliche Gewinner des russischen Ukraine-Krieges. Der Westen sucht neue Partner. Deshalb muss sich heute nicht Indien zwischen dem Westen und dem Osten entscheiden. Sondern der Westen für oder gegen Indien.
Aber wie tickt dieses Land? Wie verlässlich ist es als Partner? Wie stabil ist es? Wie bedrohlich könnte sein Aufstieg für die Weltgemeinschaft werden? Wie gefährlich sind die inneren Konflikte zwischen Hindufanatikern und der zweitgrößten muslimischen Bevölkerung weltweit? Wie brisant ist der extreme Gegensatz zwischen Arm und Reich? Wie robust ist die indische Demokratie?
IInterne Entwicklungen
Die Lebensgeschichte eines armen Mannes ist auf seinen Körper geschrieben, mit einem spitzen Stift.
Aravind Adiga, Der Weiße Tiger
Ein eigenwilliges Land
Das erste Mal war ich sozusagen zufällig in Indien. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Ich war auf dem Weg in den tibetischen Himalaja, Delhi lag einfach auf der Strecke, es war eine Zwischenstation. Und Indien interessierte mich auch nur mittelmäßig, bevor ich dort landete. Aber was ich in den ersten paar Tagen in der Hauptstadt erlebte, gefiel mir. Überraschenderweise.
In den späten Achtzigern war die Hauptstadt weniger eine Metropole als ein wucherndes Dorf, ein wildes Konglomerat aus augenscheinlich weitgehend genehmigungsfrei errichteten Gebäuden, die selten mehr als ein paar Stockwerke hoch waren. Die Straßen und Gassen eng und voll mit Menschenmassen. Männer mit Handkarren und Fahrrädern, die Milch, Eisblöcke oder Kisten voller Hühner transportierten. Mobile Händler, die schreiend und singend Süßigkeiten, Snacks oder Spielsachen anpriesen. Blau uniformierte Kinder in vergitterten Schulkarren, die von Fahrern per Pedal angetrieben wurden. Umherirrende Kühe und kläffende Straßenhunde, Tempel und Moscheen. Billige Hotels mit Vier-Quadratmeter-Zimmern und Deckenventilator. Die größeren Straßen waren verstopft von gewichtigen Ambassador-Limousinen, von Mopeds, auf denen mindestens zwei Personen saßen, hupenden Lkw und Traktoren, beladen mit Baumaterial, Zuckerrohr oder Ähnlichem.
Man musste damals kaum Angst haben in dieser Stadt, wenn man wenigstens ein bisschen Reise-Erfahrung mitbrachte, nicht einmal im Bahnhofsviertel, wo ich wie alle Backpacker abstieg. Sicher, Taschendiebe gab es hier und da, Trickbetrüger angeblich auch an den offensichtlichsten Touristenattraktionen wie dem Roten Fort, die einen erst sedierten und dann beklauten. Aber mehr nicht. Natürlich, der Unabhängigkeitskampf der Sikhs war zu der Zeit noch ein großes Thema, aber diese Glaubensgemeinschaft war auch nur eine relativ kleine Minderheit, der Zwist zerriss nicht die gesamte indische Gesellschaft. Selbst wenn es deshalb Schilder in den Stadtbussen gab, auf denen stand: »Schauen Sie unter Ihren Sitz, es könnte eine Bombe darunter liegen.« Auf Englisch und auf Hindi. Niemand schaute unter seinen Sitz, wenn er in einen Bus stieg, auch wir westlichen Reisenden nicht.
Es herrschte noch eine friedliche Stimmung im Land, ein weitgehend entspanntes Miteinander von Menschen aller Religionen. Muslime, Hindus, Sikhs betrieben kleine Geschäfte nebeneinander, in denen sie Kleidung, Haushaltswaren und Dienstleistungen aller Art offerierten. Sie führten Dhabas, Restaurants, in denen einfaches Essen serviert wurde, meist Linsen und Reis. Sie fuhren einen mit der Fahrradrikscha oder dem Mopedtaxi durch die Stadt und hatten einen Spruch aus dem Koran, ein Bild vom Sikh-Guru Nanak oder vom tanzenden Krishna mit seiner Flöte vorne im Miniatur-Armaturenbrett des knatternden Gefährts platziert. Es schien keinen Unterschied zu machen, zu welchem Gott sie beteten.
Vieles war mir natürlich völlig fremd. Manches aber auch weniger. Das bisschen Bürokratie, mit dem ich im Land bei meinen bald folgenden Reisen in Berührung kam, etwa, wenn es um Visaverlängerungen oder Tickets bei der damals noch existierenden staatlichen Indian Airlines ging, erinnerte mich an Osteuropa. Überlange Mittagspausen, selbstgefällige Beamte, aber immerhin, es gab Regeln. Sie wurden eben nur zugunsten der Staatsbediensteten strapaziert.
Schon damals gab es auch eine wachsende Mittelschicht. Es gab Familienväter, die in der Autoindustrie arbeiteten oder im Bankwesen, wie bei uns. Die morgens gegelt und gekämmt brav mit dem Essen im Henkelmann zur Arbeit radelten. Es gab selbstbewusste, gebildete Mütter. Es gab rechtschaffene Bürger, die auf Kriminalität und Korruption schimpften.
Und auch die Verständigung war leicht: Viele Menschen sprachen Englisch, wenn auch mit einem drolligen Akzent. Englisch war Amtssprache, eine Vermittlerin zwischen den vielen indischen Idiomen aus völlig verschiedenen Sprachfamilien. Viel sprachen es mit Begeisterung und Stolz, es war ein Zeichen ihrer Aufgeschlossenheit gegenüber dem Westen. Britisches Erbe im Orient, so fern war Indien – und doch so nah.
Das politische Klima war liberal. Ob mit dem Barbier oder dem Milchmann, ob über die Parlamentswahlen in Delhi oder die Mudschahedin im nahen Afghanistan, man konnte mit allen lautstark und offen über jedes Thema diskutieren. Indien war damals in vielerlei Hinsicht tatsächlich das, womit es sich bis heute brüstet: die größte Demokratie der Welt. Ständig schoben sich auch irgendwelche Demonstrationen und Kundgebungen von politischen Parteien oder Verbänden mit ohrenbetäubendem Lärm durch die Hauptstadt. Es gab Gewerkschaften für alles Mögliche, selbst für die Ohrreiniger angeblich, die auf dem zentralen Glanzstück Connaught Circus in Neu-Delhi Massagen und Reinigungen des Hörorgans vornehmlich für Reisende anboten. Die Kioske verkauften zahllose, auch englischsprachige Zeitungen mit völlig konträren Meinungen. Manche waren ziemlich radikal.
Denn Indien hatte, auch das lernte ich sehr schnell, ein besonderes politisches Selbstverständnis. So gab es, besonders im Süden, zahlreiche Menschen, die sich zum Beispiel Lenin oder Chruschtschow nannten. Ein bekannter Politiker in Tamil Nadu hieß gar Stalin. Denn das Land war nicht nur blockfrei, auch war die Sowjetunion ein wichtiger Partner. Der Zerfall des Ostblocks wurde hier deshalb ganz anders aufgenommen als in Westeuropa. Mit Staunen las ich an einem schwülen Monsunmorgen in Delhi über Käsesandwiches und Milchtee, wie die wichtigsten Zeitungen des Landes den Augustputsch, bei dem KPdSU-Funktionäre in Moskau den Reformer Gorbatschow stürzen wollten, als legitimen Akt zur Herstellung der alten Ordnung feierten. Aber so offen sozialistisches Gedankengut in den Medien zirkulierte: Deutlich dezenter agierten damals die Hindu-Hardliner, die Nationalisten, die alle anderen Religionsgemeinschaften als fremd betrachteten. Noch.
Was es auch gab, war eine immerhin teilweise funktionierende Sozialpolitik. Augenfällig war etwa, dass in den Zügen Abteile nur den Frauen vorbehalten waren. Eine andere Bestimmung reservierte den Kastenlosen und den Adivasis – also den Angehörigen der ursprünglichen Bevölkerung – einen gewissen Anteil an Jobs im öffentlichen Dienst. Ich hörte allerdings auch bald, dass staatliche Jobs nur durch Korruption zu bekommen seien: Man kaufte sie sich.
Durchgehend schön oder etwa sauber und ruhig war es in diesem Land freilich nicht, dafür ist es ja berüchtigt. Das Elend war immer präsent. Überall zogen einem Bettler am Hosenbein, um Geld zu schnorren. Viele Verstümmelte waren darunter, wie man sie in Europa erst seit ein, zwei Jahrzehnten sieht. Ich sah die Kastenlosen, dreckverschmierte Gestalten, die fast nackt in der Hauptstadt herumliefen und Müll sammelten, Jutesäcke über der Schulter. Die Armen, die tagsüber auf staubigen Verkehrsinseln dösten. Die nachts in ganzen Familien und in langen Reihen auf der Straße schliefen oder unter irgendwelchen Pappkartons. Die über Feuern aus Plastikmüll hockten oder unter den Arkaden des Connaught Circus bei Einbruch der Dunkelheit Heroin rauchten. Und ich roch die Pisse und die Scheiße in allen halbwegs uneinsichtigen Ecken, an allen unbebauten Straßenrändern.
Aber ich sah auch, dass Indien einen Weg aus diesem Elend suchte: In den Neunzigern rüstete sich das Land für die Zukunft. Die ökonomische Liberalisierung wurde ausgerufen, die Wirtschaft sollte ins Rollen gebracht werden. Ausgerechnet die Nation, aus der sich Coca-Cola 1977 zurückgezogen hatte, weil ihre Regierung zur Bedingung gemacht hatte, dass der Konzern sein Rezept herausgeben sollte, wollte nun zum Global Player werden. Bald griff eine Aufbruchstimmung um sich. Viele Menschen träumten von Wohlstand wie im Westen. Auch weil ich in diese Entwicklung Hoffnung setzte, kam ich immer wieder in das Land zurück.
Und das ganz entspannt. Man sagt ja, dass Indien polarisiert, aber bei mir war das anders. Ich habe es nie abgrundtief gehasst, und ich habe es nie restlos geliebt. Ich war von Beginn an nicht von allem in Indien begeistert, aber ich bin heute an dem meisten interessiert. Vielleicht habe ich Indien gerade deshalb ein bisschen genauer kennengelernt.
So verbrachte ich Monate in Varanasi, einer der ältesten Städte der Welt, die sich auch heute noch so anfühlt, mit ihren engen Gassen und dem verseuchten, aber heiligen Ganges, der träge dahinfließt. In dieser Stadt werden die Toten täglich zu Hunderten an den Ufern verbrannt, ständig hängt ein süßlicher Geruch in der Luft, ständig prozessieren Gemeinschaften zum Ufer hinab, um die Aufgebahrten zu den Scheiterhaufen zu begleiten. Es gibt Herbergen, eigens um zu sterben, in denen gealterte Hindus unterkommen, um sich auf die Reise ins Jenseits vorzubereiten. Mukti Bhavan heißen sie, Häuser der Erlösung. So lange lauschte ich in der heiligen Stadt der klassischen indischen Musik, die in kleinen Konzerthäusern gespielt wurde, bis sie mir trotz ihrer fremden Harmonien vertraut war. Von einem Professor an der Banaras Hindu University ließ ich mir die ersten Lektionen Hindi beibringen. Ich lernte aber auch, dass es Nicht-Gläubigen verboten ist, die hinduistischen Heiligtümer Varanasis von innen zu sehen. Was für eine exklusive Religion!
Zurück in Deutschland, begann ich nun, mich auch mit Indiens Vergangenheit zu beschäftigen. Ich studierte die alte Sprache Sanskrit, ließ mir von Altindologen die Zusammenhänge zwischen der Kultur der Hindus und der zentralasiatischer Völker erläutern. Auch Urdu lernte ich an der Uni Hamburg, die muslimische Schwester des Hindi, stärker noch geprägt von persischen und arabischen Elementen, einschließlich der arabischen Buchstaben. Davon habe ich heute das meiste vergessen.
Was ich nie vergessen kann, ist aber, wie nah sich diese beiden Sprachen sind. Und vor allem die Kulturen, die dahinterstehen. Wie vergleichweise friedlich dieses Land in den Achtzigern und Neunzigern war. Und welcher Geist mit dem Erstarken einer Strömung aus der Flasche gelassen wurde, die es bis heute dominiert: mit dem Hindunationalismus.
Mit Sorge beobachteten meine politisch gemäßigten Professoren und ich an der Hamburger Universität schon die indischen Atomwaffenversuche 1998 unter dem Premier Atal Bihari Vajpayee von der Bharatiya Janata Party (BJP). Mit einem fast entsetzten Kopfschütteln kommentierte Nayantara Sahgal, eine Cousine von Indira Gandhi, als ich sie zehn Jahre später in Nordindien besuchte, den unaufhörlichen Aufstieg der Hindunationalisten, der folgte. Mit Angst und Wut beobachteten viele Inder im Land wie in der Diaspora, wie sich der Hardliner Modi schließlich zum Helden immer größerer hinduistischer Völkerschichten erklären konnte. Für mich machte der Hindunationalismus vieles befremdlicher. Denn einiges, was ich in Indien als selbstverständlich empfunden hatte, gab es plötzlich nicht mehr: Zum Beispiel die Offenheit, mit der Reisende empfangen wurden, die Toleranz zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
Gleichzeitig trug die in den Neunzigern begonnene ökonomische Liberalisierung Früchte. Die Wirtschaft kam in Schwung. In Sachen IT und Internetkonnektivität näherte sich das Land europäischen Standards an, nicht nur in den dafür bekannten Metropolen Bangalore und Hyderabad überholte es sie bald. Auch das viel geschmähte Straßennetz, das als einer der Flaschenhälse für Indiens Entwicklung verschrien war, wurde endlich ausgebaut. Immer mehr neue Autos rasten nun über immer breitere Autobahnen, die den gigantischen Subkontinent bald von Nord nach Süd und Ost nach West durchzogen. Eigene Pkw wurden produziert, die den Indern den Zugang zur Automobilität erleichtern sollten, wenn auch teils belächelt, wie der Tata Nano von 2008, zu haben für schlappe 1 500 Euro. Aber egal: Was da lief, erschien mir so, wie ich mir das deutsche Wirtschaftswunder der Fünfziger vorgestellt hatte. Und ich gönnte es den Menschen.
Wenn es auch zunehmend schwer wurde, professionell daran teilzunehmen. Jahrelang hatte ich alle meine Journalistenjobs in Indien einfach mit einem Touristenvisum erledigt. Ich hatte in Kaschmir Polizeichefs und Dorfälteste interviewt, in Zentralindien mit Maoisten geplaudert, in Südindien Gefängnisse von innen gesehen. Alles kein Problem. Gern öffnete man mir die Türen und präsentierte sein Land. Gern sprach man auch Englisch mit dem westlichen Reporter. Doch seit den 2010er-Jahren begannen schon an den Grenzen plötzlich die Fragen. »Sie sind Autor? Was schreiben Sie denn so, Fiktion oder Sachbücher?«, wollten die forschen Beamten am Flughafen Delhi wissen. »Arbeiten Sie auch für Zeitungen? Für politische Blätter?« Bei meinen letzten Projekten musste ich bereits bei der Anfrage nach einem Visum versichern, dass ich im Land nicht journalistisch arbeiten werde. Man hatte offensichtlich über mich recherchiert.
Und wenn ich dann doch eingereist war, sah ich, wie die Gemeinschaften sich immer mehr einschlossen. Echokammern eines fragwürdigen ethnisch reinen Glücks. Als ich in Delhi für eine Reportage über eine Hindugemeinschaft recherchierte, aus der sich auf der Basis traditioneller Kampfsportarten zahllose junge Männer zu muskelbepackten Türstehern ausbilden ließen, gelang das nur, weil ich noch einigermaßen Hindi sprach. Nicht einer der Männer beherrschte – und das hatte ich zuvor selten erlebt – auch nur ein Wort Englisch. Gleichzeitig waren sie auch alles andere als gebildet. Dafür residierten einige von ihnen aber in fetten Villen im feinen Süd-Delhi, fuhren schwere Karossen. Und waren durchweg Hindunationalisten.
Das gesamte gesellschaftliche Klima hat sich geändert. Wollte in den Neunzigern in Indien noch jeder über Politik reden – so herrscht heute schlicht die Angst. Wer den Kurs der Regierung nicht schätzt, geht vielleicht noch auf die Straße und protestiert mit Gleichgesinnten. Aber einzeln äußern sich Normalbürger lieber nicht kritisch gegenüber den Hindunationalisten. »Kein Statement zu Modi«, habe ich in den vergangenen Jahren oft von Interviewpartnern gehört. Das war einmal anders in der größten Demokratie der Welt. Der Hindunationalismus hat die Gesellschaft umgeformt. Ein Riss geht durch die Mitte. Und darüber liegt ein Deckel des Schweigens, der nur manchmal in Hassreden aufbricht.
Oder eben im Privaten. Denn das alte, liberale, multiethnische Indien lebt weiter. In der jungen Generation. Ich höre es, wenn mir mein hinduistisches Gegenüber erzählt, dass es alle indischen Kulturen liebe. Besonders die muslimische. Wenn mich Leute aus dem südindischen Kerala fragen, wo denn das Problem sei, wenn Menschen aus verschiedenen Religionen oder Kasten einander heiraten. Für sie sei das schon immer ganz normal. Ich sehe es, wenn junge Inder jeden Tag meditieren oder zu Allah beten – und genau sie es sind, die am vehementesten für ein geeintes Indien eintreten.
Das ist schon speziell. Aber es überrascht mich nicht mehr wirklich. Denn Indien ist eigenwillig. Und genau dafür liebe ich dieses Land.
Gandhi
Die Attacke war abzusehen. Seit er nach Delhi zurückgekehrt war, schallten Rufe durch die Hauptstadt: Tötet Gandhi! Schon am 20. Januar 1948 hatten Hindufanatiker wenige Meter von ihm entfernt eine Bombe gezündet, zum Glück sprengte sie nur eine Mauer. »Wenn ich durch die Kugel eines Wahnsinnigen sterben soll, muss ich dies lächelnd tun«, kommentierte der Mahatma. »Gott muss in meinem Herzen und auf meinen Lippen sein.«
Er war ein Fremder im eigenen Land geworden. Genauer gesagt: in jenem Land, in das er nach Jahren in England und Südafrika zurückgekehrt war, um ihm den Frieden zu bringen. Den Pazifismus, der eine zutiefst indische Tugend war. Das hatte der Mann jedenfalls lange gedacht, der wie kein anderer für den indischen Unabhängigkeitskampf steht. Der das Land in der internationalen Wahrnehmung lange geradezu verkörpert hat.
Doch nun war die Stimmung gekippt. Die Zeiten hatten sich geändert seit der Unabhängigkeit von der britischen Krone vor einem halben Jahr: Die Massaker nach der Teilung des Landes in Pakistan und Indien, die Flüchtlingskrise. Züge aus dem Westen brachten die Leichen von Hindus und Sikhs in die Hauptstadt, Züge voller getöteter Muslime fuhren in die Gegenrichtung ab. Aus Pakistan geflüchtete Hindus lynchten die indischen Muslime als Rache für die erlittene Gewalt. Die Unruhen in Delhi wurden immer blutiger. Die Metropole, die Gandhi immer als fröhlich und bunt erlebt hatte, hatte sich in eine Stadt des Todes verwandelt.
Doch Gandhi, mittlerweile 78 Jahre alt, bleibt bei seiner vertrauten Routine. Auch am 30. Januar. Um 3.30 Uhr erhebt er sich von seinem einfachen Holzbett auf der Terrasse des Gästehauses im Zentrum Neu-Delhis. Es ist stockdunkel und bitterkalt. Gegen seinen Willen hat Innenminister Patel angeordnet, dass ein Kommissar und vier einfache Beamte vor dem Anwesen, das dem Industriellen Ghanshyam Das Birla gehört, Wache steht. Weitere 30 Polizisten in Uniform und Zivil kontrollieren die Umgebung. Er putzt sich die Zähne mit dem Zweig eines Niembaums. Er spricht seine Gebete: Rezitationen aus den heiligen Büchern der Hindus, aus dem Islam, aus allen Weltreligionen.
Dann erst tritt er, wie üblich gestützt auf seine beiden Nichten Manu und Abha, in den inneren Bereich des Hauses. Manu bedeckt die knochigen Beine des alten Mannes im Lendenschurz mit einer warmen Decke. Gandhi korrigiert den in der Nacht geschriebenen Entwurf für die neuen Statuten der Kongress-Partei, er reicht ihn seinem Sekretär Pyarelal zum Gegenlesen. Man bringt ihm ein Glas heißes Wasser mit Honig und Limone. Doch die mit Nelkenpulver versetzten Rohrzucker-Pastillen gegen seinen hartnäckigen Husten sind ausgegangen. Manu bietet ihm Penicillin an. Gandhi lehnt ab: Wie könne sie ihm so etwas vorschlagen, da er an Gott und das Gebet glaube?
Gegen sieben spricht er mit Rajen Nehru aus der Familie des Ministerpräsidenten, die eine Reise in die USA antreten will. »Als Repräsentantin einer armen Nation solltest du dort ein einfaches und sparsames Leben führen«, empfiehlt er ihr. Nach einem Bad massiert ihn sein langjähriger Mitstreiter Brij Krishna. Auf dem Tisch liegend studiert Gandhi die Tagespresse. Danach wiegt Manu ihn: 49,5 Kilogramm bringt er auf die Waage.
Er hat fast eineinhalb Pfund zugenommen, seit er vor elf Tagen sein Fasten beendete, begonnen am 13. Januar aus Protest gegen die Entscheidung der Regierung, 550 Millionen Rupien, die Pakistan zugesagt waren, zurückzubehalten. Es würde die Zwietracht zwischen den beiden Ländern weiter schüren, da war er sicher. Die Regierung hatte schließlich nachgegeben. Um 9.30 Uhr nimmt der Mahatma das erste asketische Mahl des Tages ein: gekochtes Gemüse, ein Glas Ziegenmilch, vier Tomaten, vier Orangen, Karottensaft und ein Chutney aus Ingwer, sauren Limetten und Aloe.
Keines der Themen, das er mit seinen Mitarbeitern am Vormittag diskutiert, ist erfreulich: Extremisten fordern die Ermordung von Politikern der Kongress-Partei. In Madras, im Süden des Landes, droht eine verheerende Reis-Knappheit. Der indische Kommissar, der für die südpakistanische Provinz Sindh zuständig war, wird vorgelassen. Er schildert die Not der dort verbliebenen Hindus.
Gegen Mittag interviewt ihn die berühmte Life-Journalistin Margaret Bourke-White: »Sie haben immer gesagt, dass Sie gerne 125 Jahre leben würden. Was gibt Ihnen diese Hoffnung?« Gandhi erwidert, dass er daran nicht mehr glaube: »Wegen der schrecklichen Ereignisse in der Welt. Ich möchte nicht in Dunkelheit leben.«
Nach dem Nachmittagsschlaf knabbert Gandhi ein wenig rohe Karotte und trinkt ein kleines Glas Zitronensaft. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Brij Krishna liest ihm ein Statement von Tara Singh vor: Der Wortführer der Sikhs fordert den Mahatma auf, sich nach Hindutradition in seinem letzten Lebensabschnitt in den Himalaja zurückzuziehen. Flüchtlinge bitten um Audienz, Blinde, Obdachlose. Er liest die Untersuchungsergebnisse der Zusammenstöße zwischen Hindus und Muslimen in Allahabad, dem heutigen Prayagraj. Wie ist diese Gewalt noch zu zähmen? Indien liegt in Trümmern.
Am späten Nachmittag spricht Gandhi im rückwärtigen Teil des Birla-Anwesens mit Innenminister Patel. Er bittet ihn, im Amt zu bleiben. Die Lage im Land droht nun auch die Kongress-Partei zu zerreißen. Zumal selbst der internationalen Presse die Verwerfungen zwischen Patel und Ministerpräsident Nehru nicht entgangen sind. Als zwei politische Führer aus Gujarat um eine Audienz bitten, trägt er Manu auf: »Sag ihnen, ich spreche mit ihnen. Aber erst nach dem Nachmittagsgebet. Wenn ich dann noch lebe.«
Doch das wird er nicht. Bereits am Vorabend sind zwei junge Männer in Delhi eingetroffen: Nathuram Godse und Narayan Apte haben in der ein paar Hundert Kilometer südlich gelegenen Stadt Gwalior eine Pistole gekauft. Eine Neun-Millimeter-Beretta, sieben Schuss, 1934 in Italien gefertigt. 300 Rupien haben sie dafür gezahlt. Vermittelt hat den Deal ein Hindufanatiker – wie sie selbst es auch sind. Und deren Anzahl wächst mit jedem Tag.
Der 39-jährige Godse ist in einer Brahmanenfamilie im südindischen Maharashtra aufgewachsen. In den ersten acht Lebensjahren wurde er als Mädchen erzogen, weil die Eltern nach dem frühen Tod seiner drei Brüder fürchteten, die Götter hätten alle männlichen Nachfahren verflucht. Selbst einen Ring in der Nase hat er getragen, der Name Nathuram bedeutet: der Gott mit dem Nasenring. Nach der Grundschule schickten seine Eltern ihn an eine englischsprachige Highschool zu einer Tante in die Stadt Pune. Doch er brach vor dem Abschluss ab, um sich dem 1915 gegründeten Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha (ABHM, Gesamtindische Hindu-Großversammlung) und dem 1925 gegründeten, deutlich straffer strukturierten Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS, der Nationalen Freiwilligenorganisation) anzuschließen. Jenen radikalen Organisationen, die ein rein hinduistisches Indien fordern.
Denn wie so viele andere Hindus kann der heranwachsende Godse immer weniger verstehen, was Gandhi mit seinem Land macht. Der Salzmarsch gegen die britische Herrschaft, ziviler Ungehorsam als politische Methode. Das waren rückständige Methoden. Wie konnte dieser Mann behaupten, dass Indien eins sei, über alle Religionen hinweg? Haben denn nicht die arabischen Armeen das Land seit dem siebten Jahrhundert von Westen überrannt und die Städte abgefackelt? Haben sie denn nicht die Tempel geschliffen und die Hindus gewaltsam zum Islam konvertiert? Für Godse und seine radikalen Mitstreiter gehört Indien allein ihnen: den Hindus. Muslime haben sich zu unterwerfen. Oder das Land zu verlassen. Stattdessen fastete dieser halbnackte Asket, der eigentlich ein Rechtsanwalt aus Pretoria war – nur für die Muslime?
Und so singen Godse und seine Genossen vom RSS in einer braunen Uniform, die an die Nazis erinnert, morgens beim Hissen der gelben Fahne ihre Hymne:
»Oh, geliebtes Vaterland, ich verbeuge mich ewig vor dir.
Oh, Land der Hindus, du hast mich gütlich großgezogen.
Oh, heiliges, geweihtes Land,
möge dieser mein Körper dir gewidmet sein, ich verneige mich immer wieder vor dir!«
Und dann strecken sie die Rechte zum Sonnengruß.
Der hinduistische Nationalismus ist in den Jahrzehnten zuvor als Ideologie der oberen Kasten in Westindien entstanden. Am prägnantesten formuliert wurde die Idee, auch Hindutvagenannt, vom revolutionären Nationalisten Vinayak Damodar Savarkar in den 1920er-Jahren. Er stützte seine Konzepte unter anderem auf den britischen Evolutionssoziologen Herbert Spencer, den deutschen Philosophen Friedrich Schlegel, den französische Rassetheoretiker Arthur Comte de Gobineau und den italienischen Nationalisten Giuseppe Mazzini.
Hindutva ist eine südasiatische Spielart des völkischen Nationalismus. Dabei ist sein Verhältnis zu traditionellen hinduistischen Weltanschauungen wie auch zum Westen vielschichtig. Einerseits widersetzte sich die Ideologie dem britischen Kolonialismus – andererseits eifert sie dem Westen nach und befürwortet eine rasche Modernisierung des Landes. Das Konzeptschrieb den vor Jahrtausenden aus dem Nordwesten eingewanderten indoarischen Völkern wie auch den bereits dort lebenden Ethnien zu, gemeinsam eine Nation zu bilden. Und die sei hinduistisch. Gemeint sind damit auch die in Indien entstandenen Religionsgemeinschaften der Jainas, Buddhisten und Sikhs. Muslime und Christen bleiben dagegen ausgeschlossen.
Hinduismus definierte Savarkar anhand von Territorium, Ethnie, Kultur und affektiver Bindung an das Land. Er schreibt:1 »Die erste wichtige und unabdingbare Voraussetzung für einen Hindu ist, dass er Indien als Vaterland und als Mutterland, also als das Land seiner Ahnen und Vorväter ansieht. […] Zweitens ist für Hindutva essenziell, dass ein Hindu ein Abkömmling von Hindu-Eltern ist und beanspruchen kann, dass das Blut der alten Inder und des Volkes, das aus ihnen entstand, in seinen Adern fließt. […] Das System und die Gruppe von Religionen, die wir Hindu-Dharma nennen, ist genauso wahrhaftig eine Ausgeburt dieses Bodens wie die Männer, deren Gedanken dies entsprang, oder die die Wahrheit vor ihnen enthüllt ›sahen‹. […] Demnach ist für jeden Hindu dieses Bharata bhumi(Mutter Indien) dieses Sindhusthanzugleich ein Pitribhu und ein Punyabhu – ein Vaterland und ein Heiliges Land.«
Angehörige nicht-hinduistischer Religionen sind laut Sarvarkar als »Gäste« anzusehen, solange sie den Nicht-Hindureligionen anhängen: »Dies ist der Grund, warum einige unserer mohammedanischen und christlichen Landsleute, die ursprünglich mit Gewalt zu einer nicht hinduistischen Religion bekehrt wurden und danach zusammen mit den Hindus ein gemeinsames Vaterland und einen großen Teil an gemeinsamer Kultur, Sprache, Gesetzen, Brauchtum, Folklore und Geschichte geteilt haben, nicht als Hindus anerkannt werden können. Denn für sie ist Hindustan das Vaterland, wie auch für jeden Hindu, nicht aber auch gleichzeitig das Heilige Land. Ihr Heiliges Land liegt fernab, in Arabien oder Palästina. Ihre Mythologie und Gottesmänner, Ideen und Helden sind nicht Kinder dieses Bodens.«2
Für die Anhänger dieser Theorie ist Gandhi ein gefährlicher Widersacher. Obwohl er sich für einen orthodoxen Hindu hält, spricht er sich klar gegen den Hindunationalismus aus. Nicht nur, weil er für eine Verständigung zwischen Hindus und Muslimen eintritt – sondern auch, weil er überzeugter Pazifist ist. Gandhi wirft den Hindunationalisten vor, die koloniale Unterjochung zu instrumentalisieren, um Gewalt zu legitimieren. Zudem lehnt der Mahatma – anders als die Hindunationalisten – die westliche Moderne ab. Er verachtet Materialismus und kapitalistisches Gewinnstreben.
Die hindu-muslimische Einheit ist Gandhis größtes gesellschaftspolitisches und kulturelles Anliegen. »Ich glaube fest daran, dass alle großen Religionen der Welt Wahrheit enthalten. Es wird keinen dauerhaften Frieden auf der Welt geben, solange wir nicht lernen, nicht nur anderen Glauben zu tolerieren, sondern als unseren eigenen zu respektieren«, schreibt er.3 Schon in seiner Kindheit im westindischen Gujarat hat er den mütterlichen Pranami-Glauben als eine volkstümliche Mischung von Hinduismus und Islam erlebt: Der Hindupriester las sowohl aus dem Koran als auch aus der Bhagavad Gita. Später setzte er sich intensiv mit dem Koran auseinander, er bewunderte Mohammed und glaubte an das Verbindende beider Religionen. Doch die Konflikte zwischen Hindus und Muslimen bei der Teilung haben Gandhis Träume brutal platzen lassen.