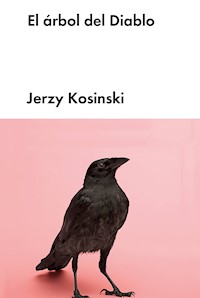7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser düstere Roman hat Millionen Leser auf der ganzen Welt erschüttert. Irgendwo im Osten Europas, während der Zweite Weltkrieg tobt: Um ihn vor den Nazis zu schützen, wird ein kleiner jüdischer Junge zu einer alten Frau aufs Land gegeben. Kurz darauf stirbt sie und der Junge bleibt allein zurück. Als er durch die zerfetzte Welt irrt, erlebt er die Gräuel des Krieges – aber auch die Perversion und Brutalität der Soldaten und der abergläubischen Landbevölkerung. Der Junge verstummt und hat sich, als der Krieg endet, für immer verändert. Der Weltbestseller in neuer Übersetzung von Andreas Decker. Kosinski schildert das Triebhafte und Abgründige im Menschen, aber auch die tiefe Vereinsamung unseres Daseins in einer klaren Prosa. Ein Meisterwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Andreas Decker
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The Painted Bird
erschien 1965 im Verlag Houghton Mifflin.
Copyright © 1965, 1976 by Jerzy N. Kosinski
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: VISIVA/99design
Alle Rechte vorbehalten
eBook 978-3-98676-151-6
Hinweis:
In diesem Buch haben wir rassistische und diskriminierende Begriffe und Äußerungen unverändert im Text belassen, sofern sie von einem Protagonisten diskriminierend und beleidigend gemeint sind.
Wir bitten unser Publikum, das Buch im zeitlichen und inhaltlichen Kontext zu begreifen und zu verstehen, dass eine Bereinigung dieser Begriffe das Buch verfälschen und verharmlosen würde.
Unser Verlag lehnt Rassismus und Diskriminierung natürlich ab.
Zum Gedenken an meine Frau Mary Hayward Weir,
ohne die selbst die Vergangenheit
ihre Bedeutung verlieren würde.
Und Gott allein,
fürwahr allmächtig,
wusste, dass sie Säugetiere waren,
aber von einer ganz anderen Gattung.
Wladimir Majakowski
1
In den ersten Wochen des Zweiten Weltkriegs wurde ein sechsjähriger Junge im Herbst 1939 wie Tausende anderer Kinder von seinen Eltern in die Sicherheit eines abgelegenen Dorfes geschickt.
Ein Mann auf dem Weg nach Osten erklärte sich für eine beträchtliche Summe bereit, eine zeitweilige Pflegefamilie für das Kind zu finden. Den Eltern blieb keine große Wahl, also vertrauten sie ihm den Jungen an.
Die Eltern glaubten, sein Überleben im Krieg auf die beste Weise gewährleisten zu können, indem sie ihn fortschickten. Wegen der Antinaziaktivitäten des Vaters vor dem Krieg mussten sie notgedrungen untertauchen, um der Zwangsarbeit in Deutschland oder der Gefangenschaft in einem Konzentrationslager zu entgehen. Sie wollten das Kind vor diesen Gefahren retten und hofften, irgendwann wieder vereint zu werden.
Aber die Ereignisse machten ihre Pläne zunichte. Im Chaos von Krieg und Besetzung sowie der kontinuierlichen Umsiedlung ganzer Bevölkerungsgruppen verloren die Eltern den Kontakt zu dem Mann, der ihr Kind in dem Dorf untergebracht hatte. Sie mussten der Möglichkeit ins Auge sehen, ihren Sohn nie wiederzufinden.
In der Zwischenzeit starb die Pflegemutter des Jungen zwei Monate nach seiner Ankunft, und das Kind blieb sich selbst überlassen, wanderte von einem Dorf ins andere, fand manchmal eine Unterkunft und manchmal auch nicht.
Die Dörfer, in denen der Junge die nächsten vier Jahre verbringen sollte, unterschieden sich ethnisch von der Region, in der er zur Welt gekommen war. Die Bauern waren von Isolation und Inzucht geprägt und hatten helle Haut, blonde Haare und blaue oder graue Augen. Der Junge hatte olivfarbene Haut, schwarze Haare und schwarze Augen. Seine Sprache war die der gebildeten Schichten, eine Sprache, die die Landbevölkerung im Osten kaum verstehen konnte.
Man hielt ihn für einen Zigeuner oder einen jüdischen Flüchtling, und Zigeunern oder Juden, die in Ghettos oder Vernichtungslager gehörten, Unterschlupf zu gewähren setzte Einzelpersonen oder Gemeinden den brutalsten Strafmaßnahmen der Deutschen aus.
Die Dörfer in jener Gegend waren seit Jahrhunderten vernachlässigt worden. Nur mühsam zu erreichen und fernab von allen urbanen Zentren stellten sie die zurückgebliebensten Teile Osteuropas dar. Es gab weder Schulen noch Krankenhäuser, nur wenige asphaltierte Straßen oder Brücken, keine Elektrizität. Die Menschen lebten nach Art ihrer Urgroßväter in kleinen Siedlungen. Die Dörfer stritten über Forst- und Wasserrechte, um die Seen. Als einziges Gesetz galt das traditionelle Recht des Stärkeren und Reicheren über die Schwächeren und Ärmeren. Was die Religion anging, war die Bevölkerung in Katholiken und Orthodoxe gespalten; vereint war sie lediglich in ihrem extremen Aberglauben und den zahllosen Krankheiten, die Menschen und Tiere gleichermaßen heimsuchten.
Sie waren ungebildet und brutal, was aber kaum ihre Schuld war. Der Boden war schlecht, das Klima rau. Die Flüsse waren größtenteils leer gefischt und überfluteten häufig die Wiesen und Felder, um sie in Sumpf zu verwandeln. Die Region wurde von großen Flächen Marschland durchzogen, während die dichten Wälder seit ewigen Zeiten Banden von Rebellen und Gesetzlosen Unterschlupf boten.
Die Besetzung dieses Teils des Landes durch die Deutschen verschlimmerte das Elend und die Rückständigkeit nur noch. Die Bauern mussten einerseits den größten Teil ihrer mageren Ernte an die Besatzungstruppen abliefern, andererseits aber auch an die Partisanen. Jede Weigerung konnte Strafexpeditionen zur Folge haben, die die Dörfer in qualmende Ruinen verwandelten.
Ich lebte in Martas Hütte und wartete jeden Tag und jede Stunde darauf, dass meine Eltern mich abholen kamen. Weinen half nichts, meine Tränen waren Marta völlig egal.
Sie war alt und krumm, als wollte sie sich in zwei Hälften brechen, konnte es aber nicht schaffen. Ihr langes Haar, das nie gekämmt worden war, bestand aus zahllosen dicken verfilzten Zöpfen, die unmöglich voneinander zu trennen waren. Sie bezeichnete sie als Elfenlocken. Darin nisteten böse Mächte, die sie weiter verflochten und Marta langsam senil machten.
Gestützt auf einen knorrigen Stock humpelte sie herum und murmelte unablässig vor sich hin, in einer Sprache, die ich nicht richtig verstehen konnte. Ihr kleines verwittertes Gesicht wurde von einem Netz aus Falten zerfurcht, ihre Haut war so rötlich braun wie ein zu lange gebackener Apfel. Ihr geschrumpfter Körper zitterte ständig wie von einem inneren Sturmwind geschüttelt, und die Finger ihrer knorrigen Hände, deren Gelenke durch Krankheit angeschwollen waren, hörten nie auf zu zittern, während der Kopf auf dem langen, dürren Hals in alle Richtungen nickte.
Ihre Augen waren schlecht. Sie starrte durch winzige Schlitze unter wulstigen Augenbrauen ins Licht. Ihre Lider glichen tief gepflügten Ackerfurchen. Die Augen tränten unablässig; die Tränen liefen durch tief eingegrabene Kanäle das Gesicht hinunter, um mit den ewig fließenden Rotzfäden aus ihrer Nase und den Speichelbläschen auf ihren Lippen zu verschmelzen. Sie sah aus wie ein alter Bovist, graugrün und völlig verrottet, der auf einen letzten Windstoß wartete, der den schwarzen, trockenen Staub aus seinem Inneren blies.
Zuerst hatte ich Angst vor ihr und schloss die Augen, wenn sie sich näherte. Dann bekam ich nur ihren üblen Körpergeruch mit. Sie schlief stets in ihren Kleidern. Das war der beste Schutz gegen die Gefahren der zahllosen Krankheiten, die frische Luft möglicherweise in den Raum hineintrug.
Um die Gesundheit zu bewahren, behauptete sie, sollte man sich nicht öfter als zweimal im Jahr waschen, Weihnachten und Ostern, und auch dann nur flüchtig und ohne sich auszuziehen. Heißes Wasser benutzte sie nur, um die zahllosen Hühneraugen und eingewachsenen Zehennägel ihrer verkrümmten Füße zu lindern. Darum steckte sie sie ein- oder zweimal die Woche ins Wasser.
Sie strich mir oft mit den alten, zittrigen Händen, die so sehr an einen Gartenrechen erinnerten, durchs Haar. Sie ermunterte mich, draußen auf dem Hof zu spielen und mich mit den Haustieren anzufreunden.
Irgendwann begriff ich, dass sie gar nicht so gefährlich waren, wie sie aussahen. Ich erinnerte mich an die Geschichten über sie, die mir mein Kindermädchen aus einem Bilderbuch vorgelesen hatte. Diese Tiere hatten ihr eigenes Leben geführt, sie liebten und stritten sich und diskutierten in ihrer eigenen Sprache.
Die Hennen drängten sich im Hühnerhaus und drängelten einander zur Seite, um an die Körner zu kommen, die ich ihnen hinwarf. Ein paar von ihnen stolzierten in Paaren, andere hackten auf die Schwächeren ein und badeten in Regenpfützen oder spreizten die Federn eitel über ihre Eier und schliefen sofort ein.
Seltsame Dinge trugen sich auf dem Bauernhof zu. Gelbe und schwarze Küken schlüpften und ähnelten kleinen lebendigen Eiern auf dürren Beinen. Einmal gesellte sich ein einsames Taubenmännchen zu der Hühnerherde. Es war offensichtlich nicht willkommen. Als der Täuberich mit schlagenden Flügeln mitten zwischen den Hühnern landete und Staub aufwirbelte, stoben sie ängstlich auseinander. Als er ihnen den Hof machte und sich mit einem affektierten Schritt gurrend näherte, standen die Hennen hochnäsig da und betrachteten ihn verächtlich. Jedes Mal wenn er näher kam, liefen sie unweigerlich gackernd davon.
Als der Täuberich eines Tages wie üblich versuchte, mit den Hennen und Küken Kontakt aufzunehmen, stürzte ein kleiner schwarzer Umriss aus den Wolken. Die Hennen rannten mit viel Getöse in Richtung Scheune und Hühnerstall. Die schwarze Kugel fiel wie ein Stein auf die Herde. Nur der Täuberich hatte kein Versteck. Bevor er überhaupt Gelegenheit hatte, die Flügel auszubreiten, drückte ihn ein kräftiger Vogel mit einem scharfen, gekrümmten Schnabel zu Boden und hieb auf ihn ein. Die Federn der Taube färbten sich rot mit Blutstropfen. Marta kam aus der Hütte gelaufen und schwang einen Stock, aber der Falke stieg geschmeidig in den Himmel, den leblosen Taubenkörper im Schnabel.
In einem besonderen kleinen und sorgfältig umzäunten Feldgarten hielt Marta eine Schlange. Das Tier glitt geschmeidig durch das Laub, dabei züngelte die gespaltene Zunge wie eine Fahne bei einer Militärparade. Der Welt schenkte die Schlange keine Beachtung; ich vermochte nie zu sagen, ob sie mich überhaupt wahrnahm.
Bei einer Gelegenheit verbarg sie sich tief im Moos ihres Nests und blieb dort lange Zeit ohne Nahrung oder Wasser, um sich seltsamen Mysterien hinzugeben, über die selbst Marta nichts sagen wollte. Als sie schließlich wieder zum Vorschein kam, glitzerte ihr Kopf wie eine eingeölte Pflaume. Dann veranstaltete sie ein unglaubliches Schauspiel. Sie versank in Reglosigkeit, ihr zusammengeringelter Körper bebte sanft. Dann kroch sie aus ihrer Haut und sah plötzlich dünner und jünger aus. Sie züngelte nicht länger, sondern schien darauf zu warten, dass die neue Haut hart wurde. Die alte, halb durchsichtige Haut war völlig abgeworfen worden und wurde nun von respektlosen Fliegen umschwärmt. Marta hob sie andächtig in die Höhe und versteckte sie an einem geheimen Ort. So eine Haut besitze wertvolle Heilkräfte, verkündete sie, aber ich sei noch zu jung, um sie zu verstehen.
Marta und ich hatten diese Verwandlung voller Erstaunen verfolgt. Sie hatte mir erzählt, die menschliche Seele verlasse den Körper auf ähnliche Weise, um hinauf zu Gottes Füßen zu fliegen. Nach ihrer langen Reise hebe Gott sie mit seinen warmen Händen auf und wiederbelebe sie mit seinem Atem. Dann verwandele er sie entweder in einen himmlischen Engel oder schleudere sie hinunter in die Hölle, wo sie für alle Ewigkeit im Feuer schmoren konnte.
Oft kam ein kleines rotes Eichhörnchen zu Besuch. Nach einer Mahlzeit tanzte es auf dem Hof, pochte mit seinem langen Schwanz auf den Boden, quiekte leise, sprang umher und ängstigte die Hühner und Tauben.
Das Eichhörnchen besuchte mich täglich und setzte sich auf meine Schulter, küsste meine Ohren, meinen Hals und die Wangen, zerzauste mein Haar mit seiner sanften Berührung. Nach seinem Spiel verschwand es wieder in dem Wald hinter dem Feld.
Eines Tages hörte ich Stimmen und rannte den nahe gelegenen Hügel hinauf. Im Schutz der Büsche sah ich entsetzt, wie ein paar Dorfjungen mein Eichhörnchen über das Feld jagten. Mit einem wilden Spurt versuchte es die Sicherheit des Waldes zu erreichen. Die Jungen warfen Steine in seinen Weg, um es davon abzuschneiden. Das kleine Geschöpf wurde schwächer, die Sprünge wurden kürzer. Schließlich fingen die Jungen es ein, aber es kämpfte tapfer weiter und biss zu. Dann beugten sie sich über das Tier und gossen aus einer Dose Flüssigkeit darüber. Etwas Schreckliches würde passieren, das spürte ich genau, und ich versuchte mir verzweifelt etwas einfallen zu lassen, wie ich meinen kleinen Freund retten konnte. Aber es war zu spät.
Einer der Jungen zog einen glühenden Ast aus der Dose, die er mit einem Riemen über die Schulter geschwungen hatte, und berührte das Tier damit. Dann warf er das Eichhörnchen auf den Boden, wo es sofort in Flammen stand. Mit einem Quieken, das mir den Atem verschlug, sprang es in die Höhe, als wollte es dem Feuer entkommen. Die Flammen hüllten es ein; nur der buschige Schwanz wedelte noch eine Sekunde lang. Der kleine, qualmende Körper wälzte sich im Staub und lag dann still da. Die Jungen lachten und stießen ihn mit einem Stock an.
Da mein Freund nun tot war, hatte ich niemanden mehr, auf den ich morgens warten konnte. Ich erzählte Marta, was passiert war, aber sie schien mich nicht zu verstehen. Sie murmelte etwas vor sich hin, betete und warf ihren geheimen Zauber über den Haushalt, um den Tod abzuwehren, der, wie sie behauptete, in der Nähe lauerte und eintreten wollte.
Marta wurde krank. Sie klagte über stechende Schmerzen unter den Rippen, wo das Herz für alle Zeiten in seinen Käfig eingesperrt flattert. Sie behauptete, Gott oder der Teufel hätte eine Krankheit dorthin geschickt, um ein weiteres menschliches Wesen zu vernichten und ihrer Zeit auf Erden damit ein Ende zu bereiten. Ich konnte nicht verstehen, warum sie nicht einfach wie die Schlange ihre Haut abwarf und wieder von vorn zu leben begann.
Als ich ihr das vorschlug, wurde sie böse und verfluchte mich dafür, ein blasphemischer Zigeunerbastard zu sein, ein Kind des Teufels. Krankheiten würden sich in einen Menschen schleichen, wenn er es am wenigsten erwartete, sagte sie. Vielleicht würde die Krankheit genau hinter einem auf dem Wagen sitzen, einem auf die Schultern springen, wenn man sich bückte, um im Wald Beeren zu pflücken, oder kröche aus dem Wasser, wenn man den Fluss in einem Boot überquerte. Krankheiten würden sich unsichtbar und hinterhältig durch Luft, Wasser oder die Berührung eines Tieres oder Menschen in den Körper schleichen; oder sie würden sogar aus einem Paar schwarzer Augen kommen, die dicht an einer Habichtsnase sitzen – dabei blickte sie mich misstrauisch an. Solche Augen, die auch als Zigeuneraugen oder Hexenaugen bekannt sind, konnten schreckliche Krankheiten, Pestilenz oder den Tod bringen. Darum verbot sie mir, ihr direkt in die Augen zu schauen; das galt auch für das Vieh auf dem Hof. Sollte ich ihr oder einem der Tiere jemals direkt in die Augen blicken, sollte ich schnell dreimal ausspucken und mich bekreuzigen.
Sie geriet oft in Wut, wenn der Brotteig, den sie knetete, sauer wurde. Dafür gab sie mir die Schuld, ich hätte einen Zauber gewirkt und würde zur Strafe zwei Tage lang kein Brot bekommen. Um Marta zu gefallen und ihr nicht in die Augen zu sehen, ging ich mit geschlossenen Augen durch das Haus, stolperte über Möbel, trat Eimer um und zertrampelte draußen Blumenbeete, stieß wie eine vom Licht geblendete Motte gegen alles Mögliche. In der Zwischenzeit sammelte Marta Gänsefedern und warf sie auf brennendes Holz. Dann wedelte sie den daraus resultierenden Qualm durch den ganzen Raum und murmelte dabei Zaubersprüche, die den bösen Bann austreiben sollten.
Schließlich verkündete sie, der Zauber sei vertrieben. Und sie behielt recht, denn beim nächsten Backen gab es gutes Brot.
Marta gab ihrer Krankheit und ihren Schmerzen nicht nach. Sie führte eine ständige, durchtriebene Schlacht mit ihnen. Machten ihr die Schmerzen sehr zu schaffen, nahm sie ein Stück rohes Fleisch und schnitt es in kleine Stücke, die sie in einen irdenen Krug legte. Dann schüttete sie Wasser darüber, das direkt vor Sonnenaufgang aus dem Brunnen geschöpft war. Der Krug wurde dann tief in einer Ecke der Hütte vergraben. Das würde ihre Schmerzen ein paar Tage lang lindern, behauptete sie, bis das Fleisch verfault war. Aber als die Schmerzen zurückkehrten, wiederholte sie die mühsame Prozedur.
Marta trank nie etwas in meiner Gegenwart und sie lächelte nie. Sie war der festen Überzeugung, dass sie mir damit Gelegenheit bieten würde, ihre Zähne zu zählen, und dass jeder auf diese Weise gezählte Zahn ein Jahr ihrer Lebensspanne abziehen würde. In der Tat hatte sie nicht mehr viele Zähne. Und ich begriff, dass in ihrem Alter jedes Jahr sehr kostbar war.
Ich versuchte zu essen und zu trinken, ohne meine Zähne zu zeigen, und ich übte im blauschwarzen Spiegel des Brunnens, mich mit geschlossenem Mund anzulächeln.
Ihre ausgegangenen Haare durfte ich nie vom Boden aufheben. Es war allgemein bekannt, dass selbst ein einziges verloren gegangenes Haar schwere Halsschmerzen verursachen konnte, sollte der böse Blick darauf fallen.
Abends saß Marta am Herd, nickte vor sich hin und murmelte Gebete. Ich saß in der Nähe und dachte an meine Eltern. Ich dachte an meine Spielzeuge, die jetzt vermutlich anderen Kindern gehörten. Mein großer Teddybär mit den Glasaugen, das Flugzeug mit den beweglichen Propellern und seinen Passagieren, die man hinter den Fenstern sehen konnte, der kleine Panzer, der sich so leicht fahren ließ, und das Feuerwehrauto mit seiner ausfahrbaren Leiter.
Nahmen die Bilder in meinem Kopf schärfere und realere Konturen an, war es in Martas Haus plötzlich wärmer. Ich konnte meine Mutter am Klavier sitzen sehen. Ich hörte die Worte ihrer Lieder. Ich erinnerte mich an meine Angst vor einer Blinddarmoperation im Alter von nur vier Jahren, an die glänzenden Krankenhauskorridore und die Schlafmaske, die die Ärzte mir aufs Gesicht gedrückt hatten und wegen der ich nicht bis zehn hatte zählen können.
Aber meine Vergangenheit verwandelte sich schnell in eine Illusion wie die unglaublichen Fabeln meines alten Kindermädchens. Ich fragte mich, ob meine Eltern mich jemals wiederfinden würden. Wussten sie, dass sie in Gegenwart von Menschen mit dem bösen Blick niemals trinken oder lächeln durften, damit diese nicht ihre Zähne zählten? Ich erinnerte mich an das breite, entspannte Lächeln meines Vaters und sorgte mich; er zeigte so viele Zähne, dass er bestimmt bald sterben würde, wenn ein böser Blick sie zählte.
Als ich eines Morgens erwachte, war die Hütte kalt. Das Feuer im Herd war erloschen, und Marta saß noch immer in der Zimmermitte, die vielen Röcke untergeschlagen und die nackten Füße in einem Wassereimer.
Ich versuchte mit ihr zu sprechen, aber sie antwortete nicht. Ich kitzelte ihre kalte, steife Hand, aber die knorrigen Finger bewegten sich nicht. Die Hand hing von der Stuhllehne herab wie nasses Leinen an einem windstillen Tag von der Wäscheleine. Als ich ihren Kopf hob, schienen mich ihre wässrigen Augen anzustarren. Solche Augen hatte ich zuvor erst ein einziges Mal gesehen. Der Fluss hatte tote Fische ans Ufer gespült.
Marta, so schloss ich, wartete auf eine Häutung, und wie die Schlange durfte sie dabei nicht gestört werden. Obwohl ich mir dennoch unsicher war, was ich tun sollte, versuchte ich mich in Geduld zu üben.
Es war Spätherbst. Der Wind ließ die brüchigen Zweige knacken. Er riss die letzten zerknitterten Blätter ab und schleuderte sie in den Himmel. Hennen kauerten eulenhaft, schläfrig und deprimiert auf ihren Schlafplätzen, öffneten unwillig ein Auge nach dem anderen. Es war kalt, und ich wusste nicht, wie man ein Feuer entzündete. Sämtliche Bemühungen, mit Marta zu sprechen, riefen keine Reaktion hervor, sie saß reglos da und starrte auf etwas, das ich nicht sehen konnte.
Ich ging wieder schlafen, da ich nichts anderes zu tun hatte, zuversichtlich, dass Marta beim Aufwachen in der Küche umherwuseln und ihre traurigen Psalmen summen würde. Aber als ich abends erwachte, weichte sie noch immer ihre Füße ein. Ich hatte Hunger, und die Dunkelheit machte mir Angst.
Ich entschied, die Öllampe zu entzünden. Ich machte mich auf die Suche nach den Streichhölzern, die Marta gut versteckt hatte. Ich holte die Lampe vorsichtig vom Regal, aber sie entglitt mir und spritzte Öl auf den Boden.
Die Streichhölzer wollten sich nicht entzünden. Als endlich eins aufflammte, brach es durch und fiel mitten in die Ölpfütze. Zuerst flackerte die Flamme dort unscheinbar und gab eine kleine blaue Rauchwolke von sich. Dann tat sie einen mutigen Sprung in die Zimmermitte.
Es war nicht länger dunkel, und ich konnte Marta gut sehen. Sie schien nicht zu bemerken, was geschah. Ihr schienen auch die Flammen egal zu sein, die sich mittlerweile zur Wand bewegt hatten und die Beine ihres Korbstuhls hinaufkrochen.
Es war nicht länger kalt. Die Flammen waren nun in der Nähe des Eimers, in dem Marta ihre Füße einweichte. Sie musste die Wärme spüren, aber sie bewegte sich nicht. Ich bewunderte ihr Durchhaltevermögen. Nachdem sie eine Nacht und einen Tag dort gesessen hatte, rührte sie sich immer noch nicht.
In dem Raum wurde es sehr heiß. Flammen kletterten Schlingpflanzen gleich die Wände hinauf. Sie knackten wie getrocknete Hülsenfrüchte, auf die man trat, vor allem am Fenster, wo ein schmaler Luftzug eindringen konnte. Ich stand an der Tür, zum Loslaufen bereit, und wartete noch immer darauf, dass Marta sich bewegte. Aber sie hockte steif da, als würde sie von allem nichts bemerken. Die Flammen leckten wie ein zuneigungsvoller Hund an ihren baumelnden Händen. Nun hinterließen sie rote Spuren an ihren Fingern und kletterten hinauf zu ihrem verfilzten Haar.
Die Flammen funkelten wie ein Weihnachtsbaum und loderten dann auf, schmückten Martas Kopf mit einem spitzen Feuerhut. Sie verwandelte sich in eine Fackel. Von allen Seiten umkreisten sie Flammen, das Wasser im Eimer zischte, wenn Fetzen ihrer abgetragenen Kaninchenfelljacke hineinfielen. Unter den Flammen konnte ich Stücke ihrer runzeligen, schlaffen Haut sehen sowie weiße Flecken an ihren knochigen Armen.
Ich rief sie ein letztes Mal, dann lief ich hinaus auf den Hof. Die Hennen in dem Hühnerstall neben der Hütte gackerten wild und schlugen mit den Flügeln. Die normalerweise so friedliche Kuh muhte und rammte den Kopf gegen das Scheunentor. Ich entschied, nicht auf Martas Erlaubnis zu warten, und ließ die Hühner frei. Hektisch rannten sie aus dem Stall und versuchten mit verzweifeltem Flügelschlagen in die Luft zu steigen. Der Kuh gelang es, das Scheunentor aufzustoßen. In sicherem Abstand zu dem Feuer nahm sie einen Beobachtungsposten ein und käute dabei nachdenklich wieder.
Mittlerweile war das Hütteninnere ein Inferno. Aus allen Fenstern und Löchern sprangen Flammen. Das Strohdach fing von unten Feuer und qualmte unheilvoll. Ich wunderte mich über Marta. War ihr das alles wirklich so gleichgültig? Hatten ihre Zaubermittel und Beschwörungen sie gegen das Feuer immun gemacht, das alles um sie herum in Asche verwandelte?
Sie war noch immer nicht herausgekommen. Die Hitze wurde unerträglich. Ich musste ans andere Ende des Hofes gehen. Nun standen auch der Hühnerstall und die Scheune in Flammen. Ein paar vom Feuer aufgescheuchte Ratten rannten panisch über den Hof. Von den dunklen Rändern des Feldes spiegelten die gelben Augen einer Katze die Flammen wider.
Marta kam nicht, obwohl ich noch immer davon überzeugt war, sie könnte unbeschadet aus dem Haus kommen. Aber als eine Wand einstürzte und das verkohlte Innere unter sich begrub, begann ich zu bezweifeln, dass ich sie jemals wiedersehen würde.
In den emporsteigenden Rauchwolken glaubte ich einen seltsamen, rechteckigen Umriss ausmachen zu können. Was war das? Konnte es Martas Seele sein, die in den Himmel entkam? Oder war sie es selbst, die von ihrer alten, krustigen Haut befreit diese Welt auf einem flammenden Besen verließ wie die Hexe in der Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hatte?
Laute Männerstimmen und Hundegebell rissen mich aus meiner gebannten Betrachtung des Spektakels aus Funken und Flammen. Die Bauern kamen. Marta hatte mich immer vor den Dorfbewohnern gewarnt. Sie hatte gesagt, dass, sollten sie mich je allein erwischen, sie mich wie eine räudige Katze ertränken oder mit einer Axt erschlagen würden.
Sobald die ersten menschlichen Gestalten im Lichtkreis erschienen, rannte ich los. Sie sahen mich nicht. Ich rannte wie ein Verrückter, stolperte über ungesehene Baumstümpfe und dornige Büsche. Schließlich stürzte ich in einen Graben. Ich hörte die fernen Stimmen von Menschen und das Krachen einstürzender Wände, dann fiel ich in Schlaf.
Halb erfroren erwachte ich in der Morgendämmerung. Nebel hing einem Spinnennetz gleich an den Grabenrändern. Ich kroch nach oben. Wo Martas Hütte gestanden hatte, stiegen Rauchwölkchen und vereinzelte Flammen aus den verkohlten Trümmern.
Ringsherum herrschte völlige Stille. Ich glaubte, dass ich in dem Graben meinen Eltern begegnen würde. Ich glaubte, dass sie selbst in der Ferne über alles Bescheid wissen mussten, was mir zugestoßen war. War ich nicht ihr Kind? Wozu waren Eltern da, wenn nicht um ihren Kindern in der Gefahr beizustehen?
Nur für den Fall, dass sie auf dem Weg waren, rief ich nach ihnen. Aber niemand antwortete.
Mir war kalt, ich war hungrig und schwach. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen oder wohin ich gehen sollte. Meine Eltern waren noch immer nicht da.
Ich zitterte am ganzen Leib und übergab mich. Ich musste Menschen finden. Ich musste ins Dorf.
Auf wunden Füßen humpelte ich über das gelbe Herbstgras zu dem fernen Dorf.
2
Meine Eltern waren nirgendwo in Sicht. Ich rannte über die Felder auf die Bauernhütten zu. An der Wegkreuzung erhob sich ein morsches Kruzifix, das einst blau angestrichen gewesen war. Oben hing ein Heiligenbild, aus dem zwei kaum noch sichtbare, aber anscheinend tränenerfüllte Augen auf die leeren Felder und das rote Glühen der aufgehenden Sonne starrten. Auf einem Arm des Kreuzes hockte ein grauer Vogel. Als er mich erblickte, spreizte er die Flügel und verschwand.
Der Wind trug den verbrannten Geruch von Martas Hütte über die Felder. Aus den sich abkühlenden Trümmern stieg ein dünner Rauchfaden in den winterlichen Himmel.
Frierend und verängstigt betrat ich das Dorf. Die Hütten mit ihren niedrigen Strohdächern und verrammelten Fenstern standen halb in der Erde versunken zu beiden Seiten des ungepflasterten Weges.
Die an den Zäunen festgebundenen Hunde entdeckten mich, stießen ihr Heulen aus und zerrten an ihren Ketten. Zu verschreckt, um mich zu bewegen, blieb ich mitten auf dem Weg stehen und wartete darauf, dass sich jeden Moment eines der Tiere losriss.
Mir kam der ungeheuerliche Gedanke, dass meine Eltern nicht hier waren und auch nicht kommen würden. Ich setzte mich auf den Boden und fing wieder an zu heulen, rief nach meinem Vater und meiner Mutter und sogar nach meinem Kindermädchen.
Frauen und Männer versammelten sich um mich und sprachen in einem mir unbekannten Dialekt miteinander. Ihre misstrauischen Blicke und Bewegungen machten mir Angst.
Einige von ihnen hielten Hunde an Leinen, die daran zerrten und mich anknurrten.
Jemand stieß mich mit einem Rechen in den Rücken. Ich hüpfte zur Seite. Ein anderer stieß mich mit einem spitzen Stock. Wieder hüpfte ich ein Stück zur Seite und schrie laut auf.
Leben kam in die Menge. Ein Stein traf mich. Ich legte mich mit dem Gesicht auf den Boden und wollte gar nicht wissen, was nun geschehen würde. Mein Kopf wurde mit getrocknetem Kuhmist, vergammelten Kartoffeln, Apfelresten und kleinen Steinen bombardiert. Ich schützte das Gesicht mit den Händen und schrie in den Staub der Straße.
Jemand riss mich auf die Beine. Ein hochgewachsener Bauer mit rotem Gesicht zerrte mich an den Haaren zu sich; mit der anderen Hand verdrehte er mein Ohr. Verzweifelt versuchte ich seinem Griff zu entkommen. Die anderen kreischten vor Lachen. Der Mann stieß mich weiter, trat mich mit seinem Holzschuh. Die Meute brüllte vor Vergnügen, die Männer hielten sich den Bauch und schütteten sich aus vor Lachen. Die Hunde kamen näher an mich heran.
Ein Bauer mit einem Leinensack drängte sich durch die Menge. Er packte mich am Nacken und schob mir den Sack über den Kopf. Dann warf er mich zu Boden und versuchte den Rest meines Körpers in die stinkende schwarze Erde zu drücken.
Ich wehrte mich mit Händen und Füßen. Ich biss und kratzte. Aber ein Schlag in den Nacken ließ mich das Bewusstsein verlieren.
Ich erwachte voller Schmerzen. In den Sack gestopft war ich über jemandes Schulter geworfen worden; seine schwitzige Wärme konnte ich durch den groben Stoff spüren. Über meinem Kopf war der Sack verschnürt. Als ich mich zu befreien versuchte, stellte mich der Mann auf dem Boden ab und trat mir die Luft aus den Lungen, bis ich benommen war. Zu ängstlich, mich zu rühren, hockte ich reglos da.
Wir kamen zu einem Hof. Eine Kuh muhte, eine Ziege meckerte, und es roch nach Mist. Ich wurde auf den Boden einer Hütte geworfen, und jemand schlug mit einer Peitsche auf den Sack ein. Ich sprang heraus, sprengte die verschnürte Öffnung, als hätte ich mich verbrannt. Der Bauer stand mit der Peitsche in der Hand da. Er prügelte mich auf die Beine. Ich hüpfte wie ein Eichhörnchen herum, während er weiter auf mich einschlug. Der Raum füllte sich mit Leuten: eine Frau mit einer fleckigen Schürze, kleine Kinder, die wie Kakerlaken hinter dem Federbett hervorgekrochen kamen, und zwei Knechte.
Sie bauten sich um mich herum auf. Einer versuchte mein Haar zu berühren. Als ich ihm den Kopf zuwandte, riss er die Hand schnell zurück. Sie unterhielten sich über mich.
Zwar verstand ich nicht viel, aber das Wort »Zigeuner« fiel oft. Ich versuchte ihnen etwas zu sagen, aber meine Sprache und die Art, wie ich mich ausdrückte, ließen sie nur kichern.
Der Mann, der mich gebracht hatte, schlug mir wieder auf die Waden. Ich sprang in die Höhe, immer höher, während die Kinder und die Erwachsenen vor Lachen kreischten.
Man drückte mir ein Stück Brot in die Hand, dann sperrte man mich in den Verschlag für das Feuerholz. Die Peitschenschläge brannten auf meiner Haut, und ich konnte nicht einschlafen. In dem Verschlag war es dunkel, und ganz in der Nähe konnte ich Ratten umherhuschen hören. Als sie meine Beine berührten, schrie ich und schreckte die Hühner auf, die hinter der Wand schliefen.
Während der nächsten Tage kamen Bauern mit ihren Familien zu der Hütte, um mich anzustarren. Der Hofbesitzer peitschte meine verkrusteten Beine, damit ich wie ein Frosch hüpfte. Man hatte mir einen Sack als Kleidung gegeben, in den man zwei Löcher für die Beine geschnitten hatte; ansonsten war ich nackt. Der Sack rutschte oft herunter, wenn ich sprang. Die Männer schüttelten sich aus vor Lachen, und die Frauen kicherten und sahen zu, wie ich mein kleines Schwänzchen zu bedecken versuchte. Ich starrte ein paar von ihnen in die Augen, und sie wandten schnell den Blick ab oder spuckten dreimal aus.
Eines Tages kam eine ältere Frau namens Olga zu Besuch. Der Hofbesitzer behandelte sie sehr respektvoll. Sie unterzog mich von Kopf bis Fuß einer genauen Musterung, untersuchte meine Augen und Zähne, tastete meine Knochen ab und befahl mir, in einen kleinen Becher zu pinkeln. Dann untersuchte sie meinen Urin.
Danach beschäftigte sie sich lange mit der großen Narbe auf meinem Bauch, dem Andenken an meine Blinddarmoperation, und knetete meinen Bauch mit beiden Händen. Nach der Untersuchung feilschte sie lange und energisch mit dem Bauern, bis sie schließlich eine Schnur um meinen Hals band und mich mitnahm. Ich war gekauft worden.
Von nun an lebte ich in ihrer Hütte. Sie bestand aus zwei Räumen, die man aus dem Erdboden gekratzt hatte. Dort lagen Haufen aus getrocknetem Gras, Blättern und Büschen sowie kleinen, seltsam geformten bunten Steinen, es gab Frösche, Maulwürfe und Krüge voller umherwieselnder Eidechsen und Würmer. In der Mitte hingen große Kessel über einem brennenden Feuer.
Olga zeigte mir alles. Ich musste mich um das Feuer kümmern, Holz aus dem Wald holen und die Tierställe ausmisten. In der Hütte gab es alle möglichen Pulver, die Olga in einem großen Mörser zubereitete, in dem sie verschiedene Zutaten mischte und zerstampfte. Auch dabei musste ich ihr helfen.
Früh am Morgen nahm sie mich mit ins Dorf. Die Frauen und Männer bekreuzigten sich, wenn sie uns sahen, grüßten aber höflich. Die Kranke wartete im Haus.
Eine stöhnende Frau hielt sich den Leib. Olga befahl mir, den warmen und feuchten Bauch zu massieren und anzustarren, während sie irgendwelche Worte murmelte und über unseren Köpfen Zeichen in die Luft malte. Einmal kamen wir zu einem Kind mit einem fauligen Bein, aus dessen zerfurchter brauner Haut blutiger gelber Eiter tropfte. Der Gestank war so schlimm, dass selbst Olga ständig die Tür aufstieß, um frische Luft hereinzulassen.
Ich starrte das faulige Bein den ganzen Tag an, während das Kind entweder schluchzte oder einschlief. Die verängstigte Familie saß draußen und betete lautstark. Als das Kind wieder die Augen schloss, hielt Olga eine rot glühende Eisenstange, die bereits im Feuer gelegen hatte, an das Bein und brannte die Wunde sorgfältig aus. Das Kind schrie laut auf, schlug um sich, fiel in Ohnmacht und kam wieder zu Bewusstsein. Der Geruch von verbranntem Fleisch erfüllte den Raum. Die Wunde brutzelte wie Schinkenstücke in einer Pfanne. Nachdem die Wunde ausgebrannt war, bedeckte Olga sie mit nassem Brot, in das man Spinnweben und Schimmel hineingeknetet hatte.
Olga kannte für fast jede Krankheit ein Mittel, und meine Bewunderung für sie wuchs zusehends. Besucher kamen mit allen möglichen Beschwerden, und fast immer konnte sie helfen. Hatte ein Mann Ohrenschmerzen, wusch Olga sie mit Kümmelöl, steckte einen Fetzen in Trompetenform gedrehtes und in heißes Wachs getauchtes Leinen hinein und zündete den Stoff an. Der an einen Tisch gefesselte Patient schrie vor Schmerzen, während das Feuer den restlichen Stoff im Ohr verbrannte. Dann blies sie die Überreste aus dem Ohr, das »Sägemehl«, wie sie es nannte, und bestrich die verbrannten Stellen mit einer Salbe aus einer zerdrückten Zwiebel, dem Magensaft einer Ziege oder eines Kaninchens und einem Schuss Wodka.
Sie schnitt auch Furunkel, Grützbeutel und Geschwüre auf und zog faule Zähne. Die Furunkel steckte sie in Essig, bis sie mariniert waren und als Medizin verwendet werden konnten. Den Eiter aus den Wunden sammelte sie in besonderen Tassen und ließ ihn ein paar Tage fermentieren. Die gezogenen Zähne pulverisierte ich in einem großen Mörser, und das so entstandene Pulver wurde auf Stücken von Baumrinde oben auf dem Ofen getrocknet.
Manchmal kam im Dunkel der Nacht ein verängstigter Bauer angelaufen, damit Olga bei einer Geburt half. Dann schlang sie ein großes Tuch um den Körper und zitterte durch Kälte und Schlafmangel. Als man sie in eines der Nachbardörfer holte und sie mehrere Tage lang nicht zurückkam, passte ich auf die Hütte auf, fütterte die Tiere und hielt das Feuer am Brennen.
Obwohl Olga einen seltsamen Dialekt sprach, verstanden wir einander irgendwann recht gut. Im Winter, wenn der Sturm heulte und das Dorf fest im Griff unpassierbarer Schneemassen war, saßen wir zusammen in der warmen Hütte, und Olga erzählte mir von allen Kindern Gottes und allen Geistern Satans.
Mich nannte sie den Schwarzen. Von ihr erfuhr ich zum ersten Mal, dass ich von einem bösen Geist besessen war, der tief in meinem Inneren kauerte wie ein Maulwurf in einem tiefen Bau und von dessen Anwesenheit ich nichts wusste. Einen Finsterling wie mich, der von diesem bösen Geist besessen war, konnte man an seinen verhexten schwarzen Augen erkennen, die nicht blinzelten, wenn sie in helle klare Augen blickten. Darum konnte ich andere Menschen anstarren und sie, ohne es zu wissen, verhexen.
Olga erklärte, dass verhexte Augen einen nicht nur mit einem Bann belegen, sondern ihn auch entfernen konnten. Starrte ich andere Menschen oder Tiere oder selbst das Korn an, musste ich darauf achten, an nichts anderes zu denken als an die Krankheit, die ich ihr gerade zu entfernen half. Denn fällt der Blick aus Hexenaugen auf ein gesundes Kind, wird es sofort von einer verzehrenden Krankheit befallen; ein Kalb wird von einer plötzlichen Krankheit heimgesucht und tot umfallen, und das aus dem Gras gemachte Heu wird nach der Ernte verfaulen.
Der böse Geist in mir zog naturgemäß andere mysteriöse Wesen an. Phantome umgaben mich. Ein Phantom ist stumm, zugeknöpft und selten zu sehen. Aber es ist hartnäckig: Auf den Feldern und in den Wäldern lässt es die Arbeiter stolpern, es späht in fremde Hütten und kann sich in eine bösartige Katze oder einen tollwütigen Hund verwandeln, und wenn es zornig ist, dann stöhnt es. Um Mitternacht verwandelt es sich in heißen Teer.
Geister fühlen sich zu bösen Geistern hingezogen. Das sind vor langer Zeit gestorbene Menschen, die zu ewiger Verdammnis verurteilt wurden und nur bei Vollmond wieder ins Leben zurückkehren. Sie haben übermenschliche Kräfte, und ihre Augen sind immer traurig nach Osten gerichtet.
Auch Vampire, die vermutlich schrecklichsten dieser nicht greifbaren Bedrohungen, weil sie oft menschliche Gestalt annehmen, werden von Besessenen angezogen. Vampire sind Menschen, die nie getauft wurden und dann ertrinken oder die von ihren Müttern im Stich gelassen wurden. Im Wasser oder den Wäldern werden sie sieben Jahre alt, danach nehmen sie wieder menschliche Gestalt an und verwandeln sich in Vagabunden, die von dem unstillbaren Verlangen getrieben sind, sich Zugang zu katholischen oder unierten Kirchen zu verschaffen, wann immer sie können. Sobald sie sich dort eingenistet haben, streichen sie ruhelos um die Altäre, beschmutzen niederträchtig die Heiligenbilder, beißen, zerbrechen oder zerstören die sakralen Gegenstände und saugen, falls möglich, schlafenden Männern das Blut aus.
Olga hatte mich im Verdacht, ein Vampir zu sein, was sie mir dann und wann auch zu verstehen gab. Um dem finsteren Verlangen meines bösen Geistes Zügel anzulegen und seine Verwandlung in ein Phantom zu verhindern, bereitete sie jeden Morgen ein bitteres Elixier zu, das ich trinken musste, während ich ein Stück mit Knoblauch bestrichene Holzkohle kaute. Auch die anderen Menschen fürchteten mich. Wann immer ich allein durch das Dorf ging, wandten sie die Köpfe ab und bekreuzigten sich. Schwangere Frauen ergriffen panisch die Flucht vor mir. Die mutigeren Bauern hetzten ihre Hunde auf mich, und hätte ich nicht gelernt, schnell abzuhauen und stets in der Nähe von Olgas Hütte zu bleiben, wäre ich von vielen dieser Ausflüge nicht lebendig zurückgekehrt.
Für gewöhnlich hielt ich mich in der Hütte auf und hinderte eine Albinokatze daran, eine in einem Käfig sitzende Henne zu töten, die schwarz gefiedert und sehr selten war. Olga maß ihr großen Wert zu. Außerdem starrte ich den Kröten, die in einem großen Krug hüpften, in die leeren Augen, hielt das Feuer im Herd am Brennen, rührte brodelnde Tränke um und schälte verfaulte Kartoffeln, wobei ich den grünlichen Schimmel, den Olga für Wunden und Blutergüsse brauchte, sorgfältig in einer Tasse aufbewahrte.
Olga genoss im Dorf einen hohen Respekt, und wenn ich sie begleitete, brauchte ich niemanden zu fürchten. Oft wurde sie gebeten, die Augen des Viehs zu besprenkeln, damit die Tiere auf dem Trieb zum Markt vor bösen Zaubern geschützt waren. Sie zeigte den Bauern, wie man beim Kauf eines Schweins dreimal auf die richtige Weise ausspuckte und wie man eine Färse mit einem besonders zubereiteten Brot mit geweihten Kräutern fütterte, bevor man sie mit einem Bullen zusammenbrachte. Im Dorf hätte niemand ein Pferd oder eine Kuh gekauft, ohne dass Olga das Tier vorher für gesund erklärte. Sie übergoss es mit Wasser; nachdem sie gesehen hatte, wie es sich schüttelte, verkündete sie ihr Urteil, von dem der Preis und oft der ganze Handel abhing.
Der Frühling kam. Das Eis im Fluss zerbrach, niedrige Sonnenstrahlen durchdrangen die schlüpfrigen Wirbel des rauschenden Wassers. Blaue Libellen schwebten über den Strömen und hatten mit den plötzlichen kalten und feuchten Windböen zu kämpfen. Dunst stieg vom gewärmten See auf, wurde vom Wind ergriffen, dann wie Wollfäden zerfasert und in die unruhige Luft gezogen.
Doch als das ungeduldig erwartete warme Wetter endlich kam, brachte es eine Seuche mit. Die Erkrankten wanden sich wie aufgespießte Erdwürmer vor Schmerzen, wurden von einem schrecklichen Frösteln heimgesucht und starben, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen. Ich eilte mit Olga von Hütte zu Hütte und starrte die Kranken an, um ihnen das Leiden auszutreiben, aber alles war umsonst. Die Seuche erwies sich als zu stark.
Die Sterbenden und Kranken stöhnten und schrien hinter den fest verrammelten Fenstern ihrer im Dunkeln liegenden Hütten. Frauen drückten die kleinen, dick eingewickelten Körper ihrer Babys, deren Leben schnell dahinschwand, an die Brust. Verzweifelte Männer deckten ihre vom Fieber geschüttelten Frauen mit Federbetten und Schafsfellen zu. Kinder starrten mit Tränen in den Augen in die blau angelaufenen Gesichter ihrer toten Eltern.
Die Seuche blieb hartnäckig.
Die Dorfbewohner traten an die Schwellen ihrer Hütten, hoben die Blicke vom irdischen Staub und suchten nach Gott. Er allein konnte ihr bitteres Leid lindern. Er allein konnte den gequälten Körpern die Gnade eines friedvollen Schlafs schenken. Er allein konnte das schreckliche Rätsel der Krankheit in alterslose Gesundheit verwandeln. Er allein konnte den Schmerz einer Mutter lindern, die um ihr verlorenes Kind trauerte. Er allein …
Aber Gott in seiner unergründlichen Weisheit wartete. Um die Hütten wurden Feuer entzündet, und die Wege, Gärten und Höfe wurden mit dem Qualm ausgeräuchert. Aus den benachbarten Wäldern ertönten die Hiebe der Äxte und das Bersten stürzender Bäume, als die Männer das für die Feuer nötige Holz besorgten, damit diese niemals erloschen. Die scharfen, energischen Axtschläge in die Baumstämme hallten durch die klare, reglose Luft. Als sie die Wiesen und das Dorf erreichten, klangen sie auf seltsame Weise dumpf. So wie Nebel eine Kerzenflamme verbirgt und dämpft, so fing die stumme, drückende, mit der Krankheit verseuchte Luft diese Laute in einem vergifteten Netz.
Eines Abends fing mein Gesicht an zu brennen und ich zitterte unkontrolliert am ganzen Leib. Olga blickte mir kurz in die Augen und legte mir eine kalte Hand auf die Stirn. Dann zerrte sie mich schnell und wortlos zu einem abseits gelegenen Feld. Dort grub sie eine tiefe Grube, zog mich aus und befahl mir hineinzuspringen.
Während ich vor Fieber und Kälte zitternd dort stand, schüttete Olga die Erde zurück in das Loch, bis ich bis zum Hals begraben war. Dann trampelte sie sie fest und glättete sie mit der Schaufel, bis die Oberfläche völlig eben war. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass sich in der Nähe keine Ameisenhügel befanden, entzündete sie drei qualmende Torffeuer.
Auf diese Weise in die kalte Erde gepflanzt, kühlte mein Körper in wenigen Augenblicken wie die Wurzel einer welkenden Pflanze ab. Ich verlor jede bewusste Wahrnehmung. Ich wurde wie ein vergessener Kopfsalat Teil des großen Feldes.
Olga vergaß mich nicht. Mehrmals am Tag brachte sie kühle Getränke, die sie in meinen Mund schüttete und die direkt durch mich hindurch in die Erde zu sickern schienen. Der Rauch von den Feuern, die sie mit frischem Moos schürte, ließ meine Augen tränen und meinen Hals brennen. Wenn der Wind den Rauch gelegentlich mit sich riss, sah die Welt von ihrer Oberfläche aus gesehen wie ein grober Teppich aus. Die kleinen Pflanzen, die in der Nähe wucherten, ragten so hoch wie Bäume. Kam Olga, warf sie den Schatten einer Riesin.
Nachdem sie mich bei Einbruch der Dämmerung ein letztes Mal gefüttert hatte, warf sie frischen Torf auf die Feuer und zog sich in ihre Hütte zurück, um dort zu schlafen. Ich blieb allein auf dem Feld zurück, fest in der Erde verwurzelt, die mich immer tiefer zu ziehen schien.
Die Feuer brannten langsam, die Funken sprühten wie die Glühwürmchen in die unendliche Finsternis hinauf. Ich fühlte mich wie eine Pflanze, die sich der Sonne entgegenstreckte, unfähig, ihre Äste zu begradigen, gefangen gehalten von der Erde. Wieder hatte ich das Gefühl, dass mein Kopf ein Eigenleben gewonnen hatte, immer schneller rollte und eine schwindelerregende Geschwindigkeit annahm, bis er schließlich die Sonnenscheibe traf, die ihn am Tag so gnädig gewärmt hatte.
Manchmal, wenn ich den Wind auf der Stirn spürte, wurde ich ganz starr vor Entsetzen. In meiner Vorstellung sah ich Armeen von Ameisen und Kakerlaken, die einander Bescheid sagten und auf meinen Kopf zueilten, zu einer Stelle unter der Oberseite meines Schädels, wo sie ihre Nester errichten würden. Dort würden sie sich dann vermehren und meine Gedanken fressen, einen nach dem anderen, bis ich so leer wie die Schale eines Kürbisses war, aus dem man sämtlichen Inhalt geschabt hatte.
Laute weckten mich. Ich öffnete die Augen und war mir meiner Umgebung nicht sicher. Ich war mit der Erde verschmolzen, aber in meinem schweren Kopf regten sich träge Gedanken. Die Welt ergraute. Die Feuer waren erloschen. Auf meinen Lippen fühlte ich die Kälte von Tau. Tropfen blieben auf meinem Gesicht und in meinem Haar kleben.
Die Laute kehrten zurück. Über meinem Kopf kreiste ein Rabenschwarm. Einer landete mit breiten, raschelnden Flügelschlägen ganz in der Nähe. Er kam langsam auf meinen Kopf zu, während die anderen zu Boden sanken.
Voller Entsetzen betrachtete ich ihre leuchtenden, schwarz befiederten Schwänze und umherhuschenden Blicke. Sie staksten um mich herum, kamen immer näher, stießen die Köpfe in meine Nähe, sich unsicher, ob ich lebte oder tot war.
Ich wartete nicht auf das, was nun passieren würde. Ich schrie. Die überraschten Raben machten einen Satz zurück. Mehrere stiegen in die Luft empor, landeten aber nicht weit entfernt wieder. Dann starrten sie mich misstrauisch an und begannen ihren kreisrunden Marsch.
Wieder stieß ich einen Schrei aus. Aber diesmal bekamen sie es nicht mit der Angst zu tun und kamen mit wachsender Dreistigkeit immer näher. Mein Herz pochte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Erneut schrie ich, aber jetzt zeigten die Vögel keine Furcht. Sie waren keine zwei Schritte von mir entfernt. Ihre Körper wurden in meinen Augen immer größer, ihre Schnäbel immer grausamer. Die weit gespreizten, gekrümmten Klauen ihre Füße ähnelten riesigen Rechen.
Ein Rabe blieb vor mir stehen, nur Zentimeter von meiner Nase entfernt. Ich brüllte ihm direkt ins Antlitz, aber er zuckte nur leicht zusammen und öffnete den Schnabel. Bevor ich erneut brüllen konnte, pickte er nach meinem Kopf. Ein paar Haare verfingen sich in seinem Schnabel. Der Vogel hackte erneut nach mir, riss noch mehr Haare aus.
Ich schüttelte den Kopf von einer Seite zur anderen und löste die Erde um meinen Hals. Aber meine Bewegungen machten die Vögel nur neugieriger. Sie umgaben mich und hackten nach mir, wo sie Platz fanden. Ich rief laut, aber meine Stimme war zu schwach, um über die Erde zu steigen, und versickerte wieder im Boden, ohne Olgas Hütte zu erreichen.
Nun spielten die Vögel ausgelassener mit mir. Je wilder ich den Kopf drehte, umso mutiger wurden sie. Sie ignorierten mein Gesicht und hackten auf meinen Hinterkopf ein.
Meine Kräfte schwanden. Den Kopf zu bewegen kam mir vor, als würde ich einen schweren Getreidesack von einer Stelle zur nächsten schleifen. Ich geriet außer mir und nahm alles wie durch einen schwärenden Nebel wahr.
Ich gab auf. Ich war jetzt selbst ein Vogel. Ich versuchte meine kalten Gliedmaßen aus der Erde zu befreien. Ich streckte die Glieder und gesellte mich zu dem Rabenschwarm. Ein frischer, belebender Windstoß trug mich plötzlich in die Höhe, und ich stieg direkt in einen Sonnenstrahl auf, der wie eine gespannte Bogensehne auf dem Horizont lag. Meine geflügelten Gefährten erwiderten mein freudiges Krächzen.
Olga fand mich inmitten des Rabenschwarms. Ich war fast erfroren, und die Vögel hatten meinem Kopf tiefe Schnitte beigebracht. Sie grub mich schnell aus.
Nach mehreren Tagen kehrte meine Gesundheit zurück. Olga sagte, die kalte Erde habe mir die Krankheit aus dem Leib gezogen. Die Krankheit sei von einem Schwarm Geister aufgepickt worden, die die Gestalt von Raben angenommen und mein Blut gekostet hätten, um sich zu vergewissern, dass ich einer von ihnen war. Das war der einzige Grund, versicherte sie, aus dem sie mir nicht die Augen ausgehackt hatten.
Wochen vergingen. Die Seuche ließ nach, und frisches Gras wuchs auf den vielen neuen Gräbern, Gras, das niemand berühren durfte, weil es bestimmt das Gift der Seuchenopfer in sich trug.
Eines schönen Morgens wurde Olga zum Flussufer gerufen. Die Dörfler zogen einen gewaltigen Wels aus dem Wasser, aus dessen Maul lange Haare sprossen. Der Fisch sah kräftig und monströs aus, einer der größten, die man je in der Gegend gesehen hatte. Einer der Fischer hatte sich beim Einholen des Netzes eine Ader aufgeschnitten. Während Olga eine Aderpresse an seinem Arm anbrachte, um das herausschießende Blut zu stoppen, schnitten die anderen den Fisch auf und holten zu jedermanns Freude die unversehrt gebliebene Schwimmblase heraus.
Plötzlich und völlig unerwartet, in einem Augenblick, in dem ich arglos und entspannt gewesen war, hob mich ein dicker Mann hoch in die Luft und rief den anderen etwas zu. Die Menge applaudierte, und man reichte mich schnell von Hand zu Hand. Bevor ich begriff, wie mir geschah, wurde die große Schwimmblase ins Wasser geworfen und ich darauf. Die Schwimmblase sank ein Stück. Jemand stieß sie mit dem Fuß an. Ich trieb vom Ufer fort, klammerte mich verzweifelt mit Händen und Beinen an der schwimmfähigen Blase fest, tauchte gelegentlich in den kalten braunen Fluss und schrie und flehte um Gnade.
Aber ich trieb immer weiter ab. Die Leute rannten am Ufer entlang und winkten. Ein paar warfen Steine, die neben mir Wasser aufspritzen ließen. Einer hätte beinahe die Blase getroffen. Die Strömung trug mich schnell in die Flussmitte. Beide Ufer erschienen unerreichbar. Die Menge verschwand hinter einem Hügel.
Eine frische Brise, wie ich sie noch nie an Land gefühlt hatte, strich über das Wasser. Ich trieb flussabwärts. Mehrere Male versank die Schwimmblase fast völlig unter den leichten Wellen. Aber sie hüpfte immer wieder empor und segelte langsam und majestätisch weiter. Dann wurde ich abrupt in einen Strudel gezogen. Die Schwimmblase beschrieb einen Kreis, wurde fortgerissen und kehrte anschließend wieder an ihren Ausgangspunkt zurück.
Ich versuchte mit ihr zu wippen, um sie durch meine Bewegungen aus dem Kreis zu reißen. Der Gedanke, das die ganze Nacht tun zu müssen, versetzte mich in Angst und Schrecken. Sollte die Schwimmblase platzen, würde ich auf der Stelle ertrinken, das war mir klar. Ich konnte nicht schwimmen.
Die Sonne ging langsam unter. Bei jeder Drehung der Blase schien mir die Sonne direkt in die Augen, ihr blendendes Funkeln tanzte auf der schimmernden Wasseroberfläche. Es wurde kühler, der Wind frischte auf. Von einer neuen Bö angestoßen verließ die Blase den Wirbel.