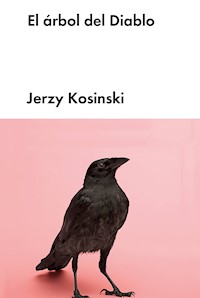7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der preisgekrönte Roman vom Bestsellerautor des Klassikers Der bemalte Vogel über die moralische und sexuelle Entfremdung eines Mannes. Verstörende Geschichten verbinden sich zu einem geheimnisvollen Kunstwerk, wie die vielen, aber zusammenhängenden Szenen in den Gemälden von Hieronymus Bosch. Von einigen Kritikern boykottiert, die seine explizite Erotik und brutale Gewalt verurteilten, gewann das Buch 1969 trotzdem den angesehenen National Book Award. David Foster Wallace hielt diesen Roman für völlig unterschätzt. Inzwischen gilt er als ein Meisterwerk und wird verglichen mit den Werken von Louis-Ferdinand Céline und Franz Kafka. Marcel Reich-Ranicki: »Obzön, brutal, poetisch – die in dem Buch dominierende Verquickung extremer Horror-Motive mit einer so kruden wie krassen Sexualität haben möglicherweise zu seinem großen Erfolg beigetragen. Ein erfreulicher Erfolg ist es aber auf jeden Fall. Denn worauf einige dieser Geschichten abzielen und was sie auf lapidare Weise lesbar machen, ist nicht weniger als der Kern unserer Existenz.« The New York Times Book Review: »Einer der bemerkenswertesten Romane der englischen Sprache … Céline und Kafka stehen hinter dieser vollendeten Kunst des gefeierten Autors von Der bemalte Vogel.« David Foster Wallace: »Eine Sammlung von unglaublich gruseligen kleinen allegorischen Skizzen, verfasst in einer knappen, eleganten Sprache, die ihresgleichen sucht. Nur Kafkas Fragmente kommen annähernd an das heran, was Kosinski in diesem Buch macht. Es ist besser als alles andere, was er je schrieb.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Sven-Eric Wehmeyer
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Steps
erschien 1968 im Verlag Random House, Inc.
Copyright © 1968 by Jerzy N. Kosinski
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Lektorat: Joern Rauser
Titelbild: Veselin Rangelov
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-190-5
www.Festa-Verlag.de
FÜR MEINEN VATER,
einen sanftmütigen Mann
Der Unstete kann das Selbst nicht erkennen, und Meditation ist für ihn unmöglich; wer aber nicht meditiert, kann keinen Frieden finden. Und wie kann es Glück geben für den Menschen, der friedlos ist?
BHAGAVADGITA
Ich reiste weiter nach Süden. Die Dörfer waren klein und arm; jedes Mal wenn ich in einem anhielt, versammelte sich eine Menschenmenge um meinen Wagen, und die Kinder verfolgten jede meiner Bewegungen.
Ich beschloss, ein paar Tage in einem kargen Dorf mit kalkgetünchten Häusern zu verbringen, um mich auszuruhen und meine Kleidung waschen und ausbessern zu lassen.
Die Frau, die diese Arbeit für mich übernahm, erklärte mir, sie könne den Auftrag zügig und ordentlich erledigen, da sie eine Gehilfin beschäftigte – eine junge Waise, die ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten musste. Sie zeigte auf ein Mädchen, das uns von einem Fenster aus anstarrte.
Als ich am folgenden Tag zurückkehrte, um meine Wäsche abzuholen, kam ich dem Mädchen im Vorderzimmer entgegen. Sie sah nur manchmal zu mir hoch. Wann immer unsere Blicke sich trafen, versuchte sie, ihr Interesse an mir zu verbergen, indem sie den Kopf tiefer und tiefer über ihre Näharbeiten beugte.
Während ich einige meiner Dokumente in der Tasche meines frisch gebügelten Jacketts verstaute, fiel mir auf, mit welcher verstohlenen Neugier sie meine Kreditkarten betrachtete, die ich vorübergehend auf den Tisch gelegt hatte. Ich fragte sie, ob sie wisse, was das sei; sie erwiderte, dass sie niemals zuvor etwas Ähnliches gesehen habe. Ich erklärte ihr, man könne mit jeder dieser Karten Möbel, Bettwäsche, Kochgeschirr, Essen, Kleidung, Strümpfe, Schuhe, Handtaschen, Parfüm und außerdem so gut wie alles andere kaufen, was man wollte – ohne Geld dafür bezahlen zu müssen.
In ungezwungenem Tonfall fuhr ich fort, ihr zu erklären, dass ich meine Karten auch in den teuersten Läden der benachbarten Stadt benutzen könnte und dass es genügte, sie vorzuzeigen, um in jedem Restaurant Essen serviert zu bekommen. Ich sagte, dass ich auf diese Weise in den besten Hotels wohnen könnte und in der Lage wäre, all das sowohl für mich selbst als auch für jeden anderen Menschen meiner Wahl zu tun. Ich fügte dies hinzu, weil ich sie mochte und fand, dass sie hübsch aussah. Und weil ich das Gefühl hatte, dass sie von ihrer Brotherrin schlecht behandelt wurde, wollte ich sie mit mir fortnehmen. Sie konnte so lange bei mir bleiben, wie sie wollte, falls das ihr Wunsch war.
Sie fragte, nach wie vor ohne mich anzuschauen, ob sie irgendwelches Geld bräuchte, als wollte sie es nur noch einmal bestätigt bekommen. Ein weiteres Mal versicherte ich ihr, dass weder sie noch ich irgendeine Menge Geld brauchen würden, vorausgesetzt, wir hätten die Karten dabei und wären bereit, sie zu benutzen. Ich versprach ihr, dass wir zwei gemeinsam in verschiedene Städte und sogar in verschiedene Länder reisen könnten; sie würde nicht arbeiten oder irgendetwas anderes tun müssen, als auf sich selbst aufzupassen. Ich wäre bereit, ihr alles zu kaufen, was sie wollte, sie würde wunderschöne Kleider tragen und entzückend für mich aussehen und ihre Frisur oder auch die Farbe ihres Haares so oft ändern können, wie sie wünschte. Damit es so käme, müsse sie nichts weiter tun als ohne ein Wort zu irgendjemandem spätabends ihr Haus verlassen und mich an dem Wegweiser am Rand des Dorfes treffen, sagte ich. Bei unserer Ankunft in der großen Stadt würde an ihre Brotherrin, so versicherte ich ihr, ein Brief geschickt werden, der erklärte, dass sie, wie schon so viele Mädchen vor ihr, von zu Hause weggegangen war, um eine Anstellung in der großen Stadt zu finden. Schließlich sagte ich ihr, dass ich an dem Abend auf sie warten würde und stark hoffte, dass sie auch käme.
Die Kreditkarten lagen auf dem Tisch. Sie stand auf und starrte sie voller Ehrfurcht an, in die sich aber auch eine Spur von Zweifel mischte; sie streckte ihre rechte Hand aus, als wollte sie sie anfassen, zog sie jedoch schnell zurück, sobald ich eine Karte nahm und sie ihr gab. Wie eine heilige Hostie hielt sie sie mit spitzen Fingern und hob sie dann zum Licht, um die darauf gedruckten Ziffern und Buchstaben genauer in Augenschein zu nehmen.
An diesem Abend damals parkte ich meinen Wagen einige Meter vom Straßenschild entfernt im Gebüsch. Bevor es vollständig dunkel wurde, kamen zahlreiche Karren auf dem Weg vom Markt zum Dorf an uns vorbei, doch niemand bemerkte mich.
Plötzlich tauchte das Mädchen hinter mir auf. Kurzatmig und verängstigt umklammerte sie ein Bündel mit ihren Habseligkeiten. Ich öffnete die Wagentür, winkte sie ohne ein Wort auf die Rückbank, startete unverzüglich den Motor und fuhr erst wieder langsamer, als wir das Dorf schon längst hinter uns gelassen hatten. Dabei erklärte ich ihr, dass sie jetzt frei sei und die Tage ihrer Armut vorüber wären. Für eine Weile saß sie ganz still da, und dann fragte sie mich unsicher, ob ich meine Karten noch hätte. Ich zog sie aus meiner Tasche und reichte sie ihr. Ein paar Minuten später konnte ich ihren Kopf nicht mehr im Rückspiegel sehen: Sie war eingeschlafen.
Spät am folgenden Vormittag kamen wir in der Stadt an. Sie wachte auf, klebte ihr Gesicht an die Scheibe und beobachtete den Verkehr. Plötzlich berührte sie mich am Arm und deutete auf das große Kaufhaus, an dem wir vorbeifuhren. Sie würde gern herausfinden, sagte sie, ob es stimmte, dass meine Karten mehr Macht ausüben konnten als Geld. Ich parkte den Wagen.
Drinnen im Laden hielt sie sich an meinen Arm geklammert, und ich spürte, wie ihr Handteller vor Aufregung feucht geworden war. Sie war, wie sie gestand, noch nie zuvor in einer Stadt gewesen, nicht einmal in einem kleinen Städtchen, und sie konnte kaum glauben, dass so viele Leute an einem einzelnen Ort zusammenkommen konnten und dennoch so viele Sachen zum Kaufen zurückließen. Sie deutete auf Kleidung, die ihr gefiel, und sie zeigte sich mit meinen gelegentlichen Hinweisen auf die Stücke einverstanden, die ihr – wie ich fand – am besten standen. Wir wählten, assistiert von zwei jungen Verkäuferinnen, die meine Begleitung mit unverhohlenem Neid anblickten, mehrere Paar Schuhe, Handschuhe, Strümpfe, ein wenig Unterwäsche, einige Kleider und Handtaschen sowie einen Mantel aus.
Jetzt war sie sogar noch verängstigter. Als ich sie fragte, ob sie befürchtete, meine Karten könnten nicht für all das aufkommen, was wir ausgesucht hatten, versuchte sie zunächst noch, ihre Befürchtungen abzustreiten, gestand diese dann aber schließlich doch ein. Warum, so fragte sie mich, mussten so viele Leute in ihrem Dorf ihr ganzes Leben lang arbeiten, um genug Geld zu verdienen, damit sie sich all das leisten konnten, was wir gekauft hatten, während ich, der ich weder ein berühmter Fußballspieler noch ein Filmstar war, offenbar gar kein Geld bräuchte, um all das kaufen zu können, was ich wollte?
Als unsere Einkäufe verpackt waren, reichte ich der Kassiererin eine der Karten; sie bedankte sich höflich bei mir, verschwand für einen Augenblick, kehrte dann zurück und gab mir die Karte zusammen mit der Quittung. Meine Freundin stand hinter mir und wirkte ungeduldig. Sie wollte sich die Schachtel greifen. Aber immer noch war sie viel zu ängstlich, um sich zu trauen.
Wir verließen das Kaufhaus. Als wir im Wagen saßen, öffnete das Mädchen das Paket und inspizierte ihre Sachen, berührte sie, roch an ihnen, berührte sie noch einmal, schloss dann die Schachtel und öffnete sie wieder. Während ich losfuhr, begann sie, die Schuhe und Handschuhe anzuprobieren. Wir hielten vor einem kleinen Hotel und gingen hinein. Den wissenden Blick des Rezeptionisten ignorierte ich und verlangte eine Suite mit benachbarten Zimmern. Mein Gepäck wurde nach oben getragen, doch das Mädchen bestand darauf, die große Schachtel selbst zu nehmen – als fürchtete sie, man könnte sie ihr stehlen.
In der Suite lief sie in ihr Zimmer, um sich umzuziehen, und kam in einem neuen Kleid wieder heraus. Sie stolzierte vor mir auf und ab, bewegte sich ungelenk in ihren hochhackigen Schuhen, betrachtete sich im Spiegel und ging wieder und wieder in ihr Zimmer zurück, um auch die anderen Kleidungsstücke anzuprobieren.
Die restlichen Päckchen, die die verschiedenen Unterwäscheartikel enthielten, wurden am späten Nachmittag von dem Geschäft geliefert. Mittlerweile war das Mädchen von dem Wein, den wir zum Mittagessen getrunken hatten, leicht beschwipst, und jetzt stand sie vor mir, als wollte sie mich mit ihrer neu erworbenen Weltläufigkeit beeindrucken, die sie offenbar in Filmen und Glamourzeitschriften gesehen hatte: So hatte sie die Hände in die Hüften gestemmt und befeuchtete die Lippen mit der Zunge, während ihr unsicherer Blick den meinen suchte.
***
Wir waren einige – ausschließlich archäologische – Assistenten und arbeiteten auf einer der Inseln zusammen mit einem Professor, der schon seit Jahren damit beschäftigt war, die Überreste einer uralten Zivilisation auszugraben, die ihre Blütezeit 15 Jahrhunderte vor unserer Epoche erlebt hatte.
Dabei handelte es sich um eine hoch entwickelte Kultur, wie der Professor behauptete, doch irgendwann musste eine gewaltige Naturkatastrophe sie ausgelöscht haben. Er hatte die vorherrschende Theorie angezweifelt, ein verheerendes Erdbeben, gefolgt von einer Flutwelle, hätte die Insel getroffen. Wir sammelten Bruchstücke von Keramik- und Tonwaren, durchsiebten Asche nach Überresten von Werkzeugen und Artefakten und förderten Baumaterialien zutage, die der Professor sämtlich als Belege für seine noch unveröffentlichte Studie katalogisierte.
Nach einem Monat entschied ich mich, die Ausgrabungen zu verlassen und eine benachbarte Insel zu besuchen. In meiner Hast, die Fähre zu erwischen, ging ich ohne meinen Lohnscheck davon, erhielt jedoch die Zusage, ihn mit der nächsten Postbarke geschickt zu bekommen. Einen Tag lang, das wusste ich, könnte ich mit dem Geld, das ich bei mir trug, noch über die Runden kommen.
Nach der Ankunft verbrachte ich den gesamten Tag damit, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Beherrscht wurde die Insel von einem schlafenden Vulkan, dessen ausgedehnte Hänge von porösem Lavagestein überzogen waren, das von Wind und Wetter derart verwittert war, dass es einen kargen, aber durchaus urbaren Boden bildete.
Ich ging zum Hafen hinunter; eine Stunde vor Sonnenuntergang, wenn die Luft sich abkühlte, legten die Fischerboote für die Nacht ab. Ich sah ihnen zu, wie sie über das ruhige, fast wellenlose Wasser glitten, bis sich ihre langen, geduckten Umrisse verloren. Mit einem Mal kam den Inseln das von ihren felsigen Graten reflektierte Licht abhanden und sie versanken in schroffer Schwärze. Und dann verschwanden sie eine nach der anderen, als würden sie lautlos unter die Meeresoberfläche gezogen werden.
Am Morgen des zweiten Tages ging ich zum Kai hinunter, um die Postbarke abzufangen. Zu meiner Bestürzung war mein Gehaltsscheck nicht mitgekommen. Ich stand auf dem Bootssteg und fragte mich, wovon ich nun leben sollte und ob ich überhaupt in der Lage wäre, die Insel zu verlassen. Ein paar Fischer hockten bei ihren Netzen und beobachteten mich; sie spürten, dass irgendetwas nicht stimmte. Drei von ihnen kamen zu mir und sprachen mich an. Ich verstand kein Wort von dem, was sie sagten, und antwortete in den zwei Sprachen, die ich beherrschte; ihre Mienen wirkten jetzt düster und feindselig, und schlagartig wandten sie sich ab. An diesem Abend nahm ich meinen Schlafsack mit zum Strand und schlief auf dem Sand.
Am nächsten Morgen gab ich mein letztes Geld für eine Tasse Kaffee aus. Nachdem ich die verwinkelten Gassen hinter dem Hafen entlanggeschlendert war, ging ich durch die Stoppelfelder zum nächstgelegenen Dorf. Die Dorfbewohner saßen im Schatten und beäugten mich heimlich. Hungrig und durstig kehrte ich wieder zum Strand zurück, während die Sonne auf mich niederbrannte. Ich besaß nichts, was ich gegen Essen oder Geld hätte eintauschen können: keine Uhr, keinen Füllfederhalter, keine Manschettenknöpfe, keine Kamera und auch keine Brieftasche. Zur Mittagsstunde, als die Sonne hoch am Himmel stand und die Dörfler in ihren Hütten Schutz gefunden hatten, suchte ich das Polizeirevier auf. Den einzigen Polizisten der Insel traf ich neben dem Telefon dösend an. Ich weckte ihn auf, doch er schien unwillig, selbst meine einfachsten Gesten verstehen zu wollen. Ich deutete auf sein Telefon und zog das Futter meiner leeren Hosentaschen heraus; ich machte Zeichen und malte Bilder, stellte pantomimisch sogar Durst und Hunger dar. All das erzielte jedoch keinerlei Wirkung: Der Polizist zeigte weder Interesse noch Einsicht und das Telefon blieb gesperrt. Es war das einzige auf der ganzen Insel; der Reiseführer, den ich gelesen hatte, hielt das sogar für wichtig genug, um auf diese Tatsache hinzuweisen.
Nachmittags flanierte ich im Dorf umher und lächelte die Bewohner an, in der Hoffnung, einen Drink angeboten zu bekommen oder zu einer Mahlzeit eingeladen zu werden. Niemand erwiderte meinen Gruß; die Dorfbewohner drehten mir den Rücken zu, und die Ladenbesitzer ignorierten mich einfach. Die Kirche befand sich auf der größten Insel der Gruppe, doch ich verfügte nicht über die Mittel, mich dorthin übersetzen zu lassen, um Essen und Unterkunft zu verlangen. Ich kehrte zum Strand zurück, als erwartete ich, dass Hilfe aus dem Meer auftauchte. Ich war ausgehungert und erschöpft. Die Sonne hatte mir hämmernde Kopfschmerzen verpasst, während Wellen von Schwindel über mich hinwegspülten. Unerwartet vernahm ich das Geräusch von Leuten, die sich in einer fremden Sprache unterhielten. Als ich mich umdrehte, sah ich zwei Frauen in der Nähe des Wassers sitzen. Faltige, graue, von dicken Adern durchzogene Fetthaut baumelte von ihren Schenkeln und Oberarmen; ihre vollen, sackartig hängenden Brüste waren in übergroße Büstenhalter gequetscht.
Sie nahmen ihr Sonnenbad und lagen ausgebreitet auf ihren Strandtüchern, von Picknickausrüstung umgeben: Proviantkörbe, Thermosflaschen, Sonnenschirme und Netze voller Obst. Auf dem neben ihnen aufgehäuften Bücherstapel waren die Bibliothekssignaturnummern deutlich zu erkennen. Offenbar waren sie Touristinnen, die bei einer einheimischen Familie wohnten. Zwar langsam, aber zielstrebig näherte ich mich ihnen, sehr darauf bedacht, sie nicht zu erschrecken. Sie hörten auf zu reden, und ich begrüßte sie lächelnd, nacheinander die mir zur Verfügung stehenden Sprachen benutzend. Sie antworteten jedoch in einer anderen. Wir hatten also keine gemeinsame Sprache, doch mir war wohl bewusst, dass Nahrung in der Nähe war. Ich ließ mich neben ihnen nieder, als hätte ich ihre Äußerungen als Einladung verstanden. Als sie zu essen begannen, beäugte ich die Lebensmittel; entweder fiel es ihnen nicht auf oder sie ignorierten meinen starren Blick. Nach ein paar Minuten bot mir die Frau, die ich für die ältere hielt, einen Apfel an. Ich aß ihn langsam, versuchte, meinen Hunger zu verbergen, und hoffte auf etwas Deftigeres. Sie sahen mich aufmerksam an.
Am Strand war es heiß, und ich döste ein. Doch ich wachte wieder auf, als die beiden Frauen sich aufrappelten, die Schultern und Rücken rot von der Sonne. Schweißrinnsale durchzogen den Sand, der an ihren schwabbeligen Schenkeln klebte, und das Bauchfett schob sich über ihre Hüften, während sie sich bückten und abstützten, um ihre Habseligkeiten einzusammeln. Ich half ihnen. Unter flirtendem Nicken gingen sie los, den inneren Rand des Strandes entlang; ich folgte ihnen.
Wir erreichten das Haus, das sie bewohnten. Beim Eintreten erfasste mich eine weitere Schwindelwelle; auf einer der Stufen stolperte ich und brach zusammen. Lachend und unermüdlich plappernd zogen mich die Frauen aus und hievten mich auf ein großes, niedriges Bett. Noch immer benommen, zeigte ich auf meinen Bauch. Sie zögerten keine Sekunde und beeilten sich, mir Fleisch, Früchte und Milch zu bringen. Bevor ich die Mahlzeit beenden konnte, hatten sie die Vorhänge zugezogen und sich die Badeanzüge vom Leib gerissen. Nackt fielen sie auf mich. Unter ihren schweren Bäuchen und breiten Rücken wurde ich begraben; meine Arme wurden gefesselt, mein Leib wurde befingert, gequetscht, bedrängt, flach gedrückt und beklopft.
Im Morgengrauen stand ich am Dock. Die Postbarke lief ein, doch weder gab es einen Scheck noch einen Brief für mich. Ich stand dort und sah zu, wie das Boot in die heiße Sonne zurückwich, die den Morgennebel auflöste und die fernen Inseln enthüllte, eine nach der anderen.
***
Ich war als Skilehrer angestellt und lebte in einem Höhenkurort, wohin man Tuberkulosepatienten zwecks Pflege und Heilung schickte. Ich bewohnte ein Apartment, von dem aus ich das Sanatorium sehen und die bleichen Gesichter der Neuankömmlinge von den gebräunten Gesichtern der Langzeitpatienten unterscheiden konnte, die sich auf den Terrassen sonnten.
Am Ende eines jeden Nachmittags kehrten meine ermüdeten Skiläufer in ihre Unterkünfte zurück, und ich ging wieder zu meinem einsamen Abendbrot. Die meiste Zeit verbrachte ich allein. Nach dem Abendessen verkündete das gedämpfte Läuten des Sanatorium-Gongs die Nachtruhe, und wenige Minuten später wurden die Lichter gelöscht, als würde die Dunkelheit von einem Fenster aufs nächste überspringen.
Von einer Hütte weit oben auf den Abhängen heulte ein Hund. Irgendwo schlug eine Tür krachend zu. Dann erblickte ich menschliche Umrisse, die sich durch den tiefen Schnee eines nahe gelegenen Feldes kämpften; die Skilehrer der benachbarten Herbergen rückten verstohlen zu ihren nächtlichen Treffen an. Aus der mächtigen Schwärze, die das Sanatorium umgab, stahlen sich Patientinnen, um mit ihren Liebhabern zusammenzukommen. Die Silhouetten berührten sich und verschmolzen miteinander, als wären sie Fragmente eines einzigen Schattens, die sich wieder zusammenfügten. Jedes Paar ging für sich. Im Mondlicht erschienen sie wie verzwergte Bergkiefern, die die Hänge heruntergekommen waren, um sich auf die windstillen Felder zu wagen. Bald waren sie allesamt verschwunden.
In den folgenden Wochen bemerkte ich, dass es einigen der kräftigeren Patienten erlaubt wurde, einen Teil des Tages draußen zu verbringen. Sie trafen sich beim Café am Fuß der Skipisten, und viele von ihnen taten sich mit den Urlaubern und den Angestellten zusammen. Im Schutz eines Fichtenhains konnte ich ziemlich häufig beobachten, wie sie paarweise davongingen, registrierte hin und wieder Partnerwechsel und prägte mir ein, wer besonders begehrt war und wer überhaupt keine Beachtung fand. Danach, also wenn der letzte Rest Tageslicht schwand und es sogar in meinem geschützten Beobachtungsposten plötzlich empfindlich kalt wurde, kehrte ich um und in meine Unterkunft zurück.
Es gab eine Frau, die ich ganz besonders im Visier hatte. Sie war kein schwerer Fall gewesen, und es hieß, ihre Genesung mache phänomenale Fortschritte: Am Ende des Monats sollte sie entlassen werden. Zwei Männer rivalisierten um sie – ein junger Skilehrer aus einem benachbarten Hotel und ein Tourist, der oft davon gesprochen hatte, den Kurort so lange nicht zu verlassen, bis auch diese Frau abgereist war.
Die Frau teilte ihre Zuwendung in gleichen Teilen zwischen den beiden Männern auf. Jeden Nachmittag kam der Tourist von seinem Hotel herübergeeilt, während der Lehrer auf Skiern heranfuhr, nachdem er seine Kursgruppe entlassen hatte. Die Frau saß in dem Café am Fuß der Pisten. Sie sah ihren beiden Verehrern zu, wie sie sich jeder auf seine Weise näherten.
Der Skilehrer spielte sein ganzes Können aus, kam in höchstmöglichem Tempo auf seinen Brettern angesaust, drehte noch im letzten Augenblick, wenn es schon fast zu spät schien, vor dem Geländer der Terrasse dramatisch ab und schleuderte eine Schneewolke vor den Tisch, an dem die Frau saß. Sein Rivale, offenbar nur ein eher mittelmäßiger Skifahrer, wanderte am Fuß der Pisten entlang und zwang so den Lehrer, das Tempo zu drosseln oder auszuweichen, da er auf diese Weise die Geschwindigkeit und Geschicklichkeit von dessen Abfahrt störte.
Eines Nachmittags kam ich bei dem Café an, bevor die Skikurse vorbei waren. Der Tourist war bereits da, anscheinend nicht gewillt, seine unbeholfenen Manöver bei den Skipisten fortzusetzen. Der Lehrer hatte seine Schülerschar auf die Idiotenhügel neben und über dem Café geführt. Als die Sonne zu sinken begann, verabschiedete er die Kursteilnehmer, raste jedoch nicht halsbrecherisch vom Gipfel des Abhangs zum Café herab, wie es sonst seine Gewohnheit war. Stattdessen bewegte er sich einen schneebedeckten Gebirgskamm entlang. Dieser Kamm war zu allen Zeiten mit Warnflaggen markiert und für alle mit Ausnahme inländischer Medaillengewinner verboten. Die Leute verließen ihre Tische und drängten sich am Terrassengeländer zusammen, um seinem langsamen Aufstieg zuzusehen. Die Frau sprang auf und rannte vom Restaurant weg zum Fuß des Hangs, wo sie auf ihn wartete. Der Tourist folgte.
Der Lehrer stieß sich ab und setzte sich in Bewegung, zunächst in weitläufigen, eleganten Kurven, wobei er die groben Felsvorsprünge umfuhr, die den Schnee durchbrachen und der Strecke den Ruf eintrugen, eine besonders gefährliche zu sein. Seine Geschwindigkeit nahm stetig zu, er beherrschte das Skilaufen tatsächlich mit der Geschmeidigkeit und Präzision eines wahren Meisters. Ich fragte mich, ob er an dem Pfosten, der das Ende der Strecke kennzeichnete, anhalten oder seine Fahrt mit einer spektakulären Drehung zu Füßen des Mädchens beenden würde. Keiner sagte ein Wort. Die langen, beinahe horizontalen Sonnenstrahlen fielen auf die Frau und den Touristen, während sie unten am Fuß der Rennstrecke standen.
Der Skilehrer schwang in die letzten 100 Meter ein, rasant und geradlinig. Das Mädchen schüttelte die Hand des Touristen ab, die auf ihrer geruht hatte, trat jetzt vor, hob die Arme und rief laut den Namen des Lehrers. Der Tourist stolperte ihr hinterher und packte sie bei der Schulter. Innerhalb einer Sekunde war der Lehrer ans Ende der Piste geflogen und spannte sich an, als wollte er zu einem Sprung ansetzen, doch anstatt sich nach vorn zu werfen und wieder aus seiner geduckten Haltung aufzurichten, schien es ihn in einer unnatürlich jähen Drehung nach links zu drängen. Er war nicht länger in der Lage, auszuweichen oder abzubremsen, seine Skier hoben sich, er segelte mit all der Wucht und all dem Schwung weiter, die die lange Abfahrt ihm verpasst hatte, und krachte plötzlich mit seiner Schulter in die ungeschützte Brust des Mannes. Beide Körper glitten ein gutes Stück die Piste hinunter und kamen schließlich am Rand der Terrasse zum Stillstand. Die Menge hastete zu ihnen; aus der Nase des Touristen tropfte Blut, er war bewusstlos, und man trug ihn ins Café. Der Lehrer saß ein paar Minuten lang auf den Stufen der Terrasse, den Kopf in die Hände gelegt, während die Frau ihm seinen Skiparka öffnete. Dann fuhr der Notarztwagen vor, und der Tourist, noch immer ohne Bewusstsein, wurde auf die Tragbahre geschnallt. Als die Sanitäter ihn anhoben, warf ich einen flüchtigen Seitenblick zur Terrassentreppe. Der Lehrer und die Frau waren nirgendwo mehr zu sehen.
***
Erst sehr viel später traf ich den Skilehrer wieder. Und dann sah ich ihn eines Abends zusammen mit einer Frau.