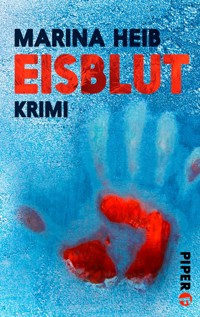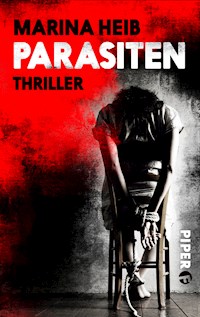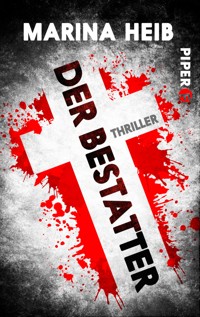
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein beklemmender Thriller: Sonderermittler Christian Beyers erster Fall Sie nennen ihn den »Bestatter«, weil er bei jeder Leiche einen Bibelvers hinterlässt. Der tote Junge auf der Waldlichtung ist bereits sein viertes Opfer. Das vierte tote Kind. Kommissar Christian Beyer und seine Sonderermittler müssen den Täter finden, bevor er noch einmal zuschlagen kann. Doch noch immer gibt es keine Spur, nichts, was die Opfer verbindet … Bei "Der Bestatter" handelt es sich um eine Neuauflage des bereits im Piper Verlag unter dem Titel "Weißes Licht" erschienenen Werkes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Für Artur
ISBN 978-3-492-98102-6 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © Piper Verlag GmbH, München 2006 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Ihnatovich Maryia / shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 2. Auflage 2011
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Man kann in das Haus hineinsehen, wenn man will. Normalerweise tut man das nicht bei fremden Häusern, es ist ja auch sehr indiskret und gehört sich deshalb nicht. Aber hier kann man, wenn man will. Denn dieses Haus ist ein Musterhaus. Ein Musterhaus für die junge Familie. Bewohnt von mustergültigen Menschen. Gebaut nach modernsten Standards, alles schön hell, Wohnzimmer mit Schiebetüren aus Glas zur Terrasse, Küche, Elternschlafzimmer nach hinten, Bad, Gästetoilette, Kinderzimmer, Vollkeller mit Partyraum. Wenn man will, kann man sogar eine Sauna einbauen, soviel Platz ist im Keller. Der pflegeleicht angelegte Garten ist nicht einsehbar. Viele Familien träumen von einem solchen Haus. Es ist wirklich besonders, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht. Manche Familienväter glauben protzen zu müssen seit dem Wirtschaftswunder. Mit einem dieser neumodischen Bungalows, einem Mercedes Strich Acht vor der Tür und riesigen Klingelschildern aus Messing. Doch dieses Musterhaus ist was für die normale Familie, die unauffällig ihr kleines, privates Glück leben will. Ohne gestört zu werden durch die neidischen Blicke der Nachbarn.
Jetzt zum Beispiel ist in diesem Haus, wie in allen anderen Häusern in dieser Straße, in dieser Stadt, ein ganz normaler Abend im Dezember. Es ist still, der Schnee, der sich an den Straßenrändern fast einen Meter hoch türmt und auf der Fahrbahn zu einer zentimeterdicken Schicht verdichtet ist, schluckt die Fahrgeräusche der wenigen Autos, die um diese Uhrzeit noch unterwegs sind. Es ist fast halb zwölf. Im Wohnzimmer, das einen aufgeräumten und gepflegten Eindruck macht, sitzt die Mutter auf der Wohnlandschaft aus braunem Cord. Das Strickzeug liegt unberührt in ihrem Schoß, sie starrt ins Leere. Man könnte denken, sie sei mit offenen Augen eingenickt oder warte abwesend auf irgend etwas. Die Fensterläden sind fest verschlossen, nur eine Stehlampe wirft ihren Lichtkegel auf den Couchtisch. Die Doppelflügeltür zum Flur steht offen.
Es ist alles ganz still. Bis die Tür geöffnet wird, die nach unten zum Partykeller führt. Der Vater tritt auf den Flur, in den Armen hält er seinen neunjährigen Sohn. Der Junge trägt eine bunte Unterhose mit kleinen Elefanten drauf. Er scheint ein wenig zu frieren. Ohne ins Wohnzimmer zu blicken, geht der Vater mit seinem Sohn stumm nach oben ins Kinderzimmer. Die eine Wand des Kinderzimmers ist blau gestrichen. Irgend jemand hat mit wenig Geschick Delphine auf die blaue Wand gemalt. Vor der Wand steht das Kinderbett. Der Vater läßt den Jungen aus seinen Armen ins Bett gleiten und deckt ihn liebevoll zu. Der Junge hat bislang kein Wort gesprochen. Keiner hat bislang auch nur irgendein Wort gesprochen.
»Möchtest du Willi haben?« fragt der Vater ihn sanft. »Willi ist fort«, antwortet der Junge tonlos. Der Vater sieht sich um und entdeckt den Teddy auf einem Kinderstuhl sitzend vor der blauen Wand, direkt neben dem Bett. »Hier ist er doch«, sagt der Vater. Er nimmt den zotteligen Bären und legt ihn dem Jungen aufs Kopfkissen, direkt neben sein Gesicht.
»Schön hast du das gemacht. Braver Junge. Nimm Willi und schlaf jetzt«, sagt der Vater mit ruhiger Stimme. Er drückt dem Jungen einen Kuß auf die Stirn und geht hinaus. Der Junge schubst den Teddy aus dem Bett und vergräbt sein Gesicht im Kissen. Er schämt sich, aber er weiß nicht warum. Sein Kopf ist so schwer. Alles tut weh. Dann kommt die Mutter herein. Sie zieht das Bettlaken wieder zurück, zieht dem Jungen den Schlüpfer mit den Elefanten herunter und reibt stumm seinen geröteten kleinen Pimmel und den blutenden Anus mit Wundsalbe ein.
Freitag, 24. Juni
»Ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Ein kurzes Stück.« Der Beamte, der Christian und sein Team vom Flughafen abgeholt hatte, parkte das Auto an einer Verbreiterung des Weges, ganz eng an den Bäumen, durch die sich ein Pfad hindurchschlängelte. Christian öffnete die Beifahrertür und stieg entschlossen aus dem Wagen. Sein rechter Fuß landete in einer tiefen Pfütze. Er nahm es mißgelaunt zur Kenntnis und schlug den Kragen seiner zerknitterten Sommerjacke hoch. Dennoch lief ihm der Regen sofort durch die dichten schwarzen Locken in den Nacken. Er fluchte laut.
Eberhard, Volker und Karen entstiegen kommentarlos dem Fond des Autos, nahmen ihre Einsatztaschen aus dem Kofferraum und folgten Christian und dem Beamten bergab, den schlammigen Pfad entlang. Seit Stunden schüttete es wie aus Kübeln. Der Waldboden war inzwischen so aufgeweicht, daß er die Schuhe der Fußgänger ansaugte und sie bei jedem ihrer Schritte nur mit widerwilligem Schmatzen wieder freigab. Innerhalb weniger Minuten waren die fünf vollkommen durchnäßt, denn die Bäume standen nicht so eng, daß ihr Blätterdach Schutz bot vor den heftigen Sturzbächen, die sich aus dicken, bedrohlich tief hängenden dunklen Wolken ergossen.
Christian verdammte leise vor sich hin brummelnd das beschissene Wetter, den dieses Jahr viel zu kalten Juni, die feindselige Natur, die nutzlosen Meteorologen, die sich wieder mal geirrt hatten und also schuld waren, daß er das falsche Schuhwerk trug, er verfluchte sich selbst, weil er dem Wetterbericht geglaubt hatte, er verfluchte die Schuhindustrie, die nicht mal in der Lage war, ihre überteuerten Produkte zu imprägnieren, weswegen er schon nach dem ersten Schritt das Gefühl einer schweren, nassen Zeitung an den Füßen hatte, er verfluchte die profitgeile Wirtschaft, die korrupten Politiker, das Leben im allgemeinen und schließlich und ganz besonders und vor allem den Tod im speziellen, denn der führte ihn hierher in dieses unwirtliche, klamme Schlammbad.
Er war stinksauer. So sauer, daß seine grünen Augen noch grüner blitzten als sonst. Er war immer stinksauer, wenn er aus einem Flugzeug stieg. Weil er überhaupt wieder in eines eingestiegen war. Weil ihn die Angst völlig fertigmachte. Weil er wußte, wie seine Kollegen sich bemühten, es nicht zu bemerken. Weil er innerlich zu einem sabbernden Jammerlappen mutierte, der die zitternden Knie, den flauen Magen und den Selbsthaß nach der Landung einzig und allein mit dieser Stinkwut bekämpfen konnte. Er mußte einfach Dampf ablassen. Vor allem nach diesem besonders elenden Flug in dem elenden kleinen Cityhopper, der in einem elenden Auf und Ab und Hin und Her durch die Wolkenschichten getaumelt war, ständig damit drohend, sich den Naturgewalten zu ergeben und einfach nach unten zu stürzen, während die Passagiere in einem kollektiven Aufschrei ihre elenden Leben an sich vorbeiziehen sähen bis zu ihrem elenden Tod, wenn ihnen die Wucht des Aufpralls ein Ende bereiten würde.
»Wir sind da.« Der Beamte, dem sie den Trampelpfad entlang gefolgt waren und dessen Namen Christian schon wieder vergessen hatte, trat zur Seite und gab den Blick frei auf eine in trübem Grün, Braun und Grau komponierte Szenerie. Der Pfad mündete auf einen Waldweg vor einer Lichtung, die nach hinten von einem großen Felsen begrenzt wurde, in den zwei Figuren eingemeißelt waren. Rechts davon öffnete sich der Wald zu einem sanft geschwungenen, vom Regen verhangenen Tal. Vor dem Felsen war behelfsmäßig mit mehreren in den weichen Boden gebohrten Metallstangen eine weiße Plastikplane aufgespannt worden, um die Leiche und ihre unmittelbare Umgebung vor dem Regen und damit dem völligen Verwischen vorhandener Spuren zu schützen. Ein rotweißes Absperrband säumte den in Planquadrate unterteilten Fundort weiträumig. Die Spuren waren mit Tafeln markiert und systematisch numeriert. Etwas entfernt von der Plane, die unter dem Gewicht des Regenwassers bedrohlich durchhing, außerhalb der Spurenschutzzone, stand schweigend eine Gruppe von vor Nässe triefenden Beamten, aus der sich ein kleiner, älterer Mann in Zivil löste und auf Christian zuging. Er streckte die Hand aus. Christian ergriff sie.
»Sie müssen Hauptkommissar Beyer sein. Ich bin Kommissar Günter Philipp, herzlich willkommen im Saarland. Schön, daß Sie so schnell kommen konnten. Wie war der Flug?«
Christian ignorierte die Frage, zwang sich zum Minimum sozial geforderter Höflichkeit und begann, Philipp mit knappen Worten sein Team vorzustellen: »Karen Kretschmer, Rechtsmedizinerin.«
Philipp begrüßte die attraktive, junge Blondine angetan: »Sehr erfreut. Unser Doc war schon hier und hat sich die Leiche angesehen, damit wir keine Zeit verlieren, bis Sie da sind. Er wartet im Institut, um Ihnen bei der Sektion zu assistieren.« Karen nickte nur, wohl wissend, daß jede Verzögerung durch überflüssiges Geplauder Christian in diesem Moment nur verärgern würde.
»Volker Jung und Eberhard Koch«, fuhr er nun ungeduldig mit der Vorstellung fort. Philipp schüttelte ihnen die Hand und faßte zusammen: »Ein Jogger hat die Leiche heute morgen um sieben Uhr vierzehn entdeckt. Er ist im Präsidium und gibt seine Aussage zu Protokoll. Wir waren kurz vor acht Uhr hier, ich habe Sie gleich benachrichtigen lassen. Der Sicherungsangriff ist von unserer Seite so gut wie abgeschlossen, Beweismittel, Pflanzen- und Bodenproben sind gesammelt, Skizzen und Fotos gemacht worden. Viel zu sehen gibt es allerdings nicht. Hier regnet es schon seit Tagen.«
Christian hörte Philipp nur noch mit halbem Ohr zu, sein Blick und seine Konzentration waren auf die Leiche unter dem Plastikbaldachin gerichtet, der er sich nun langsam näherte. Karen, Eberhard und Volker hielten sich still im Hintergrund. Sie wußten von gemeinsamen Tatortbegehungen, daß ihr Chef, bevor er seinen analytischen Verstand einschaltete, erst einmal ein Gefühl für die Atmosphäre am Schauplatz entwickeln wollte. Plötzlich war es still über der Lichtung, keiner sprach mehr, keiner außer Christian bewegte sich. Selbst die Vögel blieben stumm. Nur Christians leise, schmatzende Schritte waren zu hören und das gleichmäßige Trommeln des Regens auf den Blättern.
Der Körper lag in etwa einem Meter Entfernung mittig vor dem Felsen, aufgebahrt auf einem offensichtlich sorgsam zusammengetragenen Bett aus Reisig und Laub. Rechts und links vom Kopf der Leiche standen zwei große cremefarbene Kerzen im Boden, deren Dochte zwar schwarz, aber kaum abgebrannt waren, vermutlich waren sie kurz nach dem Anzünden durch den Regen gelöscht worden. Die Leiche war in ein ehemals weißes Laken gehüllt, das inzwischen durchnäßt und fleckig war. Nur die über dem Tuch gefalteten Hände waren zu sehen. Schmutzige Finger, abgekaute Nägel. Und das Gesicht lag frei, ein Gesicht, so wächsern und bleich wie die Kerzen. Dunkle Haare, klatschnaß. Die Augen geschlossen. Ruhig. Ein Junge. Höchstens neun Jahre alt. Weiß. Rein. Unschuldig. Tot.
Christian blieb einige Minuten stumm vor dem Jungen stehen, betrachtete ihn. Dann wandte er sich langsam um und gab seinen Leuten das Zeichen zu beginnen. Wortlos kamen sie herbei, einer nach dem anderen. Karen begutachtete die Leiche. Volker und Eberhard vollzogen die Tatortarbeit nach, die von den saarländischen Beamten schon geleistet worden war. Doch sie mußten sich ein eigenes Bild machen und dabei überprüfen, ob etwas übersehen oder verfälscht worden war. Während sie wie immer sehr leise ihrer Arbeit nachgingen, fotografierten, filmten, suchten und untersuchten, Vergleichsmaterial sammelten, protokollierten, verpackten, hielten Philipp und seine Beamten respektvoll Abstand, was Eberhard, Volker und Karen angenehm überrascht zur Kenntnis nahmen. Vor einer Woche noch hatten sie bei ihren Ermittlungen wegen der letzten Leiche, die südlich von Augsburg gefunden worden war, mit der arroganten Mißgunst der bayrischen Beamten zu kämpfen gehabt, die sich durch die norddeutsche SOKO bevormundet fühlten.
Unterdessen stellte sich Christian auf die andere Seite der Lichtung in etwa zehn Meter Entfernung, um ein Gesamtbild des archaisch wirkenden Arrangements in sich aufzunehmen. Sein Gesicht, dieses Sammelsurium von attraktiven, aber kaum zueinander passenden Einzelteilen, die durch tiefe Furchen teils voneinander getrennt, teils durch sie verbunden waren, schien trotz völliger Bewegungslosigkeit in den untersten Muskelschichten zu arbeiten.
Christian spürte weder den Regen, der ihm durch die Haare übers Gesicht und in den Kragen lief, noch die Schwere seiner nassen Klamotten. Wie hypnotisiert starrte er auf den toten Jungen, starrte und starrte, als wartete er auf irgendwas, vielleicht ein Wunder, und das Kind könnte sich plötzlich erheben und lächeln, und alles wäre gut, doch das war es nicht, er löste den Blick, ließ ihn wandern, auf die Kerzen, den Felsen, das Leichentuch, den Jungen, die Bäume, er sog den modrig-feuchten Duft des Waldbodens ein, ließ das satte Grün der Laubbäume wirken, das monotone Tropfen des Regens von den Blättern. Wie lange war er schon nicht mehr im Wald gewesen? Monate vermutlich. Nein, fast ein Jahr. Als er noch zusammen mit Mona und ihrer Kampfhundattrappe … Christian unterbrach seine abschweifenden Gedanken energisch, denn ihm war klar, daß der menschliche Geist sich gerne Schlupflöcher sucht, um der Beschäftigung mit einem Anblick, wie er ihn gerade vor sich hatte, zu entkommen. Er atmete schwer, ohne es zu bemerken. Er konzentrierte sich, ohne zu denken. Er nahm Fährte auf.
Etwa eine Stunde später trat Eberhard flüsternd zu ihm: »Nette Kollegen hier im Saarland, sehr dezent – zumindest seit wir hier sind. Aber vorher muß eine Horde Bullen ’ne Stampede über die Spuren gelaufen sein. Sieht nicht sehr ergiebig aus. Und dann noch der Regen. Naja, wir werden sehen.«
Sorgfältig trocknete und verstaute Eberhard seine Kameras. Karen packte ihr Diktiergerät weg, zog ihre Handschuhe aus, stopfte sie in einen Plastikbeutel und legte alles in ihr Köfferchen. Volker gab die Asservatenliste, die er auf Vollständigkeit und Systematik geprüft hatte, an Philipp zurück. Dann kamen auch Karen und Volker zu Christian.
Alle vier standen stumm vor der Leiche des Jungen, aufgereiht wie ein Chor, bereit, die letzte Hymne zu singen, bis Volker leise, fast andächtig aussprach, was alle beschäftigte: »Es sieht schön aus. Sehr ästhetisch.«
Christian löste sich von dem Anblick und wandte sich an die Saarländer: »Was ist das für ein Felsen hier? Was sind das für eingemeißelte Figuren?«
Philipp blickte fragend zu seinen Beamten. Der Fahrer, der Christian und seine Leute hergebracht hatte, wußte als einziger etwas zu sagen: »So was Vorsintflutliches. Ist uralt. Wird Hänsel und Gretel genannt.«
In diesem Moment krachte lautstark die Plane von einem der Halterungsstäbe, mehrere Liter angesammeltes Regenwasser ergossen sich in einem klatschenden Schwall über die Leiche, gleichzeitig riß der Himmel auf, und ein Sonnenstrahl brachte die Wassertropfen auf dem wachsweißen Kindergesicht zum Glitzern. Über dem Tal stieg ein Regenbogen empor.
Am Nachmittag des gleichen Freitags fuhr Anna Maybach mit ihrem alten Saab-Cabrio knirschend die Kiesauffahrt hinauf zum herrschaftlichen Elternhaus in der Hamburger Elbchaussee, vorbei an den akkurat gestutzten Buchsbäumchen, den prächtig blühenden Rhododendren, bis direkt vor die fünf Steinstufen, die zur Haustür führten. Anna ließ den Kies beim schwungvollen Einparken ein wenig aufspritzen, so daß einzelne Steinchen gegen die kunstreich vergitterten Kellerfenster schepperten. Sie stieg aus, knallte die Tür zu. Eine Amsel sang unbeeindruckt von diesem wenig friedlichen Auftritt weiter vor sich hin. Manchmal beschlich Anna im Garten ihrer Eltern der Verdacht, daß ihre Mutter sogar die Vögel selektierte, nach Stammbaum und klassischer Ausbildung. Diebische Elstern und unmelodisch krächzende Krähen bekamen schlicht keine Aufenthaltsgenehmigung.
Anna klingelte an der Haustür. Ihr allmonatlicher Besuch. Der Gong spielte die ersten vier Töne von Beethovens Fünfter: So pocht das Schicksal an die Pforte. Anna verzog das Gesicht, als sie das aufgeregte Getrippel ihrer Mutter auf dem Marmor der Eingangshalle hörte. Die Tür ging auf, und ein prüfender Blick musterte Anna blitzschnell von Kopf bis Fuß. Offensichtlich war Evelyn Maybach mit dem Erscheinungsbild ihrer Tochter zufrieden, denn sie umarmte Anna: »Wie schön, daß du da bist, wenn auch verspätet. Gut siehst du aus. Komm doch rein. Papa wartet schon.«
Anna folgte ihrer Mutter in den Salon, in dem die Schritte durch Teppiche aus Isfahan und Islamabad gedämpft wurden. Die pastellfarbenen Vorhänge waren geschlossen, so daß das Sonnenlicht weder die Teppiche noch die ebenfalls pastellfarbene Seidentapete ausbleichen konnte. Evelyn sah sich irritiert um: »Wo ist Walter denn plötzlich? Eben war er noch …«
Anna unterbrach ihre Mutter geringschätzig: »Als ich geklingelt habe, hat er sich in die Bibliothek zurückgezogen, um mich für meine …«, Anna blickte kurz auf ihre Armbanduhr, »… zehnminütige Verspätung zu bestrafen. Die du im übrigen auch nicht unkommentiert lassen konntest.«
Evelyn warf ihrer Tochter einen bittenden Blick zu: »Jetzt sei doch nicht so. Ich hole ihn.«
Während Evelyn zur Bibliothek trippelte, ließ Anna sich auf einem Stuhl nieder. Der Kaffeetisch war üppig gedeckt. Anna nahm ihren Seidenschal vom Hals und band sich damit die langen dunklen Haare hoch. Ihr Vater mochte es, wenn sie die Haare offen trug. Sie sah auf den Tisch: Sahnetorte für den leptosomen Vater, trockener Nußkuchen für sie und ihre etwas zu füllige Mutter – um der schlanken Linie willen war Sahne für Frauen im Maybachschen Haushalt ein Zeichen primitivster Disziplinlosigkeit. Anna schaufelte sich ein Stück Sahnetorte auf den Teller. Als ihr Vater eintrat, ein attraktiver, großgewachsener Endsechziger mit wilden grauen Haarbüscheln über der hohen Stirn und einer markanten Nase, erhob sie sich nicht.
»Hallo, Walter«, sagte sie so beiläufig wie möglich.
»Bleib ruhig sitzen«, erwiderte ihr Vater mit leichtem Grinsen. Er blickte auf die Sahnetorte: »Sind wir heute wieder spätpubertär rebellisch? Mit 34?«
»35. Vater.«
»Sie hat nur ein schlechtes Gewissen wegen der Verspätung«, bemühte sich Evelyn sofort um Deeskalation.
Walter strich seiner Frau zärtlich über die Wange: »Schon gut. Wir spielen doch nur, Häschen.«
Das Spiel, wie Walter es nannte, existierte in der Standard- und der verschärften Professional-Version. Welche Version gespielt wurde, bestimmte der erste Zug, der immer Anna vorbehalten war. Heute hatte sie durch ihre nur geringe Verspätung und das der bürgerlichen Elbchaussee-Domäne angepaßte Kostümchen die Standard-Variante eröffnet. Nach dem Kaffee, der zu kontroversen Diskussionen über Politik und Kultur Hamburgs eingenommen worden war, stolperte Evelyn, die die Spielregeln noch nie begriffen hatte, ahnungslos in die Professional-Version:
»Frau Dosse hat im Vorlesungsverzeichnis ihres Sohnes gelesen, daß du wieder einen von deinen gräßlichen Vorträgen hältst.«
»Ja, Mama. Heute abend.«
»Muß das denn sein? Du verdienst doch genug Geld.«
»Ja, Mama.«
Evelyn seufzte, Walter stichelte: »Unsere Tochter interessiert sich nun mal brennend für Gewalt.«
Evelyns Gesicht verfinsterte sich.
»Davon willst du nichts hören, Mama, ich weiß«, fügte Anna schmallippig hinzu. Abrupt erhob sich Evelyn und forderte die beiden auf, in der Bibliothek noch einen Cognac zu nehmen. Zur Feier des Tages.
Als sie dort in den Clubsesseln aus Saffianleder zwischen Hunderten von Büchern Platz genommen hatten, ihre dezent gefüllten Cognacschwenker in der Hand, zeigte Walter auf den Schachtisch aus Ahorn und Ebenholz, auf dem die Figuren aufgestellt waren.
»Wir haben schon lange nicht mehr gespielt«, sagte er.
»Du meinst Schach?« gab Anna zurück.
Er nickte. »Wann hättest du denn Zeit?«
Anna gab keine Antwort.
»Dein Vater hat dich was gefragt«, mischte Evelyn sich ein.
Anna blickte ihre Mutter verächtlich an: »In dieser Familie gibt es viele Fragen, die nicht beantwortet werden.« Dann wandte sie sich an ihren Vater: »Wenn ich den blutroten Faden von eben noch einmal aufgreifen darf. Vater. Wie du sehr wohl weißt, interessiere ich mich mitnichten für Gewalt, sie stößt mich ab, du hast keine Vorstellung, wie sehr. Mich interessiert die Rezeption von Gewalt. Ich werde heute über die Psyche von Frauen referieren, die sich in Killer verlieben. Einige heiraten sogar mehrfache Mörder noch im Knast, ohne sie jemals in Freiheit erlebt zu haben. Ich rede über weibliche Verhaltensmuster, über Opferrolle, Helfersyndrom, Angst, Sehnsucht, Nähe …«
»Du weißt, daß ich mich für alles ereifern kann, was du tust und denkst, ich fürchte nur, daß ich als komplett der schnöden Materie verhafteter Physiker wenig Wesentliches zu dem tiefenpsychologisch sicherlich hochspannenden Thema beizutragen habe.« Walter schwenkte blasiert seinen Cognac im Glas.
»Bei deiner umfassenden Bildung?« spöttelte Anna, »und deiner Lebenserfahrung? Komm, sag doch mal, wie würdest du die Bedürftigkeit von Frauen bewerten, die einem Killer wie Schmökel Liebesbriefe schreiben? Als Laie, der du ja angeblich bist.«
Walter, inzwischen nur noch wenig amüsiert, sah Anna in die Augen: »Was ist mit deiner Bedürftigkeit? Kannst du mir sagen, wie du beurteilst, was du gerade brauchst? Wenn du mich fragst: Das ist billig.«
Walter erhob sich und ging hinaus. Evelyn hatte einen leidenden Ausdruck angenommen. Anna sah in ihr Glas. Walter hatte recht. Der Punkt ging an ihn. Sie stand langsam von ihrem Sessel auf und stellte sich beschämt wie ein kleines Kind vor ihre Mutter.
»Tut mir leid«, flüsterte sie.
Evelyn erhob sich ebenfalls und nahm Anna in die Arme. Anna verkrampfte sich sofort. Die Umarmung war ihr ebenso unangenehm wie ihre deutlich spürbare Verkrampfung. Umständlich löste sie sich von ihrer Mutter und nuschelte, den Blick abgewandt: »Ich muß gehen.«
Später, zu Hause in ihrer kleinen Stadtvilla im Generalsviertel, herausgeschält aus den Prada-Pumps und dem schicken Kostüm, zurück in der verbeulten Jogginghose, die Bierflasche am Mund und Eminem im Ohr, bekam sie wieder Boden unter die Füße. Holzdielen statt Marmor. Warm und lebendig. Noch zwei Stunden bis zu ihrem Vortrag. Energisch stellte sie die Musik lauter, öffnete die Fenster und ertappte sich dabei, darauf zu hoffen, daß der von sich selbst gelangweilte Nachbar herüberkäme, um sich über die Musik zu beschweren. Den würde sie in der Luft zerreißen. Doch sofort fand Anna die Vorstellung, sich an einem harmlosen Idioten für den unerfreulichen Nachmittag mit ihren Eltern zu rächen, reichlich demütigend. Im Grunde war sie nur böse auf sich selbst. Weil sie regelmäßig in die gleichen Fallen tappte. Als wüßte sie es nicht besser.
Der Abend dämmerte langsam über dem St. Johanner Markt in Saarbrücken, als Volker und Eberhard satt und zufrieden ihre Steakmesser beiseite legten und synchron nach ihrem Bier griffen. Seit dem Mittag im Wald hatte es nicht mehr geregnet, inzwischen hatte sich die Luft sogar so erwärmt, daß man auf einen nun endlich, immerhin Mitte Juni, beginnenden Sommer zu hoffen wagte. Sie saßen draußen vor der »Tante Maya« mit Blick über den kleinen, mit Kopfstein gepflasterten Marktplatz, eine Empfehlung von Kommissar Philipp, der sie auch in einem nahe gelegenen Hotel untergebracht hatte. Vor zwei Stunden hatten sie ihre spurenkundliche Arbeit beendet, den Zeugen vernommen, Philipp bei der lokalen Ermittlungsplanung unterstützt und die weitere Vorgehensweise koordiniert. Christian war mit bei der Sektion der Kinderleiche, die Karen in der Homburger Uniklinik, dem Sitz der Saarbrücker Rechtsmedizin, durchführte. Außerdem wollte die Pathologin noch einige serologische und toxikologische Untersuchungen vornehmen. Die beiden würden später zum Essen nachkommen. Karen legte keinen großen Wert auf Eberhards Anwesenheit bei ihrer Arbeit, seit ihm bei der Untersuchung einer Wasserleiche schlecht geworden war. Und Volker leistete lieber Eberhard bei einem blutigen Steak Gesellschaft als Karen bei ihrer blutigen Arbeit.
Eberhard Koch, 34 Jahre alt, gutaussehend, durchtrainiert und wegen seines zum Hobby passenden Nachnamens »Herd« genannt, gehörte seit fünf Jahren zu Christians Team. Er war ein hervorragender Kriminaltechniker und Christians Spezialist für Tatortarbeit: ein akribischer Geist mit scharfem Auge, dem einfach nichts entging, geschätzt und zugleich berüchtigt für seine penible Art, die ganz und gar nicht zu seinen Ausbrüchen albernen Humors zu passen schien. Er lebte mit seiner Frau und seinen zwei Kindern zusammen, die er abgöttisch liebte und mit denen er seine knapp bemessene Freizeit komplett verbrachte, wenn man von den täglich anderthalb Stunden Joggen absah. Im Laufen fand Eberhard die ausgleichende Monotonie, die er als Gegengewicht zu seiner emotional aufwühlenden Arbeit brauchte.
»Noch zwei Bier?« fragte er Volker. »Für mich auch zwei«, kalauerte Volker. Eberhard winkte die Bedienung herbei und bestellte. Dann ließ er seinen Blick über die Passanten schweifen. Es war viel los um sie herum. Mehrere Kneipen säumten den fast quadratischen Platz, die Wirte hatten Tische und Stühle in den jeweiligen Brauereifarben rausgestellt, dennoch fanden nicht alle Gäste eine Sitzgelegenheit. Auch die Steinstufen um den Brunnen in der Mitte des Platzes waren belagert von jungen Leuten, die vergnügungshungrig der Samstagnacht entgegenfieberten, als gäbe es kein Morgen. Gesprächsfetzen und lautes Lachen schallten zu Volker und Eberhard herüber.
»Macht ’n ganz friedlichen hier«, fand er.
»Das Böse lauert unter der Haut, Herd«, gab Volker zurück.
Dieser knappe Kommentar war typisch für den 39jährigen, der sich durch einen scharfen Verstand und ein scheinbar von jeglichen menschlichen Gefühlen unbelecktes Urteilsvermögen auszeichnete. Zumindest wirkte er so auf Außenstehende. Die wenigen allerdings, die ihn gut kannten, wußten, daß der Buddhist, asketische Teilzeit-Vegetarier und fünffache Fahrradbesitzer ein reiches Innenleben und eine tiefe Empfindsamkeit besaß, die er geschickt verbarg, um keine Angriffsfläche zu bieten. Der brillante Fallanalytiker sicherte seit vier Jahren mit Eberhard die Spuren, untersuchte und diskutierte sie mit ihm. Seine Fähigkeiten entfaltete er jedoch am besten in der Ermittlungsarbeit, bei der psychologischen Kriegsführung im direkten Kontakt mit dem Gegner. Christian setzte ihn immer wieder bei der Befragung widerspenstiger oder verwirrter Zeugen ein. Legendär war, wie Volker eine etwa fünfzigjährige Eppendorfer Zicke »geknackt« hatte, die ihnen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wichtige Informationen in einem Mordfall vorenthielt. Stundenlang hatten Christian und Eberhard sich mit der Frau abgemüht, mit Engelszungen auf sie eingeredet, sie – absurderweise – der unterlassenen Hilfeleistung beschuldigt, sie moralisch unter Druck gesetzt, sie schmoren lassen … nichts. Sie konnte Polizisten einfach nicht ausstehen, und da dieses Credo vermutlich das einzige war, was sie aus ihrer vielversprechend wilden 68er-Jugend in ihr unausgefülltes Gattinnendasein auf hohem finanziellen Nutzlosigkeits-Niveau herübergerettet hatte, hielt sie daran fest. Bis Volker kam. Volker war sauer, weil die Frau sie alle schon viel zu viel Zeit gekostet hatte. Sie saß schnippisch auf einem Stuhl und blickte blasiert in die Gegend. Volker stellte sich vor sie, stellte sich einfach hin, direkt vor sie, mit seinen knapp zwei Metern Körpergröße ein einziger hagerer Vorwurf, aufrecht wie der Hamburger Fernsehturm, ein sehniger Turm mit tiefliegenden Augen im obersten Stockwerk unter der wenig sorgfältig rasierten Glatze, die Hände in die Hüften gestützt, und sah nur stumm auf sie herab. Eine Minute, zwei Minuten, drei … Er starrte sie an, ohne sichtbare Regung oder gar Wertung, doch er entließ sie für keine Millisekunde aus seinem Bannstrahl, der sie alles vergessen ließ, vergessen ließ, wo sie war, wer sie war, warum sie war und ob überhaupt. Nach etwa vier Minuten brach ihr Widerstand zusammen. Sie sprudelte wie ein lecker Öltanker. Auf den Fluren im Hamburger Polizeipräsidium ging hinterher das Gerücht, Volker hätte die Frau hypnotisiert, doch diese Interpretation lehnte er strikt ab. Als die Kollegen ihn fragten, was er statt dessen mit ihr gemacht habe, sagt er: »Ich habe sie aus der Zeit geschnitten und entleert.«
Die Bedienung brachte Eberhard und Volker frisches Bier. Den Blick auf das sommerabendliche Treiben und ohne anzustoßen tranken beide einen kräftigen Schluck. Eberhard sah auf die Uhr: »Brauchen ganz schön lange die beiden.«
»Karen ist gründlich. Die entknotet jede Darmschlinge«, antwortete Volker.
»Schon gut.« Eberhard nahm angewidert den nächsten Schluck.
Der Hörsaal war bis auf den letzten Platz besetzt, die Luft entsprechend schlecht. Studenten aller Semester saßen in den Reihen. Noch herrschte große Unruhe. Als regelmäßige Gastdozentin hatte sich Anna an der Hamburger Uni im Laufe der letzten drei Jahre einen harten Kern an Zuhörern aus der psychologischen Fakultät erarbeitet und durch ihr Buch auch fachfremde Anhänger dazugewonnen. Doch daß sie an einem Freitagabend den großen Saal vollbekommen würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Anna begrüßte die Studenten mit der ihr eigenen Lässigkeit und begann ihren Vortrag:
»Ich nehme an, daß Sie zu meinem heutigen Thema ›Kultfigur Killer – Monster oder Mr. Right?‹ so zahlreich erschienen sind, weil Sie ein paar hübsche Fallbeispiele mit herumspritzendem Blut, zerteilten Gliedmaßen und heraushängenden Gedärmen erwarten. Ich muß Sie enttäuschen. Um Sie aber dennoch zumindest die erste halbe Stunde im Saal zu halten, beginne ich mit ein paar kurzen Bemerkungen über die Rezeption des Killers. Klugerweise bediene ich mich dabei Ihres, ich hoffe nur in diesem speziellen Falle, sicher eingeschränkten Erfahrungshorizontes. Denn da Sie alle mehr Zeit im Kino als in der Staatsbibliothek verbringen, begeben wir uns in die Filmgeschichte – ohne allerdings zu diskutieren, ob das Kino einen Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse darstellt.
Das sogenannte Böse hat den Menschen schon immer fasziniert, denn es übt Macht aus: schwer oder gänzlich unkontrollierbare Macht. Um aber den Zusammenhalt eines jeden sozialen Gefüges zu gewährleisten, wird abweichendes Verhalten, vor allem das mit zerstörerischen Folgen, gesellschaftlich sanktioniert. Mord beispielsweise. Seit es das Kino gibt, beschäftigt es sich mit Mord und Totschlag. Auffällig ist dabei allerdings, wie sich der Typus des Mörders im Laufe der Kinogeschichte gewandelt hat. Vom absolut Bösen schlechthin, einer eher apokalyptischen Bedrohung, wird es immer mehr als zutiefst dem Menschen innewohnender Faktor akzeptiert. Die Entwicklung der Psychoanalyse prägt die ersten Bilder vom kranken Killer: Wir erinnern uns an Doktor Caligari oder Peter Lorre in ›M – Eine Stadt sucht einen Mörder‹. Den Filmen der fünfziger Jahre ist dann ein profundes Mißtrauen gegen die herrschende soziale Ordnung gemein, die die Krise nicht verhindert hat. Es gibt keine Schwarzweißmalerei mehr, keine eindeutige Trennung von Gut und Böse, statt dessen geht es um schäbige Durchschnittsexistenzen, korrupte Polizisten, schlecht bezahlte Detektive …«
Anna trank einen Schluck aus ihrem am Pult stehenden Wasserglas und prüfte mit geübtem Blick, ob sie ihre Zuhörer hatte. Sie hatte sie.
»Wir machen jetzt mal einen Sprung in die jüngere Vergangenheit. Was ist mit Blockbustern wie ›Das Schweigen der Lämmer‹ oder ›Natural Born Killers‹? Der Killer ist zum medial gefeierten Helden geworden, er erhebt sich über Recht und Gesetz, steht außerhalb der Gesellschaft, nur seiner Unabhängigkeit und seinem beruflichen Ehrenkodex – denn die meisten haben einen – verpflichtet. Der Killer ist inzwischen in vielen Filmen zum romantisierten Zorro geworden, der den Punks ihre Rebellion zurückgibt, seit die Haute Couture ihnen die Klamotten geklaut hat …«
Spöttische Lacher im Auditorium.
»Und während wir uns am filmischen Vollzug unserer gewalttätigen Phantasien durch Stellvertreter mit Star-Appeal delektieren, sitzen zu Hause zwischen pastellfarbenen Plüschkissen einsame Herzen, die die echten Killer in diesem unseren Lande anbeten, ihnen gefühlvolle Briefe schreiben und sie mit ihrer Liebe erlösen wollen. Was sind das für Frauen? Was treibt sie an? Ich helfe, also bin ich?«
Anna trank noch einen Schluck Wasser.
»Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich nicht falsch, ich gehöre nicht zu denen, die das Kino oder das Fernsehen für jedes noch so absurde gesellschaftliche Phänomen verantwortlich machen. Ob Angebot Nachfrage schafft oder erst auf sie reagiert, ist hier nicht das Thema. Ich will lediglich Ihre Sensibilität für die eigene Verführbarkeit wecken. Und für die psychische Struktur von Frauen, die sich von Gewaltverbrechern angezogen fühlen.«
Die Tür zum Hörsaal wurde quietschend geöffnet. Ein attraktiver junger Mann trat herein, der sich umsah und sich dann in Ermangelung eines anderen Platzangebots direkt vorne auf die Treppe setzte. Annas Blick blieb kurz an ihm hängen. Sie hatte das irritierende Gefühl, daß er ihr mit einem kaum merklichen Nicken die Erlaubnis erteilte, fortzufahren.
Die Sonne war schon seit einigen Stunden hinter den Häusern verschwunden, aber der Marktplatz speicherte die Wärme, so daß man immer noch draußen sitzen konnte. Volker und Eberhard waren bei ihrem vierten Bier angelangt und diskutierten die vergangene Bundesliga-Saison des HSV, als Christian und Karen plötzlich neben ihnen auftauchten. Krachend ließ Christian einen großen Pappkarton auf den Stuhl neben Volker fallen:
»Das Material, das wir schon gesichtet und katalogisiert haben. Bevor die weltweiten Logistiker von der Post wieder vier Tage brauchen, bis sie es nach Hamburg bringen, lassen wir Vater Staat lieber für das Übergepäck löhnen … Mal sehen, wie viele Kisten noch dazukommen. Den Tatortbefundbericht faxt Philipp uns morgen zu.«
Christian und Karen zogen zwei gerade frei gewordene Stühle heran und setzten sich. Eberhard und Volker sahen die beiden erwartungsvoll an. Karen hatte einen triumphierenden Ausdruck auf dem Gesicht. Die Kellnerin trat an den Tisch, ohne daß Karen sie bemerkte.
»Sperma«, sagte Karen zu Eberhard und Volker.
Die Kellnerin blickte irritiert zu Karen, wurde jedoch von allen am Tisch ignoriert. Volker beugte sich angespannt vor: »Sperma?«
»Ja. Im Darm«, erwiderte Karen knapp.
Auf Christians Gesicht spiegelte sich ein Lächeln über diese sachliche Distanziertheit, die Außenstehende oft mit Gefühlskälte verwechselten. Darüber hinaus war Karen wie die meisten Rechtsmediziner mit einer gehörigen Portion Zynismus gesegnet, der ihr den nötigen Abstand schaffte zum Grauen ihres Berufsalltags.
Eberhard grinste verstohlen über den hilflosen Blick der Kellnerin, die nicht wußte, ob sie bleiben und sich bemerkbar machen oder lieber klammheimlich wieder gehen sollte.
»Die Dame redet den ganzen Tag von Sperma, das muß Sie nicht stören«, erklärte Eberhard der Kellnerin. Erst jetzt bemerkten Karen und Volker die Bedienung. Karen lächelte sie zuckersüß an: »Achten Sie nicht auf diese Idioten. Ich hätte gerne ein Bier.« Christian bestellte das gleiche, und die Bedienung zog sich erleichtert zurück.
Manchmal wunderte er sich, daß Karen erst ein Jahr in seinem Team war, denn es kam ihm vor, als wäre sie von Anfang an dabeigewesen. Sein Kumpel Fred Thelen, der 2. Vizepräsident des BKA, hatte sie wärmstens empfohlen, denn sie hatte drei Jahre bei der IDKO, der Identifizierungskommission, gearbeitet, für die sie in Katastrophengebieten im In- und Ausland Leichen untersuchte. Zuerst hatte Christian erhebliche Vorbehalte gegen sie gehabt, nicht auf fachlicher, sondern auf gruppendynamischer Ebene. Dieses wandelnde Blondinen-Klischee, groß, schlank, mit seidigen Haaren bis zum Hintern und Augen, blaßblau wie die Quelle eines Bergsees, würde seine Truppe womöglich allein durch sein Aussehen in Hormonstreß und damit aus dem Gleichgewicht bringen. Damit hatte Christian recht behalten, doch Karen hatte die Jungs und ihre Wirkung auf sie überraschend gut im Griff. Sie ließ die Kollegen eiskalt abblitzen. Mit der Zeit überzeugte sie alle durch einen ungemein hohen Sachverstand und eine von Christian inzwischen sehr geschätzte Kombinationsgabe. In ihren Überlegungen und Theorien wagte sie auch mal Wege zu begehen, die nicht von konkreten Indizien vorgegeben waren. Karen besaß eine intuitive Phantasie, die sie weit über das hinausführte, was die meisten Pathologen an ihrem Autopsietisch im Labor zu leisten in der Lage waren.
»Die Probe ist schon unterwegs zur DNS-Analyse«, nahm Christian den Gesprächsfaden wieder auf.
»Er fängt an, Fehler zu machen«, sinnierte Eberhard.
Volker widersprach: »Nicht unbedingt. Wir werden sehen, was er uns sagt und was er verschweigt. Und inwieweit er kontrolliert, was er preisgibt.« Er wandte sich an Karen: »Gibt es sonst was Neues? Andere Spuren? Änderungen im Modus operandi?«
Karen verneinte: »Im Grunde alles wie immer. Nur daß der Mißbrauch diesmal relativ kurz zurückliegt, wenige Stunden vermutlich, und nicht Tage wie bei den anderen.«
»Gab es wieder einen Brief?« fragte Volker.
Christian nickte und zog einen handbeschriebenen Zettel hervor. »Er war wie sonst in dem Tuch eingefaltet. Ich habe den Text abgeschrieben. Das Original ist in der Materialkiste.«
Volker nahm den Zettel und las leise: »O Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund! Zerschlage, Herr, das Gebiß der Löwen! Sie sollen vergehen wie verrinnendes Wasser, wie Gras, das verwelkt auf dem Weg, wie die Schnecke, die sich auflöst in Schleim, wie eine Fehlgeburt sollen sie die Sonne nicht schauen!«
»Scheiße«, fluchte Eberhard, »ich werde daraus nicht schlau. Wer sind ›sie‹? Die Kinder?«
Christian zuckte die Schultern: »Vermutlich wieder ein biblischer Rachepsalm. Ich habe Daniel schon gemailt, er sucht danach. – Ach, ja, noch was: der Fundort. Daniel hat vorhin eine Mail an Philipp geschickt.«
Eberhard nahm den Ausdruck von Daniels Mail und betrachtete das Foto von dem gravierten Felsen, vor dem am Morgen der Junge gelegen hatte. Darunter stand: »Ein zweifellos antikes Bildwerk und wohl ein bedeutender Rest gallorömischer Kultur befindet sich eine Viertelstunde südlich von Sengscheid am Ende eines stillen Wäldchens. ›Hänsel und Gretel‹ oder ›die Engelchen‹ wird es beim Volke genannt. Infolge Verwitterung ist die Erhaltung leider sehr mangelhaft und die Bestimmung der Attribute nicht mehr leicht. Vermutlich haben wir es mit Segensgottheiten aus dem keltoromanischen Götterkreis zu tun. Das Felsenrelief mag etwa aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert stammen und diente wohl dem Kultus.«
Eberhard zeigte Volker die Mail von Daniel. Während Volker las, begann Eberhard leise zu singen: »Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitter kalt …«
Als Anna den Vorlesungssaal verließ, hatten sich die Zuhörer schon zerstreut. Nur der Mann, der zu spät gekommen war und auf der Treppe Platz genommen hatte, wartete auf sie und sprach sie mit einem gewinnenden Lächeln an: »Guten Abend, Frau Maybach, ich bin Pete Altmann.«
Anna reichte ihm die Hand und sah ihn abwartend an.
»Ihr Vortrag war sehr erhellend«, begann er sich einzuschmeicheln.
»Um so bedauerlicher, daß Sie den Anfang verpaßt haben«, lächelte Anna. Sie wandte sich zum Gehen, doch er blieb an ihrer Seite.
»Das finde ich auch. Ich hatte gehofft, Sie würden meine Lücken schließen. Am besten jetzt gleich. Bei einem Glas Wein?«
Anna blieb stehen und sah ihn überrascht an. Der Typ sah wirklich gut aus. Dunkelblond, blaue Augen, hervorragende Zähne, durchtrainiert, soweit man das unter seinem teuren Anzug erkennen konnte, braungebrannt. Anna versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr er ihr gefiel: »Warum sollte ich mit Ihnen etwas trinken gehen?«
Pete Altmann zeigte ein Siegerlächeln: »Vielleicht, weil ich neu in der Stadt bin und noch niemanden kenne?«
»Das reicht nicht«, erwiderte Anna unbeeindruckt.
»Weil ich unverschämt genug bin, sie einfach zu fragen?« fuhr er herausfordernd fort.
Anna mußte wider Willen lachen: »Meine Mutter hat mir beigebracht, nicht mit Fremden zu gehen.«
Pete zog einen Ausweis hervor: »Ich bin Polizist. Sie sind bei mir in besten Händen.« Anna blickte überrascht auf den Ausweis. »Ist Ihr Interesse an meinem Vortrag beruflicher Natur?«
Lässig klappte Pete den Ausweis zusammen und steckte ihn wieder ein. Sein Blick glitt an Annas schlanker Figur hinab, wanderte lächelnd wieder hoch zu ihrem fein geschnittenen Gesicht mit den leicht schräg stehenden Augen: »Wenn Sie klein, alt, fett und faltig wären, würde ich mich mit der Lektüre Ihres Buches begnügen und den Wein allein trinken. Aber das sind Sie nicht.«
Wieder mußte Anna lachen: »Sie sind wirklich unverschämt. Frech, sexistisch und arrogant.«
»Das heißt, Sie kommen mit?« grinste Pete.
Anna nickte.
Astrid schaltete angewidert die Spätnachrichten aus. Der Plasmabildschirm erlosch mit einem leisen Zirpen.
»Schon wieder so ein schrecklicher Kindermord«, sagte sie zu ihrem Mann. Karl gab keine Antwort, doch das war Astrid gewohnt.
»Bei Saarbrücken. Du warst doch gerade in Saarbrücken«, fuhr sie fort. Ihr Mann blickte von seinem Wirtschaftsblatt auf und sah sie scharf an: »Ja. Und? Viele Leute waren in Saarbrücken. Und sind in Saarbrücken. Und werden in Saarbrücken sein.«
Astrid spürte seine Verärgerung. »Ich meine ja nur«, fügte sie abwiegelnd hinzu.
»Was meinst du ja nur?« Karls Tonfall war herrisch.
»Ist doch bestimmt seltsam, wenn so was passiert, und man ist so … so dicht dran … irgendwie.«
Er schwieg.
Sie erhob sich aus den Polstern der cremefarbenen Couchgarnitur, warf ihm einen kühlen Blick zu und verabschiedete sich ins Bett. Müden Schrittes durchquerte sie das sechzig Quadratmeter große Wohnzimmer und ging nach oben. Eines sinnlosen Tages einsame Nacht lag vor ihr. Kaum war sie weg, ging Karl in sein Arbeitszimmer, das ans Wohnzimmer angrenzte. Er goß sich einen Cognac ein. Seine Hand zitterte leicht. Er trat ans Fenster und schaute hinaus in den dunklen Garten. Es war totenstill hier am Nordrand von Hamburg. Die Nachbarn schliefen, um am nächsten Tag den Anforderungen ihrer wohlerzogenen Kinder und ihrer gutdotierten Jobs an der Uni, beim NDR oder in irgendeinem Krankenhaus gewachsen zu sein.
Er wußte, daß er handeln mußte. Seine Frau, die dumme Pute, hatte recht: Das kam viel zu dicht an ihn ran. Karl griff zu seinem Handy und wählte eine Nummer, die wohlweislich nicht eingespeichert war.
»Hey, Joe«, sagte er leise, »es gibt was zu tun für dich.«
Samstag, 25. Juni
Am Samstag morgen, es dämmerte schon, kam Anna nach Hause zurück. Völlig erledigt schleppte sie sich die Treppe ins obere Stockwerk hoch, zog ihre Kleidung aus, ließ sie fallen, wo sie gerade stand, und legte sich ins Bett. Doch sie konnte nicht einschlafen, denn die vergangene Nacht tobte noch durch ihr System. Sie hatte Pete nach dem Vortrag in die nächstgelegene Kneipe im Univiertel geschleppt und mit ihm getrunken. Sie hatte viel zu viel getrunken, vermutlich immer noch bemüht, den Nachmittag mit ihren Eltern wenn nicht zu vergessen, so doch zu ertränken. Pete war eine gute Ablenkung gewesen. In charmantem Plauderton hatte er ihr von seiner deutsch-amerikanischen Herkunft erzählt, vom Studium in Chicago und seiner Ausbildung beim BKA und FBI. Die politische Diskussion, die sie um Bush, den Irak, Guantánamo und die Todesstrafe anzuzetteln bemüht war, wurde von ihm mit der souveränen Eleganz eines geübten Wortfechters pariert und im Keim erstickt. Er wollte mehr über sie und ihre Arbeit wissen, doch sie weigerte sich mit einem für sie untypischen Anflug von Koketterie, ihm den Vortrag noch einmal zu halten.
»Im Grunde interessieren wir uns für ein und dasselbe«, hatte Pete gesagt. »Für Mörder.«
»Ich interessiere mich nicht für Mörder, sondern für Menschen, die sich für Mörder interessieren«, entgegnete sie.