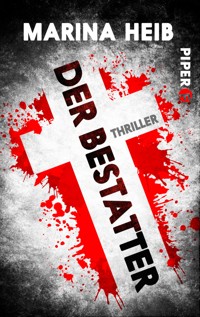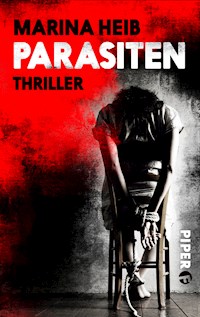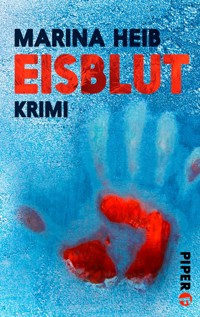
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Thriller: Ein Fall für Sonderermittler Beyer und Psychologin Maybach! Schnittverletzungen am ganzen Körper und Salz in den Wunden: Uta Berger ist das erste von drei Opfern, die vor ihrem Tod offensichtlich grausam gefoltert wurden. Die Zeit drängt, denn der Täter geht mit größter Akribie und Intelligenz vor. Und seine Motive zu verstehen, scheint der einzige Schlüssel zur Lösung des Falls. Daher ziehen die Hamburger Sonderermittler um Christian Beyer auch in diesem Fall die Psychologin Anna Maybach hinzu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Für Jochen
ISBN 978-3-492-98045-6
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2013 © Piper Verlag GmbH, München 2007 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Kirill Kurashov, Grisha Bruev / Shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2011
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Tag 1: Samstag, 28. Oktober
Schorsch hat einen guten Tag gehabt. Drei Stunden lang konnte er auf dem Jungfernstieg betteln, dann erst haben ihn die Wachmänner der Geschäftsleute vertrieben. Eine schöne Summe ist da zusammengekommen, und er hat sie gut angelegt. Nein, nicht für Essen, das hat er sich aus der Mülltonne bei Burger King in der Mönckebergstraße geholt. Die Kohle hat er in Grundnahrungsmitteln angelegt: Bier und Korn. Schorsch hat heute Abend einen feinen Zug durch die Gemeinde gemacht. Mit Hansi ist er saufen gewesen, der Hansi hält was aus.
Na ja, nicht so viel wie Schorsch, das kann keiner, und deswegen hat Hansi sich längst bei seiner Kirche verkrochen, da pennt er bis morgen Mittag und pisst sich dabei voll, denkt Schorsch kichernd. Schorsch klettert ungelenk im Offakamp über den Zaun und steigt in den Recyclinghof ein. Seit Wochen löchern ihn seine Kumpels mit der Frage, wo er übernachtet, aber er verrät es ihnen nicht. Sonst kommen sie alle, und er muss seinen Luxus mit ihnen teilen. Dann fliegen sie garantiert bald auf, und er muss verschwinden. Dabei hat er selten so einen guten Platz gehabt. Hier gibt es eine Bretterbude, wo die Leute ihre alten Möbel abstellen. Manchmal hat Schorsch ein richtiges Bettgestell zum Übernachten. Da liegt er dann wie ein heimlicher Fürst und schaut mit seiner Taschenlampe noch ein paar Pornohefte durch, die immer im Altpapier liegen, diskret verschnürt natürlich. Altkleider zum Wechseln und noch gut besohlte Schuhe liegen auch in Hülle und Fülle da. In einer anderen Bude werden Hifi-Geräte gesammelt, manche Radios funktionieren noch einwandfrei. Ein echtes Berber-Paradies. Oft nimmt Schorsch das ein oder andere mit und verkauft es an den Türken, der immer Flohmarkt macht. Dann ist Feiertag. Aber heute ist Schorsch zu müde, um noch zu wühlen. Außerdem ist er schön besoffen. Er legt sich zwischen zwei Container auf seine Pappen und schließt die Augen. Morgen wird ein guter Tag, denkt er. Schorsch denkt positiv, wenn er betrunken ist. Dann geht’s ihm bestens. Er schließt die Augen und will sich schnapsduselig in Morpheus’ Arme sinken lassen. Plötzlich hört er ein Geräusch, fast direkt neben ihm. Erschrocken linst er aus seinem Versteck. Ein dunkler Schatten geht an ihm vorüber, groß, unförmig. Er geht zum Sondermüll-Container und wirft einen Sack ab. Der Sack plumpst dumpf zu Boden und raschelt. Ein Plastiksack, denkt Schorsch. Nun ist der Schatten nicht mehr ganz so groß. Als er wieder an Schorsch vorbeikommt, drückt Schorsch sich in die Ecke. Die Schritte des Schattens entfernen sich. Stille kehrt ein, nur der sporadische Verkehr von der nicht allzu weit entfernten Kollaustraße ist noch zu hören. Schorsch überlegt. Das fällt ihm schwer, denn seine Gedanken lallen ein wenig. Der Schatten hat etwas abgeladen. Heimlich. Wollte keine Gebühr zahlen. Gebühr für Sondermüll. Sondermüll interessiert Schorsch nicht. Schorsch blickt zu dem Plastiksack. Der ist ziemlich groß, auch wenn er ihn kaum erkennen kann. Nur die Umrisse. Schorsch muss niesen. Er muss immer niesen, wenn er sich nicht entscheiden kann. Schorsch zögert noch eine Sekunde, dann schält er sich aus seinen Pappen. Die Neugier hat gesiegt. Er torkelt hinüber zum Container, kniet sich neben den Sack und betastet ihn. Schorsch kann nicht sehen, wo oben und unten ist. Er versucht, ihn aufzureißen. Es ist festes Plastik. Schorsch schafft es, ein Loch hineinzubohren. Mühsam vergrößert er das Loch. Mit der stumpfen Akribie eines Besoffenen konzentriert sich Schorsch auf seine Aufgabe. Er greift hinein in den Sack und berührt etwas Kaltes. Er tastet. Es ist ein Fuß. Erschrocken zieht er die Hand zurück. Morgen ist doch kein guter Tag, Schorsch, denkt er. Weiter kommt er nicht, denn etwas Hartes donnert auf seinen Kopf und raubt ihm das Bewusstsein. Er hört nicht mehr, wie ein Mann sagt: »Du hättest nicht niesen dürfen, du Penner!« Und er spürt auch nicht mehr, wie er geschultert und weggetragen wird.
»Das ist nicht witzig«, befand Knut, der dienstälteste Müllbeseitiger vom Offakamp. Er und seine Kollegen standen in ihren orangefarbenen Overalls im Nieselregen um den Plastiksack herum und betrachteten das, was daraus hervor lugte: der Unterleib einer jungen Frau, tot, nackt und über und über mit relativ frischen Wunden übersät. Die ersten Fliegen machten sich schon an den offenen Stellen zu schaffen und legten ihre Eier ab. Kalle stand in der Ecke und kotzte. Er hatte den Sack kurz nach Dienstbeginn entdeckt und pflichtbewusst seinen Inhalt untersuchen wollen, schließlich musste er wissen, was er in den Sondermüll tat und was nicht. Ein Mensch war definitiv kein Sondermüll, eher was für die Biotonne. Als Kalle die schon vorhandene Öffnung des Sacks vergrößert hatte, um nachzuschauen, waren zwei Ratten daraus hervorgehuscht und zwischen den Containern verschwunden. Kalle war erschrocken, und seine Kollegen hatten ihn ausgelacht. Aber denen verging das Lachen, als Kalle den Sack auf den Boden entleerte. Seitdem kotzte Kalle. Er hatte erst vor einer Woche im Offakamp angefangen, und auch wenn er nicht sonderlich stolz auf die Arbeit war, so war es doch eine anständige und ehrliche Arbeit. Als nun aber einer seiner Kollegen neben ihn trat und ihm tröstend die Hand auf den Rücken legte, presste er ein entschiedenes »ich kündige« hervor. Keiner lachte ihn aus.
Hauptkommissar Martin Ganske, dem die Leiche im Sack einen genussbetonten Samstagmorgen im Bett mit seiner Geliebten verdorben hatte, verspürte keine Lust, sich mit dem nach Kotze stinkenden Kalle zu beschäftigen, der war unter seinem Niveau. Den konnten seine Leute übernehmen, die den ersten Sicherungsangriff ausführten. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt, Spuren nummeriert und fotografiert, die Personalien der Zeugen aufgenommen. Ganske stand leicht erhöht auf einer dreistufigen Metalltreppe vor einem Container, einem ihm unwürdigen Feldherrnhügel, und betrachtete grübelnd das geschäftige Treiben rund um den Plastiksack. Er griff zu seinem Handy.
»Hallo, Hugo, ja, ich bin’s. Sorry, dass ich dich so früh störe, aber ich habe hier eine Leiche, die sieht nicht gut aus. Gar nicht gut, wenn du mich fragst. Nein, musst du nicht, aber ich denke da an was anderes …« Ganskes Miene nahm etwas Verschlagenes an. »Unsere Wunderkinder von der Soko ›Bund‹ … Ja, klar, Beyer ist schon lange raus, und die Jungs aus seiner Truppe sterben vor Langeweile … Aber lange kannst du sie nicht mehr kaltstellen, du weißt, Waller will sie endlich wieder adäquat beschäftigen, damit die Steuergelder nicht verschwendet werden, der Arsch, als ob ihn das interessieren würde … Dieser Fall hier ist meiner Meinung nach verdammt adäquat … Nein, ich habe Waller noch nicht angerufen, ich wollte zuerst mit dir reden … Genau, Hugo … Noch ein Fehler, und die sind endlich weg vom Fenster … Natürlich ist es ein Risiko, aber ich schätze es nicht allzu hoch ein, ohne Beyer sind die Jungs doch nicht mal die Hälfte wert, wenn du mich fragst … Okay, dann sind wir einer Meinung. Ich gebe jetzt Waller Bescheid, schätze, er wird von selbst auf die Idee kommen, wenn ich ihm die Infos entsprechend präsentiere …«
Eine weitere Stunde später begrüßte Ganske mit falscher Freundlichkeit die Mitglieder der von Oberstaatsanwalt Waller benachrichtigten Soko. Pete Altmann, Eberhard Koch und Volker Jung ignorierten Ganske weitestgehend und nahmen schweigend ihre Arbeit auf. Die überraschende Tatsache, dass Waller ihnen den Fall zugeteilt hatte, kommentierten sie nicht, zumindest nicht vor ihrem Widersacher. Der zog sich, verlogen Glück wünschend, in sein Privatleben zurück, überließ der Soko aber immerhin einen Teil seiner Kräfte für die aufwendige Tatortarbeit.
Es war kurz vor zehn Uhr, der Nieselregen hatte zugenommen und war mittlerweile in ein veritables Schnüren übergegangen. Sie besahen sich die Leiche, untersuchten den Ereignisort, kümmerten sich um Sicherung und Schutz der Beweismittel, um die Feststellung und lückenlose Dokumentation des Tatortbefundes, soweit noch nicht geschehen, und um die erste Informationserhebung. Einige der anwesenden Beamten, die unter Ganske mit der Arbeit begonnen hatten, waren sauer, dass Pete und seine Leute ihre bisherigen Maßnahmen begutachteten und teilweise wiederholten, ganz so, als hätten sie nicht gründlich genug gearbeitet. Andere wiederum verstanden gut, dass die Kollegen sich ihr eigenes Bild machen wollten. Es hing ganz davon ab, wie die Sympathien verteilt waren: Entweder die Beamten standen auf Ganskes Seite, der seit der Einrichtung der ersten deutschen Soko mit länderübergreifenden Kompetenzen vor gut einem Jahr von Neid zerfressen wurde, weil ihm als Protegé des Hamburger Polizeipräsidenten Hugo Dorfmann nicht die Leitung übertragen worden war. Oder sie waren alte Kollegen von Christian Beyer, der die Soko zusammengestellt hatte und trotz seines bekanntermaßen schwierigen Charakters und der Fehler, die man ihm zweifellos nachsagen konnte, immer noch von vielen eine gehörige Portion Respekt, wenn nicht Bewunderung entgegengebracht bekam. Beyer war zwar von der Truppe suspendiert, dennoch war und blieb es in den Augen aller seine Truppe.
Pete, Eberhard und Volker kannten die Vorbehalte gegen sie zur Genüge, doch sie scherten sich nicht darum. Nur Karen, Rechtsmedizinerin und früher einmal Mitglied der IDKO, der international arbeitenden Identifizierungskommission, hatte nicht mit diesen kleingeistigen, politischen Ränkespielen zu kämpfen. Als sie mit ihrem Pathologenkoffer als Letzte im Offakamp ankam, wurde sie von allen Beamten mehr als wohlwollend begrüßt. Ihre hüftlangen, blonden Haare, das feingeschnittene Gesicht und die umwerfende Figur hoben sie auf einen Sockel des Begehrens und somit über jegliche Machtspielchen. Sie machte sich schweigend an die Arbeit. Und niemand sah ihr an, wie sehr sie der Anblick der jungen Frau, gezeichnet von Verstümmelungen durch Menschenhand und Tierfraß, erschütterte. Sie schaltete ihre berufliche Distanz ein und begann mit den ersten Untersuchungen.
Vor den Schiebetoren des Offakamp hatte sich inzwischen eine Vielzahl von Bürgern versammelt, die schimpfend hupten, weil sie ihren Garten- und Sondermüll im Kofferraum nicht loswerden konnten, bevor sie in den Supermarkt fuhren, um den Kofferraum dort wieder aufzufüllen. Es dauerte eine Weile, bis die hinterste Reihe der Wartenden von den aufgeregten Beobachtungen der ersten Reihe erfuhr. Schon war der Supermarkt vergessen, und als die Vertreter der Presse dazukamen und sich aufgeregt mit den Polizisten um den Zugang zum Fundort stritten, entwickelte sich der Vormittag für viele dann doch noch zu einem Highlight. Allen war klar, dass die junge Frau mit den entsetzlichen Verletzungen sich nicht selbst in den Plastiksack gepackt hatte.
Tag 2: Sonntag, 29. Oktober
Anna schreckte aus dem Halbschlaf hoch, als die Frau neben ihr einen spitzen Schrei ausstieß. Die Maschine war in Turbulenzen geraten, rüttelte unangenehm hin und her, ächzte und knarzte, als würde der Stahl jeden Moment bersten.
»Sie haben Flugangst«, stellte Anna mehr fest, als dass sie es fragte. »Blödsinn«, gab die Frau zur Antwort, krallte ihre Hände in die Armlehnen und hielt die Luft an. Das Flugzeug sackte kurz nach unten und stabilisierte sich wieder. Anna lehnte sich in ihrem Sitz zurück. Die barsche Reaktion ihrer Sitznachbarin zeigte deutlich, dass sie nicht zu dem Typ gehörte, der sich das Händchen halten lassen wollte, um mit seiner Panik fertig zu werden. Genau wie Christian. Ein einziges Mal war er mit ihr in ein Flugzeug gestiegen, und es war für sie beide der Horror gewesen. Anna hatte noch nie auch nur leises Unwohlsein beim Fliegen empfunden, nicht mal bei einem Trip mit einer Einmotorigen über ein Gebirge in Costa Rica, wo es so heftig zugegangen war, dass selbst hartgesottene Passagiere nach den Kotztüten gegriffen hatten. Doch nach dem gemeinsamen Flug mit Christian war sie völlig fertig gewesen. Christians Anspannung hatte sich auf sie übertragen, seine Aggression nach der Landung, mit der er den Stress abbaute, führte zum Streit. Sie war wütend auf ihn gewesen, weil er sich zwar aus beruflichen Notwendigkeiten jederzeit in ein Flugzeug setzte, sie ihn aber monatelang hatte bearbeiten müssen, bis er bereit war, mit ihr in die Provence in einen Urlaub zu fliegen, den sie beide bitter nötig hatten. Die ersten beiden Tage nach der Landung machte er ihr zur Hölle, gewissermaßen als Strafe für die Todesangst, die sie ihm aufgezwungen hatte, und zwei Tage vor dem Rückflug sank seine Laune schon im Voraus unter den Nullpunkt. Vier beschissene Tage, die, gemessen daran, dass sie nur eine Woche unterwegs waren, den ersten gemeinsamen Urlaub komplett vergifteten. Da gab es nichts zu verklären, auch nicht im Nachhinein.
Anna stellte ihre Rückenlehne senkrecht, unter ihnen waren schon Hamburgs Lichter zu sehen. Ärgerlich verscheuchte sie ihre Gedanken an Christian. Immerhin hatte sie sich zwei Monate in die Natur von Kanada zurückgezogen, um ihn zu vergessen. Zeitweilig war es ihr sogar gelungen. Je länger sie einsam und wie besessen über die Seen in British Columbia gepaddelt war, je mehr ihre Muskeln von den ausgedehnten Touren schmerzten, desto weiter schienen die traumatischen Erlebnisse des letzten Sommers in die Ferne zu rücken und mit ihnen die frustrierende Beziehung. Als sie sich gestern von ihrer Freundin Helga in Vancouver verabschiedete, fühlte sie sich leicht und befreit. Kanadas Größe hatte ihr den inneren Frieden zurückgegeben, glaubte sie. Was für ein Irrtum! Mit jedem Meter, den die Maschine dem Hamburger Flughafen entgegensank, verspürte sie einen stärker werdenden Sog, sich Christians Gesicht ins Gedächtnis zu rufen. Seine ungekämmten dunklen Locken, die tiefen Furchen in seiner braun gebrannten Haut, diese Landkarte von Schmerz, Wut und Enttäuschung, die grünen Augen, die so wild und auch so sanft blicken konnten …
Anna riss sich los und blickte zum Fenster hinaus. Die Maschine taumelte durch ein paar Wolken, sank und sank, sie hatten die Wolken nun über sich, es war bereits dunkel, Hamburgs Straßenbeleuchtung glitzerte verheißungsvoll, lange Autoschlangen, die sich im Stop-and-go-Verkehr durch die Straßen wanden, so viele Menschen unterwegs, Rushhour, Hektik, und irgendwo da unten, mittendrin war auch Christian, bloß nicht daran denken, lieber an ein heißes Bad, hatte sie eigentlich noch Holz für den Kamin? Es goss in Strömen, es stürmte, und die Landung war alles andere als sanft.
Nach schier endlosem Herumstehen am Gepäckband verließ Anna die Sicherheitszone und drängte sich durch die Menge der Wartenden. Sie nahm die begehrlichen Blicke der Männer, die ihr folgten, nicht wahr. Plötzlich rief jemand ihren Namen. Anna reagierte nicht. Nur ihre Mutter wusste, dass sie heute wiederkommen würde, aber ihre genaue Ankunftszeit hatte Anna bewusst verschwiegen. Sie wollte nicht abgeholt werden, schon gar nicht von ihrer Mutter. Doch dann wurde sie am Arm gepackt und festgehalten. Erschrocken drehte sie sich um. Vor ihr stand ein unverschämt gutaussehender Mann Anfang dreißig, in edlem Designeranzug und mit strahlendem Lächeln.
»Pete! Was machst du hier?«, rief sie.
»Ich bin dein Chauffeur und Gepäckträger. Wenn ich bitten darf?« Pete nahm ihr den Gepäckwagen aus der Hand und wies mit einer kleinen Verbeugung in Richtung Parkhaus.
Anna schüttelte unwillig den Kopf: »Woher weißt du …?«
Pete eilte los, und Anna hatte Mühe mit ihm Schritt zu halten. Sie war müde und ausgelaugt von der langen Reise.
»Ich habe deine Mutter angerufen. Sie wusste zwar nicht, mit welcher Maschine du kommst, aber wozu bin ich Polizist?«
»Und was ist der Grund für diese Eskorte?«, fragte Anna misstrauisch. Sie fuhren im Aufzug auf Parkdeck sieben.
»Freundschaft?« Pete lächelte.
Anna sah Pete nur stumm an.
»Erklär ich dir im Auto«, fügte er hinzu.
Während Pete das Gepäck im Kofferraum seines Dienstwagens verstaute, ließ sich Anna mit bösen Vorahnungen auf dem Beifahrersitz nieder. Sie hatte Pete letzten Sommer kennengelernt und spontan eine Affäre mit ihm begonnen. Dann war alles aus dem Ruder gelaufen. Ihre Verbindung zu Pete, der damals als Profiler eines bundesweit ermittelnden Sonderkommandos Jagd auf einen Kindermörder machte, und die Tatsache, dass sie Psychologin war, führte auf verschlungenen Pfaden zu ihrer Verstrickung in den Fall. Dadurch hatte sie auch Hauptkommissar Christian Beyer kennengelernt, sich in ihn verliebt und versucht, nach Abschluss des Falls eine Beziehung mit ihm aufzubauen. Die allerdings aufgrund von äußeren Umständen und inneren Verletzungen grandios gescheitert war.
Wenn Pete nun hier auftauchte, um sie an einem Sonntagabend vom Flughafen abzuholen, war das kein gutes Zeichen. Sie hatten sich seit Monaten nicht gesehen. Sicher, ihre damalige Affäre war nach einigen Wirrungen in eine Art lockere Freundschaft übergegangen, aber allein schon aus Taktgefühl Christian gegenüber hatten sie sich trotz ihrer Verbundenheit eher distanziert verhalten. Und als die Beziehung zwischen ihr und Christian vollends in die Brüche gegangen war, gab es auch keinen Kontakt mehr zu Pete. Anna wollte Abstand gewinnen, von Christian und seiner ganzen Soko.
»Wie war es in Kanada?«, versuchte Pete Konversation zu machen, als er mit dem Wagen in den Verkehr einfädelte.
»Pete. Was ist los?«
Pete atmete ruhig durch. »Wir brauchen deine Hilfe.«
»Nein. Nein, vergiss es.« Anna schüttelte so vehement den Kopf, dass ihre Ohrringe hin und her flogen. Der Knoten, zu dem sie ihre schulterlangen brünetten Haare zusammengebunden hatte, löste sich auf und einige Strähnen fielen ihr ins Gesicht. Es stand ihr gut.
»Hör mir doch erst mal zu!«, bat Pete sie.
»Nicht mal das!«
»Es geht nur um eine Zeugenaussage. Nichts Wichtiges vermutlich, die Frau ist höchstens eine Ergänzungszeugin. Sie ist die Mutter von Mohsen und glaubt, etwas zu wissen. Das Ganze ist garantiert Blödsinn, sie kennt weder das Opfer, noch hat sie in irgendeiner Weise mit dem Fall zu tun. Nicht im Entferntesten. Aber wir würden Mohsen gern den Gefallen tun, er nervt uns, weil seine Mutter ihn nervt.«
»Wer ist Mohsen?«
Pete wechselte ruhig die Spur und überfuhr eine Ampel, just als sie auf Rot umsprang. »Ein Rechtsmediziner. Stammt aus dem Iran. Seit ein paar Monaten der Assistent von Karen. Sie hält große Stücke auf ihn.«
»Und was habe ich damit zu schaffen?«
Pete warf Anna einen kurzen Blick zu, bevor er wieder die Spur wechselte. »Keine Ahnung. Glaub mir, ich würde dich gerne raushalten, aber sie will nur mit dir reden. Schätze, Mohsen hat ihr von deiner Beteiligung am Bestatter-Fall erzählt. Er hat selbst keinen Schimmer, was seiner Mutter im Kopf herumspukt, sie sagt es ihm nicht. Vielleicht möchte sie mit dir reden, weil du Psychologin bist, vielleicht, weil du eine Frau bist, ich weiß es nicht. Vermutlich ist sie eine gelangweilte, von ihrem muslimischen Mann unterdrückte Mutti, die sich bei ihrem Sohn wichtigmachen will. Aber du würdest uns einen großen Gefallen tun. Hör dir einfach an, was sie zu sagen hat, und das war’s.«
Pete bog nach rechts ab.
»Warum fährst du durchs Nedderfeld? Das ist ein Umweg«, bemerkte Anna.
»Frau Hamidi wohnt in Lokstedt«, antwortete Pete so beiläufig wie möglich.
»Wo wir in einem großen Bogen vorbeifahren werden«, meinte Anna wütend, »und zwar bis vor meine Haustür. Oder du stoppst jetzt sofort und rufst mir ein Taxi!«
»Schon gut. Ich fahre dich nach Hause.«
Obwohl Pete nachgegeben hatte, begann sie, sich für ihre Absage zu rechtfertigen: »Ich will nicht, verstehst du? Egal, ob sie was zu sagen hat oder nicht. Ich will nie wieder vor eurer Pinnwand stehen und Fotos von Leichen betrachten, ich will nie wieder einem Mörder in die Seele blicken, ich will nie wieder gefesselt und bedroht werden und einen Toten mit offener Schädeldecke auf meinem Küchenboden liegen haben. Ist das deutlich genug?« Den letzten Satz schrie sie fast.
Anna öffnete das Fenster. Sie fühlte sich beklommen und atmete abwesend die feuchte, vom am Straßenrand herumwirbelnden Herbstlaub leicht modrig riechende Luft ein.
»Klar. Sorry«, murmelte Pete.
Anna beruhigte sich ein wenig. Nach ein paar Schweigeminuten fragte sie leise: »Wie geht es Chris?«
»Wer weiß das schon? Er hat den Kontakt nach seinem Weggang komplett abgebrochen, das hast du ja noch mitbekommen. Daran hat sich nichts geändert. Nur Volker sieht ihn noch. Sie spielen sonntags immer Schach bei Chris.«
»Gardé«, sagte Christian und zog seine Dame in die entsprechende Position. Sie saßen im Wohnzimmer vor einem antiken Schachtisch mit floralen Intarsien, gekauert in zwei niedrige, etwas abgewetzte Sessel. Volker zögerte kurz, dann tauschte er ab, was für beide zusätzlich den Verlust eines Pferdes nach sich zog.
»Du spielst wie ein Metzger«, kommentierte Christian Volkers Taktik.
»Nenn mich nicht so«, sagte Volker, »das erinnert mich an unseren aktuellen Fall. Du wirst es nicht glauben, aber wir haben wieder einen.«
»Verschwundene Pfadfinder suchen oder einen kleinen Zuhälter durch die neuen Bundesländer jagen?«
Von dieser und ähnlicher Brisanz waren die Ermittlungen gewesen, mit denen der Hamburger Polizeichef sie das letzte Jahr beschäftigt hatte. Die beiden fünfzehnjährigen Pfadfinder hatten sie im Chiemgau aufgetrieben, wo sie einen Bären jagen wollten, der seit Monaten zwischen Tirol und Bayern Schafe riss und die Medien beschäftigte, den Zuhälter erwischten sie in einem Puff bei Schwerin. In beiden Fällen war keine Rede von Entführung, Mord oder sonstigen Umständen gewesen, für die sie eigentlich zuständig waren. Doch Volker überhörte die Spitze.
»Im Gegenteil. Könnte schwierig werden«, gab er ruhig zur Antwort.
»Interessiert mich alles überhaupt nicht.« Christian nahm einen Schluck aus seinem Whiskyglas und stellte es unsanft wieder ab.
»Die Leiche einer jungen Frau. Anfang zwanzig. Du wirst es morgen in der Zeitung lesen.«
»Ich lese keine Zeitung. Sind doch alles Mistblätter«, sagte Christian und machte eine große Rochade.
»Sie war grauenvoll verstümmelt. Wie von einem Metzger. Der Mörder hat ihr …«
»Halt den Rand«, unterbrach Christian ihn unwirsch, »wenn du glaubst, mich wieder zurückzuquatschen zu dem Verein, dann hast du dich geschnitten.«
»Will ich nicht, auch wenn es schade ist. Pete holt übrigens gerade Anna vom Flughafen ab. Nur wegen des Falls, nichts Privates.« Er zog einen Bauern nach vorne.
Unwillkürlich hielt Christian, der gerade nach seinem Turm greifen wollte, in der Bewegung inne: »Wieso das denn?«
»Die Mutter von Karens neuem Assistenten will mit ihr reden.«
Christian hatte bei Annas Erwähnung kurz die Fassung verloren. Jetzt zog er seinen Turm und meinte möglichst gleichmütig: »Interessiert mich auch nicht.«
Volker grinste: »Schachmatt.«
Gleichzeitig parkte Pete den Wagen vor Annas kleiner Stadtvilla im Generalsviertel. Bis dahin hatten sie kein weiteres Wort mehr gewechselt. Er hievte Annas Gepäck aus dem Kofferraum. Dabei fiel sein Blick auf eine dunkle, quadratische Stelle am steinernen Pfosten rechts vom Gartentürchen.
»Wo ist eigentlich dein Praxisschild?«, fragte er überrascht.
»Im Müll. Ich war eine lausige Therapeutin.«
»Das stimmt nicht. Es ist bedauerlich, dass du das so siehst.«
»Ab nächster Woche arbeite ich als Dozentin an der Uni. Besser für mich, besser für meine Patienten.« Anna wollte ihr Gepäck nehmen, aber Pete kam ihr zuvor. Während Anna aufschloss, blickte er auf die Uhr und nahm sein Handy heraus.
»Frau Hamidi erwartet uns. Ich sage ihr jetzt ab und verschwinde, okay? Tut mir leid, dass ich dich damit überfallen habe.«
Anna zögerte kurz. Dann gab sie sich einen Ruck. Sie sollte ihren Gespenstern besser entgegentreten, statt sich von ihnen jagen zu lassen. »Trag das Gepäck rein, lass mich duschen und umziehen. Dann gebe ich dieser Frau eine Viertelstunde. Mehr nicht.«
Erleichtert nahm Pete ihr Gepäck auf und lächelte sie an: »Wenn du willst, schrubbe ich dir zum Dank den Rücken.«
»Lass den Quatsch.«
Pete folgte Anna stumm ins Haus. Sie bat ihn, das Gepäck nach oben ins Schlafzimmer zu tragen und öffnete das Wohnzimmerfenster zum Lüften. Der Anrufbeantworter blinkte und zeigte 38 neue Nachrichten an. Sie ignorierte es. Auf dem Tisch standen frische Schnittblumen, mit einer Willkommenskarte von ihrer Mutter. Auch das ignorierte sie. Es ging ihr alles zu schnell. Eigentlich hatte sie heimlich und in aller Ruhe wieder eintauchen wollen in ihr Hamburger Leben. In ein neues Hamburger Leben. Aber die Zeichen standen nicht gut.
Unterwegs zu Frau Hamidi, die in einer typisch hanseatischen Rotklinkervilla im Grandweg lebte, informierte Pete Anna knapp über die Leiche der jungen Frau. Er ging nicht ins Detail. Die Leiche war gestern Morgen auf dem Recyclinghof entdeckt worden. Dabei ein extra verschnürtes Päckchen mit ihren Kleidern, Schuhen und wenigen anderen Habseligkeiten, die sie offensichtlich zum Tatzeitpunkt bei sich gehabt hatte. Karen hatte die Leiche gemeinsam mit Mohsen obduziert und entsetzliche Verstümmelungen festgestellt. Die beiden bemühten sich seit gestern um eine Identifizierung, während Eberhard, Volker und Pete mit Tatortbefundberichten, Zeugenaussagen und Spekulationen der Presse zu tun hatten. Es war ein unergiebiger Tag gewesen. Mehr wussten sie noch nicht, und mehr wollte Anna auch nicht wissen. Nur so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Auf ihr Klingeln öffnete ein junger Mann, der sich als Mohsen Hamidi vorstellte und Anna herzlich dankte, dass sie sich die Mühe machte, gleich nach einer so langen Reise vorbeizukommen. Er besaß ein angenehmes Äußeres, sprach sanft und völlig akzentfrei. Nach einigen einleitenden Sätzen, die die Höflichkeit verlangte, brachte er Anna zu seiner Mutter, die im Wohnzimmer wartete. Auch Frau Hamidi schien überaus sympathisch, eine Frau Ende fünfzig mit dezent-eleganter Kleidung. Nachdem ihr Sohn mit Pete das Wohnzimmer verlassen hatte, bot sie Anna Platz auf einem riesigen, von Kissen übersäten Sofa an und goss Tee in orientalische Gläser. Dabei sah sie Anna prüfend an.
»Sie werden sich bestimmt fragen, warum ich mit Ihnen reden will.«
Anna nickte: »Zumal Sie von Ihrem Sohn sicher wissen, dass ich Privatperson, also keine Polizistin bin und letztes Jahr nur durch Zufall in die Ermittlungen hineingezogen wurde.«
Frau Hamidi nippte an ihrem Tee. »Darum geht es nur am Rande. Ich habe Ihren Aufsatz gelesen: Lust an Zerstörung – über die Psychodynamik von Sadisten.«
»Der Artikel wurde von meinem Kollegen als unwissenschaftlich kritisiert«, erinnerte sich Anna mit bitterem Lächeln. Ihr war immer noch nicht klar, was diese Frau von ihr wollte.
»Mag sein. Weil die Kollegen Ihres Fachbereichs nicht wissen, wie es sich anfühlt. Aber Sie wissen es.«
Frau Hamidi schwieg bedeutungsvoll.
Heftiger als beabsichtigt reagierte Anna: »Was weiß ich?« Zu ihrer Bestürzung bekam sie plötzlich das Gefühl, dass ihr Besuch hier in eine persönliche Sphäre eindringen würde, in der niemand außer ihr etwas verloren hatte.
»Sie wissen, wie es ist, gefoltert zu werden. Ich habe gehört, Sie seien letztes Jahr von einem russischen Killer gequält worden. Sie haben den Artikel geschrieben, um sich zu diesem Erlebnis Distanz zu verschaffen, um für den Verstand erfassbar zu machen, was die Seele nicht verarbeiten kann, nicht wahr?«
Unwillig erhob sich Anna: »Falls Sie tatsächlich etwas verstanden haben, wie Sie behaupten, dann wüsste ich nicht, was Sie Ihrer Meinung nach dazu berechtigt, in meine privatesten Angelegenheiten einzudringen.«
»Ich zeige es Ihnen.« Auch Frau Hamidi erhob sich. Mit leicht zittrigen Händen, aber den Blick fest auf Anna gerichtet, nestelte sie an ihrer schwarzen Seidenbluse. Anna begriff nicht, was da gerade vor sich ging. Als Frau Hamidi ihre Bluse öffnete und Anna ihren freien Oberkörper präsentierte, erkannte Anna immer noch keinen Zusammenhang. Aber sie verstand, dass Frau Hamidi wusste, was Lust an Zerstörung war. Sie hatte es augenscheinlich am eigenen Leib erfahren.
Zwei quälende Stunden später war Anna wieder zu Hause. Als Erstes kühlte sie sich im Bad die verweinten Augen mit Wasser. Auf der Rückfahrt hatte sie kein Wort herausgebracht, und nun saß Pete bei ihr im Wohnzimmer und wartete geduldig auf eine Erklärung. Anna kam etwas wacklig die Treppe herunter. Pete erhob sich und sah sie erwartungsvoll an. Sie ging auf ihn zu und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Er nahm es wortlos hin. Schwer ließ sich Anna in den Sessel fallen und befahl Pete, eine Flasche Rotwein zu öffnen. Als er ihr ein gefülltes Glas reichte, meinte er vorsichtig: »Wir machen es kurz, du bist sicher todmüde.«
»Ich bin hellwach, für mich ist jetzt mitten am Tag«, widersprach sie. »Erzähl mir von der Leiche. Was hat man der Frau angetan?«
Pete rutschte unwohl auf dem Sofa herum: »Sie hat zahlreiche, gezielt angebrachte Schnittverletzungen davongetragen. Nichts Tödliches. In jede einzelne Wunde war Salz eingerieben worden. Ganz offensichtlich wurde sie außerdem mit Elektroschocks gefoltert. Auch an den Genitalien. Vergewaltigt. Und …«
»… und ihr wurden die Brustwarzen mit einer Schere abgeschnitten«, beendete Anna den Satz bemüht sachlich. Pete nickte verärgert: »Hat Mohsen das seiner Mutter erzählt? Der tickt wohl nicht richtig! Morgen werde ich dem ganz schön …«
»Nichts wirst du. Beruhige dich. Der Kerl ist damit nicht klargekommen, auch wenn er schon ein knappes Jahr in der Rechtsmedizin arbeitet. Er wollte es seiner Mutter nicht erzählen, aber gestern Abend nach der Obduktion ist er bei ihr heulend zusammengebrochen.«
»Das kann er sich nicht erlauben, wenn er diesen Job machen will, das sollte er wissen. Was hat seine Mutter gesagt?«
Pete goss nach, denn Anna hatte ihr Glas in zwei kräftigen Zügen geleert.
Anna nahm einen nun etwas kontrollierteren Schluck und fuhr fort: »Frau Hamidi ist im Iran aufgewachsen als Tochter einer privilegierten, politisch links orientierten Familie. Als Studentin hat sie sich dem Untergrund angeschlossen, der den Sturz des Schahs zum Ziel hatte. Sie gehörte zur militärisch-marxistischen Fraktion der Partisanen der Volksfedajin, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls wurde sie vom Savak, dem Geheimdienst des Schahs, geschnappt. Und gefoltert. Schnitte, Elektrokabel, mehrfache Vergewaltigung, über Tage hinweg. Und … man hat ihr die Brustwarzen mit einer stumpfen Schere abgeschnitten.« Anna machte eine Pause, um ihre zitternde Stimme wieder unter Kontrolle zu bekommen.
»Sie hat es mir gezeigt«, fügte sie leise hinzu.
Nach einem Räuspern fuhr sie mit bemüht normaler Stimme fort: »Als dann Chomeini kam, dachten die Iraner, alles würde besser werden. Aber weit gefehlt. Er merkte, dass die Studenten sich nicht so einfach indoktrinieren ließen, und ergriff die altbekannten Maßnahmen. Mit Knüppeln bewaffnete Anhänger der Gottespartei, der Hisbollah, stürmten die Unis und schlossen sie für zwei Jahre. In dieser Zeit wurden wieder Tausende von Studenten, Studentinnen und Lehrkräften verhaftet, gefoltert und hingerichtet. Frau Hamidi hat kurz nach der Schließung der Unis das Land verlassen. Sie will nie wieder dorthin zurück. Mohsen wurde in Deutschland geboren. Er hat keine Ahnung, was seiner Mutter unter dem Schah-Regime zugestoßen ist. Frau Hamidi möchte, dass das so bleibt.«
»Und sie vermutet aufgrund der ähnlichen Verletzungen …«, grübelte Pete.
Anna nickte: »… dass der Mörder ein Iraner ist. Vielleicht jemand vom früheren Savak. Diese Geschichte mit den Brustwarzen war eine berüchtigte Spezialität des Schah-Geheimdienstes.«
Pete starrte ins Leere. »Während du dich frisch gemacht hast, hat Karen angerufen. Sie haben die Leiche identifiziert. Nur die Bestätigung der Mutter steht noch aus. Unsere Tote ist eine einundzwanzigjährige Frau. Aus gutbürgerlichem Hause, wie man so schön sagt. Bislang gibt es absolut keinen Hinweis auf einen politischen Hintergrund oder eine wie auch immer geartete Verstrickung von Geheimdiensten. Mein Täterprofil zielt weitaus eher auf einen sexuell motivierten Sadisten.« Er sah Anna direkt in die Augen: »Für wie glaubwürdig hältst du Frau Hamidi?«
Anna überlegte: »Sie machte auf mich einen sehr ruhigen und kontrollierten Eindruck. Trotzdem könnte es natürlich sein, dass sie als Folteropfer durch Mohsens Schilderung an ihr Trauma erinnert wurde und ihre These von einer alten Paranoia geprägt ist. Wenn es absolut keine Verbindung zum Iran gibt …«
Pete seufzte: »So würde ich das nicht sagen. Unsere Leiche hat zu Lebzeiten im Hauptfach Sozialpädagogik und im Nebenfach Orientalistik studiert. Trotzdem halte ich das alles für ausgemachten Blödsinn. Ich brauche keine geheimdienstlichen Verschwörungstheorien, um mir die missbrauchte und verstümmelte Leiche einer hübschen jungen Frau zu erklären.«
Erschöpft rieb sich Anna mit der Hand über die Augen. »Wie dem auch sei, ich würde vorschlagen, du machst dich an die Arbeit und kriegst das Schwein. Ich habe mit Frau Hamidi gesprochen, wie du wolltest. Das war schlimm genug. Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Ich will einfach nur schlafen.«
Manuela Berger würde lange Zeit nicht mehr schlafen können. Volker hatte sie zu Karen in die Gerichtsmedizin gebracht, damit sie die Leiche identifizieren konnte. Zuerst wies Frau Berger noch den typisch zwiespältigen Gesichtsausdruck von Verwandten auf, der einerseits geprägt war von der unterdrückten Angst, die Leiche auf dem Metalltisch könnte tatsächlich der vermisste Mensch sein, und andererseits der fragilen Sicherheit, dass das alles nur ein blöder, wenn auch schrecklicher Irrtum sein müsste. Karen wusste, was sie davon zu halten hatte: Wunschdenken.
Manuela Berger hatte ihren Sohn Lars dabei, der die Mutter vorsichtig am Arm stützte. Karen begrüßte die beiden mit leiser Stimme. Noch bemühte sich Frau Berger um Selbstbeherrschung, doch Karen wusste aus Erfahrung, wie schnell das psychische Abwehrsystem zusammenbrach, wenn die Angehörigen der nackten Wahrheit ins Gesicht blickten. Frau Berger hielt sich aufrecht, doch ihre Lippen waren zusammengepresst, ihre Hand, die sie Karen reichte, kalt und hart wie ein Eiszapfen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Leiche selbst für Außenstehende nicht ohne Erschütterung anzusehen war, fragte Karen, ob Manuela Bergers Mann die Aufgabe der Identifizierung nicht übernehmen könnte.
»Mein Exmann lebt in Kuwait, er ist Ingenieur«, presste Frau Berger heraus. Volker warf Karen einen Blick zu, der ihr die Größe des Fettnapfs, in den sie gerade getreten war, nur ungefähr beschrieb.
»Ich werde das übernehmen«, warf Lars tapfer ein. Er war Ende zwanzig, überragte seine Mutter um etwa zwei Kopflängen, und machte einen gefassten Eindruck. Noch. Seine Mutter schüttelte den Kopf: »Ich will die junge Frau selbst sehen.«
Nachdenklich betrachtete Karen die attraktive Mittvierzigerin in ihrem schicken Kostüm. Den Stiftrock strich sie mit einer fahrigen Bewegung zum wiederholten Male glatt, eine klassische Übersprungshandlung.
»Es ist kein schöner Anblick«, sagte Karen leise, »und wenn Ihr Sohn die besseren Nerven hat, wäre es mir sogar lieber …«
»Es ist nicht Uta, das kann gar nicht sein«, unterbrach Frau Berger bestimmt, »auch wenn die Beschreibung passt. Ich bin nur ein bisschen in Panik, weil sie gestern nicht zum Mittagessen kam und sich seither nicht gemeldet hat. Typisch Glucke. Aber wer weiß?« Frau Berger bemühte sich um ein Lächeln, was gründlich schiefging. »Die jungen Dinger können tausend Gründe haben, sich nicht bei ihrer Mutter zu melden, nicht wahr?«
Das »nicht wahr?« hatte sie fast flehend ausgesprochen. Sie wollte von Karen die Erlaubnis, ihren Kopf weiter in den Sand stecken zu dürfen. Vermutlich wäre sie am liebsten sofort wieder nach Hause gefahren, um weiterhin hoffen zu können, dass sich ihre Tochter melden würde. Wenn nicht jetzt, dann gleich. Oder später. Und erst wenn die Ungewissheit noch quälender wurde als die Angst vor einer traurigen Gewissheit, würde sie freiwillig wiederkommen.
Karen öffnete die Tür zum Kühlraum, wo die Leiche auf einem Metalltisch aufgebahrt lag. Ein weißes Tuch bedeckte ihren Körper. Volker blieb draußen. Mit wackligen Schritten näherte sich Frau Berger, nun deutlich Gewicht auf den Arm ihres Sohnes verlagernd. Einen Meter vom Tisch entfernt blieb sie stehen, holte noch einmal Luft und nickte Karen zu. Vorsichtig zog Karen das Tuch zurück. Sie legte nur das Gesicht frei, um der Frau noch schlimmere Albträume zu ersparen.
Manuela Berger blickte in das wächserne Gesicht, in dem Karen die schlimmsten Verletzungen überschminkt hatte. Plötzlich kam ein qualvoller, fast unmenschlicher Laut über ihre Lippen, und sie sackte zusammen. Lars und Karen konnten sie gerade noch halten, bevor sie auf den Fliesenboden aufschlug.
Volker kam sofort hinzugerannt, nahm Manuela Berger hoch und trug sie hinaus, wo wie immer eine Liege bereitstand. Karen wollte folgen, um sich um Frau Berger zu kümmern, doch Lars blieb wie betäubt vor der Leiche stehen.
»Sie ist es, oder?«, fragte Karen behutsam.
Lars nickt apathisch: »Uta. Sie ist es.«
Karen fasste ihn ganz leicht am Arm, um ihn aus seiner Starre zu lösen und hinauszuführen. Doch er riss sich los, erschrocken durch die Berührung, die er nicht einmal bewusst wahrgenommen hatte, und fuhr herum.
»Wer tut so was?«, schrie er. Sein Gesicht war verzerrt von Hass und Verzweiflung.
In dieser Nacht schien es keinen Schlaf zu geben. Als hätte sich etwas Dunkles, Böses über der Stadt ausgebreitet, das einen instinktiv zwang, die Augen nicht zu schließen, weil die Angst zu groß war, es könnte keinen Tag mehr geben und das Licht nicht mehr zurückkommen und ewige Finsternis würde sich ausbreiten, eine Finsternis, so undurchdringlich, dass selbst das Atmen schwer fiel. In dieser Nacht gab es keinen Schlaf. Auch für Christian nicht.
Nachdem er Volker nach dessen wie üblich überragendem Sieg zur Tür gebracht hatte, saß er im Wohnzimmer und fand keine Ruhe. Er lauschte dem Herbststurm, der von draußen gegen die Fensterscheiben tobte, er lauschte dem Herbststurm, der in ihm selbst tobte. Anna war wieder da. Anna. Als er sie letztes Jahr kennengelernt hatte, hatte er kaum zu hoffen gewagt, dass daraus einmal mehr werden würde. Sie war jung, klug und schön. Und sie war die Affäre von Pete, diesem halbamerikanischen Profiler aus der FBI-Schmiede. Pete, der ihm damals vom BKA als Aufpasser ins Team gesetzt wurde, war ihm schon am ersten Tag auf den Geist gegangen mit seiner selbstbewussten, jugendlichen Frische. Unvorstellbar, dass sich Anna schließlich gegen Pete und für ihn entschieden hatte. Aber er hatte das getan, was er am besten konnte. Er hatte es versaut, gründlich versaut.
In einem Anfall von Selbstekel trank Christian den letzten Schluck aus seinem Whiskyglas, griff nach seiner Jacke und flüchtete aus der Wohnung, in der seine Gedanken doch nur immer wieder gegen die gleichen Mauern prallten. Er brauchte frische Luft und ging los, ohne auf den Weg zu achten. Christian war schon immer gerne ziellos durch die Gegend gelaufen, wenn er auf andere Gedanken kommen wollte. Der Wind pfiff ihm um die Ohren, zerrte an Haaren und Kleidung, seine zu dünne Jacke flatterte, er zog sie enger um sich, lehnte sich leicht gegen die Kraft des Sturms an. Absichtslos ging er am Kaiser-Friedrich-Ufer entlang, blieb gedankenverloren stehen, versuchte, sich eine Zigarette anzustecken, was wegen des Sturms nur schwer gelang. Zwei Ratten spielten an der Böschung miteinander. Von ihrem Quieken aus seiner Versunkenheit gerissen, ging er weiter.
Hoffentlich hielt Anna Abstand zu dem neuen Fall. Und zu Pete. Sie war zwar eine starke Frau und kam mit dem Schrecken, den sie letztes Jahr erlebt hatte, inzwischen zurecht, aber Christian wollte nicht, dass sie etwas Ähnliches jemals wieder durchmachen musste. Er liebte sie im Grunde immer noch, und nur das konnte erklären, dass er sich unversehens vor ihrem Haus wiederfand.
Petes Wagen stand nicht mehr da, aber durch das Küchenfenster, das nach vorne lag, konnte man erahnen, dass im Wohnzimmer dahinter noch Licht brannte. Christian widerstand nur mit Mühe dem Impuls, zu klingeln. Anna, dachte er, schöne Anna. Er hatte sie im Stich gelassen damals, sich im eigenen Sumpf aus Selbstmitleid gesuhlt und irgendwann keinen Gedanken mehr daran verschwendet, dass Annas Probleme weitaus schwerwiegender waren als seine blöde verletzte Eitelkeit. Okay, am Anfang hatte er ihr noch zur Seite gestanden, hatte ihr die Hand gehalten und die Seele behütet, wenn die Angst sie an der Gurgel packte und ihr die Luft abschnürte. Sie war so tapfer gewesen, hatte alle Kraft aufgewandt, um ihn nicht spüren zu lassen, wie schlecht es ihr ging. Dass sie sich verkrampfte, wenn sie beim Sex seine Leidenschaft unwillkürlich als Bedrohung empfand. Dass sie den Geruch von Sperma nur schwer ertrug. Dass sie sich in der Rolle der Therapeutin nicht mehr ertrug. Anna hatte das alles durchlitten, sie hatte dagegen angekämpft mit ihrem ganzen Verstand und jeder Faser ihres Körpers. Und sie hatte gesiegt. Er hingegen hatte sich sofort gehen lassen, als auch nur das Geringste schiefging, er hatte sich zurückgezogen wie ein beleidigtes Kind, geschmollt, und alle Welt für sein Scheitern verantwortlich gemacht, nur nicht sich selbst. Dafür schämte er sich. Er war Anna nicht wert. Er sollte sie in Ruhe lassen. Was tat er überhaupt hier? Herrgott noch mal, was sollte das? Er war raus aus der Show, sowohl beruflich als auch privat. Und das war besser so, für alle Beteiligten. Abrupt wandte er sich um und machte sich auf den Heimweg.
Schorsch wachte blinzelnd auf. Mann, hatte er einen Brummschädel! Wohl zu viel gesoffen gestern mit Hansi, grinste er in sich hinein. Er wollte aufstehen, doch es ging nicht. Seine Glieder waren wie Blei. Schorsch schüttelte den Kopf, um noch wacher zu werden. Das tat verdammt weh. Er wollte die Hand heben und sich am Kopf kratzen. Aber auch das ging nicht. Weder die eine Hand noch die andere ließ sich bewegen. Schorsch hatte eine schrecklich trockene Kehle, einen Nachbrand der höllischsten Sorte. Was hatte er gestern bloß für ’nen beschissenen Stoff gekippt? So schlimm war es ja noch nie gewesen. Er versuchte noch einmal, sich aufzurichten. Es ging ums Verrecken nicht. Er konnte sich keinen Millimeter bewegen. Wo war er überhaupt? Kein Himmel über ihm zu sehen. Nur Dunkelheit, tiefschwarze Dunkelheit. Kein Autoverkehr von der Kollaustraße, sondern absolute Stille. Er war in einem Raum. In einem absolut stillen, absolut schwarzen Raum. Es war kalt und roch modrig. Und er konnte sich nicht bewegen. Doch allzu große Gedanken machte sich Schorsch nicht. Er war mit jeglichen Arten von Blackouts vertraut. Am besten er schlief noch ’ne Runde, dann würde er klarer sein, sich bewegen können und Hansi unter der Brücke abholen. Friedlich wollte sich Schorsch wieder in den Nebel gleiten lassen, doch eine Tür quietschte metallisch, und ein plötzliches grelles Licht über seiner Lagerstatt blendete ihn. Er kniff die Augen zusammen und fluchte: »Mach’s Licht aus, du Arsch, ich will schlafen!«
Ein amüsiertes Lachen war zu hören und dann eine sehr angenehme Stimme: »Du hast fast zwanzig Stunden verpasst, du Penner. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Das wird zwar nicht mehr allzu lange dauern, aber vorher wollen wir noch etwas Spaß haben, wir beide.«
Und ganz plötzlich war Schorsch hellwach und erinnerte sich an den Plastiksack im Recyclinghof. Den Plastiksack mit dem Fuß drin. Beim Sondermüll. Schorsch wurde schlagartig übel. Aber bewegen konnte er sich immer noch nicht. Keinen einzigen Millimeter.
Tag 3: Montag, 30. Oktober
Christian belegte sich gerade ein Knäckebrot mit schon leicht gewellten Käsescheibletten, als es Sturm klingelte. Verwundert sah er auf die Uhr. Kurz nach sieben. Er drückte den Summer und wartete an der Tür, bis der Fahrstuhl oben ankam. Dass er mit freiem Oberkörper in einer ausgebeulten Jogginghose dastand, juckte ihn wenig. Aus dem Aufzug trat eine Frau, die zu viel Make-up aufgetragen hatte, um die Spuren ihrer durchwachten Nacht zu übertünchen. Es war ihr nicht gelungen.
»Manu«, entfuhr es Christian. Seit mindestens fünf Jahren hatte er weder etwas von ihr gesehen noch gehört. Sie hatte sich kaum verändert. Sie war immer noch perfekt frisiert, perfekt gekleidet, teuer und stilvoll, die typische Vogue-Leserin, deren Glanz schon lange nicht mehr in den Augen liegt sondern in den Knöpfen des Chanel-Kostüms und die sich ihr Botox nicht von jedem Scharlatan spritzen lässt. Allerdings schienen durch die überpflegte Fassade kleine Risse hindurch, zumindest heute, zumindest um diese Uhrzeit. Wortlos ging Manuela Berger an ihm vorbei in die Wohnung. Christian folgte ihr. »Was ist denn los? Du siehst ja furchtbar aus.« Manuela ignorierte Christians bekannt uncharmante Art.
»Meine Tochter. Irgendein Schwein hat meine Tochter umgebracht«, stieß sie zitternd hervor. Christian nahm ihr den Mantel ab.
»Setz dich, ich mach uns Kaffee«, sagte er.
»Ich will keinen Kaffee, ich will, dass du den Kerl zur Strecke bringst.«
Sanft drückte Christian sie in die Polster seines Sofas. »Ich bin nicht mehr bei der Polizei. Suspendiert. Seit knapp einem Jahr.«
»Das ist mir egal.«
Christian sah Manuela nachdenklich an. Vor einigen Jahren hatte er eine Affäre mit ihr gehabt, doch als sie sich ernsthaft in ihn verliebte und ihren Mann und ihre beiden Kinder für ihn verlassen wollte, war ihm die Sache zu bedrohlich geworden, und er hatte sich von ihr getrennt. Nicht im Guten.
»Du findest ihn, und du tötest ihn für mich. Das bist du mir schuldig.«
Ohne Rücksicht auf die Straßenverkehrsordnung raste Volker auf seinem »One-Fucking-Gear«-Bike in Richtung Schanzenviertel. Er war spät dran. Der 41-jährige Verhörspezialist hatte heute Morgen etwas zu lange für seine buddhistischen Übungen gebraucht, irgendwie hatte er dabei jedes Zeitgefühl verloren. Zuspätkommen war in Volkers Augen eine Respektlosigkeit den Kollegen gegenüber, also trat er in die Pedale wie ein Berserker und beging fast eine folgenschwere Respektlosigkeit einer Passantin gegenüber. Er konnte gerade noch bremsen.
Als Volker trotz der kühlen Temperaturen verschwitzt in der schäbigen Einsatzzentrale ankam, saßen seine Kollegen Eberhard und Daniel schon im Konferenzzimmer. Daniel, ehemaliger Hacker und Spezialist für jegliche legalen und illegalen Recherchen per Datenautobahn, grüßte nur mit einem kurzen Brummen und versenkte seinen Blick wieder in die Boulevard-Zeitung vor ihm. Eberhard, der 35-jährige Kriminaltechniker, der wegen seiner Liebe fürs Kochen Herd genannt wurde, stand in einer alten Jeans und einem fleckigen Baumwollhemd hinter Daniel und stemmte mit einem Eisen einen langen und tiefen Riss in der Wand weiter auf. Er machte dabei einen Höllenlärm und überzog alles mit einer feinen Staubschicht, was Daniel nicht weiter zu stören schien. Der Riss existierte, seit sie in diese Bruchbude eingezogen waren, und er hatte sich seitdem stetig vergrößert.
»Was soll’n das, Herd?«, fragte Volker. Sie hatten weiß Gott andere Dinge zu tun.
»Seit Monaten telefoniere ich hinter der Hausverwaltung her. Bis die einen Handwerker schicken, ist der Riss so breit wie der Grand Canyon. Also mache ich es selbst. Aufstemmen, auffüllen, zuspachteln. Ist eh besser, wenn ich mich drum kümmere, dann weiß ich, dass es anständig gemacht wird.« Eberhard klopfte und kratzte und stemmte ungerührt weiter.
»Yvonne flippt aus, wenn sie die Sauerei sieht«, meinte Volker.