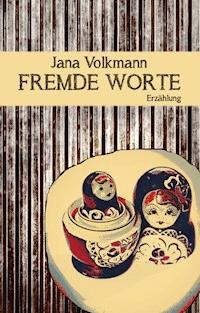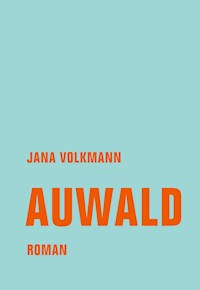Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jana Volkmann erzählt mit feinem Humor von Tieren, Menschen und gleichberechtigten Formen des Zusammenlebens, die ebenso selbstverständlich wie revolutionär sind. Eine Sommernacht in der Wiener Innenstadt, zwei Frauen sind auf dem Heimweg, als ihnen in einer kleinen Gasse ein herrenloses Pferd begegnet. Das leicht verwahrloste Tier trottet ihnen nach bis zu ihrem Häuschen in der Vorstadt und bezieht im Garten Quartier. Fortan kümmern die beiden sich um den neuen Mitbewohner. Was zunächst wie eine märchenhafte Fantasie anmutet, steigert sich zu einem außergewöhnlichen Roman über das Zusammenleben von Tier und Mensch, über Tierrechte und Ausbeutung, über Selbstbestimmung und ihre Grenzen. Mit Eleganz und Witz erzählt Jana Volkmann eine hochaktuelle Geschichte, in der Hühnerfabriken gestürmt werden, Schweine über die Simmeringer Hauptstraße galoppieren – und jede*r für sich entscheiden muss, wie wir in Zukunft leben wollen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jana Volkmann
DER BESTE TAG SEIT LANGEM
Roman
Der Verlag dankt für die Unterstützung
Für die Arbeit an diesem Buch hat die Autorin ein Projektstipendium des BMKÖS sowie ein Stipendium des Fritz-Hüser-Instituts für Literatur und Kultur der Arbeitswelt Dortmund erhalten.
© 2024 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Sebastian Menschhorn
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Jessica Beer
ISBN ePub:
978 3 7017 4726 9
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 1790 3
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Epilog
Danksagung
»Ich schreibe mit zwei Katzen an meiner Seite, während ich an euch denke. Möge ich sie niemals verraten, denn damit verriete ich mehr als mich selbst, ich verriete das Beste vom Menschen.«
– Hélène Cixous, Liebes Tier
»Es ist ein merkwürdiges Gefühl, für Mäuse zu schreiben.«
– Marlen Haushofer, Die Wand
Kilometerweit Wiese. Im Halbdunkel kurz nach Sonnenuntergang noch geschäftiger als sonst. Selbst von hoch oben müsste man das Surren hören, das wie von der Landschaft selbst zu kommen scheint, das in Wahrheit aber das Werk tausender, abertausender Insekten ist, zu einem einzigen großen Chor vereint. Man könnte zwei parallellaufende Linien in der Landschaft ausmachen, sähe man genauer hin: Dort, wo sich die alten Gleise befinden, bleiben noch immer deutlich sichtbare Schneisen, auch wenn sich durch den Schotter hindurch schon längst die Gräser gebrochen haben und die Holzschwellen beinahe nicht mehr zu sehen sind, wohl weil sie morsch geworden, mit Ameisenhilfe in kleinere und immer kleinere Schwellenstücke zerfallen und schließlich zugewachsen sind. Die Metallschienen hingegen bleiben und trotzen, dabei gibt es hier nichts, dem man sich auf Dauer widersetzen könnte.
Folgte man diesen Schneisen ein Stück weiter in die Landschaft hinein, stieße man auf einen Zug, der freilich längst, noch in anderen Zeiten, zum Stillstand gekommen ist. Von oben sähe man, wie aufgefädelt, die nahezu intakten Dächer der Waggons. Folgte man nun den Dächern bis kurz vor das Ende des Zugs, täte sich plötzlich ein Licht auf, ein Flackern, ein grelles Rot vor dem nun bereits tintenblauen Himmel und den zu Schlagschatten verhärteten Silhouetten kahler Bäume. Man könnte meinen, der Waggon stünde in Flammen, doch bei näherem Hinsehen zeigte sich, dass das Feuer sich davor befände, draußen, und es wäre kreisrund eingehegt von Steinen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit schlichtweg aus dem früheren Gleisbett entfernt worden wären. Sähe man nun noch genauer hin, könnte man einen Trampelpfad ausmachen, welcher vom Waggon in die Wiese hineinführt: ein Wildwechsel, wenn man das glauben möchte, denn einen Menschen oder gar eine Gemeinschaft von Menschen könnte man sich hier nur schwer vorstellen. Wie auch? Ungewöhnlich wäre es nicht, hätten die Wildtiere aus der Umgebung die alten Garnituren zu Koben umgewidmet, denn früher oder später wäre es ihnen zweifellos gelungen, die Waggontüren zu öffnen oder schlicht ein Fenster zu zerstören, durch das sie mühelos ins Innere des Zuges klettern könnten.
Der Wildwechsel verlöre sich bald schon zwischen den Bäumen; nun wäre die Dunkelheit schon zu groß, um erkennen zu können, ob er dahinter wieder auftauchen und wohin er führen würde. Auch der Ursprung des Feuers bliebe rätselhaft. Man könnte nun die Koordinaten aufschreiben, eine Markierung auf eine Karte setzen und sich versprechen, bei Tageslicht wiederzukommen, um alles offen Gebliebene aufzuklären.
Kapitel 1
Cordelia sah das Pferd zuerst. Es stand an die Außenwand eines Gasthauses gelehnt, als hätte es gesoffen, und schaute leer in die von einer Unzahl Sterne perforierte Nacht. Sein linker Vorderhuf war in Schonstellung gebracht. Ein weißes Spitzenhäubchen, das es über seinen Ohren trug, wurde von einer Laterne so stark angestrahlt, dass sich eine flirrende Aura darum bildete, während das schwarze, dumpfe Fell alles übrige Licht absorbierte, nur an manchen Stellen beinahe bläulich aufschimmerte. Einem so derartig räudig ausschauenden Tier so etwas aufzusetzen, so ein dekoratives Deckchen, kam mir boshaft vor wie ein grausamer Kinderstreich. Es trug keinerlei Zaumzeug, Geschirr oder Sattel; so wirkte das Pferd wie jemand, der einen Hut trägt und ansonsten nackt ist, wobei der Hut nicht von der Nacktheit ablenkt, sondern sie ganz im Gegenteil grotesk verstärkt. Ich blieb auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen. Cordelia trat vorsichtig ins Sichtfeld des Pferdes, die linke Hand zur Beschwichtigung erhoben. Der Schweif des Rappen schlug abwechselnd gegen die Wand und gegen die eigene Flanke, ansonsten war das Pferd reglos. Es machte nicht den Eindruck, als könne es noch gefährlich werden.
Die Fensterläden des Gasthauses waren verschlossen. Kein Licht leuchtete dahinter, auch in den anderen Häusern war es dunkel, die ganze Straße entlang. Einzig die Gaslaternen schimmerten sanft, und damit es nicht zu sehr wie vor hundert Jahren aussah, gab es da und dort ein beleuchtetes Schaufenster. Die letzten Tage, warb ein Bekleidungsgeschäft in handgeschriebenen Lettern. Ich wagte mich näher heran, weil meine Nichte Cordelia sich näher wagte und weil auf ihr Urteil, anders als auf meines, Verlass war. Das Pferd sah mich erst, als auch ich direkt in sein Blickfeld trat. Es erschrak nicht, also erschrak ich ebenfalls nicht. Es stieß mich mit dem Kopf an, der eben noch trübe heruntergehangen hatte, und ich begann, es zu kraulen. Meine Hände waren beherzt und angstlos. Als ich sicher war, dass es gegen Berührungen nichts einzuwenden hatte, nahm ich ihm die Haube ab, denn Tiere, die sowas tragen, haben schon genug Erniedrigungen über sich ergehen lassen. Ich ließ sie zu Boden fallen und schob sie mit der Fußspitze ein Stück beiseite, bis dass ein Gully sie sich einverleibte. Geräuschlos fiel sie hinab in die Kanalisation, ins Unterbewusstsein unserer Stadt. Die Ohren des Pferdes zuckten in alle Richtungen.
Nichts auf der Erde war so weich wie diese Pferdenase. Ich stellte mir vor, dass das für alle Pferdenasen galt: Egal, wie alt und struppig das Pferd bereits war, wenn mit den Jahren überhaupt etwas mit ihren Nasen geschah, dann nur, dass sie noch weicher wurden. Ich kraulte seine Stirn, kämmte mit den Fingern durch seine Mähne. Die Augenlider des Pferdes sanken auf Halbmast. Nie hatte ich ein so müdes Tier gesehen. Ich kraulte und kämmte, bis mir der Arm schwer wurde, und sann, ohne dass der Rappe etwas davon mitbekam, darüber nach, was man am besten machte mit einem fremden Pferd, noch dazu mitten in der Nacht. Ich fragte mich, ob es mir zugelaufen war oder ob Cordelia und ich nicht vielmehr ihm zugelaufen waren. Ab wann Tiere überhaupt als einander zugelaufen gelten. Wann man einander behalten durfte, wann man dazu sogar verpflichtet war. Sie klingeln ja kaum an der Haustüre, die herrenlosen Katzen und Hunde, und fragen, ob man vielleicht eine Schüssel Wasser übrig hat. Dann löste mein Gedanke sich auch schon wieder im Nebel aus Wein, Pferd und Nacht auf. Ich tätschelte die mir zugewandte Seite des Pferdes und bildete mir ein, dass es staubte. An einigen Stellen war das Fell abgeschürft und gab den Blick auf raue, graue Pferdehaut frei. So sehen Pferde aus, die Tag für Tag in ein Geschirr gespannt sind, ohne dass jemand auf die Idee kommt, dessen Sitz zu überprüfen. Das Pferd taumelte einen Schritt nach vorne und lehnte sich noch dichter an die Wand. Selbst seine Unterlippe hing hinunter, es hatte nicht genug Kraft, sein Gesicht bei sich zu behalten. Wir hatten es sehr wahrscheinlich mit einem Fiakerpferd zu tun.
»Cordelia«, sagte ich, »ein Fiakergaul. Und auch noch ein versehrter. Na super.« Sie sah mich unergründlich an. »Was machen wir denn jetzt?«
Meine Stimme klang ein wenig angezecht. Ich lallte nicht, aber besonders deutlich sprach ich auch nicht gerade; es fühlte sich an, als hätte ich außer den Worten noch etwas anderes im Mund. Das mit meiner Stimme wurde über die Jahre immer schlimmer. Sie gab mich jedesmal preis, aber heute waren es höchstens drei weiße Spritzer gewesen, bei einer so kleinen Menge konnte man schlecht einen für überflüssig erklären. Andere trinken diese Mengen vorm Frühstück und können dann noch die Merseburger Zaubersprüche oder ein Dialektgedicht aus dem Gedächtnis runterrattern, in einer theatralen Deutlichkeit, als sprächen sie vor Publikum. Solche Talente trifft man in jedem guten Wirtshaus, da muss man nicht einmal Pech haben.
Das Pferd hatte offensichtlich die Arbeit niedergelegt und war stiften gegangen. Einen Fiakergaul lässt man nicht einfach durch die Gegend spazieren und an Gasthäusern lehnen, wie es ihm beliebt. Eigentlich wäre es das Beste, ihn einfach in Frieden lehnen und seine Geschicke selbst bestimmen zu lassen. Streiks stimmten mich sentimental; zwischen Aufruhr und Rührung lag bei mir nicht viel. Ich gratulierte dem Pferd zu seiner klugen Entscheidung, tätschelte abermals seinen Hals, und wünschte ihm alles Gute. Wieder stieß es seinen Kopf gegen meine Brust. Dann sagte ich: »Lass uns nach Hause gehen, Cordelia.«
Wenn ich nüchtern war, sagte ich nur selten ihren Namen. Dazu brauchte ich Mut, und im normalen Leben war ich so feig, dass es kaum auszuhalten war. Sie lief voraus und drehte sich an der nächsten Kurve nach mir um, wartete, bis ich sie eingeholt hatte. Noch im Abbiegen hörte ich hinter uns Hufgetrappel, etwas ungleichmäßig, so als lahmte der Rappe auf einem Bein. Das ist das ärmste Pferd auf Erden, dachte ich, und dann geht es ausgerechnet uns hinterher, was für ein Los. In regelmäßigen Abständen wartete Cordelia auf mich, dann warteten wir gemeinsam auf das Pferd, dann liefen wir in unseren jeweils eigenen Geschwindigkeiten wieder weiter. Während wir immer stiller und schlapper wurden, schien das Pferd mit jedem Schritt zu neuen Kräften zu gelangen und dem Weitergehen, immer Weitergehen seines Berufsstands alle Ehre zu erweisen.
Einem einzigen anderen Menschen begegneten wir am Heimweg: Eine Frau kam auf der anderen Straßenseite aus einem imposanten Haus heraus; es war eine kleine, zierliche Frau, die in einer gigantischen Türe erschien. Sie trug ein kurzes schwarzes Kleid und kleine, spitze, schmale Schuhe. Mit einem eleganten Satz sprang sie in den Hauseingang zurück, als sie Cordelia und mich sah, und wieder auf den Gehsteig hinaus, als sie den Rappen bemerkte. Sie setzte sich eilig in die Gegenrichtung in Bewegung, ließ es sich jedoch nicht nehmen, sich noch ein paarmal nach uns umzusehen, empört und verschreckt. Ihre Bewegungen wirkten, als wären sie Teil einer Choreografie, der offene Mantel schwang mit Eile und Grazie um sie herum.
»Gute Nacht«, rief ich ihr hinterher, was sie nur noch schneller werden ließ. Hinter mir kicherte jemand. Ich drehte mich um, sah Nichte und Gaul. Wir triumphierten, nur war uns noch nicht klar, über wen und was. Dabei bestand keinerlei Zweifel, dass nicht das Pferd bei der Passantin für Unbehagen gesorgt hatte, sondern vielmehr meine Erscheinung. Bei mir hatte sich etwas gelockert. Ich kam mir vor wie ein jugendlicher Unruhestifter, gefangen im Körper einer angealterten Frau. Dem Alkohol konnte ich keine Schuld zuweisen, ich hatte es schon länger bemerkt – besonders daran, wie die Menschen mir begegneten, mit einer argwöhnischen Neugier.
Ohne das Pferd hätten wir den Nachtbus genommen oder uns ein Taxi geleistet, zumal Cordelia und ich weit außerhalb des Stadtkerns wohnten, eher an der Außenhaut der Stadt; falls es so etwas gab, bildeten wir ihr Abschlussgewebe, die letzte Schranke zwischen etwas und nichts. Mit dem Pferd jedoch blieb uns nichts anderes übrig, als durch Bezirke und Außenbezirke bis nach Hause zu laufen. Zwischendurch hielten wir an einer Wasserpumpe, wo ich für Cordelia und den Rappen eine beachtliche Menge kalten Wassers herausließ. Ich selbst verzichtete. Der Rappe schlappte eine Lacke auf den Asphalt und zog eine Spur nasser Hufeisenabdrücke hinter sich her, als wir weiterliefen. Wir erreichten das Gartentor pünktlich bei Sonnenaufgang. Ich geleitete das Tier in den Garten. Es lief behutsam über den Pfad, keine einzige Blume knickte es um, trat nicht einmal neben die Steinplatten. Auf dem Rasen hinter dem Haus kam es zum Stehen, wankte vor und zurück. Dann sank es hin und legte sich seitwärts, wie man es nur von ungeheuerlich erschöpften Pferden kennt. Von meinem Blickwinkel betrachtet füllte sein Körper einen großen Teil der Rasenfläche. Über uns in der Linde machten Vögel unterschiedlicher Arten einen Krawall, als wollten sie uns um jeden Preis verjagen. Cordelia legte sich neben den Rappen, nicht zu dicht, und ich legte mich in angemessenem Abstand neben Cordelia. Der Weg die sieben Stufen hinauf zur Haustür erschien mir unermesslich weit. Während wir schliefen, wurde es Tag, und Menschen frisierten sich, zogen sich an, frühstückten und fuhren zur Arbeit.
Als ich von einer in Hörweite zugeschlagenen Autotür geweckt wurde, waren meine Kleider klamm und steif von der nachtfeuchten Wiese, mein Hals kratzte, in meiner Schläfe pulsierte es und ich hatte einen Hunger, als wäre ich zwölf Tage lang ohne Nahrung durch die Tundra gelaufen, bloß um hier in meinem eigenen Garten zu landen. Mein Mund war trocken. Das Pferd hatte ich vergessen. Als es mir wieder einfiel, misstraute ich meiner Erinnerung, was so furchtbar war, dass ich auf keinen Fall überprüfen wollte, ob das Pferd wirklich existierte. Es erschien mir beides gleich wahrscheinlich: dass uns mitten in der mondlosen, menschenlosen Nacht ein Fiakerpferd ohne Herr und ohne Halfter zugelaufen war, oder dass ich mir das ausgedacht hatte, ohne meine Fantasie besonders anzustrengen. Cordelia kam zu mir und legte ihren Kopf an meine Schulter. Ihre Ruhe beruhigte auch mich, ich bemühte mich, beim Atmen ihren Rhythmus zu halten.
Mein Grundstück, unser Grundstück, war von einer ungeheuerlichen Hecke gesäumt, so hoch und dicht, dass die Nachbarn uns nur zu Gesicht bekamen, wenn wir es darauf anlegten. Die Hecke war auf unserer Seite nur mäßig gut gestutzt, es streckten sich zwar Zweiglein heraus, aber mit ihrem tapfer senkrechten Wuchs erinnerte sie an eine Zimmerwand, so dass sie unseren Garten weniger als einen Teil der Außenwelt erscheinen ließ, sondern vielmehr als eine Erweiterung des Hauses, wie eine Art Windfang. Ich dämmerte noch einmal weg, ohne richtig einzuschlafen. Als ich schließlich die Augen aufschlug, sah ich zuerst Cordelias Haar, wie es sich über die Wiese ergoss, dann hob ich meinen Kopf und meinen Blick. Durchs Genick fuhr mir ein Schmerz, der jedoch weit milder war, als ich es nach einer Nacht ohne Bett erwartet hätte. Ich fühlte mich beinahe vital, ganz ungewohnt um diese Uhrzeit. Allmählich ergaben die verschwommenen Fragmente meines Blickfeldes ein zusammenhängendes Bild. Ein schwarzes, schmutziges Pferd graste in meinem Garten. Aus meiner Liegeposition schien es gigantisch, es nahm den gesamten Himmel ein, überragte die Hecke und sämtliche Bäume. Dass ich so ruhig daneben hatte schlafen können, neben diesen mahlenden Zähnen und stampfenden Hufen, sprach nicht für meine geistige Verfassung. So sanft wie möglich erhob ich mich, nichts tat mehr weh; ich füllte dem Pferd einen Putzkübel voll Wasser, in den es sogleich den Kopf hängte und in ungeduldigen Schlucken trank, dann kochte ich Kaffee.
Cordelia hatte sich in der Zwischenzeit auf dem Sofa eingerollt. Als ich hinging und sie auf die Stirn küsste, schnarchte sie kurz auf, ohne zu erwachen. Ich setzte mich mit einem Kaffee auf die Stufen und sah dem Pferd dabei zu, wie es durch den Garten pflügte. Es handelte sich, sah ich, bei dem Rappen um eine Stute. Sie hob den Kopf und begann, mit geschürzten Lippen an der Hecke zu zupfen, so dass das ganze Konstrukt ins Zittern geriet. Sie zupfte etwas beherzter, schon ging ein Wanken durch die Hecke, das von der anderen Seite aus betrachtet sicher nicht ganz unverdächtig aussah.
»Bitte nicht«, sagte ich, denn wenn mir eines heilig war, dann mein Sichtschutz, und die Stute hörte sogleich auf und wandte sich wieder dem Rasen zu. Sie wogte beim Essen vor und zurück. Der Garten schwankte.
Kapitel 2
Ich hörte genau hin. Spulte zurück und lauschte erneut. In meinem Arbeitszimmer gab es nur mich und meine Wörterlisten und Wörterbücher, meine Nachschlagewerke auf sich biegenden Borden. Die Kaffeeränder auf der Schreibtischplatte, die mein Alter wie Jahresringe dokumentierten. Einen Stuhl, der quietschte, und einen Teppich darunter. Auf der Fensterbank verstaubten Muscheln und Schneckenhäuser: Erinnerungen, die längst nur noch als Hüllen, Hülsen, Schalen vorhanden waren. Vom Meer geschliffene und eingetrübte Glasscherben. Was Leute aufheben, die alles aufheben. Die Vorhänge hatte ich zugezogen und den Spalt, der sich beständig ohne mein Zutun zwischen den Stoffbahnen öffnete, mit zwei Wäscheklammern verschlossen. Auf dem Schreibtisch hatte ich eine Tasse Kaffee, ein Glas Wasser und eine Schale mit gesalzenen Nüssen aufgereiht. Dass draußen im Garten ein fremdes Pferd graste, kümmerte mich hier drin nicht, es hatte, solange ich am Schreibtisch saß, nichts mit mir zu tun.
Drei Tage zuvor hatte ich noch mit meinem Klienten telefoniert. Er hatte überrascht getan, als ich ihm meinen Preis genannt hatte, und zwar nicht, weil es ihm zu wenig vorgekommen war. Er hatte es als Affront aufgefasst, dass ich nicht bereit gewesen war, meine Preise zu drücken, nur weil wieder jemand der Ansicht war, dass man nebenbei vorm Fernseher transkribieren konnte oder in der Stunde zwischen Hund und Wolf im Halbschlaf. Ich kannte diese Argumentation bereits: Interviews zu führen war seiner Ansicht nach zur einen Hälfte harte Arbeit und zur anderen schöne Kunst. Interviews abzuschreiben, also aus halben Sätzen ganze, aus einer Aneinanderreihung von Grammatikfehlern, Ellipsen, Füllwörtern und Ähs und Quasis etwas zu machen, das jemand anderer nicht bloß inhaltlich halbwegs verstehen konnte, sondern auch interessant fand, das war Trottelarbeit, das konnte jeder. Aber da hatte er sich die Falsche ausgesucht.
»Wissen Sie«, hatte ich ihn aufgeklärt, »dass Künstliche Intelligenz intelligent genug ist, nicht nur Fragen zu beantworten, sondern sie auch gleich selber stellen könnte, aber dass sie noch lang nicht so weit ist, um aus dem, was Sie mir schicken, etwas zu machen, das nicht komplett non sequitur ist? Einfach, weil in Wahrheit niemand, kein einziger Mensch, so redet, wie er zu reden glaubt, gescheit und in vollständigen, hübschen Sätzen? Bitte, versuchen Sie Ihr Glück. Lassen Sie meine Arbeit doch einfach von einer Maschine machen, so schwer kann’s ja nicht sein. Ich sage Ihnen, Sie werden sich anhören, als hätten Sie gerade erst sprechen gelernt, und Ihre Gesprächspartnerin auch. Die wird sich bedanken. Sie können sich nicht vorstellen, was das mit dem Selbstwertgefühl macht, wenn man schwarz auf weiß sieht, dass man keinen geraden Satz herausbringt. Viel Erfolg!«
Ich hatte gespürt, dass er mir widersprechen wollte. Dass er kurz davor war, es darauf ankommen zu lassen, und sich in Gedanken bereits irgendeine Transkriptionssoftware herunterlud. Dann gab er klein bei. Er hatte seine Gesprächspartnerin, eine Medizinhistorikerin, in einem Kaffeehaus getroffen, was der Atmosphäre sicher zuträglich war, mich aber vor das Problem permanent scheppernden Geschirrs stellte. Er hatte alles mit seinem Smartphone aufgezeichnet und sich nicht die Mühe gemacht, das Mikrofon so auszurichten, dass man verstand, worauf es ankam. Im Hintergrund murmelte der ganze Saal. Ich hörte, wie die Medizinhistorikerin bei der Kellnerin einen Espresso und ein kleines Soda-Zitron bestellte; meine Lieblingskombination. Er nahm eine Melange. So sagte er es: »Ich nehme eine Melange.«
Die Medizinhistorikerin erzählte unter Klimpern und Klirren von der Pockeninokulation, die in ihren Worten zur größten Errungenschaft der Menschheitsgeschichte wurde. Was das für Gespräche waren, die ich gegen Honorar abschrieb, war stets eine Überraschung, im Guten wie im Schlechten. Dieses war eine gute Überraschung. Am liebsten war mir, wenn ich en passant etwas lernte, das ich sonst nie gelernt hätte. Bei der Arbeit fragmentierte sich mein Bewusstsein; ich konzentrierte mich auf das Hören und Abschreiben, aber nie ganz, daneben gab es auch jenen Teil von mir, der zuhörte und nachdachte, während Buchstaben Zeile um Zeile den Weißraum des Dokuments einnahmen. Ich glaubte der Medizinhistorikerin alles, nur nicht die Details – ich machte meine Arbeit gut, und das bedeutete, neugierig zu sein, den großen Zusammenhang nicht zu hinterfragen und den Kleinigkeiten zu misstrauen. Alle paar Sätze stoppte ich mithilfe eines Fußpedals die Audioaufzeichnung, um mir auf meiner Schreibtischunterlage ein bislang unbekanntes Wort zu notieren oder eine Phrase, die ich stichprobenartig nachrecherchieren wollte, weil sie mir allzu abseitig erschien oder weil sie eine Statistik enthielt, die man schnell als falsch entlarven und dann alles auf die Person schieben konnte, die das Ganze transkribiert hatte – auf mich. Dann trat ich erneut auf das Pedal und das Gespräch ging weiter.
Es würde in einer Wochenzeitung erscheinen, die einen guten Ruf genoss, obwohl sie an allem sparte, was wichtig war. Schlusskorrektorat, das war einmal. Es lag also an mir, dafür zu sorgen, dass die Medizinpionierin Lady Mary Wortley Montagu korrekt geschrieben wurde, obwohl ihr Name merkwürdig aussah: eine Sonderleistung im Dienst der guten Sache. Für mich ging es um nichts Geringeres als um exakte Wissenschaft. Lady Montagu hatte im achtzehnten Jahrhundert ihre eigenen Kinder inokulieren lassen, als in England noch niemand wusste, was das genau bedeutete. Ich wusste es bis heute nicht. Das Medizinwörterbuch stand in einer Reihe neben Fremdsprachenwörterbüchern, Enzyklopädien, Bestimmungsbüchern, Thesauren. Ich musste nur hinter mich greifen, in das hüfthohe Regal, das meinen größten Schatz enthielt. Der Pschyrembel war mein alter Freund für besondere Aufgaben. Ich blies einen Staubfilm vom Buchschnitt. Die Partikel flogen durchs Zimmer, schillerten, verloren sich. I wie Inokulation: »Einbringen (Übertragung, Impfung) von Erregeroder Zellmaterial in ein Nährmedium oder einen Organismus.« Man schnitt eine Pocke auf, nahm etwas vom Pockeninhalt heraus, schnitt jemand anderem in den Arm, gab den Pockeninhalt auf Schnitt Nummer zwei, und voilà: eine Sorge weniger. Lady Montagu musste mutig gewesen sein, mutig, unerschrocken und ein der Wissenschaft ergebener Geist. Sie soll ganze Königshäuser dazu gebracht haben, es ihr gleichzutun.
Die Medizinhistorikerin sprach mit Bedacht, so, als hätte sie jeden ihrer Sätze schon mehrmals aufgesagt. Auf der Schwelle zwischen Zuhören und Abschreiben fiel ich in eine Art Trance. Aber dann blieb ich hängen. Vielleicht hatte mein Klient achtlos eine Serviette auf sein Smartphone gelegt, oder es war in eine Ritze in der Bank gerutscht, jedenfalls klang es kurz so, als würde die Medizinhistorikerin am fernen Ende des Raums in ein leeres Marmeladeglas sprechen. Normalerweise gab ich in solchen Fällen nach dreimaligem Zurückspulen und Hinhören auf und vermerkte im Transkript den exakten Zeitstempel und das Wort »unverständlich«. Aber nicht in diesem. Ich spielte die Stelle noch ein weiteres Mal ab, diesmal mit halber Geschwindigkeit. Nur ein einziges Wort fehlte mir, dann hätte ich es. Aber sagte sie wirklich Kuhinokulation? Der Pschyrembel war keine Hilfe. Die Suchmaschine kannte das Wort nicht. Vom Duden war schon gar nichts zu erhoffen. Ich tippte den Namen der Medizinhistorikerin in die Browserleiste: Sie lehrte an einer Schweizer Universität, neben ihrem aktuellen Lehrplan stand eine Telefonnummer. Nach einmaligem Klingeln hob sie ab. Mir schwante, dass mich jede Sekunde des Telefonats ein Vermögen kosten würde, also kam ich gleich zum Punkt.
»Grüß Gott«, meldete ich mich. »Ich habe eine Verständnisfrage zum Thema, äh, Kuhinokulation?«
»Sind Sie bei mir im Seminar?«
»Ja! Genau.«
»Name?«
»Grünsperger Sieglinde«, fiel mir ein.
»Nie gehört.«
»Ich sitze immer hinten.«
»Und was wollen Sie wissen, Frau Grünsperger?«
»Kuhinokulation. Was das ist?«
»Um Himmels willen, Sie haben aber lang geschlafen.«
»Das können Sie laut sagen.« Ich war sicher, sie fand mich ebenfalls sympathisch.
»Also. Als man damals angefangen hat mit der Inokulation gegen Pocken, ist man bald draufgekommen, dass man die Erreger auch Kühen entnehmen konnte, nicht nur erkrankten Menschen. Das war ungefährlicher, die Erfolgsquote war für damalige Verhältnisse riesig. Das war im Grunde die erste Impfung. Vakzin kommt von vacca. Das ist Lateinisch. Sie wissen ja sicher, was es heißt.«
»Kuh.« Ich schwitzte.
»Aber ja. Was für eine Idee! Was meinen Sie, wie viele damals gestorben wären, wäre man da nicht draufgekommen?«
»Sehr, sehr viele.«
»Genau. Natürlich war das den wenigsten geheuer. Etwas vom Tier in den Menschen hineinzugeben, es in sein Blut zu mischen – das war Material für die ärgsten Schauermärchen, in denen Menschen nicht mehr Menschen waren, sondern Mischwesen, hybride Biester. Gesund, aber schrecklich.«
»Grad, dass ihnen keine Hörner wachsen.«
»Ganz genau. Oder gar ein Euter.«
»Oder dass sie auf einmal Kälbchen gebären«, fantasierte ich.
»Ha! Die Leute wussten schon, wovor sie Angst hatten.«
»Kuhinokulation ist also wirklich ein Wort?«
Sie seufzte. Ich verabschiedete mich und schrieb endlich den Satz nieder. Danach ging die Audioaufzeichnung ohne Pannen weiter und ich geriet bald wieder in einen guten Rhythmus: hören, tippen, Pause und wieder von vorn.
Um meine müden Augen für die letzten Revisionen zu rüsten, nahm ich die Feuchtigkeitstropfen aus der Schreibtischschublade. Ich schüttelte das Fläschchen und schraubte es auf, legte den Kopf in den Nacken, träufelte mir links und rechts die Lösung auf die Netzhaut. Ohne mir viel dabei zu denken, recherchierte ich die Zusammensetzung: Hyaluronsäure wurde früher aus Hahnenkämmen gewonnen, heute jedoch hauptsächlich aus Hefe. Das brachte mich um den schönen Schauer, mir mich mit Federn und Flügeln vorzustellen, oder wie es wäre, mir mein eigenes Frühstücksei zu legen. Andererseits konnte man sich natürlich genauso gut oder noch viel besser vor Hefepilzen fürchten, wenn man es unbedingt darauf anlegte.
Gegen Abend war ich fertig, rang mich in der E-Mail zu einer Bemerkung über das äußerst interessante Interview und zu einem Dank für die Zusammenarbeit durch, schickte das Dokument ab und entfernte die Klammern von den Gardinen. Sofort brach der Spalt auf und gab den Blick in den Garten frei.
Kapitel 3
Dass Cordelia auch hier lebte, war einer Verkettung von Zufällen geschuldet, die sich erst im Nachhinein als glücklich, oder wenigstens nicht ausschließlich schrecklich, herausstellten. Sie hatte nicht, so wie ich, ihr ganzes Leben hier verbracht, und ich fragte sie hin und wieder, wie es war, wenn man dieses Haus zum ersten Mal betrat, als neuer Mensch und mit dem unverstellten Blick eines Eindringlings. Ihre Antworten fielen stets ein wenig unterschiedlich aus, aber insgesamt gaben sie preis, dass sie sich keinerlei Gedanken über das Haus machte, in dem wir lebten.
Das Haus war bereits in einem schlechten Zustand gewesen, als es gerade zum ersten Mal tapeziert worden war. Es gab ein Schwarzweißbild aus der Zeit, als es ganz neu gebaut worden war. Ein Paar mittleren Alters stand davor: ein Mensch in Kittelschürze, die Arme hinter dem Rücken verschränkt; ein anderer stand in einem Anzug mit zu kurzen Hosenbeinen da, als würde er jeden Augenblick nach vorn kippen, hilflos einem aus der richtigen Achse gerückten Körperschwerpunkt ausgeliefert. Sie hatten sich so positioniert, dass eine Lücke zwischen ihnen war, sie einander jedoch fast an den Ellbogen berührten. Genau über der linken, vom Anzugträger weiter entfernten Eingrifftasche der Kittelschürze befand sich ein runder, etwas ungleichmäßiger Fleck auf dem Foto, der, weil das Bild auch sonst nirgends scharf war, für mich jahrelang wie der Kopf meiner Schwester ausgesehen hatte. Sie war damals noch ein Baby und, laut einer vor allem durch sie selbst kolportierten Legende, ungewöhnlich klein gewesen, einen geradezu unmöglichen Kopfumfang habe sie gehabt, winzig wie ein Apfel.
In der Chronologie unserer Familienereignisse wäre das nur angemessen gewesen: Sie hätte dabei sein müssen, als das Paar sich für das Bild aufstellte, aber das war sie nicht. Ihre Abwesenheit war mir bis heute ein unerträglich großes Rätsel. Es gab meines Wissens niemanden, der sie damals auch nur einen Augenblick lang anstelle der abgebildeten Personen auf dem Arm gehalten oder auf sie aufgepasst hätte. So wenig, wie es einen Grund gab, sie nicht ins Bild hineinzulassen. Es wurde eine Variante der Wirklichkeit abgebildet, in der sie nicht existierte, eine minimale Verschiebung der Gegebenheiten. Wäre das der Fall gewesen und sie nie auf die Welt gekommen, ich wäre in diesem Haus kümmerlich eingegangen. So ergänzte ich sie in meiner viel zu lange währenden, noch immer nicht ganz verwundenen Kinderfantasie, glich den Mangel aus und stopfte sie in die elterliche Schürzentasche, ließ sie von dort in eine eben erst im Entstehen begriffene Umgebung hineinschauen. Ich habe nie erfahren, wer das Foto geschossen hatte. Alle paar Jahre fiel es mir in die Hände, dann hielt ich es so ins Licht, dass der Fleck sich als Fleck abzeichnete: An dieser Stelle war das Fotopapier matter, es reflektierte das Licht nicht. Ich versuchte trotzdem festzustellen, ob sich in dem Kreis nicht doch ein Gesicht offenbarte, wenigstens ein kleiner Mund.
Alles sah schief aus auf dem Bild, besonders das Gebäude. Der Fotograf hatte keinen Sinn für Achsen, so dass die Wände nicht parallel zu sein schienen, sondern nach oben hin leicht auseinanderstrebten. Schon damals hatte das Haus nicht den Zukunftssinn gewöhnlicher Neubauten verströmt, erst recht nicht jener kecken und forschen Häuser, die in den Jahren darauf ringsum entstanden waren, gebaut für Menschen, die die zwei schiefen Personen auf dem Foto nicht einmal als Dienstboten angestellt hätten. Dieses Haus hatte stets eher so gewirkt, als würde dort etwas zu Ende gehen, als gehörte es in eine Zeit davor, nicht zur Gegenwart und erst recht nicht zur Zukunft.
In den Fenstern hingen noch keine Vorhänge. Hinter dem Glas war es schwarz. Nichts stand auf den Simsen. Die Regenrinne knickte sich an der Fassade hinab. Unter einem blechernen Himmel schien der