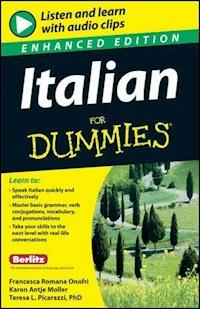Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Hat „50 Shades of Grey" auch Ihre Kasse kräftig klingeln lassen? Und haben auch Sie sich gefragt: „Warum?" Verlagsprofi Jodie Archer und Englisch-Professor Matthew Jockers haben einen Algorithmus entwickelt, der die Antwort darauf gibt – und der mit 97-prozentiger Genauigkeit vorhersagen kann, welche Schmöker zu Bestsellern werden. Archer und Jockers haben viel Überraschendes über unser Leseverhalten und das Erfolgsrezept fesselnder Romane herausgefunden, zum Beispiel: Menschliche Nähe kommt an, Sex (meistens) nicht. Dieses Buch, welches bereits Furore in der deutschen Presse gemacht hat, ist etwas für alle, die Belletristik lesen, verkaufen, einkaufen, lektorieren …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JODIE ARCHERMATTHEW L. JOCKERS
DERBESTSELLERCODE
Was uns ein bahnbrechender Algorithmus über Bücher, Storys und das Lesen verrät
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
The Bestseller Code – Anatomy of the Blockbuster Novel
ISBN 978-1-250-08827-7
© Copyright der Originalausgabe 2016:
Copyright © 2016 by Jodie Archer and Matthew L. Jockers
All rights reserved. Published by arrangement with
St. Martin’s Press, 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010.
© Copyright der deutschen Ausgabe 2017:
Börsenmedien AG, Kulmbach
Übersetzung: Sascha Mattke
Covergestaltung: Holger Schiffelholz
Gestaltung und Satz: denksportler Grafikmanufaktur
Herstellung: Daniela Freitag
Lektorat: Egbert Neumüller
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-86470-499-4eISBN 978-3-86470-500-7
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 • 95305 Kulmbach
Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444
E-Mail: [email protected]
www.plassen.de
www.facebook.com/plassenverlag
Für Andrew, einen Vater, und Angela, eine Ehefrau
INHALT
Danksagungen
1 Das Bestseller-o-meter oder wie Textanalysen das Verlagswesen verändern können
2 Die Paten oder warum man Zeit für Verabredungen braucht
Die Listen: Thema
3 Die Stimmung oder wie man perfekte Wellen bildet
Die Listen: Handlung
4 Die Debütanten oder warum es auf jedes Komma ankommt
Die Listen: Stil
5 Die dunklen Heldinnen oder was Frauen brauchen
Die Listen: Figuren
6 Der Eine oder als der Algorithmus zwinkerte
Die Listen: Alle Datenpunkte
Epilog
Der maschinengeschriebene Roman oder warum es wirklich auf die Autoren ankommt
Nachtrag oder ein wenig Hintergrund zu den Methoden
DANKSAGUNGEN
Wenn wir uns bei jemandem bedanken wollen, laden wir ihn eigentlich eher zu einem Glas Wein ein oder schauen mit einer guten Flasche bei ihm vorbei. Beim Schreiben dieses Buches haben wir jedoch gelernt, dass es unter ernsthaften Autoren unausgesprochene Regeln gibt, die man nicht missachten sollte. Eine davon dürfte lauten, dass ein Buch eine Seite mit offiziellen Danksagungen braucht. Also: Danke an Don Fehr und sein Team bei der Trident Media Group. Unser Dank gilt auch Daniela Rapp und dem Team von St. Martin’s Press in New York. Laura Stickney und dem Team von Penguin Press in New York – vielen Dank. Danke an Aaron Dominguez und Emelie Harstad von der University of Nebraska, an Andrea Lunsford, Ramon Saldivar und Sianne Ngai von der Stanford University. Danke an Gabi Kirilloff, Yeojin Kim und Mark Bessen. Danke, Bridget Flynn, Janet Warham, Matthew A. und Audrey Jockers. Danke, Rob McDonald. Danke, Stephen und Jenny Whitehead. Vielen Dank an Elizabeth Wood und Dan Powers. Und danke an Bodi Mack.
Wir laden jeden von Euch jederzeit gerne auf ein Glas Wein ein (außer natürlich die Kinder).
1
DAS BESTSELLER-O-METER ODER WIE TEXTANALYSEN DAS VERLAGSWESEN VERÄNDERN KÖNNEN
Im Frühjahr 2010 hat Stieg Larssons Literaturagent einen guten Tag. Am 13. Juni erreicht The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest (deutscher Titel Vergebung)1 – der letzte Band der Trilogie eines bis dahin unbekannten Autors – auf Anhieb Platz eins der meistverkauften Bücher mit festem Einband auf der Liste der New York Times. Man kann sich gut vorstellen, dass die neuesten Marktdaten beim Morgenkaffee ein rundum erfreulicher Anblick für den Agenten waren: The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest stieg direkt an der Spitze ein, der erste Band The Girl with the Dragon Tattoo (Verblendung) war das bestverkaufte Taschenbuch und der Nachfolger The Girl Who Played With Fire (Verdammnis) stand auf einem ansehnlichen zweiten Platz. So lief es in den USA schon 49 Wochen lang, und volle drei Jahre in Europa. Da fällt es schon schwer, nicht selbstgefällig zu werden.
Im nächsten Monat meldete Amazon, dass Larsson als erster Autor überhaupt eine Million Bücher für den e-Reader Kindle verkauft hatte; in den zwei Jahren darauf kam er in allen Formaten auf insgesamt 75 Millionen Exemplare. Nicht schlecht für einen Mann aus einem kleinen skandinavischen Land, der vom unbekannten politischen Aktivisten zum Schriftsteller wurde – und zwar zu einem, der für seine Bücher im schwedischen Original eher uncharmante Titel wählte und darin brutale Vergewaltigungs- und Folterszenen beschrieb. Männer, die Frauen hassen – auf Englisch als The Girl with the Dragon Tattoo erschienen, auf Deutsch als Verblendung – war in mehr als 30 Ländern die Buchsensation des Jahres.
Die Medien verstanden den Erfolg nicht. Die wichtigen Zeitungen ließen Meinungsartikel darüber schreiben, was um Himmels Willen auf dem Büchermarkt los ist. Warum dieses Buch? Warum solch eine Aufregung? Was war das Geheimnis? Hätte man das voraussehen können?
Die Antworten auf diese Fragen blieben blass. Rezensenten redeten sich die Köpfe heiß. Sie kritisierten die Struktur der Romane, ihre Form, Handlung, Charaktere. Sie stöhnten über schlechte Übersetzungen und beschwerten sich über die Dummheit der Leser. Aber immer noch verkauften sich die Bücher so schnell, wie sie gedruckt wurden. Ob in Großbritannien, USA, Japan oder Deutschland, ob männlich, weiblich, alt, jung, schwarz, weiß, hetero- oder homosexuell – ganz egal wo, ganz egal wer: Jeder kannte jemanden, der Larssons Bücher las.
So etwas passiert nicht sehr oft in der Welt der Bücher. Ein Phänomen wie Larsson erlebt sie, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr. Der größte Durchbruch ist seitdem E. L. James mit Fifty Shades of Grey (Shades of Grey) gelungen. Doch anders als Larsson stand sie für eine große Werbekampagne zur Verfügung, während Larsson starb, noch bevor seine Romane erschienen. Die riesigen Verkaufszahlen, die mit der Trilogie sogar ohne die persönliche Unterstützung des Autors erreicht wurden, sind wahrscheinlich einfach unergründlich. Verrückt. Unvorhersehbar.
Schauen wir uns ein paar Zahlen an. Ein Unternehmen namens Bowker aus dem US-Bundesstaat Delaware ist der globale Marktführer für bibliografische Informationen und vergibt exklusiv ISBN-Identifikationsnummern für Bücher in den USA. Laut dem Bowker-Jahresbericht werden jährlich etwa 50.000 bis 55.000 neue belletristische Werke veröffentlicht. Nimmt man die steigende Zahl an E-Books hinzu, die im Selbstverlag erscheinen und keine ISBN haben, ist die Zahl sogar noch viel größer. In den USA schaffen es pro Jahr 200 bis 220 Romane auf die Bestsellerliste der New York Times. Selbst bei einer konservativen Berechnung machen sie also weniger als ein halbes Prozent aller neu herausgebrachten fiktionalen Bücher aus. Und noch deutlich weniger als dieses halbes Prozent kommt nicht nur auf die Liste, sondern steht auch noch Woche für Woche darauf und wird dadurch, so der Branchenjargon, zu einem zweistelligen „Double digit“-Erfolg. Nur ein paar Handvoll Autoren gelingt es, zehn oder mehr Wochen auf der Liste zu bleiben. Und von diesen wenigen wiederum verkaufen nur drei oder vier innerhalb eines Jahres eine Million Exemplare eines einzelnen Titels. Wie schaffen diese Bücher das?
Klassischerweise geht man davon aus, dass ein Schriftsteller bestimmte Fähigkeiten benötigt, um Leser zu gewinnen: Er braucht Sinn für eine stringente Handlung und überzeugende Charaktere, und er sollte über etwas mehr als nur grundlegende Grammatikkenntnisse verfügen. Autoren mit großer Fangemeinde können noch mehr: Sie haben ein Auge für menschliche Schicksale und plausible Irrungen und Wirrungen, und sie beherrschen den vorsichtigen, passgenauen Gebrauch von Semikolons. Das macht sie zu guten Autoren, und mit genügend Zeit und Hingabe wird jeder wirklich gute Autor sein Publikum schon finden. Tritt dann der ganz große Erfolg ein, lesen Tausende von Menschen zur gleichen Zeit das gleiche Buch – diesen Krimi, nicht jenen, diesen Roman mit Aussichten auf den Pulitzer-Preis, nicht jenen. Dann, so heißt es, ist ein Zauber im Spiel, ein Geheimnis, das offenbar zu schwer zu entschlüsseln ist, sofern nicht Oprah Winfrey mit einer Empfehlung in ihrer beliebten Fernsehshow nachgeholfen hat. Der unerwartete Erfolg von Büchern wie Larssons Millennium-Trilogie, Fifty Shades of Grey, The Help (Gute Geister), Gone Girl (Gone Girl – Das perfekte Opfer) und The Da Vinci Code (Sakrileg) gilt als riesiger Glücksfall und als so wenig beeinflussbar wie ein Sechser im Lotto.
Der Begriff „Bestseller“ entstammt übrigens der Welt der Bücher und ist vergleichsweise jung. Er wurde erst im späten 19. Jahrhundert in die Wörterbücher aufgenommen, ungefähr zu der Zeit, als auch die ersten Listen der meistverkauften Bücher erschienen. Eigentlich ist der Begriff neutral, doch ihm haften einige irreführende Bedeutungen an. Nachdem der International Copyright Act von 1891 die Verbreitung von billigen Raubkopien britischer Romane eingeschränkt hatte, begann das Literaturmagazin The Bookman im Jahr 1891 in London und im Jahr 1895 in New York, monatliche Verkaufszahlen von Büchern zu veröffentlichen – bis dahin war es kaum möglich gewesen, solche Daten systematisch zu erheben. Mit den Listen, die in allen Großstädten veröffentlicht wurden und typischerweise die sechs meistverkauften Bücher des Monats enthielten, hielten zwei neue Aspekte Einzug in die Bücherwelt: Das einzige Kriterium, um in den Bestsellerlisten zu erscheinen, waren die Verkaufszahlen, was zugleich ein neues System für Literaturempfehlungen entstehen ließ. Diese Empfehlungen wurden nicht etwa von ausgewählten Literaturkritikern oder Herausgebern ausgesprochen, sondern basierten auf den Vorlieben eines ganz normalen Leserpublikums – der Geschmack der Leser war die einzige Maßgabe, und so ist es auch heute noch. Der Begriff „Bestseller“ enthält demnach nicht etwa ein Urteil über die Qualität oder Art eines Buches. Er beschreibt weder ein Genre noch steht er für Populärliteratur. In der etablierten Literaturszene aber wird das Wort oft abwertend benutzt, weil in ihr die Meinung vorherrscht, der Geschmack der breiten Masse stehe für schlechte Literatur. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein ausgewogeneres und weniger subjektives Bild: Unter den Bestsellern finden sich Pulitzer-Preisträger und große amerikanische Romane ebenso wie Belletristik für den Massenmarkt. Auf den Bestsellerlisten stehen Toni Morrison und Margaret Atwood einträchtig neben Michael Connelly und Debbie Macomber. Genau aus diesem Grund sind Bestsellerlisten ein so spannendes kulturelles Phänomen und ein ausgesprochen dynamisches Feld für die Forschung.
Natürlich lohnt es sich, einen Bestseller zu schreiben, und für Literaturagenten oder Verleger lohnt es sich sehr, ein solches Buch zu finden. Für den Buchhandel lohnt sich der Verkauf von Bestsellern ebenso. Für viele Händler reicht allein der Verkauf der wenigen sehr erfolgreichen Titel aus, um im Geschäft zu bleiben und überhaupt weiter Bücher verkaufen zu können.
Und das sind nur die finanziellen Aspekte. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen sieben- oder gar achtstelligen Vorschuss für das Buch erhalten, das Sie schon immer schreiben wollten. Nicht viele Autoren kommen in diesen Genuss. Aber es gibt sie. Sie können den verarmten Dichter mit Stift und Notizheft idealisieren, so viel Sie wollen. Aber finden Sie nicht auch die Vorstellung reizvoll, die Geschichte, die Sie sich ausgedacht haben, läge überall auf Nachttischen und neben Badewannen und würde auf iPads und Kindles in verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt gelesen?
Die meistverkauften Bücher eines Jahres bringen Glamour und Dramatik in den Literaturbetrieb. Sie stehen für prachtvolle Häuser, schicke Autos und glitzernde Diamanten. Wenn Sie auf die Beststellerliste kommen und sich eine Weile dort halten, dann werden Sie verehrt und respektiert, verabscheut und missbilligt. Möglicherweise werden Sie in die Jury für einen Literaturpreis berufen und gebeten, andere Bücher zu rezensieren. Wahrscheinlich sichert sich irgendjemand die Filmrechte an Ihrem Stoff. Die Leute reden über Sie.
Wäre es nicht toll, wenn der Erfolg nicht so zufällig wäre?
Weiße Schwäne
Die kühne Behauptung dieses Buches lautet, dass Bucherfolge nicht beliebig entstehen und dass der Buchmarkt nicht so unberechenbar ist, wie viele meinen. Unabhängig vom Genre haben Bestseller bemerkenswert viele verborgene Eigenschaften gemeinsam, die uns neue Erkenntnisse darüber liefern, was wir lesen und warum. Und noch mehr: Mit Algorithmen ist es möglich, neue und noch unveröffentlichte Bücher zu entdecken, deren DNA der von Bestsellern ähnelt.
Eine häufig wiederholte „Wahrheit“ der Buchbranche lautet, verlegerischer Erfolg sei eine Frage von großen Namen, horrenden Marketingbudgets und umfangreichen Werbekampagnen. Natürlich haben solche Faktoren Einfluss. Unsere Analysen jedoch widersprechen der Vorstellung, dass dieser Rummel wirklich das Wichtigste ist. Autoren, die viel Mühe in ihr Schreibhandwerk investieren, werden es gerne hören: Fünf Jahre Forschung sprechen dafür, dass der Erfolg eines Buches maßgeblich davon abhängt, ganz einfach die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben. Hinter der Bestsellerliste der New York Times steht also letztlich nicht mehr und nicht weniger als das Manuskript des Autors – schwarze Tinte auf weißem Papier, ganz ungeschminkt.
Mithilfe einer Software, die Tausende von Büchern nach Tausenden von Merkmalen durchsucht, haben wir herausgefunden, dass sich diejenigen Bücher, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit Erfolg am Markt haben, durch faszinierende Muster auszeichnen – Muster, die ihre eigene Geschichte über die Leser und das Lesen erzählen. In diesem Buch beschreiben wir, wie und warum wir ein Modell dafür entwickelt und damit festgestellt haben, dass 80 bis 90 Prozent der Bestseller in unserem Forschungskorpus leicht als solche zu erkennen sind. Unsere Computer meldeten bei 80 Prozent der tatsächlichen New York Times-Bestseller der letzten 30 Jahre, dass sie wahrscheinlich in der Bestsellerliste erscheinen würden. Zudem haben wir jedes Buch wie ein neues, ungelesenes Manuskript behandelt und es nicht nur binär als „Bestseller-Material“ oder „kein Bestseller-Material“ klassifiziert, sondern auch einen Wert für seine Erfolgswahrscheinlichkeit berechnet. Diese Daten sind schon für sich genommen faszinierend. Doch darüber hinaus werden wir Ihnen erklären, wie sie entstehen, und geben Ihnen eine Antwort auf die Frage, warum es Ihnen so schwerfällt, das Buch auf Ihrem Nachttisch aus der Hand zu legen.
Schauen wir uns ein paar von unseren Daten an. Als Wahrscheinlichkeit für einen Bestseller-Erfolg von Dan Browns jüngstem Roman Inferno gibt der Computer 95,7 Prozent an. Für Michael Connellys The Lincoln Lawyer (Der Mandant) sind es 99,2 Prozent. Beide kamen tatsächlich auf Platz eins der Hardcover-Bestsellerliste der New York Times – seit langer Zeit eine der prestigeträchtigsten Positionen, die man in der Bücherwelt erobern kann. Natürlich handelt es sich in beiden Fällen um bereits etablierte Autoren. Aber unser Computermodell interessiert sich nicht für Namen und Reputation und kann mit der gleichen Treffsicherheit Prognosen über unbekannte Autoren treffen. The Friday Night Knitting Club (Die Maschen der Frauen), der erste Roman von Kate Jacobs, erreichte 98,9 Prozent. The Luckiest Girl Alive (Ich. Bin. So. Glücklich.) von Jessica Knoll, ein ganz anderer Debütroman, wurde mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent zum Bestseller erklärt – allein auf Grundlage des Textes. Jacobs wie Knoll standen tatsächlich viele Wochen lang auf der Bestsellerliste. Der Debütroman The Martian (Der Marsianer) von Andy Weir lag bei 93,4 Prozent, und zwar ohne die Information, dass sich Matt Damon für die Hauptrolle in der Verfilmung interessiert. Solche Beispiele gibt es aus allen Genres: The First Phone Call from Heaven (Das Wunder von Coldwater), ein spirituelles Märchen von Mitch Albom, kam auf 99,2 Prozent, The Art of Fielding (Die Kunst des Feldspiels), das literarische Debüt von Chad Harbach, auf 93,3 Prozent und Bared to You (Versuchung), ein erotischer Liebesroman von Sylvia Day, auf 91,2 Prozent.
Diese Angaben zum Bestseller-Potenzial von Büchern haben manche Menschen begeistert, andere wütend und ziemlich viele misstrauisch gemacht. In vielerlei Hinsicht ist das verständlich. Die Bewertungen sind verstörend und beeindruckend. Einigen erfahrenen Kennern der Buchbranche kommen sie absurd vor. Aber sie könnten das Verlegen von Büchern verändern. Und sehr wahrscheinlich werden sie verändern, wie Sie über den Inhalt des Bestsellers denken, den Sie als Nächstes lesen werden.
An dieser Stelle möchten wir festhalten, dass keines der von uns genannten Bücher auf den Markt gekommen ist, weil es bei unseren Analysen gut abgeschnitten hat. Außer den Zahlen, die wir in diesem Buch nennen, haben wir weder Agenten noch Verlagen irgendwelches Material zur Verfügung gestellt. Zudem sollte klar sein, dass sich diese Daten nur auf die abgeschlossene Welt unseres Forschungskorpus beziehen. Wir haben die Titel darin so ausgewählt, dass es in etwa das enthält, was Sie bei einem Besuch in einer normalen großen Buchhandlung sehen würden. Agenten und Verleger bringen fleißig Bücher in den Handel – es ist keineswegs so, dass es nicht genug zu lesen gäbe. Manche Menschen in den Verlagen stehen im Ruf, ein goldenes Händchen zu haben. Doch wenn man bedenkt, dass die Bestsellerquote in der Branche derzeit unter einem halben Prozent liegt, müssen auch sie viel riskieren, um einen Volltreffer zu landen. Nicht zu vergessen ist auch, dass jedes Jahr die gleichen lang etablierten Erfolgsautoren auf den Bestsellerlisten erscheinen. Stephen King, James Patterson, Danielle Steel – sie alle sind schon 68 Jahre alt. So sehr sich die Fans auch immer noch für ihre neuen Romane begeistern: Das hohe Alter dieser Autoren zeigt, dass die Verlage noch keine nächste Generation entdeckt haben, die ihrerseits 30 oder 40 Jahre lang konstant Bestseller produzieren wird. Im Jahr 2014 etwa hat die gesamte US-Buchbranche, trotz Tausender abgelehnter und veröffentlichter Manuskripte, keinen einzigen Mega-Bestseller hervorgebracht (The Girl With the Dragon Tattoo, Fifty Shades of Grey und Gone Girl stammen aus früheren Jahren), und im Jahr 2012 konnte kein Manuskript das Komitee für den Pulitzer-Preis überzeugen. Warum?
Allgemein gilt als ausgemacht: Bestseller sind Freaks. Sie sind glückliche Ausreißer. Ausnahmeerscheinungen am Markt. Schwarze Schwäne. Wenn das stimmt, warum sollte man dann, wenn erst einmal ein Bestsellerautor gefunden ist, noch auf jemand anderen setzen? Warum Millionen in irgendeinen 22 Jahre alten Schriftsteller investieren statt in Stephen King? Wie soll man wissen können, ob ein neuer Autor die Ausgaben, die sich nur für einen kommenden Preisträger lohnen würden, wert ist?
Passenderweise ist die Sprache in Buchverlagen voller Ausdrücke aus der Welt des Glückspiels. In Konferenzen wird häufig mit leidenschaftlichen Argumenten darüber gestritten, ob man auf einen Debütautor „setzen“ sollte oder nicht. In der Aufregung eines Bietergefechts zwischen konkurrierenden Häusern kann es dazu kommen, dass eines von ihnen „all in“ geht, also fast den gesamten Etat einer Saison für nur einen Titel ausgibt. Das ist spannend, und natürlich sind die Einschätzungen dazu fundiert, aber es bleibt ein Roulettespiel. Bevor J. K. Rowlings Harry Potter bei Bloomsbury unterkam, lehnten zwölf Verlage den Roman ab. Rowling wurde geraten, ihren regulären Job zu behalten. Die Marke Harry Potter ist heute nach Schätzungen fünfzehn Milliarden Euro wert. Auch John Grisham wurde von mindestens 16 verschiedenen Verlagen abgelehnt; inzwischen hat er über ein Dutzend Mal das bestverkaufte Buch des Jahres geschrieben.2 Kathryn Stockett wurde von 60 Literaturagenten abgelehnt, bevor sie jemanden fand, der The Help (Gute Geister) für sie anbieten wollte. Dieser Roman stand später hundert Wochen lang auf der New York Times-Bestsellerliste. Ohne Frage gibt es viele ähnliche Autoren, deren Werke gerade unbeachtet auf einem Stapel mit neuen Manuskripten in Büros von New York bis London liegen.
Jeder, der auch nur entfernt mit der Welt von Lesern und Autoren verbunden ist, kennt jemanden, der jemanden kennt, der monatelang mitten in der Nacht aufsteht, um noch vor der Arbeit an seinem Roman zu schreiben. Jemanden, der sich von einer Geschichte um einen Mord inspiriert und von der Muse geküsst fühlt. Jemanden, der seine Manuskripte in freudiger Erwartung durch ganz Manhattan verschickt und dann nichts als vorformulierte Absagen erhält.
Diese Freunde von Freunden, die jeder kennt, sind in bester Gesellschaft. Nachdem er das Manuskript von The Spy Who Came in from the Cold (Der Spion, der aus der Kälte kam) gelesen hatte, prophezeite ein Lektor John le Carré, dass er als Schriftsteller keine Zukunft habe. Lord of the Flies (Herr der Fliegen) von William Golding wurde 21-mal abgelehnt. Jack Kerouac erhielt für das inzwischen legendäre On the Road (Unterwegs) von einem Literaturagenten einen Brief, in dem stand: „Ich mag dieses Buch absolut nicht.“ Ursula Le Guin wurde als „unlesbar“ zurückgewiesen. Ihr unlesbarer Roman The Left Hand of Darkness (Die linke Hand der Dunkelheit) hat danach zwei wichtige Preise gewonnen. Sogar Georg Orwells Fabel Animal Farm (Farm der Tiere) wurde als nicht veröffentlichungswürdig erachtet, und zwar von keinem geringeren als T. S. Eliot. Der große Poet fand eine der inzwischen bedeutsamsten politischen Allegorien aller Zeiten „nicht überzeugend“.
Verlegen oder Nichtverlegen ist eine schwierige Frage. Wer große Erfolge beim Geschichtenerzählen vorhersagen will, muss versuchen, die Empfindungen und das Innenleben Hunderttausender verschiedener Menschen einzuschätzen. Das ist keine einfache Aufgabe, und die Gründe für die letztlichen Entscheidungen sind oft sehr gut nachvollziehbar. Die vielen US-Lektoren zum Beispiel (und wir haben einige von ihnen befragt), die The Girl with the Dragon Tattoo ablehnten, waren der Meinung, all die schwedische Politik in dem Roman würde amerikanische Leser langweilen. Sie fanden Lisbeth Salander ein bisschen zu launisch und aggressiv für eine weibliche Hauptfigur. Sie glaubten, das Mainstream-Lesepublikum sei nicht empfänglich für ein Buch mit grausamen Schilderungen von analer Vergewaltigung und Lisbeth als Rächerin mit ihren Tattoo-Nadeln. All das klingt nach einer vernünftigen Einschätzung.
Insofern ist es nicht überraschend, dass Lektoren, wenn sie ganz ehrlich sind, manchmal eingestehen, dass man zum Vorhersagen großer Erfolge kaum mehr tun kann als einen feuchten Finger in den Wind zu halten oder die geheimnisvolle Kristallkugel zu befragen, die bei den höchstbezahlten Agenten und Verlegern unter dem Schreibtisch verborgen zu sein scheint. Wenn der Autor nicht bereits einen großen Namen wie James Patterson oder Nora Roberts hat, ist das Ganze reine Glückssache. Manchmal helfen die Umstände – zum Beispiel wenn die Autorin eine Hollywood-Diva ist, die über ihr Sexleben schreibt. Aber sogar wenn der Erfolg eine sichere Sache scheint, haben wir schon gesehen, dass umfangreiche Druckauflagen nach hohen Vorschüssen im Schredder endeten. Man kann sich auf die Leser einfach nicht verlassen.
Naturgemäß tut jeder Literaturagent und jeder Verleger, was er kann, um kommerziellen Bucherfolg besser zu verstehen – ob es um einen Massenmarkt mit etablierten Serien-Autoren wie Patricia Corn-well geht oder um die weniger herausragenden, aber immer noch ansehnlichen Einnahmen, die mit anderen beliebten Schriftstellern zu erzielen sind. Dazu passt eine berühmte Anekdote über den heutigen Ex-Chef eines der größten New Yorker Verlage: Als er gebeten wurde, einen Buchtitel für einen definitiven Megahit zu nennen, lautete seine Antwort „Lincoln’s Doctor’s Dog“ („Der Hund des Arztes von Lincoln“). Die Kombination aus beliebtem Präsidenten mit der ständigen Sorge der Amerikaner um ihre Gesundheit und ihr beliebtestes Haustier konnte gar nicht scheitern.
Natürlich war die Aussage ironisch gemeint, doch tatsächlich erschien anschließend nicht nur ein Buch mit exakt diesem Titel, sondern sogar zwei. Beide waren Flops. Der Literaturprofessor und Autor John Sutherland, der zwei Forschungsarbeiten über Bestseller-Bücher geschrieben hat, beendete eine seiner Studien mit diesen Worten: „Als Faustregel kann gelten: Verkaufsschlager sind definiert durch hohe Verkaufszahlen. Sonst nichts.“ Etwas konkreter ergänzte er, „nach signifikanten Mustern, Trends oder Regelmäßigkeiten in Erfolgsbüchern zu suchen, ist, wenn nicht nutzlos, dann zumindest verwirrend“. Dieses Urteil klang vernünftig, begründet und endgültig – bis Computer begannen, zu lesen und die geheimen Zutaten für das Erreichen von Bestsellerlisten zu entdecken.
Aus Liebe zu Büchern
Kommen wir zurück zu den mehrfach abgelehnten, aber inzwischen weltbekannten Schriftstellern. Die Bestseller-Prognose unseres Modells für J. K. Rowling lag bei 95 Prozent, für John Grisham waren es 94 Prozent, für Patterson 99,9 Prozent. Wie die tatsächlichen Verkaufsdaten zeigen, waren diese Einschätzungen korrekt. Getäuscht hat sich das Modell allerdings bei The Help (Gute Geister) von Kathryn Stockett: Der Roman gehört zu den etwa 15 Prozent der Bücher, mit denen unser System nicht zurechtkam – es errechnete nur eine 55-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür, dass Stocketts Geschichte ein Bestseller wird. In den folgenden Kapiteln erklären wir das komplexe Vorgehen unserer Lektoren-Maschine genauer. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass das Modell tief in die Strukturen eines Buches blickt. Im Fall von Stocketts Roman sagte es uns, dass er in seiner gesamten Stilistik gut zu einem amerikanischen Publikum passt und dass die Themenwahl prinzipiell gelungen ist, dass aber emotionale Sprache und insbesondere Verben nicht so eingesetzt werden wie in den Romanen, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf die Bestsellerliste kommen. Trotzdem zog das Buch nach seiner Veröffentlichung viel Aufmerksamkeit von Rezensenten auf sich, weil darin eine weiße Autorin über weite Strecken den Dialekt ihrer schwarzen Hauptfiguren imitiert. Die Meinungen über die Wirkung dieses erzählerischen Mittels waren gespalten. Unser Modell stimmte insofern genau mit den gemischten Einschätzungen der Kritiker von der New York Times bis zur Leser-Community Goodreads überein.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum wir ein Computermodell für die Arbeit entwickelt haben, die gute Lektoren bereits erledigen? Wahrscheinlich hätte Rowling mithilfe unserer Software früher einen Verlag gefunden. Wahrscheinlich hätte Grisham einen weitaus höheren Vorschuss für seinen ersten Thriller A Time to Kill (Die Jury) bekommen. Aber letzten Endes haben diese Autoren ihr Publikum auch so gefunden. Die Lektoren waren sich unsicher, ob sie Gute Geister veröffentlichen sollten oder nicht, und das Modell wusste es ebenfalls nicht recht. Worin also besteht sein Nutzen?
Bei unserem Wunsch, das Geheimnis von Bucherfolgen zu entschlüsseln, geht es um mehr als nur Geld. Natürlich ist es faszinierend, dass ein Computerprogramm J. K. Rowling, Liane Moriarty (99,6 Prozent) oder Jonathan Franzen (98,5 Prozent) als klar aussichtsreich identifizieren kann. Eine öffentliche Diskussion über den Grenzbereich zwischen Mensch und Maschine ist wichtig, und zwar erst recht, wenn es um Kreativität geht. Aber wenn Sie erlauben: Unterstützung bei dem Versuch, lohnende Manuskripte für eine bedrohte Branche zu finden, bedeutet auch, diese Branche nicht nur am Leben zu erhalten, sondern auch ihre Vielfalt zu sichern. Unsere Arbeit ist natürlich getrieben von dem Interesse, verborgene kulturelle Muster zu identifizieren und zu erklären. Konkreter aber geht es uns um Möglichkeiten, neue Autoren zu entdecken. Wir wollen Verleger ermutigen, ihr Budget nicht nur für Patterson, Steel und King auszugeben, sondern für junge Autoren, die diese Veteranen eines Tages ersetzen könnten. Wir wollen Autoren unabhängig von ihrer Erfahrung mehr Informationen und Unterstützung für ihr Handwerk zur Verfügung stellen. Uns ist daran gelegen, auch Menschen, die nicht über die richtigen Kontakte in der Buchbranche verfügen, zu einem Publikum verhelfen. Für unser Modell spielt es keine Rolle, ob Sie schon einmal etwas veröffentlicht haben, ob Sie einen akademischen Abschluss in Literatur haben, ob Sie männlich oder weiblich sind, spanischer oder asiatischer Herkunft, ob Sie hübsch und 25 Jahre alt sind oder weniger hübsch und 70 Jahre alt. Und vor diesem Hintergrund kann unsere Arbeit eben potenziell auch dafür sorgen, dass der Zugang zu einer schriftstellerischen Laufbahn verbessert wird. Vielleicht bekommt eines Tages jemand, den Sie kennen, eine Wertung von 80 Prozent und kann sich deshalb einen Vorschuss sichern. Dann könnte er endlich seinen Job kündigen und müsste nicht mehr mitten in der Nacht aufstehen, um zu schreiben.
Unsere Beschäftigung mit Büchern, die auf der bekanntesten und renommiertesten Liste – der wöchentlichen Bestsellerliste der New York Times – stehen, ist zugleich ein offener Aufruf an die Leser: Egal ob sie sich beruflich oder privat mit Büchern beschäftigen, sollen sie sich an der interessanten Diskussion über Texte beteiligen, die von Massen von Menschen gelesen werden.3 Bestseller sind eine Klasse von Büchern, die gern als reiner Zeitvertreib abgetan werden und nicht als lohnender Gegenstand der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung oder zumindest als Ergebnis bemerkenswerter Kunstfertigkeit gelten. Doch wenn wir Bestseller ignorieren, lassen wir weite Teile der Gegenwartskultur und der Geschichte des Lesens außer Acht. Neben dem Wert, der sich in Verkäufen in Millionenhöhe niederschlägt, besteht der Wert von Autoren auf den Bestsellerlisten darin, dass ihre Bücher uns zum Lesen bringen. Sie regen unsere Vorstellungskraft an, lassen uns fühlen, diskutieren, nachdenken und in andere einfühlen. Mit ihnen können wir fantasieren, spionieren und dem Alltag entfliehen. Die Romanautoren auf der New York Times-Liste bilden das Herzstück der literarischen Debatten und Diskurse im ganzen Land, in Bars, in Zügen und beim Abendessen. Auf sie blicken wir, um unsere kulturelle Entwicklung zu verfolgen. Wir blicken auf sie, um unsere Welt zu verstehen. Wir blicken auf sie, um Geschmack und Meinung zu entwickeln und um zu üben, beides zum Ausdruck zu bringen. Wenn es uns mit diesem Buch gelingt, unseren Lesern neue Einblicke in ihre Lieblingsbeschäftigung zu geben, dann sind wir mehr als zufrieden.
Vielleicht ist es Ihnen bereits aufgefallen: Sie haben es hier mit zwei Autoren zu tun, deren Leidenschaft für die Bedeutung von Büchern und Lesen so groß ist, dass sie zusammengenommen 50 Jahre mit Forschung und Lehre über das Geschichtenerzählen verbracht haben, und viele weitere Jahre mit dem Kaufen und Verkaufen von Büchern für die größten Unternehmen der Branche. Wir haben das Recht, unterschiedliche Romane oder sogar ein und denselben Roman zu lieben und zu hassen, gelehrt und verteidigt. Wir haben uns für die Veröffentlichung von Geschichten in vielen Genres eingesetzt. Wir haben, manches Mal anonym, unseren besten Studenten und unseren Freunden, die Schriftsteller werden möchten, geholfen, Briefe an Eltern, Lebensgefährten und zukünftige Verleger zu verfassen, in denen sie erklären, dass sie einfach nicht anders können – dass sie ihren normalen Alltag und ihr Medizinstudium aufgeben müssen, um sich der berauschenden, ekstatischen und manchmal depressiv machenden Droge des Lebens mit Geschichten und Wörtern hinzugeben. Wir sind, so viel ist sicher, vollständig von der befreienden und aufklärerischen Kraft des Lesens und des Schreibens von Literatur überzeugt. In allerster Hinsicht sind wir Lesende und erst danach Schreibende. Bei so viel Begeisterung für Bücher drängt sich aber natürlich eine Frage auf: Was in aller Welt hat uns dazu gebracht, uns ihnen mit Computern zu nähern?
Zwei Erfahrungswelten
Für niemanden ist das „Bestseller-o-meter“, wie wir unser Modell genannt haben, so überraschend wie für uns selbst. Um ehrlich zu sein, begann unsere Beschäftigung damit mit nicht viel mehr als einem dringenden Bauchgefühl. Dann arbeiteten wir vier Jahre lang täglich zusammen und kamen so zu Ergebnissen, die keiner von uns erwartet hatte, obwohl wir auf ganz unterschiedliche berufliche Erfahrungen zurückgreifen konnten. Jodie Archer kennt sich mit der Welt der Verlage und mit zeitgenössischer Unterhaltungsliteratur aus. Matthew Jockers kommt aus der Literaturwissenschaft und ist auf dem neu entstehenden Forschungsgebiet der digitalen Geisteswissenschaften aktiv.
Alles fing damit an, dass Jodie Archer ihren Posten als Lektorin bei Penguin Books aufgab, um an der Stanford University einen Doktor in Anglistik zu machen. Aus ihrer Zeit im Verlagsgeschäft brachte sie eine Frage mit, die sie einfach nicht zufriedenstellend beantworten konnte: Was macht einen Roman zu einem Beststeller? Daran hängen weitere, nicht weniger spannende Fragen: Was bringt Menschen zum Lesen? Welchen Sinn hat das Lesen fiktionaler Werke in der Gegenwartskultur?
Zu Beginn ihrer Ausbildung bei Penguin arbeitete Archer im Vertrieb. Manchmal ging sie in der Mittagspause in den nächstgelegenen Buchladen, um zu überprüfen, ob das viele Marketing-Geld, das ihr Verlag für die Platzierung im Handel ausgab, auch ankam. Nach der gängigen Praxis – und das ist kein Branchengeheimnis – bezahlen Verlage bestimmte Summen an den Handel, damit der ihre Top-Titel an den prominentesten Plätzen in den Geschäften ausstellt. Einige Händler sind gegen Bezahlung zum Beispiel bereit, ein Buch in die erste Reihe auf ihrem ersten Tisch zu legen oder im Regal das komplette Buchcover frontal zu zeigen. Diese strategischen Platzierungen sollen verkaufsfördernd wirken. Zu dieser Zeit hielt sich The Da Vinci Code gerade schier endlos auf den Bestsellerlisten. Woche für Woche konnte Jodie Archer bei jedem ihrer mittäglichen Besuche an einem großen blauen „Bestseller“-Schild erkennen, dass Dan Browns Roman die Welt eroberte.
Dies ging über Monate so. Als viele Verlage mit hohen Marketingausgaben versuchten, in seinem Windschatten ähnliche Titel zu positionieren, wurde unübersehbar, dass The Da Vinci Code in einer ganz eigenen Liga spielte. Der phänomenale Erfolg des Buches ging über das hinaus, was sich mit Vertrieb und Marketing erreichen lässt. Keine Marketing-Investition kann seine langanhaltende Wirkung auf die globale Vorstellungskraft erklären, von den 80 Millionen verkauften Exemplaren ganz zu schweigen. Ein derartiger Erfolg konnte kein bloßer Hype sein. Es musste irgendetwas jenseits von Marketing geben, etwas, das mit genau diesen Worten auf den Seiten genau dieses Buches zusammenhängt.
Zu behaupten, Marketing und öffentliche Aufmerksamkeit hätten keinen Einfluss auf die Verkaufszahlen von Büchern, wäre Unsinn. Natürlich haben sie das. Es muss ein Zusammenhang bestehen, denn etwa 80 Prozent der Bestseller stammen aus den fünf größten Verlagshäusern – und natürlich haben die im Marketing ganz andere Möglichkeiten als kleinere Konkurrenten. Jedoch wäre es ebenso vermessen zu behaupten, die Wirkung von Marketingausgaben sei in der Welt der Bücher auf irgendeine Weise konsistent. Dafür gibt es zu viele Beispiele von horrend hohen Ausgaben, die zu nichts führten, und von im Eigenverlag erschienenen Büchern, die per Mundpropaganda zu riesigen Erfolgen wurden. Fifty Shades of Grey wurde zunächst von einem Verlag ohne jedes Marketingbudget und nur als eBook oder als erst nach der Bestellung gedrucktes Taschenbuch veröffentlicht. Die Veröffentlichung von The Shack (Die Hütte) von William P. Young wurde zunächst per Kreditkarte finanziert und nur über eine Website für 300 Dollar beworben, und doch hat sich das Buch inzwischen mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Weitere Bestseller, die auf unkonventionellen Wegen zu Erfolg bei Käufern und Kritikern kamen, sind Mark Z. Danielewskis experimenteller Internet-Roman House of Leaves (Das Haus) und Chris Wares ursprünglich selbstveröffentlichtes Buch Jimmy Corigan: The Smartest Kid on Earth (Jimmy Corigan: Der klügste Junge der Welt), das zu den bekanntesten Vertretern der zurzeit boomenden Gattung der Graphic Novels gehört. Solche Beispiele gibt es zuhauf. Auf jeden Fall reichen sie aus, um zu zeigen, dass „Marketing“ bestenfalls eine begründete Vermutung darstellt und keineswegs eine wirkliche Antwort auf die Frage, warum manche Romane ein Millionenpublikum finden, während von anderen kaum eine Handvoll verkauft wird.
Als Jodie Archer ihre Forschungsfrage an Matthew Jockers herantrug, der zu dieser Zeit als Dozent in Stanford und Mitgründer des Stanford Literary Lab arbeitete, begann sich eine bessere Antwort abzuzeichnen. Im Jahr 2008 hatte Jockers soeben seine Arbeit an einer kontroversen computergestützten Studie über die Erzählperspektive des religiösen Textes Book of Mormon (Buch Mormon) abgeschlossen. Die Computeranalyse des Schreibstils unterstützte die Annahme, dass das Buch von einem Kollektiv mehrerer Urheber geschrieben worden war, und lieferte Belege für eine Theorie zur Entstehungsgeschichte, die von den Mormonen bis dahin als falsch zurückgewiesen wurde. Letztlich waren die Ergebnisse der Analyse nicht völlig eindeutig. Aber die Reaktionen auf ihre Veröffentlichung, zu denen auch eine interessante Gegendarstellung eines Teams von mormonischen Gelehrten an der Brigham Young University gehörte, zeigten, welche revolutionäre Kraft die Computeranalyse von Texten haben kann.
Diese Arbeit im Bereich der Autoren-Zuordnung und „Stilometrie“ überzeugte Jockers, dass Computer dabei helfen können, Aspekte von Texten zu erkennen, die wir andernfalls übersehen würden. Nach weiterer Forschung fand er heraus, dass ein Computerprogramm mit einer Trefferquote von 82 Prozent korrekt angeben konnte, ob der Urheber eines Textes männlich oder weiblich ist; dazu musste er nichts weiter tun, als die Verwendung einfacher Wörter wie „the“ und „of“ zu untersuchen. Jockers war nicht der Erste, der herausfand, dass Frauen und Männer unterschiedlich schreiben, jedoch konzentrierte sich seine Arbeit speziell auf Romane des 19. Jahrhunderts. Bald darauf entdeckte er, dass sein Computer einzig mithilfe des Wortes „the“ relativ sicher erkennen konnte, ob ein Autor aus Amerika oder England stammt.
Jodie Archers Reaktion darauf lautete mehr oder weniger: „Na und?“ Dass ein Computer einen Briten von einem Yankee unterscheiden kann, war zwar eine beeindruckende Vorstellung, doch dabei ging es um ein künstliches Problem, das eigentlich gar keines war. Bevor sie sich überzeugen ließ, wollte sie sehen, dass die Maschine eine wirklich wichtige literarische Frage beantworten kann. In gleichem Maße unbeeindruckt war übrigens Jockers von Archers Leidenschaft für zeitgenössische Bestseller – er hielt sie für einen netten Zeitvertreib ohne weitere Bedeutung. Also musste er erst noch davon überzeugt werden, dass sie Gold enthielten, nach dem es sich zu graben lohnt.
Das alles liegt ein paar Jahre zurück. Wenig später schlossen wir uns zusammen, um gemeinsam der These nachzugehen, dass Bestseller einen besonderen Satz an subtilen Signalen enthalten – einen verborgenen Bestseller-Code. Statt zu erraten, was Bücher zu Verkaufsschlagern macht, wollten wir dem vertrauen, was die Leser, sicherlich unbewusst, schon herausgefunden hatten. Die Bestsellerliste, vordergründig ein Sammelsurium sehr unterschiedlicher Bücher, zeigt eine wöchentliche Liste der beliebtesten Merkmale, zusammengestellt nach der kollektiven Meinung. Konnte es sein, dass wir aus dieser gemeinschaftlichen Abstimmung der Leser etwas lernen können? Konnte unsere Computer ein Signal in all dem Rauschen finden? Haben all die aufmerksamkeitsstarken Romane – seien es intellektuell anspruchsvolle aus dem Lehrplan von Universitäten oder seichte, spannende Strandlektüren – etwas gemeinsam?
Sollte die Antwort Ja lauten, bot sich für uns die Chance, etwas darüber lernen, wie Erfolg funktioniert. Möglicherweise würden wir sogar beweisen können, dass eine lang gehegte Theorie der Buchbranche nicht zu halten ist, und Verkaufserfolge vorhersagbar machen.
Also begannen wir, unserem Computer das Lesen beizubringen.
Wenn Maschinen lesen
Natürlich können Computer nicht wirklich lesen, wenigstens nicht so, wie Sie dieses Buch lesen. Aber Computer können Bücher auf die Art und Weise lesen, mit der sie eigentlich alles tun. Sie „lesen“ (das heißt, sie registrieren Eingaben) und gliedern diese Eingaben dann in Einheiten, denen wir Menschen Bedeutung beimessen: Dinge wie Buchstaben, Kommas, Wörter, Sätze, Kapitel und so weiter. Das ist eine Art Nachahmung des menschlichen Lesens, und je anspruchsvoller wir es dem Computer beibringen, desto anspruchsvoller wird auch seine Nachahmung. Der Unterschied zwischen dem Lesen des Menschen und dem Lesen der Maschine besteht darin, dass Menschen wissen, dass die gelesenen Inhalte eine Bedeutung haben. Ironischerweise aber bringt uns das Lesen durch Computer die Details eines Romans näher, als es jeder noch so erfahrene menschliche Literaturkritiker könnte. Der Grund dafür ist, dass Computer bestens dafür geeignet sind, Muster zu erkennen. Sie können Muster in einem Ausmaß und mit einer Detailgenauigkeit analysieren, die kein Mensch je erreichen würde.
Kommen wir zu der Frage zurück, mit der unsere Forschungsarbeit begann: Sind Bestseller vorhersagbar? Um etwas vorherzusehen, muss man in der Lage sein, sich wiederholende Muster zu erkennen – wenn Sie nicht gerade Hellseher sind, geht es bei Vorhersagen einzig und allein um etablierte Muster. Bedeutsame Muster in Wörtern zu erkennen ist üblicherweise die Aufgabe von Literaturkritikern und Wissenschaftlern. Der berühmte Mythologe Joseph Campbell zum Beispiel hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt zu lesen. Dabei achtete er besonders darauf, Gemeinsamkeiten in diesen Geschichten zu finden. Er war ein Meister der Mustererkennung. Aber selbst bei höchstem Einsatz kann ein menschlicher Leser nur eine bestimmte Zahl von Büchern und Geschichten analysieren, und gleichzeitig sind auch seine Möglichkeiten begrenzt, ein einzelnes Buch bis ins letzte Detail zu untersuchen. Die Frage des Maßstabs spielt also in beiden Richtungen eine Rolle: Ein Auge muss sozusagen durch ein Mikroskop, das andere durch ein Makroskop blicken.
Ein weiterer Wissenschaftler, den wir wegen seiner Beharrlichkeit verehren, ist Christopher Booker. Er hat 30 Jahre seines Lebens damit verbracht, Hunderte von Büchern zu lesen, um seine Theorie zu belegen, dass sich alle literarischen Werke und tatsächlich jede einzelne Geschichte sieben grundlegenden Handlungstypen zuordnen lassen. Wahrscheinlich hat Booker in 40 Jahren tausend Bücher gelesen. Wahrscheinlich war er in der Lage, sich ihre Inhalte besser zu merken, als es jeder von uns jemals könnte. Ein Cluster aus vernetzten Computern aber kann, wenn er einmal programmiert ist, an einem einzigen Tag Tausende von Romanen auf Tausende von Datenpunkten hin überprüfen. Darüber hinaus verfügen Computer über die unheimliche Fähigkeit, Dinge ans Licht zu bringen, die wir Menschen entweder für selbstverständlich halten oder schlichtweg übersehen.
Sehen wir uns ein Beispiel dafür an. Als Leser, insbesondere als erfahrene und sorgfältige Leser, achten wir vielleicht ganz bewusst darauf, welche Adjektive ein bestimmter Autor benutzt. Aber vermutlich nehmen wir nicht wahr, wie das zahlenmäßige Verhältnis von Adjektiven zu Substantiven bei ihm aussieht, also wie häufig ein Autor ein Adjektiv einsetzt, um ein Substantiv zu variieren. Genau das aber gehört zu den Dingen, die ein Computer sehr leicht ermitteln kann, und es ist wichtig, denn solche Daten verraten uns etwas über Darstellung und Stil. Außerdem kann ein Computer dieses Verhältnis im einen Buch mit dem in unzähligen anderen Büchern vergleichen. Stellt die Maschine fest, dass der Wert in Bestsellern etwas höher oder niedriger ausfällt, dann hat dieses Merkmal eine gewisse Aussagekraft.