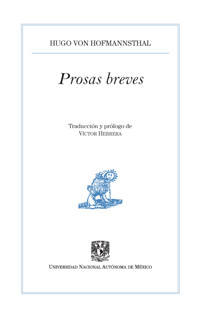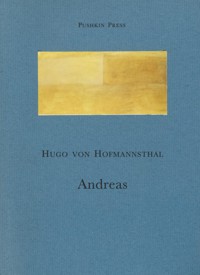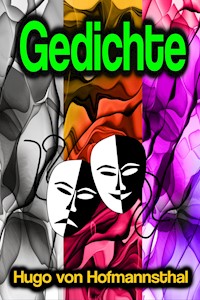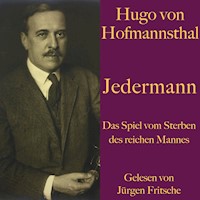Der Brief des Lord Chandos. Schriften zur Literatur, Kultur und Geschichte E-Book
Hugo von Hofmannsthal
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Das essayistische Werk HofmannsthaIs steht ganz im Zeichen einer sensiblen Aufmerksamkeit für die gesamte Weltliteratur. Das E-Book bietet in repräsentativem Querschnitt die wichtigsten Schriften von 1893 bis 1927, darunter den berühmten fiktiven "Brief" des Lord Chandos - ein Meilenstein der Poetik im 20. Jahrhundert -, das "Gespräch über Gedichte"? Texte zum Theater, z. B. zu den Salzburger Festspielen, zur Geschichte, über Balzac, Goethe, Freud u. a. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Ähnliche
Hugo von Hofmannsthal
Der Brief des Lord Chandos
Schriften zur Literatur, Kultur und Geschichte
Reclam
2000 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2017
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960931-7
Inhalt
[7]Schriften zur Literatur, Kultur und Geschichte
[9]Algernon Charles Swinburne
Das moralische England besitzt eine Gruppe von Künstlern, denen der Geschmack für Moral und gesunden Gemeinsinn so sehr abgeht, daß sie für Saft und Sinn aller Poesie eine persönliche, tiefe und erregende Conception der Schönheit halten, der Schönheit an sich, der moralfremden, zweckfremden, lebenfremden. Auch wenn unter diesen Künstlern ein sehr großer Dichter ist, pflegt man ihm niemals auf rotsamtenem Kissen den goldenen Lorbeer ins Haus zu tragen, den Alfred Tennyson trug und vor ihm einmal Robert Southey und viel früher einmal John Dryden, das schöne, goldene, altertümliche Spielzeug. Er braucht es auch nicht. Er hat schöne, seltsame und kostbare Gedanken, sein Hirn ist mit altertümlichen und doch wunderbar glühenden Bildern angefüllt, er hat goldene Worte und Worte wie rote und grüne Edelsteine, und ihm werden aus ihnen Gebilde, schön und unvergänglich wie die funkelnden Fruchtschalen des Benvenuto Cellini.
Diese Künstler sind keine einfachen Menschen, denen ein erlebtes Gefühl zu einem naiven und lieblichen Lied wird.
Sie gehen nicht von der Natur zur Kunst, sondern umgekehrt. Sie haben öfter Wachskerzen gesehen, die sich in einem venezianischen Glas spiegeln, als Sterne in einem stillen See. Eine purpurne Blüte auf braunem Moorboden wird sie an ein farbenleuchtendes Bild erinnern, einen Giorgione, der an einer braunen Eichentäfelung hängt. Ihnen wird das Leben erst lebendig, wenn es durch irgendeine Kunst hindurchgegangen ist, Stil und Stimmung empfangen hat. Beim Anblick irgendeines jungen Mädchens werden sie an die [10]schlanken, priesterlichen Gestalten einer griechischen Amphore denken und beim Anblick schönfliegender Störche an irgendein japanisches Zackornament. Das alles ganz natürlich, ohne Zwang und preziöse Affektation, als Menschen, die in einer riesigen Stadt aufgewachsen sind, mit riesigen Schatzhäusern der Kunst und künstlich geschmückten Wohnungen, wo kleine sensitive Kinder die Offenbarung des Lebens durch die Hand der Kunst empfangen, die Offenbarung der Frühlingsnacht aus Bildern mit mageren Bäumen und rotem Mond, die Offenbarung menschlicher Schmerzen aus der wächsernen Agonie eines Kruzifixes, die Offenbarung der koketten und verwirrenden Schönheit aus Frauenköpfchen des Greuze auf kleinen Dosen und Bonbonnieren.
Es ist charakteristisch, daß der erste, um den sich diese Gruppe von Künstlern sammelte, ein Kritiker war, ein genialer Mensch, der malen gelernt hatte, um zu verstehen, wie man Leben in farbige Flecke und verschwimmende Tinten übersetzt, um dann mit berauschender Beredsamkeit aus Bildern die lebendigen Seelen der Künstler und der Dinge herauszudeuten: John Ruskin, dessen Kritik ein Nachleben, ein dithyrambisches und hellsichtiges Auflösen und Wiederschaffen ist.
Es ist nicht unnatürlich, daß dieser Gruppe von Menschen, die zwischen phantasievollen Künstlern und sensitiven Dilettanten stehen, etwas eigentümlich Zerbrechliches, der Isolierung Bedürftiges anhaftet.
Die Luft ihres Lebens ist die Atmosphäre eines künstlich verdunkelten Zimmers, dessen weiche Dämmerung von den verbebenden Schwingungen Chopinscher Musik und den Reflexen patinierter Bronzen, alter Samte und nachgedunkelter Bilder erfüllt ist.
Die Fenster sind mit Gobelins verhängt, und hinter denen kann man einen Garten des Watteau vermuten, mit [11]Nymphen, Springbrunnen und vergoldeten Schaukeln, oder einen dämmernden Park mit schwarzen Pappelgruppen. In Wirklichkeit aber rollt draußen das rasselnde, gellende, brutale und formlose Leben. An den Scheiben trommelt ein harter Wind, der mit Staub, Rauch und unharmonischem Lärm erfüllt ist, dem aufregenden Geschrei vieler Menschen, die am Leben leiden.
Es herrscht ein gegenseitiges Mißtrauen und ein gewisser Mangel an Verständnis zwischen den Menschen in dem Zimmer und den Menschen auf der Straße.
Diese Künstler kommen, wie gesagt, nicht vom Leben her: was sie schaffen, dringt nicht ins Leben. »Was sie schaffen«, sagen die auf der Straße, »sind lächerliche und verwerfliche Gefäße der Üppigkeit und der Eitelkeit.« Es sind jedenfalls zerbrechliche kleine Gefäße der raffinierten Empfindsamkeit, die gut auf altem Samt stehen zwischen Filigran und Email und schlecht auf weichem Holz, zwischen einer alten Bibel und einer Werkzeugkiste, einem Gesangbuch und einem zerrissenen Band Smiles über »Charakter«, »Sparsamkeit« oder »Selbsthilfe«. Da ist unter ihnen Einer, der füllt diese zierlichen und zerbrechlichen Gefäße mit so dunkelglühendem, so starkem Wein des Lebens, gepreßt aus den Trauben, aus denen rätselhaft gemischt dionysische Lust und Qual und Tanz und Wahnsinn quillt, füllt sie mit so aufwühlenden Lauten der Seele und solcher Beredsamkeit der Sinne, daß man ihn nicht länger übersehen kann.
Zwar auch er wird nicht eigentlich populär. Man trägt den goldenen Lorbeer an seiner Tür vorbei von dem Sarge eines Dichters heiliger und offener Dinge auf den Schreibtisch eines anderen Dichters guter und klarer Dinge. Aber in die feinen Seelen junger Leute fällt viel von seiner Art, mit bebenden Nerven in die Tiefen zu tasten, wo verworren die Wurzeln der Gefühle liegen, »die Weinbeere Liebe [12]heftig mit den Zähnen zu pressen, bis ihre Süße herb und bitter wird«.
Er hat für die Darstellung gewisser innerer Erlebnisse eine solche pénétrance des Tones gefunden, gewissen Stimmungen eine so wunderbare Körperlichkeit, solche Sprache an alle Sinne gegeben, daß er gewissen Menschen einen feineren und reicheren Rausch geschenkt hat als irgendein anderer Dichter.
Die minder empfänglichen aber auch empfinden den Schauer, der von konzentrierter Schönheit ausgeht, bei dem prunkenden und glühenden Reichtum seiner Rhetorik, dem rollenden Triumph der strömenden Bilder, deren Duft seltsam und unvergeßlich, deren Musik tief aufregend und deren Glanz fremd und traumhaft ist.
Der Dichter, von dem ich rede, heißt Swinburne, Algernon Charles Swinburne.
1865 erschien ein lyrisches Drama: »Atalanta in Kalydon«, mit wunderbarer Verlebendigung des erstarrten Mythos, prachtvollen Gebeten und Chören. Es war eine tadellose antike Amphore, gefüllt mit der flüssigen Glut eines höchst lebendigen, fast bacchantischen Naturempfindens. Nicht das zur beherrschten Klarheit und tanzenden Grazie emporerzogene Griechentum atmete darin, sondern das orphisch ursprüngliche, leidenschaftlich umwölkte. Wie Mänaden liefen die Leidenschaften mit nackten Füßen und offenem Haar; das Leben band die Medusenmaske vor, mit den rätselhaften und ängstigenden Augen; wie in der Adonistrauer, im Kybelekult flossen die Schauer des reifsten Lebens und des Todes zusammen; und Dionysos fuhr, ein lachender und tödlicher Gott, durch die unheimlich lebendige Welt.
Aus tiefsinnigen Beinamen der Götter, aus Mysteriendunkel, aus der lallenden Gewalt heiliger Hymnen, aus [13]Strophen der Sappho, aus den marmornen Leibern sonderbarer und widernatürlicher Gebilde des Mythos war eine wilde Schönheit wach geworden, von keiner heiligen Scham gebändigt. Nach der »Atalanta« kam das Buch, das man immer nennt: ein einfacher Band Lyrik: »Gedichte und Balladen.«
Wieder für den neuen Wein höchst seltsame und altertümliche Gefäße: eine Ballade des Villon, eine Litanei, eine Erzählung des Boccaccio, ein Mysterienspiel mit lateinischen Bühnenangaben, eine Verfluchung im Stile der hebräischen Propheten, eine Legende auf Goldgrund, ein »Triumph des Lebens« und ein »Lob der Liebe« in der Manier der Humanisten oder ein Abenteuer aus dem »Livre des grandes merveilles d’amour« …
In diesen wunderlichen Wahlen liegt nicht Spielerei, sondern ein souveränes Stilgefühl. Dieser ganze große und künstliche Apparat schlägt die Stimmung an, wie in der naiven Ballade der heulende Wind, wenn Mord geschieht, und das Blühen der kleinen Blumen, wenn Liebe redet. Nur daß Jeder den heulenden Wind kennt und die Wiesenblumen, und nicht jeder den Zauber unbeholfener Anmut, der von den gemalten Legenden des Fra Angelico ausgeht, und den Duft heißer und reifer Dinge in den Gartengeschichten Messer Giovan Boccaccios.
Es ist der raffinierte, unvergleichliche Reiz dieser Technik, daß sie uns unaufhörlich die Erinnerung an Kunstwerke weckt und daß ihr rohes Material schon stilisierte, kunstverklärte Schönheit ist: die Geliebte ist gekleidet in den farbigen Prunk des hohen Liedes Salomonis mit den phantastischen Beiworten, die so geheimnisvoll geistreich das Unheimliche an der Liebe in die Seele werfen: das Unheimliche, wie Kriegespfeifen, das Ängstigende, wie irrer Wind in der Nacht; oder die Geliebte wird gemalt, wie die kindlichen Meister des Quattrocento malen: auf einem [14]schmalen Bettchen sitzend, eine kurzgesaitete Laute in den feinen Fingern oder einen rot und grünen Psalter; oder sie steht im Dunkel, wie die weißen Frauen des Burne-Jones, mit blasser Stirn und opalinen Augen. Und der Hintergrund erinnert an phönikische Gewebe, oder an Miniaturen des Mittelalters: da hat die Göttin Venus eine schöne Kirche, und an den Glasfenstern sind ihre Wunder gemalt …
Oder das ganze Gedicht ist die Beschreibung einer Camée, die vielleicht gar nicht existiert; oder der psychologische Vorgang ist in eine Allegorie übersetzt, in eine so plastische, so malbare, so stilisierte Allegorie, daß sie aussieht wie ein wirkliches Gemälde des fünfzehnten Jahrhunderts. Man erinnert sich an die Gabe der Renaissancemeister, ihre Träume in lebendige Bilder zu übersetzen und in farbigen Aufzügen verkleideter Menschen zu dichten: so sehr wird alles Person: der bewaffnete Wind und die große Flamme mit riesigen Händen, und der Tag, der seinen Fuß auf den Nacken der Nacht setzt …
Der Inhalt dieser schönen Formen ist eine heiße und tiefe Erotik, ein Dienst der Liebe, so tieftastend, mit solchem Reichtum der Töne, so mystischer Eindringlichkeit, daß er im Bilde der Liebesrätsel die ganzen Rätsel des Lebens anzufassen scheint.
Was hier Liebe heißt, ist eine vielnamige Gottheit, und ihr Dienst kann wohl der Inhalt eines ganzen Lebens sein.
Es ist die allbelebende Venus, die »allnährende, allbeseelende Mutter« des Lucrez, die vergötterte Leidenschaft, die Daseinserhöherin, die durch das Blut die Seele weckt; dem Gott des Rausches verwandt, verwandt der Musik und der mystischen Begeisterung, die Apollo schenkt; sie ist das Leben und spielt auf einer wunderbaren Laute und durchdringt tote Dinge mit Saft und Sinn und Anmut; sie ist Nôtre dame des sept douleurs, die Lust der Qual und der [15]Rausch der Schmerzen; sie ist in jeder Farbe und jedem Beben und jeder Glut und jedem Duft des Daseins.
Es hat immer passionate pilgrims gegeben, Pilger und Priester der Leidenschaft: Lobredner des Rausches, Mystiker der Sinne, Sendboten der Schönheit. Es gibt darüber tiefe Worte der orientalischen Religionen, schöne Worte des Apostels Paulus, geistreiche Gedanken der Condillac und der Hegel und verführerische Dithyramben der christlichen Dichter.
Aber niemals sind auf dem Altar der vielnamigen Göttin kostbarere Gewürze in schöneren Schalen verbrannt worden als von dem Mann, dem sie vor ein paar Wochen den goldenen Lorbeerkranz nicht gegeben haben, weil er nichts Heiligeres zu tun weiß, als auf dem reichen blauen Meer mit wachen Augen die unsterbliche Furche zu suchen, aus der die Göttin stieg.
[16]Das Tagebuch eines jungen Mädchens
Journal de Marie Bashkirtseff
Es steht sehr viel in diesen beiden Bänden, die vom dreizehnten bis zum vierundzwanzigsten Lebensjahre, vom Erwachen des Mädchens im Kind bis zum Tode, reichen: es wird von fast allen Dingen geredet mit einer Offenheit, die an die Memoiren der Madame Roland erinnert, mit der Freude, die kokette und künstlerische Menschen am Demaskieren und Analysieren haben; von fast allem und doch von allem mit einer so persönlichen spielenden Anmut, mit einer so duftigen, überlegenen Kindlichkeit, daß alle Dinge des gemeinen Lebens ihre Schwere und oft so taktlose Häßlichkeit verlieren und werden, wie die Dinge im Traum sind.
Und doch stehen sehr viele traurige Dinge darin, aber sie verstimmen nicht, sie erdrücken nicht, und die schönste Lebendigkeit spült sie wieder weg. Es stehen auch gewiß eine Menge Banalitäten darin, eine Menge alltäglicher Empfindungen und abgegriffener Gedanken: aber eine rätselhafte, alles durchatmende Grazie gibt ihnen Duft und Glanz.
Ich glaube, man kann dieses Buch nicht unpersönlich lesen; es ist geschrieben wie ein koketter und herzlicher Brief an irgendeinen Unbekannten.
Es ist das französische Tagebuch einer Russin; daraus erklärt sich viel von seiner fast verwirrenden Lebendigkeit. Dieses Déracinement, dieses Übersetzen der ganzen Persönlichkeit in einen fremden Stil des Lebens und Fühlens und Denkens hat etwas, das eigentümlich frei und überlegen macht. Mir fällt ein Wort aus dem Tagebuch Hebbels [17]ein, »von den Menschen, denen das Umgraben ebenso gut tut als den Bäumen schlecht«.
In dem vierzehnjährigen Mädchen ist eine groteske Vorurteilslosigkeit der Reflexion, eine Freiheit und Frechheit der Beobachtung, die empörend sein könnte, wenn sie nicht reizend wäre; dieses Sehen der Dinge in freier, lichter Luft, ohne jede konventionelle Beleuchtung, kehrt später in ihrer künstlerischen Technik wieder – sie malt plein air, wie sie immer plein air gesehen und erlebt hat. Sie hat die große Gabe des Erlebens, die feine und starke Resonanz für äußere Reize, in der sich Kinder und Künstler begegnen. Sie erzählt einmal von dem russischen Frühling, wie der stark und berauschend ist, mit einem verwirrenden Sehnen und Treiben in der Luft, das sich über einen wirft; in Paris aber merkt man nichts vom Frühling, es wird ein bißchen wärmer, man läßt sich bei Worth ein paar Frühjahrstoiletten machen und fährt ins Bois und erlebt dabei gar nichts.
Aus dem Land, wo der Frühling so stark ist mit Treiben und Blühen und Gären, wo man einfache Gefühle fühlt, auf stillen Landgütern wohnt, viel reitet, meistens kein Gesprächsthema hat und früh schlafen geht, fällt das kleine Mädchen in die trockenheiße Atmosphäre kosmopolitischer Mondainetät, in ein Leben mit fanierten halben Farben, mit hastigen, nervösen, tausendfach gebrochenen Gedanken.
Sie lebt dieses Leben mit und lebt es heißer und hastiger als irgend jemand; ihre unverbrauchten Nerven antworten lebhafter, lauter und origineller auf jede Erregung; ihre biegsame und verführerische Seele funkelt und glüht, aber sie verglüht dabei, und mit vierundzwanzig Jahren hat sie ausgeglüht.
Ihr äußeres Leben ist ganz einfach: ein paar Winter in Nizza und Rom, später in Paris; ein paar Reisen durch Italien, ein paar durch Deutschland; eine kindische Liebe, ein Flirt mit anmutigem Anfang und schalem Ende; eine große [18]Sehnsucht nach Kunst und Ruhm, ein paar Jahre Atelier-Existenz, ein Erfolg im Salon, ein Anfang von Berühmtheit, die Freundschaft einiger Künstler, ein paar Wochen qualvollen Leidens auf einem kleinen, in weißem Atlas versteckten Eisenbettchen und der Tod in Jugend und Schönheit, den die Griechen den glücklichen nannten. Aber nie wurde ein Leben fieberhafter, lebensdurstiger gelebt.
Mit dreizehn Jahren hat sie, wie ein Albdrücken, die Angst, ihr Leben zu versäumen, zu vergeuden, zu vertändeln. Sie klagt, daß ihre Lehrerinnen ihr die Zeit stehlen. Sie macht selbst einen Studienplan. Sie erlernt in zwei Jahren das Latein des Gymnasiums. Sie übermüdet ihre Stimme durch zu vieles Singen. Sie schreibt bis zum Morgengrauen. Sie führt mit einer rätselhaften Willenskraft das unerbittlich genaue Tagebuch über alle äußeren Ereignisse, über jede Stimmung und Verstimmung. Dabei die hundert anstrengenden und irritierenden kleinen Pflichten des Familienlebens, des Lebens in einer Gruppe anspruchsvoller, affektierter und sehr empfindlicher Menschen, »ma famille gobeuse et poseuse«, wie sie einmal sagt. Und ein unaufhörliches fieberhaftes Bilanzmachen, ein Zählen der Tage und Wochen mit einer brennenden Sehnsucht nach dem »wirklichen Leben«.
Sie kann keinen Augenblick ruhig sein; überall öffnen sich ihr die verlockenden Wege ins Grenzenlose; je mehr sie sieht, desto mehr will sie sehen, je mehr sie erfährt, desto mehr sehnt sie sich zu wissen; es ist eine schwindelnde Beweglichkeit, ein Spielen mit der eigenen Persönlichkeit, eine ruhelose Lust, Stimmungen schillernd wechseln zu lassen, sich selbst herumzuwerfen, zwischen Madonna und Karikatur, immerfort zu überraschen, zu entgleiten und zu verwirren; eine wundervolle Fähigkeit, jede fremde Erregung nachzubeben, zu trösten, zu verspotten, zu überreden; das unausgesetzte, siegessicherste, unlogischeste und reizendste [19]Einsetzen und Durchsetzen ihres Ich. Es ist nichts Totes in ihren Gedanken, nichts, mit dem sie nicht frauenhaft spielte, nichts abstrakt Farbloses: mit Gott kokettiert und schmollt sie, der Jungfrau Maria schreibt sie Briefe; sie läuft einem König auf der Hotelstiege in den Weg und redet ihn an; sie fängt mit einem großen Künstler einen anonymen Briefwechsel an, in dem sie nichts weniger als artig ist …
Sie ist zu keinem Menschen und keinem Hunde, keiner Blume, keiner Landschaft und keiner Bildergalerie in einem unpersönlichen Verhältnisse gestanden; sie kann an keinem Wesen vorbeigehen, ohne es zu verwirren, zu mißhandeln oder sich drein zu verlieben, ohne daß sie innerlich damit etwas erlebt.
Es ist ihr Nervensystem das feinste und komplizierteste Musikinstrument im Dienste der Subjektivität, das sich denken läßt; sie hat die größte Gewalt über die Regungen, die wir die unwillkürlichen nennen, und ihre Gabe der Autosuggestion erinnert an die einer anderen wunderbaren Frau, die wir kennen. Auch sie kann weinen und blaß werden, wenn sie will: Stimmung komponiert und dekomponiert ihre Miene. »Souvent«, erzählt sie, »je m’invente un héros, un roman, un drame, et je ris et pleure de mon invention comme si c’était la réalité.«
Und ein anderes Mal: »Je m’épanouis au bonheur, comme les fleurs au soleil.«
Man ist nicht umsonst ein außergewöhnliches Wesen mit solchen Feengeschenken: man wird davon ein sehr eitles kleines Mädchen. Aber es ist in dieser grenzenlosen Eitelkeit wenigstens unendlich viel Grazie.
Es ist Grazie in jeder Pose, die entwaffnende übermütige Grazie verzogener Kinder.
Sie schildert sich unzählige Male mit der naiven und künstlerischen Freude am Ausmalen hübscher Dinge; sie sitzt sich in fast jeder Toilette Modell: in dem langen, [20]weichen, weißen Wollkleid, mit dem sie in der Nacht im Garten träumt, im lauen Licht des großen gelben Mondes von Nizza, zwischen schwarzen Palmen, und im Reitkleid und in Soireetoilette (Louis Quinze, blaßrosa mit moosgrünem Sammt, dazu hat sie wunderschönes rötlichblondes Haar und kleine rosige Hände) und im weißen Peignoir, an ihrem kleinen Schreibtisch unter lauter großen ernsten Büchern, Dante und Balzac und Publius Syrus …
Was alle diese kleinen Pastellporträts so hübsch macht, ist das starke Stilgefühl in ihnen, das feine Talent, das sich nicht erlernen läßt, für Zusammenstimmung von Nuancen; Frauen haben das nicht oft, es geht ihnen der lyrische Sinn ab, der Sinn für Stimmung und Details; das, was wir an Männern gern das Frauenhafte nennen.
Das Fieber des Lebens, das sie verbrennt, ist im Grund ein durstiges und bebendes Verlangen nach Macht, nach irgendeiner Herrschaft und Königlichkeit. Ihre Mutter und tausend andere Menschen haben ihr so oft gesagt, daß sie schön und bezaubernd originell ist, bis in ihrem ruhelosen Kopf historische Spielereien und blasse Möglichkeiten berauschend durcheinandergehen. »Ah si j’étais reine!«
En attendant ist sie so hochmütig als möglich.
Alles, was an Macht und Königlichkeit erinnert, berauscht sie: Die Paläste der Colonna und Chiarra; die königlichen Treppen des Vatikan; irgendein Triumphwagen in irgendeinem Museum; irgendein hochmütiges und ruhig überlegenes Wort, eine feine und legitime Arroganz.
Sie selbst ist für diesen großen Stil der Vornehmheit bei aller inneren Eleganz ihres Wesens zu lebhaft und zu nervös; es liegt in ihrer stark betonten Sympathie dafür etwas von dem Neid, mit dem Napoleon einsah, daß er das legitime Gehen nicht erlernen könne; sie spricht zu laut und wird zu leicht heftig; auch der Ton des Tagebuchs ist lauter, weniger reserviert, als man in guter Gesellschaft gewöhnlich [21]spricht. Die Koketterie um ihrer selbst willen, die Koketterie als galantes Turnier wie in den spanischen Lustspielen, als ein graziöses und grausames Kampfspiel; die Kunst des Redens als Waffe, die Kunst, verführerisch zu plaudern, zu verwirren, zu überreden, als ernsthafte sophistische Technik; das rastlose Lernen; die leidenschaftliche Lust am Singen, als an der königlichen Kunst des Musikmachens, Musikwerdens, die bezwingt, fortträgt, beherrscht … welche Macht und welcher Wille zur Macht in diesem kleinen Mädchen!
Bei alledem langweilt sie sich manchmal; oder besser gesagt, sie fühlt eine innere Leere und Unruhe. Erfolge sogar langweilen schließlich und sehen aus wie Enttäuschungen. Man fängt an, sich nach dem Wunderbaren zu sehnen, nach irgendeinem Nievorhergesehenen, ganz Anderen. Es fängt ein seltsames Suchen an, ein Reisen nach dem, was dem Leben einen Sinn geben soll; neue Länder sind es nicht, neue Menschen auch nicht, man errät sie immer so genau vorher; die Liebe ist es auch nicht, wenigstens nicht die bekannte der Salons und des Bois, mit anmutigem Anfange und schalem Ende; das Leben ist es auch nicht, in dem erlebt man immer nur sich selbst wieder. Sie sitzt wie Hagar in der Wüste und wartet auf eine lebendige Seele: »Je dessèche d’inaction, je moisis dans les ténèbres! le soleil, le soleil, le soleil! …«
Es gibt Stunden des herben Hochmuts, wo ihr nichts der Berührung wert erscheint, kein Wort wert, es zu schreiben, und das ganze Leben nicht lebenswert, bis das Andere kommt, das Wirkliche. Dieses Warten ist lang und qualvoll: »Notre-Dame qui n’êtes jamais satisfaite«, Unsere liebe Frau von der ewigen Unruh’, hat sie einer genannt.
Endlich wird es unerträglich, dieses sinnlose bebende Suchen und Warten, und man geht hin und »hält dem Leben, was einem das Leben versprochen hat«, und wird ein [22]Künstler und schafft das Leben aus sich selbst heraus, das lachende, blühende, lebendige Leben.
So ist die kleine Marie Bashkirtseff eine große Künstlerin geworden. Sie ging hin und malte Gassenjungen und arme Frauen, kleine Ausschnitte aus dem gemeinen Leben, und malte sie mit der Unmittelbarkeit des Erlebens, der Unbefangenheit des Schauens, die so selten ist, malte sie mit dem goldenen Ton der reinen Freude am Dasein: »Je ne maudis pas la vie, je l’aime et la trouve bonne. J’aime pleurer, j’aime me désespérer, j’aime à être chagrine et triste et j’aime la vie malgré tout.«
Sie war schon sehr krank; leidend und lächelnd malt sie den Frühling mit duftiger, durchsonnter Luft und blühenden Apfelbäumen und jungen Mädchen, »alanguies et grisées«, und malt das Leben mit den goldatmenden und lachenden Farben, die in ihr sind, und fängt an, berühmt zu werden, und stirbt.
Auf ihr Tagebuch aber hat ein Dichter diese Verse geschrieben:
Non, la mort n’est qu’un mot. Je te sens si vivante
En lisant ces feuillets o¡u se posa ta main,
Qu’il me semble te voir, dans la grâce mouvante
De tes longs vêtements, passer sur le chemin …
[23]Gabriele d’Annunzio
I
Man hat manchmal die Empfindung, als hätten uns unsere Väter, die Zeitgenossen des jüngeren Offenbach, und unsere Großväter, die Zeitgenossen Leopardis, und alle die unzähligen Generationen vor ihnen, als hätten sie uns, den Spätgeborenen, nur zwei Dinge hinterlassen: hübsche Möbel und überfeine Nerven. Die Poesie dieser Möbel erscheint uns als das Vergangene, das Spiel dieser Nerven als das Gegenwärtige. Von den verblaßten Gobelins nieder winkt es mit schmalen weißen Händen und lächelt mit altklugen Quattrocento-Gesichtchen; aus den weißlackierten Sänften von Marly und Trianon, aus den prunkenden Betten der Borgia und der Vendramin hebt sich’s uns entgegen und ruft: »Wir hatten die stolze Liebe, die funkelnde Liebe; wir hatten die wundervolle Schwelgerei und den tiefen Schlaf; wir hatten das heiße Leben; wir hatten die süßen Früchte und die Trunkenheit, die ihr nicht kennt.« Es ist, als hätte die ganze Arbeit dieses feinfühligen, eklektischen Jahrhunderts darin bestanden, den vergangenen Dingen ein unheimliches Eigenleben einzuflößen. Jetzt umflattern sie uns, Vampyre, lebendige Leichen, beseelte Besen des unglücklichen Zauberlehrlings! Wir haben aus den Toten unsere Abgötter gemacht; alles, was sie haben, haben sie von uns; wir haben ihnen unser bestes Blut in die Adern geleitet; wir haben diese Schatten umgürtet mit höherer Schönheit und wundervollerer Kraft, als das Leben erträgt; mit der Schönheit unserer Sehnsucht und der Kraft unserer Träume. Ja [24]alle unsere Schönheits- und Glücksgedanken liefen fort von uns, fort aus dem Alltag, und halten Haus mit den schöneren Geschöpfen eines künstlichen Daseins, mit den schlanken Engeln und Pagen des Fiesole, mit den Gassenbuben des Murillo und den mondänen Schäferinnen des Watteau. Bei uns aber ist nichts zurückgeblieben als frierendes Leben, schale, öde Wirklichkeit, flügellahme Entsagung. Wir haben nichts als ein sentimentales Gedächtnis, einen gelähmten Willen und die unheimliche Gabe der Selbstverdoppelung. Wir schauen unserem Leben zu; wir leeren den Pokal vorzeitig und bleiben doch unendlich durstig: denn, wie neulich Bourget schön und traurig gesagt hat, der Becher, den uns das Leben hinhält, hat einen Sprung, und während uns der volle Trunk vielleicht berauscht hätte, muß ewig fehlen, was während des Trinkens unten rieselnd verlorengeht; so empfinden wir im Besitz den Verlust, im Erleben das stete Versäumen. Wir haben gleichsam keine Wurzeln im Leben und streichen, hellsichtige und doch tagblinde Schatten, zwischen den Kindern des Lebens umher.
Wir! Wir! Ich weiß ganz gut, daß ich nicht von der ganzen großen Generation rede. Ich rede von ein paar tausend Menschen, in den großen europäischen Städten verstreut. Ein paar davon sind berühmt; ein paar schreiben seltsam trockene, gewissermaßen grausame und doch eigentümlich rührende und ergreifende Bücher; einige, schüchtern und hochmütig, schreiben wohl nur Briefe, die man fünfzig, sechzig Jahre später zu finden und als moralische und psychologische Dokumente aufzubewahren pflegt; von einigen wird gar keine Spur übrigbleiben, nicht einmal ein traurig-boshaftes Aphorisma oder eine individuelle Bleistiftnotiz, an den Rand eines vergilbten Buches gekritzelt.
Trotzdem haben diese zwei- bis dreitausend Menschen eine gewisse Bedeutung: es brauchen keineswegs die Genies, ja nicht einmal die großen Talente der Epoche unter [25]ihnen zu sein; sie sind nicht notwendigerweise der Kopf oder das Herz der Generation: sie sind nur ihr Bewußtsein. Sie fühlen sich mit schmerzlicher Deutlichkeit als Menschen von heute; sie verstehen sich untereinander, und das Privilegium dieser geistigen Freimaurerei ist fast das einzige, was sie im guten Sinne vor den übrigen voraus haben. Aber aus dem Rotwelsch, in dem sie einander ihre Seltsamkeiten, ihre besondere Sehnsucht und ihre besondere Empfindsamkeit erzählen, entnimmt die Geschichte das Merkwort der Epoche.
Was von Periode zu Periode in diesem geistigen Sinn »modern« ist, läßt sich leichter fühlen als definieren; erst aus der Perspektive des Nachlebenden ergibt sich das Grundmotiv der verworrenen Bestrebungen. So war es zu Anfang des Jahrhunderts »modern«, in der Malerei einen falsch verstandenen Nazarenismus zu vergöttern, in der Poesie, Musik nachzuahmen, und im allgemeinen, sich nach dem »Naiven« zu sehnen: Brandes hat diesen Symptomen den Begriff der Romantik abdestilliert. Heute scheinen zwei Dinge modern zu sein: die Analyse des Lebens und die Flucht aus dem Leben. Gering ist die Freude an Handlung, am Zusammenspiel der äußeren und inneren Lebensmächte, am wilhelm-meisterlichen Lebenlernen und am shakespearischen Weltlauf. Man treibt Anatomie des eigenen Seelenlebens, oder man träumt. Reflexion oder Phantasie, Spiegelbild oder Traumbild. Modern sind alte Möbel und junge Nervositäten. Modern ist das psychologische Graswachsenhören und das Plätschern in der rein-phantastischen Wunderwelt. Modern ist Paul Bourget und Buddha; das Zerschneiden von Atomen und das Ballspielen mit dem All; modern ist die Zergliederung einer Laune, eines Seufzers, eines Skrupels; und modern ist die instinktmäßige, fast somnambule Hingabe an jede Offenbarung des Schönen, an einen Farbenakkord, eine funkelnde Metapher, eine [26]wundervolle Allegorie. Ein geistreicher Franzose schreibt die Monographie eines Mörders, der ein experimentierender Psychologe ist. Ein geistreicher Engländer schreibt die Monographie eines Giftmischers und Urkundenfälschers, der ein feinfühliger Kunstkritiker und leidenschaftlicher Kupferstichsammler war. Die landläufige Moral wird von zwei Trieben verdunkelt: dem Experimentiertrieb und dem Schönheitstrieb, dem Trieb nach Verstehen und dem nach Vergessen.
In den Werken des originellsten Künstlers, den Italien augenblicklich besitzt, des Herrn Gabriele d’Annunzio1, kristallisieren sich diese beiden Tendenzen mit einer merkwürdigen Schärfe und Deutlichkeit: seine Novellen sind psychopathische Protokolle, seine Gedichtbücher sind Schmuckkästchen; in den einen waltet die strenge nüchterne Terminologie wissenschaftlicher Dokumente, in den andern eine beinahe fieberhafte Farben- und Stimmungstrunkenheit.
In seinen zahlreichen längeren und kürzeren Novellen – keine, auch die längsten nicht, lassen sich eigentlich »Romane« nennen – bewegen sich vielerlei und äußerst verschiedene Menschen; aber alle haben einen gemeinsamen Grundzug: jene unheimliche Willenlosigkeit, die sich nach und nach als Grundzug des in der gegenwärtigen Literatur abgespiegelten Lebens herauszustellen scheint, jenes Erleben des Lebens nicht als einer Kette von Handlungen, sondern von Zuständen.
Da ist die Geschichte eines armen Dienstmädchens: eine Geschichte, simpel wie eine Legende, eine Art Monographie des Lebens einer bestimmten Spezies Pflanze: eine halb verbetete, halb verträumte Jugend, dann Dienst, [27]Dienstbotenklatsch, ein paar Wallfahrten, viel Gebete; Freundschaft, animalische Stallfreundschaft mit einem alten, kränklichen Esel; der Tod des Esels; ein Wechsel im Dienst, eine späte müde Art von Liebe zu einem Landbriefträger, und Ehe und Tod. Alles ist wahr, von einer niederschlagenden Wahrheit: nicht kraß und brutal, aber revoltierend, unerträglich durch den Mangel an Luft, durch die Konzeption des Menschen als einer Pflanze, die vegetiert, sich langweilt und abstirbt. Oder die Geschichte eines Tramwaybediensteten, Giovanni Episcopo: er ist sensitiv und feig; seine Frau hat Liebhaber, die ihn und sein Kind brutalisieren; er fürchtet sich, sehnt sich fort und schaut seinem Schwiegervater, einem Säufer, Branntwein trinken zu; und das dauert Jahre und Jahre … Oder die Geschichte, wie die Bauern, weil ihrem Dorfheiligen die Wachskerzen gestohlen worden sind, halb wahnsinnig vor Fanatismus den wächsernen vergoldeten Heiligen auf die Schulter nehmen und mit Sensen und Dreschflegeln über die nächtigen Äcker ins Nachbardorf stürmen und die Kirchentür sprengen und auf den Altar des anderen Heiligen, des Rivalen, den ihrigen setzen wollen und wie die zwei Haufen wütender Menschen mit den zwei heiligen Namen als Feldgeschrei in der finstern Kirche zwischen Lilien, Schnitzwerk und Blutlachen die Nacht durch morden.
Aber man glaubt vielleicht, daß das Quälende dieser Lebensanschauung, diese eigentümliche Mischung von Gebundensein und Wurzellosigkeit, durch den Zwang kleiner Verhältnisse erklärt werden soll? Keineswegs. Einige dieser Novellen spielen in der Gesellschaft, in den Kreisen der überlegenen, unabhängigen Menschen. Gleich »L’Innocente«, das Buch, welches von allen Werken des d’Annunzio die größte Zahl Auflagen erlebt hat. Es ist das Plaidoyer eines Kindesmörders. Ein Bericht, der auf Jahre zurück ausholt und aus den unscheinbarsten Kleinigkeiten eine [28]unwiderstehliche Schlußkette neuropathischer Logik zusammensetzt. In diesem Buch hat Herr d’Annunzio ein Meisterwerk intimer Beobachtung geschaffen. In keinem modernen Buche seit »Madame Bovary« ist die Atmosphäre des Familienzimmers, der enge ewig wechselnde Kontakt zusammenlebender Menschen ähnlich geschildert: das Erraten der Stimmung des anderen aus dem Klang der Schritte, der Färbung der Stimme; alle Qual und alle Güte, die sich in ein besonders betontes Wort, eine rechtzeitig gefundene Anspielung legen läßt; das Erraten des Schweigens; die unerschöpfliche Sprache der Blicke und der Hände. Verglichen mit diesem wirklichen Miteinander- und Ineinanderleben von Ehegatten ist das Verhältnis in Bourgetschen oder Maupassantschen Eheromanen ein flaches, ein bloßes Nebeneinanderleben, von dem sich einzelne Duoszenen, Krisen abheben. Der Erzähler der Geschichte, der Ehemann, ist eines jener Wesen von morbider Empfindlichkeit, hellsichtig bis zum Delirium und unfähig, zu wollen. Auch er steht wurzellos im Leben, schattenhaft, müßig. An einer Mauer seiner Villa ist eine Sonnenuhr befestigt. Manchmal gleiten seine Blicke über den Quadranten, der die Inschrift trägt: »Hora est bene faciendi«. Gut tun! In der Arbeit den Sinn des Lebens suchen! Wie lang ist es doch her, daß ein deutscher Roman die Menschen bei der Arbeit aufsuchen wollte! Man hat diese Devise, vielleicht durch eine falsche Ideenassoziation, als etwas philiströs empfunden. Man wollte keine »staatserhaltenden« Romane: man wollte sich die Freiheit nehmen, den Menschen sowohl beim Verbrechen als beim Genuß, sowohl beim romantischen als beim psychologischen Müßiggang aufzusuchen. Oder, da die Neigungen der Romanfiguren immer bis zu einem gewissen Grad die Neigungen der Künstler reflektieren: man fand den Begriff des Schwebens über dem Leben als Regisseur und Zuschauer des großen Schauspiels verlockender als den [29]des Darinstehens als mithandelnde Gestalt. Es scheint, daß man auf einem Umweg zur bürgerlichen Moral zurückkommt, nicht weil sie moralisch, aber weil sie gesünder ist …
Im »Innocente« läßt sich deutlich der Punkt wahrnehmen, wo der raffinierte Verismus der Seelenzergliederung in Phantastik umschlägt. Die Frau des Kindesmörders, das Opfer seiner willenlosen Grausamkeiten und endlosen Quälereien, ist eine Figur von so scharf duftendem, quintessenziertem Stimmungsgehalt, daß sie darüber zum Symbol wird. Sie ist nur leidende Anmut, eine graziöse Märtyrerin, reizend und unwirklich wie jene blassen Märtyrerinnen des Gabriel Max, mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Kindlichkeit und Hysterie. In einer Bewegung ihrer weißen blutleeren Hände, in einem Zucken ihrer blassen feinen Lippen, in einem Neigen des blühenden Weißdornzweiges, den sie in den schmalen Fingern trägt, liegt eine unendlich traurige und verführerische Beredsamkeit. Wenn sie so daliegt, die fast durchsichtige Stirn und die schmalen Wangen von dunklem Haar eingerahmt, und der Polster, auf dem sie schläft, minder bleich als ihr Gesicht – diese ganze Technik des Weiß auf Weiß erinnert frappant an Gabriel Max –, so berührt sie wie ein Kunstwerk, eine Traumgestalt. Man begreift vollständig, daß sie einen Traumtod sterben kann, daß sie zum Beispiel im Wald die Schläge einer Axt auf irgendeinen unsichtbaren Baum wie Schläge des Lebens gegen ihre überfeine Seele empfinden und an dieser Emotion, also gewissermaßen an einem poetischen Bild, sterben kann.
Etwas Ähnliches geschieht dieser Figur wirklich. Aber nicht im »Innocente«, sondern in einem der poetischen Bücher von d’Annunzio, den »römischen Elegien«, die als »Geliebte« ganz die gleiche sensitive Frauengestalt enthalten. Römische Elegien! Uns klingen die zwei Worte bedeutend und besonders, wie ein erlauchter Name. Zum [30]Überfluß ist denen des Italieners ein Distichon aus denen des Deutschen vorangesetzt:
»Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe
Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom.«
So wird ausdrücklich ein gleicher Inhalt angekündigt, und Vergleichung scheint geradezu herausgefordert. Dichter steht gegen Dichter und Epoche gegen Epoche. In antik-heiterem Liebesleben die glückliche Vorzeit in sich aufleben lassen, von der Liebe den hohen naiven Stil des Lebens lernen und lebend und liebend sich jener heroischen und verklärten Wesen als wesensgleicher werter Vorfahren erinnern, in genialen Metamorphosen bald die antike göttliche Welt vertraulich zu sich in Schlafstube und Weinlaube ziehen, bald ehrfurchtsvoll im eigenen Treiben das Ewige und Göttern Verwandte begreifen, das war das »Römische« an diesen deutschen Elegien von 1790. Was hat Rom dazu gegeben? Goldene Ähren und saftige Früchte, von der Sonne Homers gezeitigt, eine reinlich konturierte, simple, fast Tischbeinsche Landschaft und von all seinen unzähligen berauschenden Erinnerungen nichts als das Gärtchen des Horaz, die Hütte des Tibull voll Liebesgeplauder und Duft von Weizenbrot und die Spatzen des Properz. Nie haben die Grazien das liebliche Brot unsterblicher Verse von einfacheren Holztellern gegessen und klareres Quellwasser dazu getrunken. Auch in den »Römischen Elegien« des Heutigen, des Italieners, wandeln die Grazien. Aber der Dichter hat sie erst in das Atelier des Tizian geschickt, sich umzukleiden. Sie wandeln beim Plätschern der Renaissancefontänen durch die Laubgänge der mediceischen und farnesischen Villen; farbige Pagen warten ihnen auf, und im smaragdgrünen Bosket spielen weiße Frauen im Stil des Botticelli auf langen Harfen. Zu diesen Elegien hat Rom all [31]seine Erinnerungen hergegeben: die herrischen, die sehnsüchtigen, die prunkenden, die mystischen, die melancholischen. Diese komplizierte Liebe saugt aus der Landschaft, aus Musik, aus dem Wetter ihre Stimmungen. »Wie ein Wiesel Eier saugt«, sagt der melancholische Jacques. Diese Liebe ist wie gewisse Musik, eine schwere, süße Bezauberung, die der Seele Unerlebtes als erlebt, Traum als Wirklichkeit vorspiegelt. Es ist keine Liebe zu zweien, sondern ein schlafwandelnder wundervoller Monolog, das Alleinsein mit einer Zaubergeige oder einem Zauberspiegel. Um so öder ist das Erwachen, dieses ernüchterte Anstarren:
»Und meinen Blicken erschien ihre Hand wie gestorben, ein totes
Schien sie, ein wächsernes Ding, diese lebendige Hand.
Die mit so funkelnden Träumen die Stirn mir umflocht und die, wehe,
Süßeste Schauer der Lust mir durch die Adern gesandt!«
In den beiden »Römischen Elegien« wiederholt sich eine Situation: wie der Dichter, auf dem Lager der Liebe halb aufgerichtet, den Schlaf der Geliebten belauscht. Welch sicheres Glück bei Goethe, welch sicheres Umspannen des Besitzes, welch seliges Genügen! Wie einen kleinen Vogel in der hohlen Hand, hält der Glückliche Leib und Seele der Geliebten, den blühenden Leib und das warme, naive hingebende Seelchen. Dem Modernen erscheint der kleine Vogel weniger zutraulich und weniger leicht zu besitzen. Wie er sich über die blasse, leise atmende Gestalt mit Liebesaugen beugt, kommt ihm nur der eine Gedanke: wie wenig die ruhelose, sehnsüchtige Seele unter diesen geschlossenen Lidern ihm gehört, wie die Träume sie bei der Hand nehmen und fortführen, wohin er nicht folgen kann. Und wenn die geliebten Lider sich öffnen und der Blick der suchenden Augen sich jenseits verlieren will, jenseits des Lebens, in [32]vergeblicher Sehnsucht, muß er den bleichen Mond und den unendlichen mächtigen Himmel und die unruhigen Bäume und die sehnsüchtig flimmernden Sterne bitten, ihm nicht diese kleine sehnende Seele ganz zu rauben … »Gebet, wenn ich Euch verehrte, gebt, daß ihre Seele wandermüde sich an mich schmiege, weinend, mit unendlicher Liebe.« Es ist, als hätte sich in den hundert Jahren, die zwischen diesen beiden Liebestagebüchern liegen, alle Sicherheit und Herrschaft über das Leben rätselhaft vermindert bei immerwährendem Anwachsen des Problematischen und Inkommensurablen.
Gegenüber diesem ekstatischen Auffliegen der Liebe, dieser uneingeschränkten mystischen Hingabe an die Stimmung, wie nüchtern bei Goethe die weise Beschränkung, wie simpel, wie antik! Dem nervösen Romantiker ist die Liebe halb wundertätiges Madonnenbild, halb raffinierte Autosuggestion; unter den Händen Goethes war sie nichts als ein schöner Baum mit duftenden Blüten und saftigen Früchten, nach gesunden Bauernregeln gepflanzt, gepflegt und genossen. Das war ihm »römisch«; er dachte an den Hymenäus des Catull, diese lebenatmende Hymne, die in der Ehe nichts Heiligeres und nichts Unheimlicheres sieht als in der heiligen Ernte oder im saftsprühenden Weinlesefest. Er dachte an den Dichter, der in einem unsterblichen Buch die reife Leidenschaft der Dido und die herbe Mädchenliebe der kleinen Lavinia malt und in einem andern lehrt, die goldenen Honigwaben auszuschneiden und die reifen Birnen zu brechen. Ein Tagebuch der Liebe wie die »Elegie romane« steht nur noch halb auf der Erde. Es enthält den Ikarusflug, es enthält auch den kläglichen Fall und die lange, öde, elende Ermattung. Es enthält den Rausch der Phantasie und den Katzenjammer der Neurose und Reflexion. »Cio che ti diede ebrezza devesi corrompere«, aus Lust wird Leid, aus Blumen Moder und Staub. So schließt [33]mit dem Jammer des Psalmisten, was mit der Ekstase des Doktor Marianus begonnen.
Um die reine Schönheit zu erreichen, muß die Gestalt der Geliebten immer traumhafter werden, muß die Liebe selbst immer mehr einem Haschischrausch, einer Bezauberung gleichen. Das ist im »Isotteo« erreicht. Isotteo, Triumph der Isaotta, ist gleichzeitig ein reales und ein phantastisches Buch, gleichzeitig Wirklichkeit und Traum. Es ist nirgends darin gesagt, daß die beiden Menschen darin kostümiert sind, aber alle ihre Gedanken sind es. Diese Dichterseele ist so erfüllt mit den faszinierenden Abenteuern der Vergangenheit, daß sie unter der Berührung der Liebe unwillkürlich wie aus einem tiefen Brunnen eine Märchenwelt aufschweben läßt. »Mir war, als ströme aus ihrer Rede eine Bezauberung und unterwerfe alle Büsche und Bäume …« »Ihr Hände, die ihr meinen Qualen das Tor der schönen Träume aufschlosset …« »Ich kränze dich, Quell, wo ich an jenem Tag einen Trunk tat, der mir lebendig bis ins Herz zu gleiten schien …« Realität und Phantasma rinnen völlig ineinander: Die Hände der Geliebten öffnen das Tor der Phantasie; wenn die Geliebte und der Dichter nebeneinander herreiten, ist es ihm, als ritten Lancelotto und Isolde mit der weißen Hand durch den smaragdfunkelnden Wald der Poesie; um ihren blonden Kopf sieht er gleichzeitig einen Kranz Rosen und die Glorie seiner Träume gewunden. Im Triumphzug der Isaotta gehen die Horen mit Feuerlilien in der Hand, hinter ihnen Zefirus, Blumenduft hauchend, gehen Flos und Blancheflos, Paris und Helena, Oriana und Amadis, Boccaccio und Fiametta, geht der Tod, kein Gerippe, sondern ein schöner heidnischer Jüngling mit den Gelüsten und Träumen als valets de pied.
Das ist es, was ich den Triumph der Möbelpoesie genannt habe, den Zauberreigen dieser Wesen, von denen nichts als Namen und der berückende Refrain von Schönheit und [34]