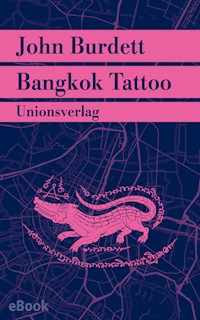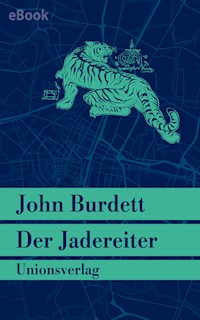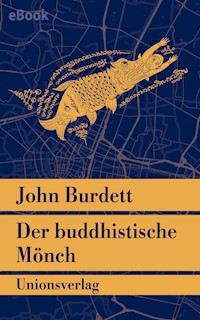
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Polizist im berüchtigten achten Bezirk von Bangkok hat Sonchai Jitpleecheep schon viel gesehen. Kein Verbrechen aber hat ihn je an der menschlichen Spezies zweifeln lassen. Doch Sonchai spürt, dass er in diesem Augenblick ein solches Verbrechen mit ansehen muss: Im abgedunkelten Raum der Polizeistation läuft ein Snuff-Movie. Und die junge Frau, die in diesem mörderischen Film vor seinen Augen getötet wird, ist niemand anderes als Damrong, die begehrteste Prostituierte Bangkoks – und Sonchais ehemalige Geliebte. Auf der Suche nach ihren Mördern muss er sich Gegnern stellen, die weitaus größer sind, als er erwartet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Nie zuvor hat Sonchai, der Polizist des berüchtigten achten Bezirks von Bangkok, ein Verbrechen mit ansehen müssen, das ihn so erschütterte. In einem Snuff-Movie wird eine junge Frau ermordet – die Prostituierte und Sonchais ehemalige Geliebte Damrong. Auf der Suche nach ihren Mördern sieht er sich weitaus größeren Gegnern gegenüber als erwartet.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
John Burdett (*1951 in London) arbeitete vierzehn Jahre als Anwalt in Hongkong und London, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er ist der Schöpfer der in und um Bangkok angesiedelten Krimireihe mit dem Ermittler Sonchai Jitpleecheep. Er lebt in Bangkok und in Frankreich.
Zur Webseite von John Burdett.
Sonja Hauser ist als Übersetzerin aus dem Englischen tätig. Sie übersetzt u. a. die Werke von Lucinda Riley, Emily Hauser, Sujata Massey und E. L. James.
Zur Webseite von Sonja Hauser.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
John Burdett
Der buddhistische Mönch
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Sonja Hauser
Jitpleecheep ermittelt in Bangkok (3)
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2008 im Verlag Alfred A. Knopf, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 im Piper Verlag, München.
Originaltitel: Bangkok Haunts
© by John Burdett, 2007
© der deutschen Übersetzung: Piper Verlag GmbH, München 2008
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Fisch - Bhanupong Chooarun (Shutterstock); Karte Bangkok - nestign (Alamy Stock Vector)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31076-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 08:55h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER BUDDHISTISCHE MÖNCH
Ein perfektes Produkt1 – Nur wenige Verbrechen lassen uns um die Zukunft …2 – In Dr. Supatras unterirdischem Reich hängen Kreissägen und …3 – Wenn Sie ihn selbst noch nicht erlebt haben …4 – Ich habe mich natürlich schon in ihrer Wohnung …5 – Als der in diesem Fall zuständige Beamte habe …6 – Vergangene Nacht hat Damrong mich heimgesucht. Wahrscheinlich wusste …7 – Da ich im Augenblick keine anderen Spuren verfolgen …8 – Natürlich wissen Lek und ich ganz genau …9 – Drei Stunden später fahre ich mit dem Taxi …10 – Von meinem Schreibtisch aus sehe ich zu …11 – Ich dachte, Vikorn würde seinen Bentley benutzen …12 – Wenn Supermann sich in Godot zu verwandeln beginnt …13 – In dem Dorf Sleepy Elephant gibt es keinerlei …14 – Wir sind winzige Figuren am Glücksarmband der Unendlichkeit …15 – Am nächsten Tag sucht Lek mich gegen vier …16 – Gerade bereite ich mich innerlich auf einen Besuch …17 – Komm rauf«, weist Vikorn mich an. »Ich möchte …18 – Ich warte auf einem Sofa im ersten Stock …19 – Nok hat mich angewiesen, nach elf zu kommen …20 – Eine Leiche, auf die Ihre Beschreibung von gestern …21 – Jedes schwere Verbrechen lässt sich irgendwie erklären …22 – Er hats dir erzählt, nicht?«, höre ich die …23 – Die unvermittelte Einmischung des Mönchs in den Fall …24 – Während der gesamten Heimfahrt beschäftigen mich Stanislaus Kowlovski …Der Maskierte25 – Die FBI-Frau starrt eine Terrine mit fetten …26 – Es gibt jede Menge bankrotte Staaten, genügend Kleptokratien …27 – Fünf Uhr früh: Der Busbahnhof in Surin ist …28 – Wo steckt er, Lek?«29 – Er schickt mir die Fotos per E-Mail …Elefantenfallen30 – Das Telefon auf meinem Schreibtisch klingelt. Es ist …31 – Chatuchak-Markt, morgen um zwanzig nach elf, Stand 398 …32 – Als ich in Smiths Kanzlei auftauche, schenkt der …33 – Ich habe keine Ahnung, wie oder warum Baker …Endspiel34 – Liebster Bruder35 – Der Morgen, der blutrot über den östlichen Baumspitzen …36 – Gestern wurde die tödliche Langeweile erneut unterbrochen …EpilogDankMehr über dieses Buch
John Burdett: »Thais glauben an Geister, aber nicht ohne Ironie.«
Über John Burdett
Über Sonja Hauser
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von John Burdett
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Thailand
Zum Thema Großstadt
Zum Thema Religion
Für Nit
Du hast mich verhext, und ich ging unter;
Es fällt mir so schwer zu gehen.
Bob Dylan, Tonight I’ll Be Staying Here with You
Ging der Ewige vorüber in Gestalt eines Luden.
Das Gezwitscher verstummte.
Jean Genet, Notre-Dame-des-Fleurs
Das klammernde Bewusstsein ist tief und subtil;
Alle Potenziale sind wie eine Sturmflut.
Ich erkläre dies nicht den Unwissenden,
Aus Angst, sie könnten auf die Idee kommen,
das sei das Selbst.
Gautama Buddha, The Sandhinirmochana Sutra
Ein perfektes Produkt
1
Nur wenige Verbrechen lassen uns um die Zukunft des Menschen bangen. Ich beobachte gerade eines.
In einem verdunkelten Raum des Polizeireviers von District 8, in Gesellschaft meiner guten FBI-Freundin Kimberley Jones sowie eines Toshiba-LCD-Bildschirms, der hoch oben an der Wand angebracht ist, damit ihn niemand abmontieren kann.
Der Film, den ich mir mit der FBI-Frau ansehe, wurde mittels zweier professioneller Kameras mit Zoom, Weitwinkel, Schwenks et cetera gedreht, und ich habe mir sagen lassen, dass mindestens zwei Profis an seiner Herstellung beteiligt gewesen sein müssen. Farbe und Schärfe sind, Abermillionen Pixeln sei Dank, ausgezeichnet; es handelt sich um das Produkt einer hoch entwickelten Zivilisation, wie es unsere Ahnen noch nicht kannten. Am Ende des Films bricht die hartgesottene Kimberley, wie von mir erhofft, in Tränen aus. Warum soll es ihr besser gehen als mir?
»Sag mir, dass das nicht wahr ist.«
»Tja, wir haben die Leiche.«
»Du lieber Himmel«, meint Kimberley. »Ich hab schon Blutigeres gesehen, aber noch nie etwas so Unheimliches. Und ich dachte, mich kann nichts mehr erschüttern.« Sie steht auf. »Ich brauch frische Luft.«
In Bangkok?, denke ich, während ich sie über einige Flure hinaus in den öffentlichen Bereich führe, wo braunhäutige Männer und Frauen, kaum halb so groß wie sie, darauf warten, ihre häuslichen Sorgen bei einem Cop abzuladen. Es herrscht nicht gerade festliche Atmosphäre, aber immerhin geht es hier menschlich zu. Als extrovertierte Amerikanerin scheut Kimberley sich nicht, ihre roten Augen vor Publikum abzutupfen, das natürlich meint, ich hätte sie gerade irgendeines kleineren Drogenvergehens wegen – Haschischbesitz zum Beispiel – festgenommen. Wir sehen uns um. Auf den Plastikstühlen sitzen drei junge attraktive Frauen, alle Prostituierte. (Keine anständige Thai würde sich so kleiden.) Sie bedenken uns mit bösen Blicken. Kimberley, vermute ich, würde sie am liebsten aus Freude darüber, dass sie am Leben sind, umarmen. Ich dirigiere sie hinaus auf die Straße – wo uns etwas entgegenschlägt, das man zwar nicht als »frische Luft« bezeichnen kann, aber immerhin die Lunge füllt. »Mein Gott, Sonchai, was für eine Welt. Welche Monster bringen wir bloß hervor?«
Wir haben etwas Seltenes erreicht, Kimberley und ich: ein sexloses – aber dennoch vertrautes Verständnis zwischen einem Mann und einer Frau gleichen Alters, die sich körperlich attraktiv finden, jedoch – aus Gründen, die sich rationaler Analyse entziehen – beschlossen haben, nicht aktiv zu werden. Es überraschte mich, dass sie nach einem verzweifelten Anruf meinerseits kurzerhand ein Flugzeug nach Bangkok bestieg. Ich ahnte nichts von ihrer Spezialisierung auf Snuff Movies; genauso wenig wusste ich, dass diese im Augenblick der letzte Schrei bei der internationalen Polizei sind. Jedenfalls beruhigt es, von einem hochklassigen Profi, der sich mit der neuesten Technologie auskennt, unterstützt zu werden. Kimberley ist nicht intuitiv wie ich, hat dafür aber einen messerscharfen Verstand. Soll ich sie wie einen Mann oder wie eine Frau behandeln? Gibt es in ihrem Land Verhaltensmaßregeln für einen solchen Fall? Ich umarme sie kumpelhaft und drücke ihre Hand – offenbar das richtige Vorgehen. »Schön, dich hier zu haben, Kimberley«, sage ich. »Noch mal danke, dass du gekommen bist.«
Sie lächelt mit jener Unschuld, die sich oft nach emotional tief greifenden Erlebnissen manifestiert. »Tut mir leid, ich bin ein Waschlappen.«
»Beim ersten Mal Sehen hab ich genauso reagiert.«
Sie nickt ohne das geringste Zeichen von Verwunderung. »Wo hast du das Ding her, von ’ner Razzia?«
Ich schüttle den Kopf. »Nein, es ist mir anonym nach Hause geschickt worden.« Sie bedenkt mich mit einem wissenden Blick; aha, eine private Sache also, scheint er zu sagen.
»Und die Leiche, wo hat man die gefunden? Am Tatort?«
»Nein, in ihrer Wohnung, ordentlich auf dem Bett ausgebreitet. Die Leute von der Spurensicherung sind sich sicher, dass sie woanders umgebracht wurde.«
Jetzt kommt die amerikanische Superwoman in ihr zum Vorschein. »Die kriegen wir, Sonchai. Verrat mir, was du brauchst, dann sorg ich dafür, dass du’s kriegst.«
»Keine Versprechungen«, erwidere ich. »Das hier ist nicht der Irak.«
Sie runzelt die Stirn. Wahrscheinlich haben die Amerikaner diese Art von Spott allmählich satt. »Nein, aber der Film ist professionell gemacht, in einem bestimmten Stil. Wenn der Typ in dem Streifen nicht aus den Vereinigten Staaten oder Kanada kommt, fress ich ’nen Besen.«
»Eine Hollywood-Produktion?«
»Ich würde mit der Suche in Kalifornien beginnen, allerdings nicht in Hollywood, sondern eher im San Fernando Valley, bei ’ner Produktionsfirma mit internationalen Beziehungen. Das lässt sich unter Umständen mit Nachforschungen fürs FBI verbinden.«
»Wonach würdest du Ausschau halten? Der Mann im Film trug doch eine Maske.«
»Die Augenlöcher sind ziemlich groß, und von jedem, der in die Staaten einreist, werden biometrische Daten erfasst. Gib mir ’ne Kopie von der DVD, dann setz ich unsere Spezialisten auf die Sache an. Wenn es ihnen gelingt, eine ordentliche Vergrößerung von seinen Augen hinzukriegen, ist das genauso gut wie ein Fingerabdruck oder sogar besser. Darf ich mir die Leiche ansehen?«
»Wenn du möchtest. Wie weit willst du dich bei dem Fall engagieren?«
»Von Chanya weiß ich, dass du ziemlich aus der Fassung bist. Das geht mir auch an die Nieren. Wenn ich irgendwie helfen kann, mach ich das.«
»Chanya hat dir das gesagt?«
»Sie liebt dich. Und sie meint, dass du moralische Unterstützung von einer Kollegin gebrauchen könntest. Ich hab ihr versprochen zu tun, was ich kann, wenn du mich lässt.«
Die FBI-Frau ahnt nicht, welchen Bonus sie sich bei mir erwirbt, indem sie eine schwangere Ex-Prostituierte aus der Dritten Welt als Freundin und Gleichgestellte behandelt. Heroismus solcher Art bringt uns in diesem Winkel der Erde zum Staunen. Auch Chanya mag Kimberley, und wer sich die Zuneigung einer Thai-Frau erworben hat, erfährt von ihr alles.
Ein Tuk-Tuk fährt vorbei, dessen Zweitaktmotor schwarze Abgase in die Luft bläst. Früher waren die Dinger Symbole Thailands: drei Räder, ein Stahldach auf vertikalen Streben und ein fröhlich lächelnder Fahrer. Heutzutage sind sie Touristenspielzeuge für immer weniger Passagiere. Bis jetzt hat das 21. Jahrhundert nicht allzu viel Neues gebracht; wir ahnen, dass eine Rückkehr zur altbekannten bitteren Armut unser Anteil an der Globalisierung sein wird. Kimberley hat das noch nicht gemerkt – sie ist erst zwei Tage hier, und schon packt sie der Arbeitseifer. Ihr fallen Tuk-Tuk und schwarze Abgase überhaupt nicht auf.
»Ich lasse die DVD nicht von meinen Leuten kopieren«, sage ich. Sie schaut mich an. »So etwas wird in sehr geringer Zahl produziert und international auf Spezialmärkten verkauft.« Ich spüre, wie ich rot werde. »Unser Land ist arm.« Immer noch dieser Blick: Ich muss Farbe bekennen. »Sie würden sie verkaufen.«
Sie wendet sich ab, damit ich ihre Verachtung nicht sehe. Erst nach einer ganzen Weile meint sie: »Ich hab mich wieder gefangen. Du kannst mir ruhig sagen, wie du das Ding kopieren lässt.«
»Überhaupt nicht. Ich stecks in die Tasche. Du kannst die Daten im Konferenzzentrum des Grand Britannia direkt von der DVD mailen.«
Kimberley bleibt im Wartebereich, während ich die DVD hole – fünf Komma sieben Megabyte Essenz des Bösen. Als wir wieder draußen sind, starrt sie einem jungen Mönch nach. Er ist Anfang bis Mitte zwanzig und strahlt exotische Eleganz aus, die nicht zu dem Internetcafé passt, in das er gerade tritt.
»Der Sangha sieht die Nutzung des Internets in öffentlichen Räumen nicht gern, ahndet sie jedoch nicht«, erkläre ich, froh, nicht mehr über das Snuff Movie sprechen zu müssen. »Die Mönche informieren sich oft über buddhistische Websites.«
»Kommt er häufiger hierher? Mir scheint das kein Ort zu sein, an dem sich Mönche normalerweise rumtreiben.« Offenbar verspürt auch Kimberley das Bedürfnis nach Small Talk.
»Ich hab ihn gestern das erste Mal gesehen. Keine Ahnung, zu welchem Wat er gehört.«
2
In Dr. Supatras unterirdischem Reich hängen Kreissägen und unterschiedlichste Messerarten an den Wänden, von Hackbeilen bis zu eleganten Stiletten. Ich habe ihr noch nichts von der DVD erzählt; nur die FBI-Frau und Chanya wissen Bescheid, was nicht sonderlich für die Thai-Integrität spricht, oder? Nicht, dass ich Supatra nicht vertrauen würde. In unserer Zeit ohne Ehre heben sich die, die sie besitzen, besonders deutlich ab. Supatra ist genauso unbestechlich wie ich. Warum ich ihr dann nichts von der DVD gesagt habe? Weil ich sie nicht beeinflussen wollte.
Ich stelle sie Kimberley vor. Dr. Supatra bedenkt sie mit einem argwöhnischen Blick; heutzutage haben wir alle ein kleines Problem mit dem westlichen Überlegenheitskomplex – auch wenn Kimberley letztlich nicht mehr wirklich darunter leidet. Wir lernten uns vor ungefähr fünf Jahren bei der Aufklärung eines Falls hier in Bangkok kennen; damals war Kimberley noch eine hormongesteuerte Männerjägerin. Inzwischen wirkt sie sehr viel trauriger, aber auch weiser. Nun kennt sie die Thai-Sitten gut genug, um die Hände zu einem durchaus beachtlichen Wai an die Lippen zu führen, das Supatras höherem Status aufgrund ihres Alters Rechnung trägt: Sie ist über fünfzig, nur wenig mehr als eins fünfzig groß, schlank und sieht streng aus in ihrem weißen Laborkittel. Jetzt, da Kimberley ihre Demut demonstriert hat, kann Supatra ihr Herz öffnen und führt uns aus dem Labor ins Kellergewölbe. Mit nachdenklich schräg gelegtem Kopf – eine Technik, die wunderbarerweise ihre mangelnde Körpergröße ausgleicht – fragt sie: »Nun, Sonchai, wissen Sie, wer das Opfer ist?«
Ich zucke unwillkürlich zusammen, was Dr. Supatra nicht mitbekommt – anders als Kimberley mit ihren unerbittlichen blauen Augen.
»Ich habe ihre Fingerabdrücke in der nationalen Datenbank überprüft. Es handelt sich um eine gewisse Damrong aus Isakit.«
»Eine Prostituierte?«
»Klar.«
»Hm.«
Mittlerweile haben wir den Aktenschrank des Todes erreicht, etwa hundert mannsgroße Schubladen in einer Wand. Ohne die Nummer überprüfen zu müssen, wendet Dr. Supatra sich einer in Kniehöhe zu und signalisiert mir mit einer Geste, dass ich sie herausziehen soll. Sie ist schwer, aber leichtgängig; ein mittelstarker Ruck setzt sie in Bewegung, und schon gleitet Damrong, Kopf zuerst, heraus. Wieder zucke ich zusammen. Dr. Supatra schreibt das meiner Sensibilität zu; die FBI-Frau blickt tiefer.
Sie ist auch mit ihrem aufgeschwollenen Gesicht noch attraktiv: eleganter Kinnbogen, hohe Wangenknochen, ägyptische Katzenaugen, schmale, aber sinnliche Lippen, ebenmäßige weiße Zähne, dieses gewisse Etwas …
Wem mache ich etwas vor? Natürlich hat das Strangulieren ihre Gesichtszüge auf schreckliche Weise verzerrt und entstellt; doch als die Schublade ganz herausrollt, besteht kein Zweifel mehr an der Vollkommenheit ihres Körpers, der Fülle ihrer Brüste, der perfekten Form ihrer festen, aber anschmiegsamen Hüften. Ihre Schambehaarung ist rasiert, in einer ihrer Schamlippen steckt ein Silberring. Um ihren Nabel ringelt sich eine Schlangentätowierung mit einem Schwert. Unwillkürlich greife ich nach ihrem schlaffen linken Handgelenk und drehe es herum, wo sich an der Innenseite eine schmale helle Narbe befindet, etwa zweieinhalb Zentimeter lang, von einem Längsschnitt in eine der Adern. Dr. Supatra nickt. »Ja, die habe ich auch gesehen. Eine alte Verletzung. Falls sie von einem Selbstmordversuch stammt, war der nicht sonderlich ernst gemeint.«
»Ja«, pflichte ich ihr bei.
Dr. Supatra hat gute Arbeit geleistet. Am liebsten würde ich die große, durch ordentliche Stiche geschlossene Y-förmige Öffnung von Damrongs Körper, die vom Brustkorb bis zum Unterleib reicht, zudecken. Alle Organe sind entnommen; der Anblick schmerzt – besonders jetzt, da die FBI-Frau sich auf meinen Gesichtsausdruck konzentriert.
»Nun«, frage ich schluckend, »was können Sie uns sagen?«
»Über die Todesursache? In diesem Fall stimmt der äußere Schein mit dem tatsächlichen Geschehen überein. Sie wurde mit einem etwa einen Zentimeter dicken Nylonseil erwürgt, dem orangefarbenen Strick, den Ihre Männer um ihren Hals gefunden haben: Die Fasern stimmen mit denen der Mordwaffe überein. Alle ihre inneren Organe sind unverletzt, und es gibt auch keinerlei Wunden, Viren oder Bakterien, die ihren Tod verursacht haben könnten.«
»Keine Hinweise auf gewaltsame Penetration?«
»Nein. Offenbar wurde ein Gleitmittel benutzt. Natürlich bedeutet das nicht notwendigerweise, dass der Geschlechtsverkehr mit ihrer Einwilligung stattfand, nur, dass er relativ schmerzlos erfolgte.«
»Sperma?«
Kopfschütteln. »Vagina und Anus wurden penetriert, vermutlich von einem Penis mit Kondom, denn ich konnte keine Spermaspuren entdecken.«
Ich schweige einen Augenblick, weil ich merke, dass Dr. Supatra bewusst etwas zurückhält, bevor ich frage: »Und?«
»Keine Partydrogen. Wie ihr Geisteszustand zum Zeitpunkt ihres Todes auch immer gewesen sein mag – durch Drogen wurde er nicht beeinflusst.«
»Irgendwelche Hinweise auf Gegenwehr?«, erkundigt sich die FBI-Frau.
Dr. Supatra schüttelt den Kopf. »Nein, das ist ja das Merkwürdige. Eigentlich würde man zumindest blaue Flecken oder verkrampfte Muskeln erwarten, aber nichts. Es sieht fast so aus, als wäre sie in gefesseltem Zustand erwürgt worden – doch auch auf eine gewaltsame Fesselung gibt es keine Hinweise.«
»Verdammt«, sagt Kimberley. Dr. Supatra hebt eine Augenbraue. »Tja, wahrscheinlich will ich das Ende einfach nicht glauben.«
»Ende?«, fragt Dr. Supatra. »Was für ein Ende?«
Kimberley hält die Hand vor den Mund, aber es ist zu spät. Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als Dr. Supatra von der DVD zu erzählen. Supatra nickt; als Profi begreift sie sofort, warum ich ihr erst jetzt davon berichte. Sie schenkt mir sogar ein mütterlich verständnisvolles Lächeln.
»Trägheit ist eine nationale Schwäche«, erklärt sie der FBI-Frau. »Sonchai hatte Angst, dass ich faul werden und meine Arbeit nicht richtig erledigen würde, wenn ich den Film sähe.«
»Ich wollte die DVD schon zurückhalten, bevor ich wusste, dass Sie sich mit dem Fall beschäftigen würden«, erwidere ich.
»Sie haben sie doch auch noch aus anderen Gründen nicht erwähnt, oder? Snuff Movies erzielen hohe Preise auf dem internationalen Markt, heißt es. Was bedeutet, dass Sie etwas sehr Wertvolles in Händen halten.« Und an Kimberley gewandt, fügt sie hinzu: »Aber wie war das noch mal mit dem Ende, das Ihnen so wenig gefällt?«
Kimberley will ihr darauf keine Antwort geben, also verspreche ich Dr. Supatra, ihr die ganze DVD zu zeigen, sobald Zeit dazu ist. Allerdings hat die FBI-Frau noch eine andere Frage. »Dr. Supatra, ist Ihnen zuvor jemals ein Fall von Strangulation untergekommen, in dem es keinerlei Hinweise auf Gegenwehr gab?«
Dr. Supatra mustert sie neugierig, als wäre ihr soeben klar geworden, welche Bedeutung diese Frage für einen Farang haben kann. »Nicht, dass ich wüsste, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass unsere Kultur ein eigenes Bewusstsein besitzt.«
Kimberley runzelt die Stirn. »Ein eigenes Bewusstsein?«
»Im Hinblick auf den Tod«, erklärt die Pathologin. »Der Umgang einer Kultur mit dem Tod definiert auch ihre Einstellung zum Leben. Verzeihen Sie, wenn ich das sage, aber der Westen vermittelt manchmal den Eindruck, als würde er ihn leugnen. Thais sehen das ein bisschen anders.«
»Inwiefern unterscheidet sich Thailand da von uns?«
»Es geht nicht um Thailand allein, sondern um ganz Südostasien. Wir stehen alle auf Geister – die Malaysier sind viel schlimmer als wir. Natürlich gibt es zu diesem Thema keine Statistiken, aber wenn man den Thais glauben darf, übersteigt die Zahl der Untoten die der Lebenden um ein Hundertfaches.«
»Sie als Wissenschaftlerin glauben das doch nicht, Dr. Supatra, oder?«
Dr. Supatra lächelt fragend. Ich nicke. »Tja, ich bin Wissenschaftlerin, aber eben keine westliche. Mit Sonchais Erlaubnis würde ich Ihnen gern etwas zeigen.« Wieder nicke ich, und schon folgen wir Dr. Supatra in ihr Büro. Immer noch mit Sphinxlächeln holt sie ihren Laptop sowie eine Sony-Videokamera aus einer Schublade. »Damit beschäftige ich mich in den meisten Nächten«, sagt sie und demonstriert, wie sie die Kamera aufs Bürofenster richtet, das auf die Pathologie mit den Leichenreihen in den Stahlgruften geht und die Bilder auf ihrem Computer aufzeichnet. »Möchten Sie die Ausbeute der letzten Nacht anschauen?« Wieder sieht sie mich fragend an; schließlich ist die FBI-Frau mein Gast. Ich nicke zum dritten Mal, ein wenig verlegen. Erliege ich der Versuchung der Boshaftigkeit? Plötzlich werde ich ob dieser unangekündigten Initiation nervös; vielleicht flippt die FBI-Frau ja aus? Aber jetzt ist es zu spät für einen Rückzieher. Kimberley sitzt an Dr. Supatras Schreibtisch, während diese an ihrem Laptop hantiert. »Leider muss ich Infrarotlicht benutzen, weshalb die Bilder nicht besonders deutlich sind. Trotzdem lässt sich die Sache wissenschaftlich nur schwer erklären.«
Ich beobachte Kimberley, wie sie die Bilder betrachtet, die ich selbst bereits kenne. Sie wird blass, starrt mich einen Moment lang ungläubig an, wendet sich wieder dem Laptop zu, schüttelt den Kopf, zuckt zusammen. Dann presst sie die Hand auf den Mund, als müsste sie sich übergeben. Dr. Supatra beendet die Vorstellung.
Die FBI-Frau steht auf. »Tut mir leid«, sagt sie mit vor Zorn rotem Gesicht. »Ich bin Gast in diesem Land, aber das kann ich einfach nicht lustig finden.«
Dr. Supatra sieht mich kurz an, bevor sie die Hände hebt. Ich sage auf Thai: »Ist schon in Ordnung. Kimberley reagiert genauso wie ich beim ersten Mal Sehen. Sie versucht, sich selbst davon zu überzeugen, dass das nicht die Realität ist, dass so etwas nicht passieren kann, dass es sich um einen Trick handelt.«
»Was mache ich jetzt?«, fragt Dr. Supatra auf Thai. »Sie ist ziemlich aus der Fassung. Ich glaube, das war keine gute Idee, Sonchai. Soll ich einfach so tun, als wärs doch ein Trick?«
Ich zucke mit den Achseln. »Wählen Sie die einfachste Lösung.«
»Entschuldigung«, sagt Dr. Supatra auf Englisch zu Kimberley. »Das ist unser berühmter Thai-Humor. Nehmen Sie es mir nicht übel.«
Die FBI-Frau ringt sich ein Lächeln ab. »Schon okay. Wahrscheinlich ist das wieder so eine Kulturfrage. In einem anderen Zusammenhang hätte ich’s vielleicht auch witzig gefunden. Ich bin nun wirklich kein Spielverderber, aber einen so groben Scherz hatte ich nicht erwartet.«
»Tut mir leid.« Dr. Supatra führt die Hände zu einem Wai an die Lippen, um ihr aufrichtiges Bedauern zu signalisieren.
Nun möchte Kimberley beweisen, dass sie nicht nachtragend ist. »Ausgesprochen clever«, sagt sie. »Keine Ahnung, wie Sie das hingekriegt haben. Gehört es zur Thai-Kultur, zu glauben, dass Geister kopulieren und einander diese … äh … hässlichen Dinge antun? Das höre ich zum ersten Mal. Erstaunliche Effekte. Filmen ist vermutlich Ihr Hobby.«
»Stimmt«, bestätigt Dr. Supatra. »Es ist alles eine Sache der Kameraführung. Um das Treiben der Geister zu begreifen, muss man allerdings wissen, dass der Hirntod nicht unbedingt die Triebe ersterben lässt. Und das sieht dann nicht besonders hübsch aus, da pflichte ich Ihnen bei.«
»Wie haben Sie das mit den nicht-menschlichen Gestalten gedreht?«
»Mittels eines speziellen Animationsprogramms«, antwortet Dr. Supatra mit einem kleinen Wai in Richtung des sitzenden Buddha in seinem Schrein auf halber Höhe der Wand. Sie bittet um Verzeihung für ihre Notlüge.
»Unglaublich. So was hab ich noch nie gesehen. Wirkt professioneller als manches aus Hollywood.«
Dr. Supatra nimmt das Kompliment schweigend hin und führt uns wieder die Treppe hinauf. An ihrem ausweichenden Blick beim Abschied merke ich, dass sie wütend auf mich ist, weil ich sie ermutigt habe, ihr Hobby einer Farang zu offenbaren.
Nun möchte ich mich eigentlich nicht über Damrong unterhalten, aber leider sitze ich in der Falle. Ich muss Kimberley im Taxi zu ihrem Hotel bringen; ihr Schweigen lastet auf mir wie ein immer schwerer werdendes Gewicht, während sie aus dem Fenster starrt.
»Chanya weiß Bescheid«, sage ich nach einer Weile. »Das alles war, bevor sie und ich uns kannten. Sie hat nur deshalb mit dir über den Fall geredet, weil sie seine Wirkung auf mich fürchtet. Sie glaubt, dass du mir auf psychologischer Ebene beistehen kannst. Sie selbst fühlt sich machtlos.«
Kimberley erwidert erst einmal nichts. Irgendwann beugt sie sich zum Fahrer vor, um ihm zu sagen, dass er uns zum State Tower bringen soll, nicht zu ihrem Hotel. Eine kluge Wahl. So weit oben über der Stadt, im Dome, einer Restaurant-Bar im Freien, gleich unter den Sternen, ein exotischer Cocktail mit Kokosnusssaft in Kimberleys Hand, ein Kloster-Bier in der meinen, haben wir das Gefühl, als berührten unsere Köpfe den Nachthimmel: Wir befinden uns sozusagen in einem kosmischen Beichtstuhl.
»Tja, das war so«, beginne ich.
3
Wenn Sie ihn selbst noch nicht erlebt haben, ist der Zustand schwer zu begreifen. Hätte ich Damrong nie kennengelernt, wäre mir der männliche Wahn, den ihr Westler »verliebt sein« nennt, vermutlich auch fremd geblieben, Farang. In Thailand ist die Einstellung zur »Liebe« ein bisschen anders.
Gleich zum peinlichsten Teil der Geschichte: Sie verführte mich nach allen Regeln der Kunst, schon eine Woche, nachdem sie in der Bar meiner Mutter zu arbeiten begonnen hatte, die ich immer noch gemeinsam mit dieser leite. Wie alle guten Papasans hatte ich mir geschworen, niemals die Dienste unserer Angestellten in Anspruch zu nehmen, und es bis dahin auch nicht getan. Doch ich fühlte mich einsam ohne meinen Partner Pichai, der in Ausübung seiner Pflicht getötet worden war, und merkte nicht, wie offensichtlich mein Interesse an dem neuen Superstar sein musste. Mit ziemlicher Sicherheit wusste sie bereits vor mir um meine Gefühle. Wann kippt die Bewunderung eines Mannes für eine Frau in Besessenheit, die der Buddha so vehement kritisiert? Ich weiß nur, dass Songkran war, das thailändische Neujahrsfest, die heißeste Zeit überhaupt. An jenem Songkran vor etwa vier Jahren vertraute ich dem Computer in meinem liebeskranken Zustand Proustsche Ergüsse an:
Gestern Abend sah ich von der Tür zur Bar aus, wie sie mit einem Motorradtaxi in unserer Soi eintraf, bekleidet mit einem neuen, grellbunten Kleid, das das Wesen dieser schrecklichen Jahreszeit zu verkörpern schien, und mit einem arroganten Zurückwerfen ihrer dichten schwarzen Mähne, die sich seidig schimmernd über ihre zierlichen Schultern ergoss, stolz ins Bordell marschierte, in dem ich sie, nur sie, erwartete …
Oje. Jeder Mann in dem Zustand dürfte für das Objekt der Begierde sehr leicht zu durchschauen sein. Ich glaube, es war in der Nacht, in der ich diese Worte geschrieben hatte, so gegen zwei Uhr, als ich die Bar zuschließen wollte, in der nur noch sie sich aufhielt. Die Stereoanlage hatte ich bereits ausgeschaltet; die hässlichen Geräusche vor dem Zusperren – Flaschenklappern, Abfallrascheln, Wasserplätschern in der Spüle – schienen von der Einsamkeit zu künden, unter der ich litt. Ich senkte den Blick, als sie auf dem Weg nach draußen an mir vorbeikam, doch sie legte sanft die Hand unter mein Kinn und hob meinen Kopf hoch, bis ich ihr in die Augen sehen musste. Mehr war nicht nötig. In unserer Begierde machten wir uns nicht die Mühe, in eins der Zimmer oben zu gehen.
»Du bist ein außergewöhnlicher Liebhaber«, flüsterte sie mir hinterher zu. Das sagen alle Nutten, und wie alle Freier wollte ich es glauben.
Heute erscheint mir die ganze Affäre von Anfang bis Ende klischeehaft, und das sage ich der FBI-Frau auch. Sie sieht mir nicht in die Augen, während ich die traurige Geschichte erzähle, die in engem Zusammenhang mit der Wildheit des Songkran-Festes stand, bei dem früher einmal heiliges Wasser sanft und liebevoll über Mönchen und angesehenen Älteren ausgegossen wurde; heutzutage hat der Farang es in Bangkok für sich vereinnahmt: Dreißig-, Vierzig- und Fünfzigjährige spritzen wie die Lausbuben Passanten aus riesigen Wasserpistolen an; angetrunken werden sie ziemlich aggressiv, bis sie sich schließlich mit ihren Plastikspielzeugen müde auf dem Gehsteig zusammenrollen. Alle, die die Bar an jenem Abend betraten, waren nass bis auf die Haut; die Klügeren hatten ihre Handys in wasserdichte Beutel gesteckt. Es regierte der Wahnsinn.
Ich nehme einen Schluck Bier. Die FBI-Frau und ich verfolgen die priapeische Bahn des Orion am Himmel.
»Erspar mir den Mittelteil und komm lieber gleich zum Ende«, sagt die FBI-Frau augenscheinlich emotionslos, aber mit rauer Stimme.
»Erlebt ihr Frauen die Leidenschaft jemals so extrem wie wir Männer?«
»Meinst du völlige psychische Auflösung, Auslöschung der Identität, Zerstörung des Ego, permanente Verunsicherung, egal, ob man gerade mit dem Objekt der Begierde im Bett liegt oder nicht? Klar.«
»Und wie endet das normalerweise?«
»Demjenigen, der mehr leidet, bleiben zwei Alternativen: den anderen umbringen oder sich verkrümeln, solang’s möglich ist.« Ein hastiger Blick in meine Richtung. »Du als Cop weißt besser als die meisten Menschen, dass es keine schlimmere Gewalttätigkeit gibt als bei Paaren.«
Ihre scharfsinnige Farang-Analyse verblüfft mich. Ich hatte nicht erwartet, so schnell zum Höhepunkt des Abends zu kommen. Etwa zehn Minuten des Schweigens vergehen, bevor es mir gelingt zu sagen:
»Nach unserer ersten gemeinsamen Nacht hab ich ihr das Versprechen abgenommen, mit keinem Freier mehr zu schlafen. Sie sollte nur noch Drinks servieren und flirten; ihren Einnahmeverlust würde ich ausgleichen, egal, wie hoch er wäre. Ein klassischer Fall von verrücktem Lover, der sich die Keuschheit seiner Geliebten erkaufen will. Sie hat ihren Teil der Abmachung ungefähr zehn Tage lang eingehalten, bis dieser durchtrainierte junge Engländer daherkam, mit dem sie sich einen Schwips antrank. Er zahlte ihre Auslöse und entführte sie vor meinen Augen nach oben.« Wieder eine lange Pause. »Es ist so, wie du sagst: Entweder man wird zum Mörder, oder man macht sich vom Acker. Ich hab meine Mutter gebeten, sich den Rest der Nacht um die Bar zu kümmern, und es den Mädchen überlassen, ihr zu erzählen, was passiert war. Dann hab ich mir eine zweiwöchige Auszeit auf Ko Samui gegönnt, und in der hat meine Mutter sie vor die Tür gesetzt.«
Kimberley schüttelt den Kopf. Ein mitfühlendes, aber auch etwas boshaftes Lächeln spielt um ihre Lippen. »Dann hat also deine Mama dich gerettet?«
Ich nicke. »Nicht nur sie allein. Als ich von Ko Samui zurückkam, hatte Chanya bei uns angefangen. Wer das Morbide kennt, weiß das Normale zu schätzen. Ich glaube nicht, dass Chanya mir ohne die Erfahrung mit Damrong so wichtig geworden wäre. Das Universum besteht aus Gegensätzen.«
Auf dem Rückweg zur Sukhumvit sagt die FBI-Frau im Taxi: »Wolltest du ihr in der Nacht, als sie vor deinen Augen mit dem Engländer nach oben verschwand, nach? Hättest du fast die Kontrolle verloren?«
»Ja. Meine Waffe steckte in ihrem Holster unter der Theke. Das war mir sehr bewusst.«
»Und die zwei Wochen auf Ko Samui hast du dann gegen Mordfantasien angekämpft?«
»Die ganze Zeit. Sie kamen in Schüben. Nur am Morgen war ich stark genug, mich dagegen zu wehren. Die restlichen Stunden hab ich mich mit Alkohol und Ganja betäubt.«
»Und sie? Warum hat sie das gemacht? War es nicht selbstzerstörerisch, sich mit ihrem Boss einzulassen?«
»Die wirklich Armen haben letztlich kein Ich, das sie zerstören könnten. Wenn sie irgendwie Macht erlangen, wissen sie genau, dass sie sie nur vorübergehend besitzen. Sie sind nicht geübt im Planen der Zukunft. Die wenigsten glauben überhaupt, eine zu haben.«
Die FBI-Frau wirkt nachdenklich. »Tatsächlich?«
»Für die Armen ist die Geburt das Grundübel, denn sie bringt einen Körper, der ernährt und gepflegt werden muss, und dazu den Fortpflanzungstrieb. Alles andere ist Kinderkram, auch der Tod.«
Kimberley seufzt. Sie denkt an die Damrong-DVD, das ist klar. »Ich hatte schon befürchtet, dass du so was sagen würdest.«
Als wir das Grand Britannia erreichen, fragt sie: »Sie hätte dir jede körperliche Perversion oder Erniedrigung erlaubt, um deine Seele in ihren Bann zu schlagen, stimmts?«
Ich schweige.
Nach einer Weile erkundigt sie sich: »Das Hobby von Dr. Supatra – ist das typisch Thai, oder gehe ich recht in der Annahme, dass sie zur Exzentrik neigt?«
Ich hüstle. »Alle Thais sind exzentrisch, Kimberley. Wir waren nie Kolonie, also haben wir kein rechtes Gefühl für globale Normen.«
»Du hast die Aufnahmen doch selber gesehen, oder?
Ich meine, das waren nicht bloß kopulierende Geister, sondern groteske Sachen mit Dämonen und Geschöpfen aus der Unterwelt. Ausgesprochen clever, aber auch ziemlich morbide.«
Ich zucke mit den Achseln. »Sie ist seit mehr als zwanzig Jahren Gerichtspathologin. Versuch, dir ihre Psyche vorzustellen.«
Die FBI-Frau nickt ob dieser im Hinblick auf ihre kulturellen Vorurteile einleuchtenden Erklärung. Allerdings scheint ein Gedanke sie weiter zu beschäftigen. »Sonchai, ich bekomme allmählich das Gefühl, dass in diesem Land endlos viele Realitätsschichten nebeneinander existieren. Bist du eigentlich ehrlich zu mir? Wenn das Zeug auf Dr. Supatras Laptop echt wäre, könnte sie doch weltberühmt sein. Bestimmt hätten sich National Geographic, Discovery Channel und Scientific American dafür interessiert, oder?«
Ich verkneife mir ein Lächeln bei dem Gedanken daran, Supatra im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu erleben. »Dr. Supatra ist ein sehr zurückhaltender Mensch«, erkläre ich. »Ich glaube, sie würde lieber das Zeitliche segnen als sich dem Medienrummel aussetzen.«
Mittlerweile ist die FBI-Frau aus dem Taxi heraus, dessen Tür noch offen steht, und sie streckt den Kopf mit gerunzelter Stirn zu mir herein. »Heißt das, dass die Aufnahmen tatsächlich echt sind? Oder es sein könnten?«
»Nun, das hängt davon ab, was du unter ›echt‹ verstehst«, antworte ich und schließe sanft die Tür.
Auf dem Weg zurück zu Chanya lasse ich all die intensiven, leidenschaftlichen Momente mit Damrong vor meinem geistigen Auge Revue passieren. Ich glaube, es gab keinen Tag, an dem wir nicht mindestens dreimal miteinander schliefen: »Verrat mir deine Herzenswünsche, Sonchai, was dir Spaß macht. Stell mit mir Dinge an, die du noch nie mit einer Frau gewagt hast. Sonchai, mach mich zu deiner Sklavin, tu mir weh, wenn du möchtest. – Du darfst es, weißt du?«
Schwarz auf weiß mag das kitschig wirken, aber es steigt zu Kopf, wenn man es von einer Frau hört, die einen gedanklich und emotional in ihren Bann geschlagen hat.
Zu Hause wartet Chanya auf mich. Sie sieht sich gerade eine Seifenoper an (Magier, Geister und Skelette verleihen einem häuslichen Dramolett Würze) und begrüßt mich mit einem trägen Blinzeln sowie dem Gruß aller Leute vom Land: »Hast du schon was gegessen?«
»Ja, einen Happen.«
Nachdem ich sie geküsst habe, beginne ich, ihren Bauch zu streicheln. Wir witzeln gern, dass der Fötus eine Reinkarnation meines früheren Partners und Bruders im Geiste Pichai ist. – Aber letztlich begreifen wir das beide nicht als Scherz, denn seit Kurzem träumen wir fast nächtlich von ihm, und Chanya kann ihn genau beschreiben, obwohl sie ihn nie persönlich kennengelernt hat. Also frage ich: »Wie gehts Pichai?«
»Gut, er strampelt vor sich hin.« Sie sieht mir in die Augen. »Und?«
»Ich hab Kimberley die DVD gezeigt. Ihrer Meinung nach kann man die Augen des Täters biometrisch analysieren, das wäre dann so etwas wie ein Fingerabdruck. Heutzutage muss jeder Ausländer bei der Einreise in Thailand auf Drängen der Vereinigten Staaten ein digitalisiertes Passfoto einreichen. ›Freiheit und Demokratie‹ heißt das wohl. Früher oder später werden wir ihn erwischen.«
Sie legt mir die Hand auf die Stirn, um zu prüfen, ob ich Fieber habe. »Du hast dich noch nie so aufwühlen lassen von einem Fall. Liegts daran, dass ihr mal ein Paar wart?«
»Woran sonst?«
»Nun, vielleicht hats mit dem Ende von dem Film zu tun. Was meint Kimberley dazu?«
»Mit dem kommt sie auch nicht zurecht. War eine merkwürdige Stimmung beim Anschauen.«
»Sogar noch im Tod gelingt es dieser Frau, deine Welt auf den Kopf zu stellen.«
Ich brauche eine Weile, bis ich diese scharfsinnige Beobachtung verdaut habe. »Nicht nur die meine. Obwohl die FBI-Frau nun wirklich nicht naiv ist, hat sie einen Schock erlitten. Tja, das passiert wohl, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Man wills nicht glauben, aber die Beweise sind überwältigend.«
Chanya ergreift meine Hand und legt sie tröstend auf ihren Bauch.
4
Ich habe mich natürlich schon in ihrer Wohnung umgesehen, in der ihre Leiche gefunden wurde, allerdings nur oberflächlich, weshalb ich gern noch eine gründlichere Durchsuchung vornehmen würde. Gestern hätte ich genug Zeit gehabt, aber da war leider Mittwoch, und mittwochs lässt man am besten die Finger von den Toten. Im Westen führen alle Straßen nach Rom; im Osten kann man jeden Aberglauben nach Indien zurückverfolgen. Unsere brahmanischen Lehrmeister haben uns genaue Instruktionen hinterlassen, unter anderem Farbempfehlungen für die unterschiedlichen Wochentage. Wenn in Thailand dienstags eine auffällige Häufung von Pinktönen festzustellen ist, dann liegt es daran. Normalerweise halte ich mich nicht an diese Tradition, aber nervös, wie ich jetzt bin, beuge auch ich mich ihr. Heute beispielsweise wähle ich bewusst Orange für Socken, Hemd und Taschentuch – sicher ist sicher.
Damrongs Apartment befindet sich in einem Wohnhaus der Mittelklasse an der Soi 23, nur einen Katzensprung von unserer Bar, dem Old Man’s Club, entfernt, wo ich die vergangene Nacht verbracht habe. (Ja, ich gebs zu: Ich wollte Chanya und Pichai an einem Mittwochabend, wenn der schwarze Gott Rahu den Himmel beherrscht, kein Unglück bringen; falls Damrongs Geist sich auf mich stürzen würde, dachte ich, wäre es besser, mich diesem Angriff im Club zu stellen.)
Es ist später Vormittag, als ich die Bar für den Abend vorbereite; im Wesentlichen besteht meine Aufgabe darin, Bier und Höherprozentiges zu bestellen, zu überprüfen, ob das Putzpersonal ordentlich gearbeitet hat, und mich um den Buddha zu kümmern, eine Figur von etwa einem halben Meter Höhe, die auf einem Regal hoch über der Kasse thront. Der Buddha hat einen Mordsappetit auf Lotusgirlanden und lässt den Glücksstrom sofort versiegen, wenn ich vergesse, für Nachschub zu sorgen. Bevor ich mich in Richtung Damrongs Wohnung bewege, suche ich in einer Soi einen Straßenverkäufer mit Lotusgirlanden, Kreung Sangha Tan (Mönchskörbe voll hübscher Sachen wie Seife, Chips, Bananen, Zucker, Instantkaffee, die man erwirbt und für sein Lieblings-Wat spendet, um sich Verdienste zu erwerben), Glockenspielen, Bambusstühlen und Schnittblumen auf. Ich kaufe drei Girlanden, bringe sie in den Club, schmücke unseren gierigen kleinen Buddha damit und entzünde ein Räucherstäbchen, das ich pflichtschuldig zwischen den Händen halte, während ich ihn mit einem Wai bedenke, hoffend, dass ich genug getan habe, um den heutigen Tag unbeschadet zu überstehen.
Dann warte ich etwa eine halbe Stunde auf meine Mutter, bis diese in einem BMW mit getönten Scheiben eintrifft. Ihr Chauffeur lässt sie unmittelbar vor dem Club heraus und lenkt den Wagen dann auf einen Privatparkplatz in der Soi 23. In letzter Zeit ist sie ein bisschen fülliger geworden und trägt nun eher locker geschnittene, klassische Kleidung als knallenge schwarze Leggings und T-Shirts. Heute hat sie sich für einen langen Tweedrock mit dazu passendem Blazer (in donnerstäglichen Orangetönen) entschieden – hochklassige Klamotten, aber eindeutig für Damen mittleren Alters –, und für jede Menge Goldschmuck dazu. Sie ist der Inbegriff der konservativen Geschäftsfrau; man könnte sie gut und gern für eine Universitätsprofessorin halten. Ich begrüße sie mit einem Küsschen auf die Wange, während sie meine Versorgung des Buddha mit einem anerkennenden Nicken kommentiert, bevor sie sich an einen der Tische setzt und sich eine Marlboro anzündet.
»Der Club ist einfach zu altmodisch, Sonchai«, sagt sie mit einem Blick in Richtung der auf alt gemachten Jukebox mit ihren blinkenden Sternen sowie der Poster von Marilyn Monroe, Frank Sinatra, den Mamas & Papas, den Doors, den frühen Beatles und Stones. »Wir müssen was ändern, um attraktiver zu werden. Alle anderen Bars hat man renoviert, und im Fire House und Vixens tanzen die Mädchen nackt. Wir verlieren Kunden.«
Ich schüttle stirnrunzelnd den Kopf. Die Aussicht, auch hier bald nackt tanzende Mädchen auf der Bühne zu erleben, empfinde ich als einen Schritt auf die kalkulierte Ausbeutung zu. Meine Mutter, die meine Vorbehalte kennt, runzelt ihrerseits die Stirn.
»Die Zeiten ändern sich, Sonchai, und wir müssen uns anpassen. Die Bar ist eine wichtige Einnahmequelle für dich – von deinem Polizistengehalt allein könntest du nicht leben. Nimm endlich die rosa Brille ab. Neun von zehn Mädchen, die sich hier bewerben, wollen nackt tanzen, weil sie wissen, dass man so die Kunden fängt. Ein Mann, der sich nicht sicher ist, ob er bumsen, sich besaufen oder früh ins Bett gehen möchte, um seinen Jetlag loszukriegen, wird beim Anblick von Brustwarzen und Schamhaaren schwach. Der Westen erliegt seiner eigenen Heuchelei, und immer mehr Chinesen und Inder, die auf schnörkellose Action aus sind, suchen die Bars auf. Seien wir doch ehrlich: Die Mädchen sind zu arm, um sich Gedanken über Schicklichkeit zu machen.«
»Hast du denn keine Sorge, was aus uns wird, Chart Na?«
»Das nächste Leben bestimmt sich dadurch, wie großzügig wir in diesem sind und wie viel Mitgefühl wir zeigen, nicht dadurch, wie sehr wir uns den Mächten des Marktes unterwerfen.«
Ich weiß, dass sie recht hat, will aber im Augenblick nicht diskutieren, also reiche ich ihr die Schlüssel, sage ihr, wie viel Bier und Schnaps ich bestellt habe, und verabschiede mich wie ein artiger Sohn mit einem Küsschen von ihr. Erst draußen auf der Straße wird mir bewusst, wie mulmig mir ist vor dem zweiten Besuch in Damrongs Wohnung, und ich spiele mit dem Gedanken, meinen Assistenten Lek zu bitten, dass er mich begleitet. Doch am Ende unterdrücke ich dieses Gefühl und marschiere die Soi Cowboy entlang, wo gerade die mit Jeans und T-Shirts bekleideten Mädchen aus ihren Schlafräumen in den oberen Etagen auftauchen und sich hungrig über ihr Frühstück von den Ständen hermachen, die zu dieser Tageszeit die Straßen säumen.
An diesem Ende der Soi 23 befinden sich etliche Lokale, die sich am westlichen Geschmack orientieren, und zahlreiche Garküchen, die eher von Kunden mit einer Vorliebe für Isaan-Gerichte frequentiert werden; die meisten unserer Mädchen stammen aus dem armen Norden und gewöhnen sich nie an die Bangkoker Küche. Ein Stück weiter, hinter der indischen Botschaft, folgen hauptsächlich Wohnhäuser, manche davon im Hinblick auf die Soi-Klientel erbaut. Das, in dem sich Damrongs Apartment befindet, wirkt jedoch eher sauber und sachlich und beherbergt offenbar Einheimische mittleren Einkommens. Dem Thai-Geschmack entsprechend, hat man sich bei der Gestaltung der Wachmannuniformen viel Mühe gegeben: weiße Jacke, purpurrote Schärpe, türkische Pluderhose, weiße Strümpfe, Lackschuhe und eine hübsche Kappe. Aufgrund dieser dem Selbstbewusstsein förderlichen Eleganz lässt sich der Mann an der Tür nicht allzu sehr von meiner Polizeimarke beeindrucken und notiert gemächlich die Nummer, bevor er einen gleichermaßen herausgeputzten Kollegen ruft, der mich in den zwölften Stock begleiten soll. Im Aufzug erklärt mir der Wachmann, warum die Wohnungstür einige Tage zuvor gewaltsam geöffnet wurde: Immer neue Männer, hauptsächlich Farang und Japaner, hatten sich an der Rezeption besorgt darüber geäußert, dass sie sie nicht erreichen könnten. Und normalerweise verschmähte sie solche geschäftlichen Gelegenheiten nicht.
Der Mann lässt mich mit einer Schlüsselkarte in die Wohnung, tritt aber selbst nicht ein. Es ist ihm nicht peinlich, seine Geisterphobie zu gestehen; vielmehr bedenkt er mich mit einem merkwürdigen Blick – liegt es an meinem Farang-Erbe, dass ich bereit bin, ganz allein über die Schwelle zu treten?
Sobald sich die Tür hinter mir schließt, empfinde ich das gleiche Gefühl der Trostlosigkeit, das sich bei meinem letzten Besuch einstellte. Natürlich war ich oft hier, als die Leidenschaft noch die Macht besaß, die weißen Wände rosig zu färben. Doch selbst in solchen Momenten fiel mir die Kargheit der Wohnung auf. Alle Prostituierten, die ich kenne, besitzen mindestens ein Kuscheltier – nur nicht Damrong. Und es findet sich auch kein einziges Foto von ihr in dem Apartment, was erstaunlich ist bei einer so schönen Frau.
Sie lag nackt auf ihrem Bett, mit einem leuchtend orangefarbenen, etwa einen Zentimeter dicken, tief in ihrem Nacken vergrabenen Seil; ich muss all meinen Mut zusammennehmen, um das Schlafzimmer zu betreten.
Erinnerungssplitter an wilden, hemmungslosen Sex wirbeln durch mein Gehirn; sie stehen in deutlichem Kontrast zu dem sterilen weißen Raum. Damrong war sehr reinlich und mochte den Schweiß und den Geruch des Sex letztlich nur dann, wenn sie sich darin verlor. An der gegenüberliegenden Wand hängt noch immer das Foto eines großen, angreifenden Elefantenbullen; dies ist das einzige Bild in der ganzen Wohnung. Als ich sie einmal nach dem Sex fragte, warum es sich an der Wand befinde, antwortete sie lachend und mit unverhohlenem Sarkasmus, das Tier erinnere sie an mich.
Ihre Grausamkeit fehlt mir nicht, aber dass es diesen unbeugsamen Geist nicht mehr gibt, ist ein Verlust für die Welt. Das leuchtend weiße Kissen liegt auf dem leuchtend weißen Laken, das zurückgeschlagen aussieht wie ein Verband. Sie liebte harte Betten, was bedeutete, dass die Matratze sofort nach dem Entfernen der Leiche wieder ihre ursprüngliche Form annahm. Keine Blumen, keine Tapete, kein Schmutz, kein Leben. »Der Hinweis liegt darin, dass es keine Hinweise gibt«, murmle ich, einer Zen-Anwandlung nachgebend, aber letztlich hat der Satz sogar seine Richtigkeit. Die Küche präsentiert sich noch makelloser als das Schlafzimmer. Als ich eine Schublade herausziehe, fällt mir ein, dass sie, die so viele Männer hier empfing, von allem nur ein Exemplar besaß: einen Löffel, eine Gabel, ein Paar Essstäbchen. Trotzdem war sie nicht geizig. Untypisch für eine Thai, zahlte sie ihre Mahlzeiten selbst, wenn wir ausgingen. Sie gab mir das Gefühl, mehr Geld zu haben als ich; ziemlich oft kam ich mir vor wie die Nutte.
Bei der Untersuchung des Türschlosses kann ich keine Spuren von Gewalteinwirkung entdecken. Als die Mörder die Leiche hierherbrachten – dazu war bestimmt mehr als eine Person nötig, benutzten sie offenbar Damrongs Schlüsselkarte. Aber wie gingen sie vor? Rollten sie sie in einen Teppich, oder schleiften sie sie aufrecht mit wie eine Betrunkene? Offenbar wurde mindestens einer der hübsch gekleideten Wachleute bestochen, damit er nicht so genau hinsah und auch bei der späteren Vernehmung stumm bleiben würde. Nein, das ist nicht der Tatort; ihre Leiche wurde zur Irreführung der Polizei hier deponiert. Ich schließe die Wohnungstür hinter mir, froh darüber, dass ich es geschafft habe, den Kontakt mit ihrem Geist zu vermeiden.
Der nächste Schritt ist ein Besuch bei Damrongs Familie. Sie stammte aus Isakit, dem ärmsten Teil der ärmsten Region Thailands im Nordosten, Isaan. Ich selbst bin nicht bereit für die Reise, aber die Pflicht gebietet, einen örtlichen Polizisten mit diesem Auftrag zu betrauen. Also weise ich die Vermittlung an, die Damrongs Heimatdorf nächstgelegene Polizeistation ausfindig zu machen. Nach einer Weile meldet sich am anderen Ende der Leitung eine schroffe ländliche Stimme. Der Mann weiß, dass ich von Bangkok aus anrufe, redet aber im örtlichen Dialekt, einer Unterart des Khmer, sodass ich ihn bitten muss, ins Thai zu übersetzen, doch darum drückt er sich elegant. Irgendwann gelingt es mir, ihm das Versprechen abzuringen, dass er einen Beamten zu Damrongs Mutter schickt. Laut Akten starb ihr Vater, als sie ein Teenager war. Sie hat einen jüngeren Bruder, der, soweit ich weiß, noch lebt. Eine Überprüfung der Datenbank ergibt, dass er vor zehn Jahren wegen Besitzes von und Handels mit Yaa Baa, das heißt Methamphetaminen, verurteilt wurde.
Wenn ich nichts über Damrongs Familiengeschichte wüsste, käme ich vielleicht auf die Idee, ihre Mutter zu einem Gespräch nach Bangkok einzuladen, doch während unserer kurzen Affäre erzählte Damrong mir etwas über sie, das ein solches Vorgehen unmöglich macht. Also beschließe ich, meine Ermittlungen mithilfe der Regierungsdatenbank fortzuführen, wofür ich die Genehmigung von Colonel Vikorn, dem Chef von District 8, einholen muss. Bislang habe ich ihn nur in groben Zügen über den Fall informiert, aber heute Morgen werde ich mich mit ihm treffen, denn donnerstags pflegen der Colonel und ich ein seltsames Ritual.
Nennen wir es eine Folge der Globalisierung. Wie bei vielen Thais (etwa dreiundsechzig Millionen, die paar Freaks wie ich nicht mitgezählt) war auch Colonel Vikorns Interesse an der westlichen Kultur früher, gelinde gesagt, ziemlich mau. Mit den Jahren jedoch, als er älter wurde und sein Methamphetamin-Kerngeschäft ihm immer lukrativere Exportverträge erschloss, wollte er mehr über seine Kunden erfahren und beauftragte mich, ihn über wichtige Tendenzen in Europa und den Vereinigten Staaten auf dem Laufenden zu halten, vor allem über die Preisentwicklung bei Yaa Baa im Straßenhandel der Großstädte. Irgendwann bestand meine Existenzberechtigung fast nur noch darin, das aufzuspüren, was die New York Times zu den Themen »Methamphetamine, Drogenbehörde, Drogenmissbrauch, Pornoindustrie« bot. Der Punkt »Porno« war dabei ursprünglich lediglich als Abwechslung zu den herzergreifenden Geschichten über die Kriminalisierung von drogensüchtigen Familien gedacht, die sich sonst durch Alkohol an den Rand des Abgrunds gebracht hätten. Nach einer Weile jedoch entwickelte Vikorn eine gewisse Faszination für die Pornografie. Er wollte immer mehr erfahren, und seit Kurzem ist er ganz wild darauf. Vor ein paar Tagen habe ich zufällig einen grandiosen Artikel im Archiv der New York Times gefunden. Ich weiß, dass Vikorn sich nicht sonderlich für den Fall Damrong interessiert, also muss ich ihn mit diesem Bericht auf die falsche Fährte locken.
»Hören Sie sich das an«, sage ich und fasse den Inhalt des Artikels kurz für ihn zusammen.
Der Colonel ist so begeistert, dass ich ihm den Text Wort für Wort übersetzen muss. Darin geht es um die Entwicklung der Pornografie innerhalb eines Jahrzehnts, in dem sie sich von einer anrüchigen Millionen-Dollar-Branche zu einer gewaltigen und folglich angesehenen Milliarden-Dollar-Industrie gemausert hat, vom Schmuddelpostkartenhandel über Videotheken und Postversand zu Downloads aus dem Internet. (Allein im Jahr 2000 wurden in den Staaten siebenhundert Millionen Hardcore-Porno-Videos oder -DVDs ausgeliehen – das sind genau zweieinhalb Filme pro US-Bürger, in denen im Schnitt zwei oder mehr Penisse eine entsprechende Anzahl von Mündern oder Vaginas penetrieren, was bedeutet, dass der Durchschnittsamerikaner 2000, als der Artikel erschien, mittelbar an nicht weniger als fünf Orgien teilnahm. Angeblich hat sich die Zahl seitdem mehr als verdoppelt. Und dabei sind noch nicht einmal die Statistiken für homosexuelle Pornografie berücksichtigt.) Mit anderen Worten: Auch konservative Unternehmen konnten sich dem Investitionsanreiz der Pornografie nicht mehr entziehen. Ähnlich wie die Internet-Wetten überdauerte sie im Wesentlichen das Zerplatzen der Dotcom-Blase, was beweist, dass ein Engagement in diesem Bereich praktisch nur Erfolg bringen kann.
Als ich mit meiner Übersetzung fertig bin, strafft Vikorn, sonst ein eher ziemlich lässiger sechzigjähriger Zyniker, die Schultern. Ihm scheint etwas Wesentliches aufgegangen zu sein. Plötzlich sieht er zehn Jahre jünger aus.
»Lies mir noch mal die Zahlen vor«, weist er mich an und fügt anerkennend hinzu: »Erstaunlich. Farangs sind ja noch durchtriebener als thailändische Polizisten. Soll das heißen, dass diese heuchlerischen westlichen Fernsehjournalisten, die sich immer so schrecklich über unsere Bordelle aufregen, den größten Teil ihres Lebens in Fünf-Sterne-Hotels verbringen, wo sie sich Pornos im Pay-TV ansehen?«
»Tja, die westliche Kultur basiert nun mal auf Heuchelei«, erkläre ich.
Doch Gangster von Vikorns Kaliber besitzen die Begabung, Gelegenheiten zu erkennen, wo gewöhnliche Sterbliche nur Dunkelheit sehen. Er schüttelt den Kopf, als wäre ich ein armer Trottel, der nicht in der Lage ist, einen Tausender aufzuheben, der vor ihm auf dem Boden liegt.
»Nein, auf Masturbation«, korrigiert er mich, reibt sich die Hände und nimmt die Pose eines Landschulmeisters ein. »Tja, worauf warten wir noch? Lass uns einen Film drehen.«
»Keine Chance. Das begreifen Sie nicht. In amerikanischen Pornos wimmelts vielleicht von Silikontitten und Lippenstift auf Schwänzen, die meisten Frauen haben Pickel auf dem Arsch, und die Schauspieler sind möglicherweise noch schlechter als die unseren« – ja, ich gebe zu, dass ich selbst hin und wieder in amerikanische Produktionen hineinschaue, genau wie du, Farang, oder? –, »aber die künstlerische Gestaltung ist erstklassig. Die Kameraleute wollten für gewöhnlich früher richtungweisende Arthouse-Filme machen. Sie benutzen Weitwinkel, Zoom, Schwenks, Überblendtechnik, Zeitlupe und Großaufnahmen von Körperteilen, wie man sie selber noch nicht gesehen hat. Das sind Vollblutprofis. Mr und Mrs Wichs aus Utah kaufen keine billigen Streifen, die irgendwo in einem Hinterzimmer an der Soi 26 mit ’ner Handycam gedreht wurden. Die sind Besseres gewohnt.«
Mein Herr und Meister reibt sich das Kinn, während er mich fragend mustert. »Was ist ein Arthouse-Film?«
Ich kratze mich am Kopf. »Das weiß ich auch nicht so genau. Ein Fachausdruck aus der Branche. Wahrscheinlich ein Film, der sich verkaufen soll, indem er vorgibt, nicht kommerziell zu sein.«
»Woher kenne ich denn diesen Satz?«
Ich will seine Frage gerade beantworten, als mir klar wird, wie weit voraus der Colonel mir wieder einmal ist. Wir wechseln einen Blick.
»Yammy«, sage ich. »Aber der wartet im Gefängnis auf sein Verfahren, bei dem er zum Tod verurteilt wird, dafür wollen Sie doch sorgen.«
Vikorn hebt Hände und Schultern. »Was bedeutet, dass jetzt der beste Augenblick wäre, ihm einen Deal anzubieten, oder?«
Resigniert akzeptiere ich, dass ich jede Möglichkeit verspielt habe, heute im Fall Damrong weiterzukommen. Sorry, Farang, ich fürchte, ich muss abschweifen.
5
Als der in diesem Fall zuständige Beamte habe ich die gesamte Yammy-Akte im Kopf. Auf der Taxifahrt nach Lard Yao gehe ich gedanklich die Fakten durch.
Yammy stammt aus einer Familie der unteren Mittelschicht in Sendai; sein Vater war Salaryman für Sony, seine Mutter eine traditionelle japanische Hausfrau, die höllisch gute Walfischsteaks mit Seetang kochte. In jungen Jahren wurde Yammy stark geprägt von den Sony-Kameraprototypen, die sein Vater mit nach Hause brachte. Schon kurz nach dem Gehen lernte er den Umgang damit, meisterte dafür aber nie wirklich die Kunst der verbalen Kommunikation. In einer introvertierten Kultur wie der japanischen spielte das keine große Rolle, aber leider beherrschte er auch den geschriebenen Ausdruck nicht sonderlich gut. Doch egal: Sein Vater, der sich der deprimierenden Folgen eines angepassten Lebens nur zu bewusst war, erkannte etwas Geniales im Unvermögen seines Sohnes. Unter großen Opfern brach die Familie ihre Zelte ab und zog nach Los Angeles um, wo Yammys Mangel an schulischer Bildung nicht weiter auffiel und sein Vater ihn so bald wie möglich auf die Filmhochschule schickte. Alles lief gut bis zu einem Ausflug nach San Francisco, wo Yamahato senior als erster Tourist seit zwei Jahrzehnten von einer Straßenbahn überrollt wurde. Yammys Mutter investierte das Geld von der Lebensversicherung in die weitere Ausbildung ihres Sohnes, weigerte sich aber, noch eine Minute länger in Amerika zu bleiben. Auch ohne seine Mutter und ihre köstlichen Seetang-Walfischsteaks gelang es Yammy dank seiner fotografischen Begabung bald, sich als Kameramann in Hollywood einen Namen zu machen.
»Super«, lobte sein Lieblingsregisseur ihn. »Du besitzt diesen asiatischen Blick fürs Detail, dein Ego behindert die geschäftliche Seite nicht, und du hast ein Gefühl für künstlerische Perfektion. Du wirsts noch zu was bringen in der Werbung.«
»Ich will aber nicht in die Werbung«, erwiderte Yammy. »Ich möchte einen Spielfilm drehen.«
Der Regisseur, der früher – wie der erste, zweite und dritte Kameramann, der Oberbeleuchter, der Tontechniker und der Kabelhelfer – ebenfalls Spielfilme hatte machen wollen, schüttelte traurig den Kopf. »Tja, das ist nicht so einfach, Junge«, erklärte er. »Und sonderlich viel mit Talent hat es auch nicht zu tun.«
Das wusste Yammy bereits. Würden die Studios Jahr für Jahr den gleichen Schrott produzieren, wenn Talent wichtig wäre? Nun, manchmal gelang sogar in Hollywood etwas richtig gut, aber Yammy interessierte der amerikanische Markt nicht; er wollte nach Japan zurückkehren, sobald er seine Fähigkeiten perfektioniert hätte. Seine Vorbilder waren Akira Kurosawa, Teinosuke Kinugasa, Sergei Eisenstein, Vittorio De Sica, Ingmar Bergman und Luis Buñuel – Kinogenies, von denen die meisten Leute in Hollywood noch nie etwas gehört hatten, nicht einmal auf der Filmhochschule. Und Yammy ahnte, dass seinem Erfolg in Kalifornien ein weiteres, vermutlich unüberwindliches Hindernis im Weg stand. Schließlich drehten er und sein Team zu der Zeit gerade in Kolumbien einen Werbespot für Parfüm, den man genauso billig und sehr viel einfacher auf einem Berg in Colorado hätte machen können. Wie Yammy es in einem Fax an einen Freund in Sendai ausdrückte: »Erstens schnupfe ich kein Kokain, zweitens nehme ich kein Koks, drittens ist mir Schnee schnuppe. Alle hier halten mich für einen FBI-Spitzel.«