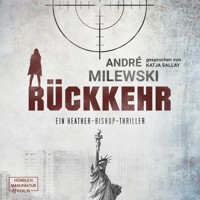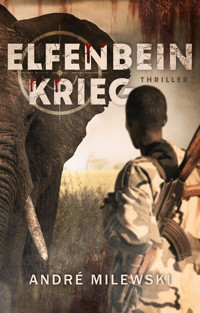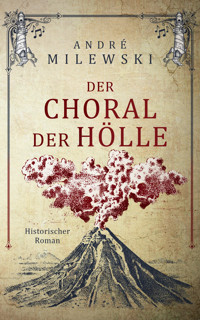
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1883 will Leonhard Mahler im weit entfernten Java sein Glück finden – wie viele andere Europäer sucht er den schnellen Reichtum. Leonhards Onkel lebt bereits in der niederländischen Kolonie, doch er ist nicht der ehrbare Geschäftsmann, für den sein Neffe ihn hält … Dagegen versucht Femke, die Tochter eines niederländischen Kolonialbeamten, fortzukommen von diesem Ort und löst dabei einen Skandal in der Gesellschaft von Javas Hauptstadt Batavia aus. Und dann ist da noch Bimo, ein junger javanischer Taschendieb, der davon träumt, irgendwie nach Europa zu gelangen. Doch all ihre Pläne, Wünsche und Hoffnungen rücken plötzlich in den Hintergrund, als eine Katastrophe über sie und ihre Welt hereinbricht. Jetzt geht es nun nur noch um eines: überleben! Eine packende Geschichte, vor dem Hintergrund der größten Naturkatastrophe des letzten Jahrtausends. Ein Roman über ein Ereignis, das die Welt veränderte. Nominiert für den Selfpublishing-Buchpreis 2021!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
DER CHORAL DER HÖLLE
ANDRÉ MILEWSKI
INHALT
Prolog
1. Der Aufbruch
2. Große Pläne
3. Der neue Posten
4. Glücksgefühle
5. Frei atmen
6. Neue Partnerschaft
7. Arrest
8. Geschäftsmänner
9. Suezkanal
10. Weißes Meer
11. Fleisch
12. Der Eklat
13. Schwarze Sonne
14. Der Vulkan am Ende der Welt
15. Der zerbrochene Teller
16. Fremd
17. Nachbeben
18. Familienzusammenführung
19. Verstoßen
20. Rosige Perspektiven
21. Fahrt zum Feuerberg
22. Der Auftrag
23. Ergebnisse und Schlussfolgerungen
24. Cargo
25. Zahltag
26. Geliefert
27. Endlich frei
28. Welch ein Zirkus!
29. Ein neues Schiff
30. Der Anfang vom Ende
31. Experten
32. Abaddon
33. Verderben
34. Unzerstörbar
35. Niedergang
36. In der Pflicht
37. Ausklang
38. Bestandsaufnahme
39. Abschied
Coda: Das Kind
Personenregister
Fakten & Fiktion
Über den Autor
Nachwort
Copyright © 2021 André Milewski
www.andre-milewski.de
Verlag: André Milewski
c/o WirFinden.Es
Naß und Hellie GbR
Kirchgasse 19
65817 Eppstein
Umschlaggestaltung:
© Giessel Design
www.giessel-design.de
unter Verwendung von Stockbildern von Shutterstock
Karte: © André Milewski
Korrektorat: SKS Heinen
1. Auflage
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
»Geht nach Ostindien; und von dort, ihr wisst,
kehrt von drei Männern einer nur zurück!«
DER ZERBROCHENE KRUG VON HEINRICH VON KLEIST
PROLOG
BATAVIA, HAUPTSTADT VON NIEDERLÄNDISCH-INDIEN, 1680
Nachdem das Beben nachgelassen hatte, rannte Pieter van Vlekke sofort aus dem Rathaus ins Freie und hielt geradewegs auf die Unterstadt zu.
»Mijnheer! Warten Sie, es ist zu gefährlich«, rief ihm einer der feigen Ratsdiener noch hinterher, aber Pieter beachtete die Warnung nicht. Seine Sorge galt den drei Schiffen der VOC, die erst am Morgen im Hafen festgemacht hatten und jetzt mit Sicherheit in der aufkommenden Panik der Einheimischen in Gefahr liefen, geplündert zu werden. Pieter war seit sechs Jahren Gouverneur im Kirchhof Europas, wie Batavia spöttisch aufgrund der hohen Sterblichkeit der Kolonisten genannt wurde, und in dieser Zeit hatte er vor allem gelernt, dass den dreckigen, ungebildeten Menschen, die früher Anspruch auf dieses Land erhoben hatten, alles zuzutrauen war. Schnell erreichte er die Festungsmauer, die das gesamte Verwaltungsviertel der Stadt umgab. Auf den Türmen, die in gleichmäßigen Abständen verteilt waren, konnte er die ängstlichen Blicke der Gardisten sehen. Vereinzelt zogen sich frische Risse durch das Mauerwerk, verursacht durch das Beben.
Das Haupttor stand offen, wie immer um diese Tageszeit. Auch wenn das Areal immer noch im geschützten Bereich lag, hatte es schon seit Jahren keine Aufstände oder Angriffe mehr gegeben. Die Javaner hatten sich mit dem Herrschaftsanspruch der VOC abgefunden. Gleichwohl kam es vor der Mauer immer noch zu vereinzelten Übergriffen auf die nicht einheimische Bevölkerung, zu der außer den herrschenden Niederländern auch eine große Anzahl von Chinesen und Mardijker gehörten. Aber als Pieter jetzt aus dem Tor durch die Straßen der Unterstadt lief, an der Tigergracht entlang, gab es in dieser Hinsicht nichts zu befürchten. Überall sah er verängstigte und verwirrte Menschen, die vor ihren Häusern und Geschäften standen oder kauerten. Sie warfen ihm überraschte Blicke zu, als er in hohem Tempo an ihnen vorbeilief. Einen rennenden Niederländer sah man in Batavia so häufig wie eine Schneeflocke. Aus gutem Grund, denn Pieter lief in der brütenden, feuchten Hitze der Schweiß bereits in Strömen über das Gesicht und den Rücken, doch er achtete nicht darauf. Über die Dächer hinweg konnte er bereits die hochaufragenden Masten der Schiffe der Ostindien-Kompanie sehen, die sich nur ganz sachte hin und her bewegten.
Schließlich erreichte er Sunda Kelapa, das Hafenviertel, in dem ihn ein bestialischer Gestank in Empfang nahm. Er wusste nur zu gut, woher diese Ausdünstungen herrührten und sein Blick ging zu den Kanälen, die parallel zur Straße verliefen. In dieser Kloake badeten die Einwohner der Unterstadt und nahmen ihre Waschungen vor. Pieter hatte schon oft vergeblich versucht, die Menschen davon abzuhalten, weil die Kanäle als Abwasserleitungen der Oberstadt dienten und die Einwohner somit in einer Jauche aus Fäkalien und anderen menschlichen Ausscheidungen planschten. Doch diesmal waren die Kanäle frei von Badenden. Stattdessen drängte eine große Anzahl von ihnen zur Pier, wo sich einige Soldaten der VOC aufgebaut hatten und versuchten, die Menge daran zu hindern, an Bord der Schiffe zu gelangen.
Ich bin keine Sekunde zu früh hier, dachte Pieter. Bitte Herr, lass jetzt keinen Schuss fallen!, schickte er ein innerliches Stoßgebet gen Himmel.
Doch sein frommer Wunsch wurde nicht erhört. Ein Arkebusenschuss krachte laut donnernd über den Anleger und Pieter sah, wie einer der Einheimischen zusammenbrach. Wie tollwütige Hunde sprangen die Einheimischen auf den Schützen los, begruben ihn unter ihren Leibern und schlugen wie wild auf ihn ein. Ehe einer seiner Kameraden feuern konnte, brüllte Pieter, so laut er konnte: »Aufhören! Seid ihr denn alle wahnsinnig? Lasst ab von ihm!«
Tatsächlich reagierten die Menschen. Sie gaben den Soldaten frei, der aus vielen Wunden blutete, und wichen einige Schritte zurück. Mit großen Augen sahen sie ihn an, wie er schnaufend dastand, seine feinen Gewänder von dem Lauf durch die schmutzigen Straßen völlig verdreckt und mit schweißnassem Haar, das an seinem Kopf klebte. Währenddessen zogen die anderen Soldaten der VOC ihren verletzten Kameraden auf die Beine und führten ihn fort von der aufgebrachten Menge, vor der Pieter jetzt alleine stand – vor seinen Füßen der tote Leib des Mannes, der von dem Schuss getroffen worden war.
Die Einheimischen, zumeist Fischer, murmelten verwirrt untereinander und wichen einige Schritte zurück. Sie achteten ihn, dessen war er sich bewusst. Aber er war sich nicht sicher, ob dieser Respekt reichte, um einen Aufstand zu verhindern.
»Mijnheer, Sie müssen uns helfen!«, sprach ihn einer der Fischer an, ein ziemlich alter Mann mit nur noch wenigen grauen Haaren auf dem Schädel. Pieter erkannte ihn. Er hieß Satria und war früher eine Art Sultan gewesen, ehe auch sein Volk sich der VOC beugen musste. »Wir müssen Orang Alijeh besänftigen, ehe er uns alle in den Tod schickt!« Die Stimme des Alten zitterte.
»Wen müssen wir besänftigen?« Pieter blickte irritiert in die Augen des Mannes.
»Ihr habt es doch auch gespürt, Mijnheer. Die Erde hat gebebt! Orang Alijeh ist erwacht und er ist zornig!«
»Wer in Namen des Herrn ist Orang Alijeh?«, fragte Pieter.
»Er ist der Gott des Vulkans! Und wenn er zornig ist, bebt die Erde und er speit Feuer aus seinen Nüstern!«
»Rede doch keinen Unsinn.«
»Kein Unsinn, Mijnheer. Orang Alijeh ist wütend, weil immer mehr fremde Eindringlinge in das Reich seiner Kinder einfallen.«
»Du meinst Eindringlinge wie mich?«, fragte Pieter mit scharfer Stimme.
Satria nickte ruhig.
»Abergläubischer Humbug! Sieh dich doch um, keiner der Vulkane hier auf der Insel zeigt ein Zeichen von Aktivität.« Pieter drehte sich um und wies mit der Hand ins Landesinnere, wo sich mächtige Bergkuppen in den Himmel erhoben.
»Nicht hier, Mijnheer. Es war auf Pulau Krakatau.«
»Krakatau? Das liegt in der Sundastraße, weit von hier entfernt. Das ist nicht …« Er verstummte. Sein Blick folgte der Hand des Alten, der nach Westen deutete. Dort sah Pieter eine tiefschwarze Rauchsäule in den Himmel aufsteigen.
»Wir müssen dorthin, um Orang Alijeh ein Opfer darzubringen!«
Pieter zögerte und sah in die Gesichter der Einheimischen, die ihn erwartungsvoll ansahen. Er war sich bewusst, dass es keinen Gott des Vulkans gab, aber ebenso wusste er, dass man den Glauben der Menschen hier nicht mit einigen Worten beikommen konnte. Sein Blick ging zu einem der Soldaten der VOC.
»Sagen Sie dem Kapitän Bescheid, dass wir mit einem der Schiffe auslaufen werden!«
»Aber …«
»Keine Widerrede!«
Nach einer knappen halben Stunde befand sich Pieter gemeinsam mit dem alten Fischer und drei weiteren Einheimischen an Bord der Zijp, dem kleinsten und schnellsten der drei Schiffe der VOC. Er hatte Kurs auf die Sundastraße befohlen, die direkt zwischen Sumatra und Java, den beiden großen Hauptinseln von Niederländisch-Indien verlief. Der Kapitän, ein mürrischer Mann mit großem Backenbart, war nicht begeistert gewesen von seinem Befehl. Aber er fügte sich. Sie machten gute Fahrt und schon nach wenigen Stunden bogen sie in die Meerenge. Als ihr Schiff unweit der Küste Javas entlang segelte, konnte Pieter zahlreiche Menschen am Ufer der Hafenstadt Anjer stehen sehen. Ihre Blicke waren auf die mächtige Rauchsäule gerichtet, der sie nun entgegenfuhren.
»Er ist sehr wütend«, murmelte Satria neben ihm, je näher sie der Insel Krakatau kamen, die sich in beinahe zentraler Lage in der Sundastraße befand.
Schließlich tauchte die Insel auf und Pieter nahm sich sofort ein Fernrohr. Als er hindurchblickte, sahen seine Augen ein flammendes Inferno. Aus dem Gipfel des höchsten Berges der Vulkaninsel, der spitz aufragte, schlugen Flammen und glühende Lava wälzte sich die Hänge hinab. Sie setzte den Urwald, der sich rings um den Berg befand, in Brand. Eine riesige Wolke aus schwarzem Rauch türmte sich auf und verdunkelte die Sonne.
»Herr im Himmel«, entfuhr es Pieter entsetzt.
»Wir müssen auf die Insel«, sagte der Alte neben ihm mit Entschlossenheit. »Nur dort können wir Orang Alijeh besänftigen.«
»Unmöglich. Das ist Wahnsinn. Niemand kann jetzt einen Fuß auf die Insel setzen!«
»Wenn wir es nicht tun, wird es ein großes Unglück geben, Mijnheer.«
Pieter blickte zweifelnd in Richtung des Vulkaneilands, das komplett in Flammen zu stehen schien. Er schüttelte mit dem Kopf.
»Wir können dort nicht hin.«
»Aber wir müssen. Noch ist Zeit. Spürt Ihr es nicht? Orang Alijeh ruht nur kurz, er wird sich erneut erheben, viel schrecklicher als zuvor. Und dann wird nichts und niemand vor seinem Zorn sicher sein.«
»Es ist ein Vulkan«, brüllte Pieter den Alten an. »Wie wollt Ihr einen Vulkan besänftigen?«
»Für Euch mag es nur ein Vulkan sein, Mijnheer. Aber wir leben seit Generationen hier. Wir kennen unsere Götter. Bringt mich an den Strand der Insel und Ihr werdet sehen. Im Gegenzug verspreche ich Euch, dass mein Volk keinerlei Aufruhr starten wird, solange Ihr in der Burg seid.«
Pieter verschlug es für einen Moment die Sprache, als Satria ihn mit seinen Worten unverhohlen mit Aufstand drohte. Sein Blick wanderte erneut zum Krakatau. Er überlegte.
Soll der Alte doch zum Vulkan fahren. Vielleicht verbrennt er dort. Aber wenn nicht, könnte ich die nächsten Jahre ohne Störungen regieren. Immerhin habe ich sein Wort.
Schließlich nickte er.
»Also gut. Wir werden so dicht wie möglich heranfahren, den letzten Rest der Strecke müssen deine Leute und du mit dem Ruderboot zurücklegen.«
Der Kapitän brachte die Zijp so dicht an die Insel heran, wie er es verantworten konnte. Die Besatzung ließ eines der Beiboote zu Wasser, in dem Satria und seine drei Begleiter saßen. Die Javaner ruderten auf den Strandabschnitt am westlichen Ende der Insel zu, der noch unbehelligt von der Lava war.
»Die sind doch verrückt«, sagte der Kapitän kopfschüttelnd, der neben ihm stand. »Und wir ebenso, dass wir uns so dicht an dieses Inferno heranwagen!«
»Keine Sorge, sobald es ein Anzeichen einer Gefahr für das Schiff gibt, werden wir davonsegeln – egal, ob die Einheimischen wieder zurück sind oder nicht.« Pieter sah dem Ruderboot hinterher. Kurz spielte er mit dem Gedanken, einfach jetzt schon den Befehl zum Abdrehen zu geben. Mit dem Wind kam der Geruch von Schwefel herüber. Er zückte sein Taschentuch und hielt es sich vor Mund und Nase.
Aber abgesehen von dem beißenden Geruch und einem leichten Aschefall geschah nichts. Mit dem Fernrohr beobachtete Pieter, wie das Ruderboot mit den vier Männern unbeschadet den Strand erreichte. Satria sprang als Erster und Einziger heraus und rannte an Land. Dort fiel er auf die Knie und vergrub sein Gesicht im Sand. So verharrte er eine gefühlte Ewigkeit, ehe er sich wieder erhob. Als er sich wieder aufgerichtet hatte, zog er sich die Kette um seinen Hals über den Kopf. Er rief einige Worte, dann schleuderte er den Anhänger, so weit er vermochte, auf den Strand, bis zu den ersten Ausläufern des dichten Urwalds. Dann kehrte er zurück zum Boot.
Mit skeptischem Blick betrachtete Pieter den Alten, als dieser mit seinen Begleitern wieder zurück an Deck der Zijp kam.
»Ist Orang Alijeh jetzt besänftigt?«, fragte er mit spöttischem Unterton.
»Ja. Er hat das Opfer akzeptiert«, erwiderte Satria zufrieden. »Wir werden nichts mehr zu befürchten haben.«
»Gut. Und ich hoffe, du hältst dein Versprechen, das du mir gegeben hast.«
»Es wird genauso geschehen. Wir werden Frieden haben.«
Sie kehrten zurück nach Batavia. Die dunkle Rauchfahne, die aus dem Krater des Vulkans emporstieg, verblasste in den kommenden Tagen und schon bald war jegliche Erinnerung in den Köpfen der Menschen daran verschwunden. Wie Satria es gesagt hatte, gab es von nun an für Pieter van Vlekke einen Grund weniger, sich Sorgen zu machen. Die einheimische Bevölkerung begehrte nicht mehr auf und fügte sich in ihr Los. Unter Pieters Führung blühte Batavia auf und Stück für Stück vergrößerte sich die Stadt – und mit ihr auch der Einflussbereich der VOC auf Java. Bald legte Batavia auch den ungeliebten Beinamen als Kirchhof Europas ab und wurde stattdessen Königin des Ostens genannt. Von der Insel Krakatau hörte Pieter den Rest seines langen Lebens kein einziges Grollen mehr.
DER AUFBRUCH
HAMBURG, 22. APRIL 1883
Im Hafen wehte eine frische Brise und sie trug den verheißungsvollen Duft von Freiheit und Abenteuer in sich. Leonhard Mahler schloss die Augen und holte tief Luft, ehe er seinen Seesack schulterte und sich durch die Menschenmengen, die sich über die Landungsbrücken schoben, hindurchzwängte. Die Sonne stand hoch am Himmel und es war ein wunderschöner Frühlingstag. Aber das war nicht der einzige Grund, der so viele Menschen in den Hafen getrieben hatte. Die Piers waren voll belegt mit riesigen Segelschiffen, Dampfern und Frachtern aus Übersee. Die Schauerleute entluden die Frachträume und die begehrten Waren aus aller Herren Länder wurden teilweise sofort an Ort und Stelle verkauft. Leonhard war noch nie in seinem Leben aus Norddeutschland herausgekommen, aber genauso stellte er es sich auf einem orientalischen Basar vor, der in den Büchern von Karl May, die er so gerne las, wortreich beschrieben wurde.
Aber es gab auch noch einen anderen Grund, weswegen sich hauptsächlich junge Männer seines Alters heute im Hafen aufhielten. Denn viele Schiffe tauschten auch einen Teil ihrer Besatzungen aus und hatten demzufolge Bedarf an neuen Matrosen. Vor beinahe jedem größeren Schiff waren aus diesem Grund Werber unterwegs. An Tagen wie heute mussten sie nicht weit gehen, um neue Fahrensmänner zu finden. Im Gegenteil, sie hatten jetzt die freie Wahl und konnten die am besten geeignetsten Männer heraussuchen.
Leonhard hatte den anderen Bewerbern aber etwas voraus: eine feste Zusage. Zufrieden blickte er auf den Zettel in seiner Hand und hielt dann Ausschau nach dem Schiff, auf dem ihn der Decksmeister schon erwartete. Nach einer Viertelstunde des Suchens erblickte er endlich den gewaltigen grün-weißen Rumpf der India, eines imposanten Segeldampfers. In der Mitte des Stahlrumpfes erhob sich ein riesiger Schornstein, der jedoch von den vier Masten, über die das Schiff ebenfalls verfügte, noch überragt wurde. Die India war eines der größten und schnellsten Passagierschiffe, die auf der Route zu seinem Zielort unterwegs waren. Vor einem Fallreep, über das sich die Passagiere an Bord begaben, konnte Leonhard einen Mann in einer blauen Offiziersuniform sehen, der gemeinsam mit einem Matrosen dastand und die neuen Crewmitglieder anwarb. Mit pochendem Herzen begab er sich zu ihm. Gleich würde er sein Ziel, Hamburg endlich zu verlassen und in Batavia ein neues Leben zu starten, erreichen.
»Alles klar, dann an Bord mit dir, mein Junge«, brummte der Offizier gerade einem Bewerber zu, der daraufhin mit freudestrahlendem Gesicht über das Fallreep an Bord kletterte.
Dann war Leonhard an der Reihe.
»Guten Tag, Herr Deckoffizier, mein Name ist …«
»Hast du einen Besenstiel verschluckt, Junge?«, blaffte ihn der erfahrene Seemann an. »Hier wirst du keinen Preis für gute Manieren gewinnen, das sage ich dir gleich. Außerdem bin ich Oberdeckoffizier. Also, was willst du?«
»Ich …« Leonhard stockte und streckte dann einfach seine rechte Hand mit dem Papier aus.
Der Offizier nahm das Schreiben entgegen und warf einen prüfenden Blick darauf.
»Schlechte Nachrichten, Kleiner. Unser alter Decksmeister ist nicht mehr an Bord, er ist in Ceylon besoffen über die Reling gekippt.« Der Matrose hinter dem Anwerber lachte lauthals. »Ich habe also keine Verwendung für dich.« Mit diesen Worten drückte er Leonhard den Zettel zurück in die Hand. »Der Nächste!«
»Aber hier steht, dass eine Stelle für mich frei gehalten wird«, protestierte Leonhard und machte keine Anstalten, beiseite zu gehen und dem Mann hinter sich Platz zu machen.
»Hörst du schlecht? Wir haben keine Verwendung für dich, also verpfeif dich!« Der Matrose machte einen Schritt auf ihn zu und sah ihn mit grimmiger Miene an.
Leonhard beachtete ihn nicht und sah an ihm vorbei zum Offizier.
»Ich bitte Sie, ich muss auf dieses Schiff. Sie haben doch bestimmt etwas für mich zu tun. Egal was. Ich übernehme jede Aufgabe!«
»Hau ab!« Der Matrose stieß ihn hart weg. Leonhard taumelte einige Schritte zurück und landete auf seinem Hosenboden. Alle Männer um ihn herum lachten.
Er rappelte sich wieder auf und ging erneut auf den Matrosen zu.
»Was denn, noch nicht genug?«, sagte dieser breit grinsend und ballte erwartungsfroh die Fäuste.
Da legte sich eine Hand auf Leonhards Schulter.
»Lass es gut sein, Junge.« Er blickte zur Seite und sah in die tiefblauen und von tiefen Falten eingerahmten Augen eines Mannes, der mehr als doppelt so alt war wie er. »Du wirst dir nur eine Tracht Prügel einfangen.«
Leonhard zögerte einen Moment, warf noch einen Blick auf den grobschlächtigen Matrosen mit dem fiesen Grinsen im Gesicht und nickte dann dem alten Seebären zu. Danach sah er wie vor den Kopf geschlagen zu, wie viele der anderen Männer an Bord der India gehen durften. Einer nach dem anderen kletterte das Fallreep hinauf, sogar der ältere Kerl, der ihn eben vor Schlimmeren bewahrt hatte. Schließlich stand er ganz alleine auf der Pier und fühlte sich den Tränen nahe.
Der Deckoffizier blätterte in einer Kladde in seiner Hand und legte dann die Stirn in Falten. Er sagte etwas zu dem Matrosen, der nur mit den Schultern zuckte. Dann legte sich sein Blick auf Leonhard.
»Möchtest du immer noch mitfahren, Junge?«
»Ich … ja, natürlich, Herr Oberdeckoffizier!« Sofort machte Leonhard einen großen Satz nach vorne. »Ich kann …«
»Still.« Der Offizier musterte ihn streng und fasste ihn dann an seinen rechten Oberarm. »Ziemlich schlaff. Hast du schon mal hart gearbeitet?«
Leonhard nickte eifrig. »Jawohl, Herr Oberdeckoffizier, das habe ich. Sogar sehr hart.«
Der Seemann warf ihm einen mitleidigen Blick zu, schlug dann erneut seine Kladde auf und zog einen Stift aus der Tasche.
»Name?«
»Leonhard Mahler, Herr Oberdeck…«
»Spar dir den Scheiß«, fuhr ihm der Matrose über den Mund. »Mach, dass du an Bord kommst!« Er deutete auf das Fallreep.
Leonhard zögerte kurz und sah den Offizier an, der mit seiner Eintragung fertig war und ihm zunickte. Sofort eilte Leonhard zum Fallreep und kletterte daran empor auf das Deck, wo sich die mindestens zwanzig neuen Besatzungsmitglieder bereits in einem Halbkreis um eine Gruppe von weiteren Offizieren der India aufgestellt hatten. Er stellte sich dazu.
»Dich hätte ich hier nicht mehr erwartet.« Mit erstauntem Gesicht sah ihn der Seemann von eben an und lächelte.
»Man sollte mich eben nicht unterschätzen«, gab Leonhard grinsend zurück.
»Das sehe ich. Ich bin Tjark.« Der Mann streckte ihm die Hand entgegen.
»Freut mich. Ich heiße Leonhard Mahler.«
Hinter ihm kamen auch der Offizier und der Matrose an Deck. Der Oberdeckoffizier stellte sich in die Mitte und brüllte dann mit lauter Stimme jeweils einen Namen und die Station, die dieser zugeteilt wurde. Die anderen Männer in Uniform, Offiziere und Unteroffiziere, nahmen die neuen Freiwilligen dann in Empfang und verschwanden mit ihnen, sobald die Abteilung vollzählig war. Leonhard betrachtete währenddessen das Schiff. Es war noch schöner, noch gewaltiger, als er sich in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hatte. Auch wenn es bereits über eine Dampfmaschine verfügte, so war die Takelung an den vier Masten wie bei einer normalen Bark vorhanden.
»Mahler!«
Leonhard bekam einen Stoß in die Seite.
»Er meint dich«, flüsterte ihm Tjark ins Ohr.
»Hörst du schlecht?«, schrie ihn der Oberdeckoffizier an. »Los, mach, dass du zu deiner Abteilung kommst.«
»Viel Glück«, raunte Tjark ihm zu, als er den Seesack schulterte und losging. »Du wirst es brauchen.«
Leonhard ging mit drei weiteren Männern einem Bootsmann hinterher, der sie ohne ein Wort des Willkommens sofort unter Deck führte. Auch die anderen sagten nichts, was bei Leonhard für ein mulmiges Gefühl sorgte. Sie stiegen immer tiefer in den Bauch des Schiffes hinab, bis sie zu einer massiven Stahltür kamen. Der Bootsmann öffnete das Luk mit seinen schwieligen und ölverschmierten Händen, die Leonhard erst jetzt auffielen. Aus der offenen Tür strömte ihnen der Geruch von Kohle und Asche entgegen, an dem nichts verheißungsvoll war. Er sah einen riesenhaften Ofen, dessen enormen Ausmaße nur erahnen ließen, was für eine Hitze er imstande war auszustrahlen.
»Willkommen im Kesselraum!«
Der Dunst von Beschränkung und Schweiß umschloss ihn.
GROSSE PLÄNE
BATAVIA, EINE WOCHE SPÄTER
Mit glänzenden Augen beobachtete er die Szenerie. Der Markt ganz in der Nähe des Hafens Tjandjong Priok war der beste Ort der Welt. Egal, was alle anderen sagten. Hier war noch das alte Batavia zu sehen, die ursprüngliche Atmosphäre. Auch wenn es von den Kolonialherren abfällig als benedenstad – Unterstadt – bezeichnet wurde. Sollten die sich bloß von hier fernhalten und in ihrer Oberstadt glücklich werden. Er würde immer das alte Batavia vorziehen. Hier gab es alles, was das Herz begehrte. Außerdem waren der Trubel und die schier unglaubliche Menge an Menschen, die sich quälend langsam an den Ständen vorbeischoben, eine Einladung, der kein Taschendieb der Welt widerstehen konnte. Vor allem die Besucher aus dem fernen Europa waren ein allzu leichtes Ziel, aber ebenso die Asiaten, die interessiert an den Gewürzständen standen und sich minutenlang mit dem Händler unterhielten und versuchten, ihm kostenlose Proben abzuschwatzen. Bei den Arabern hingegen musste man auf der Hut sein, sie verfügten quasi über einen Extrasinn, der nur bei Taschendieben anschlug. Einen Araber zu bestehlen, galt daher als die Königsdisziplin. Die Einheimischen waren tabu, das verstand sich von selbst. Doch gerade an diesem Morgen war ein weiteres Passagierschiff aus Europa angekommen und nun strömten die Reisenden auf den Markt. Es waren Deutsche, Niederländer, Franzosen und Spanier darunter. Gut betuchte Leute, denen es nicht wehtat, wenn ein praller Geldbeutel mehr oder weniger in ihrem Reisegepäck wäre. Es war einfach, aber nicht ohne Risiko. Denn die Kolonialherren schickten an Tagen wie heute die doppelte Anzahl von Polizisten auf den Markt, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Doch selbst das war heute kein Problem.
Bimo drehte den Kopf zur Seite und sah seine Begleiterin an.
»Was meinst du? Sollen wir anfangen?«
Femke schüttelte den Kopf und ihre blonden Haare flogen ihr dabei über das Gesicht. Sie strich sich die Strähnen zur Seite.
»Lass uns abwarten, bis die Streife da vorne in die nächste Gasse einbiegt.« Sie reckte ihr Kinn ein Stück nach vorne in Richtung der zwei Männer in der dunkelblauen Uniform, die mit argwöhnischen Blicken durch die Gänge des Marktes schritten.
»Ganz wie Sie meinen, Prinzessin«, erwiderte Bimo schulterzuckend und grinste, als Femke ihn mit einem bitterbösen Blick bedachte. Sie hasste es, wenn er sie Prinzessin nannte, obwohl sie in seinen Augen genau das war. Immerhin war sie die Tochter eines hochrangigen Beamten der Stadt, der zwar nicht adlig war, in einem Ort wie Batavia diesem Ideal jedoch recht nahekam. Außerdem sah Femke genauso aus, wie Prinzessinnen in den Märchenbüchern aus Europa beschrieben wurden. Sie war blond, hatte eine blasse Haut und ihre Gesichtszüge waren dermaßen fein und anmutig, dass alleine ein Blick aus ihren blauen Augen ausreichte, um die Knie der Männer zum Schlottern zu bringen. Bimo liebte die Märchen aus Europa. Seine Nenek hatte als Kindermädchen bei verschiedenen niederländischen Familien gearbeitet und von dort viele Märchenbücher mit nach Hause gebracht. Großmutter beherrschte die Sprache der Kolonialisten nicht nur perfekt, sie konnte sie auch lesen. Also las sie ihm die Märchen aus fernen Landen vor und brachte ihm später bei, sie selbst zu lesen. »Sprache ist der Schlüssel«, pflegte seine Nenek immer zu sagen. Und Bimo wusste, dass sie damit recht hatte. Er lernte also nicht nur Niederländisch, bald beherrschte er auch Deutsch, Portugiesisch, Englisch und sogar etwas Chinesisch. Alles hatte er sich selbst beigebracht und er war stolz darauf. Sein Ziel war es, eines Tages aus Batavia fortzugehen, am liebsten nach Europa. Denn so sehr er seine Heimat und vor allem den Hafen auch liebte, brannte in ihm eine Sehnsucht, das Land aus den vielen Erzählungen, die er liebte, endlich mit eigenen Augen zu sehen. Es musste ein wunderschönes Land sein. Doch dafür brauchte er Geld. Viel Geld.
»Jetzt können wir los.« Femke gab ihm einen Stoß in die Seite, dann sprang sie von dem Querbalken des Zauns, auf dem sie saßen, und landete auf dem Boden. Sie wickelte sich mit schnellen Handgriffen ein Tuch um den Kopf, um ihre langen blonden Haare zu verstecken.
»Man sieht trotzdem sofort, dass du eine Europäerin bist«, bemerkte Bimo.
Femke zuckte mit den Schultern. »Na und? Davon gibt es Tausende hier. Hauptsache, man erkennt mich nicht sofort anhand der Haarfarbe.«
»Nur anhand deines hübschen Gesichts …« Bimo biss sich auf die Zunge und er spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss.
»Wenn du glaubst, ich falle auf deine Schmeichelei herein und gebe dir mehr als die Hälfte der Beute, dann hast du dich geirrt. Jetzt komm!« Femke marschierte in die Marktgasse. Bimo folgte ihr dichtauf, um sie in dem Gedränge nicht aus den Augen zu verlieren.
Sie schlenderten eine Weile durch das Gewimmel und gönnten sich ein paar Jambuse, deren Verlust der Obsthändler verschmerzen konnte.
»Da vorne«, sagte Femke mit lautem Schmatzen und zeigte unauffällig auf einen unglaublich dicken Mann.
»Oh mein Gott, der muss verdammt reich sein«, murmelte Bimo und sah den Europäer bewundernd an.
»Vor allem ist er zu fett, um uns zu folgen.« Seine Freundin warf ihre halb aufgegessenen Jambus achtlos auf den Boden. »Machen wir es wie immer.«
»Nein, diesmal bist du dran«, sagte Bimo entschieden. »Ich lenke ihn ab und du greifst dir den Geldbeutel.«
»Ich, aber … du bist geschickter.« Femke sah unsicher zu ihrem auserkorenen Opfer hinüber.
»Eine bessere Gelegenheit zum Üben wirst du nicht bekommen. Dieser Mann sieht nicht sehr beweglich aus. Außerdem bist du selber verdammt geschickt. Du schaffst das.«
»Also gut.«
Sie gingen langsam in die Nähe des voluminösen Mannes, der sich gerade mit seiner Begleiterin an einem der Stoffstände aufhielt und angeregt mit dem Händler plauderte. Er sprach Malaiisch, aber dies mit einem derart furchtbaren Akzent, dass Bimo sofort klar war, dass dieser Mann aus Deutschland kam – ein Land in Europa, direkt neben den Niederlanden und aus dem einige seiner Lieblingsmärchen stammten. Die Frau an der Seite des Dicken war deutlich jünger und in ihren Gesichtszügen erkannte er eine gewisse Ähnlichkeit zu dem älteren Mann.
»Hörst du das?«, sagte Femke. »Er spricht die Landessprache. Er war also bestimmt schon öfter hier. Wir sollten es doch lieber bei jemand anderem versuchen.«
»Ach was, der ist genau richtig.«
»Nein, ich finde, wir sollten …« Femke verstummte und sah mit offenem Mund zu dem Mann hinüber, der gerade einen dunklen Lederbeutel von seinem Gürtel losmachte, ihn aufzog und einige Goldmünzen daraus in seine Hand fallen ließ. Auch der Händler schien sein Glück kaum fassen zu können. Bimo sah den gierigen Ausdruck in seinen Augen.
»Also abgemacht! Sie liefern mir zehn Ballen ihrer besten Seide an Bord des Schiffes. Hier die Anzahlung«, hörte Bimo den beleibten Mann sagen und verfolgte, wie dieser dem Händler zwei der Goldtaler in die Hand drückte. Dann stopfte er die restlichen Münzen zurück in den Beutel und band diesen wieder an den Gürtel.
Es war nicht nötig, noch ein Wort zu wechseln. Femke sah ihn entschlossen an und nickte. Jetzt wurde es ernst.
Der dicke Mann und seine Tochter wandten sich von dem Stand des Stoffhändlers ab und gingen weiter. Bimo atmete tief durch, drängte sich an einigen Leuten vorbei und rannte dann mit voller Absicht und viel Schwung in den Mann hinein. Es fühlte sich an, als würde er gegen eine weiche Matratze laufen, wie in dem Märchen mit der Prinzessin, die auf einem Turm aus ganz vielen weichen Bettpolstern schlief.
»Hey, pass doch auf, du dreckiger Bengel«, fluchte der Dicke.
»Entschuldigt vielmals, Mijnheer. Es tut mir furchtbar leid. Allah soll mich dafür bestrafen, dass ich nicht darauf geachtet habe, wohin meine Füße mich trugen und ich gegen euren zerbrechlichen Körper gestoßen bin.«
»Das ist doch … erst läufst du rücksichtslos in mich hinein und dann verspottest du mich auch noch?«
»Ich …« Bimo taumelte zurück, als die rechte Hand des Mannes plötzlich nach vorne schnellte und ihm eine klatschende Ohrfeige verpasste. Verdutzt rieb er sich die Wange. Damit hatte er nicht gerechnet.
»Lass dir das eine Lehre sein, Bursche!«
»Ganz gewiss, Mijnheer.« Bimo neigte den Kopf.
»Vater, pass auf! Eine Diebin!« Die Tochter des Mannes kreischte laut auf, als Femke mit ihrer schmalen Hand hinter seinem Rücken an den Geldbeutel langte und diesen fingerfertig vom Gürtel löste – ganz, wie Bimo es ihr gezeigt hatte. Doch als sie sich umwandte, packte die Tochter sie am Arm. Doch Femke wand sich aus ihrem Griff und schlug dem jungen Mädchen mit geballter Faust ins Gesicht. Mit einem Schrei ging die zu Boden.
»Na warte!« Der dicke Mann erwies sich als beweglicher und vor allem flinker als vermutet, er drehte sich geschmeidig um die eigene Achse und versuchte, nach Femke zu greifen, doch in diesem Moment sprang Bimo nach vorne und trat dem Mann mit dem Fuß direkt in den Magen. Keuchend sackte der vornübergebeugt in sich zusammen.
»Komm schnell!« Bimo griff nach Femkes Hand und rannte los, zwischen den umstehenden Menschen, die alle verwundert zusahen, aber zum Glück war niemand daran interessiert, sie festzuhalten oder am Weglaufen zu hindern. Sie bogen um die Ecke, die aus der Gasse hinaus in den nächsten Gang führte. »Ich glaube, wir haben es gescha…« Eine Faust flog gegen seinen Kopf. Der Schlag fegte ihn von den Beinen. Benommen landete er auf dem Boden vor einem Gewürzstand und war unfähig, sich zu rühren.
»Na, wen haben wir denn da? Meine Verehrung, Fräulein de Wit.« Der Kerl, der Bimo niedergeschlagen hatte, hielt nun Femke am Handgelenk fest und drehte es herum, bis sie den Geldbeutel freigab. »Ich glaube, es ist besser, wenn ich das an mich nehme und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgebe, nicht wahr?« Der Mann lächelte und ließ einen goldenen Schneidezahn aufblitzen.
»Mahler, Sie verfluchter Mistkerl!«, zischte Femke den Mann an. »Lassen Sie mich los!«
»Wie Sie es wünschen, Fräulein.« Als er seinen Griff lockerte, fiel Femke nach hinten und landete auf ihrem Hintern. Sofort krabbelte sie zu Bimo, der immer noch kleine Sterne vor seinen Augen tanzen sah.
»Alles in Ordnung?«, fragte Femke ihn mit besorgter Miene.
»Mir dreht sich alles.«
»Der kleine Gauner wird schon keinen bleibenden Schaden davontragen«, höhnte der Deutsche, der ihn niedergeschlagen hatte. Bimo kannte ihn gut, Ludger Mahler bezeichnete sich zwar als Geschäftsmann, jedoch war dessen Gewerbe kaum gesetzmäßiger als sein eigenes. Aber ein Europäer, der die Einheimischen betrog und bestahl, wurde eben anders behandelt als jemand wie er.
»Da sind die Diebe!« Der dicke Mann kam in Begleitung seiner Tochter und zwei Kolonialbeamten auf sie zugestapft.
»Lauf weg, schnell«, stammelte Bimo und sah zu Femke.
»Aber nicht doch.« Mahler war hinter sie getreten und legte eine Hand auf ihre schmale Schulter. »Sie bleiben schön hier, Fräulein de Wit.«
Dann waren die Polizisten auch schon bei ihnen. Sie machten ein überraschtes Gesicht, als sie Femke erkannten.
»Nicht schon wieder«, seufzte einer der Männer und schüttelte den Kopf. »Ihr Vater wird nicht darüber erfreut sein, Mevrouw.«
»Sie kennen diese diebische Elster?«, fragte der dicke Mann. Der Beamte nickte nur stumm. Dann wurde Bimo auf die Beine gezogen.
»Dann bringen wir die beiden mal zum Richter.«
»Ich nehme an, dies gehört Ihnen?«, fragte Ludger Mahler den Bestohlenen und hielt den Geldbeutel in die Höhe.
»Ja, tut es. Vielen lieben Dank für Ihr beherztes Eingreifen, guter Mann.«
Der Angesprochene neigte den Kopf leicht.
»Ludger Mahler. Es war mir eine Freude, behilflich sein zu können.«
»Ah, ein Landsmann«, strahlte der Dicke. »Das freut mich natürlich umso mehr, Herr Mahler. Mein Name ist Georg Kopperschmidt und dies ist meine Tochter Otilie.«
»Ebenfalls sehr erfreut, Herr Kopperschmidt. Falls Sie während Ihres Aufenthalts in Batavia noch einmal Hilfe benötigen, lassen Sie es mich wissen. Ich lebe seit einigen Jahren hier und kann Ihnen vielleicht behilflich sein.«
»Danke für Ihr freundliches Angebot. Davon werde ich gerne Gebrauch machen.«
»Entschuldigen Sie kurz, die Herren«, sagte einer der Polizisten und sah dann Ludger Mahler an. »Wären Sie so frei, uns zu begleiten und eine Aussage zu machen bezüglich dieses Halunken?« Er deutete auf Bimo.
»Aber selbstverständlich.« Mahler wandte sich noch einmal an den Dicken. »Sie sehen, die Bürgerpflicht ruft. Wo kann ich Sie später finden, Herr Kopperschmidt?«
»Ich werde während meines Aufenthalts bei einem meiner Geschäftspartner in Weltevreden wohnen. Sie wissen, wo das liegt?«
»Natürlich. Wie heißt Ihr Geschäftspartner?«
»Johan van Leeuwen.«
»Der Name ist mir ebenfalls bekannt. Ich werde Ihnen morgen Nachmittag einen Besuch abstatten, wenn Sie erlauben.«
»Gewiss. Dann bis morgen, Herr Mahler.«
»Bis morgen. Passen Sie bis dahin gut auf Ihr Geld auf, Herr Kopperschmidt.« Mahler lachte und wandte sich dann wieder zu dem Polizisten um. »Jetzt können wir los.«
Während Femke freundlich von den Beamten aufgefordert wurde, loszugehen, gingen sie mit ihm weniger zurückhaltend um. Einer der Polizisten hielt ihn eisern am Oberarm fest und schob ihn durch die Marktgassen. Die Leute machten ihnen Platz und warfen Bimo mitleidige Blicke zu. Sie wussten, was Dieben für eine Strafe drohte. Mehrere Monate in einem Arbeitslager waren zu erwarten. Auch Bimo war sich dessen bewusst. Die niederländischen Kolonialherren waren dafür bekannt, sehr harte Strafen zu verhängen, als Abschreckung. Und vor allem der Richter, zu dem ihn die Beamten jetzt mit Sicherheit bringen würden. Rutger de Wit, Femkes Vater. Und da seine Tochter involviert war, würde er bestimmt nicht zögern, Bimo in eines der am weitesten entfernten Lager zu schicken, auf Borneo oder – was noch schlimmer wäre – auf den Molukken. Er musste unbedingt vorher fliehen. Um Femke musste er sich jetzt keine Sorgen machen, ihr Vater würde seine einzige Tochter mit Sicherheit nicht zu einer Strafe verurteilen.
Während er sich umsah und überlegte, wie er am besten entkommen könnte, stieß Ludger Mahler, der hinter ihnen herging, plötzlich einen Schrei aus. Der Beamte, der Bimo am Arm festhielt, stürzte zu Boden. Der Mann riss ihn mit herunter, löste dann aber seinen Griff. Blitzschnell sprang Bimo auf die Beine und sah, wie der Polizist und der Deutsche auf dem Boden lagen.
»Lauf weg! Schnell«, rief Femke und klammerte sich an dem zweiten Beamten fest, der sich gerade auf Bimo stürzen wollte.
Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Mit einem großen Satz sprang er auf einen der nächstgelegenen Marktstände, dessen Besitzer sofort lautstark protestierte. Aber Bimo achtete nicht auf ihn, sondern rannte über die Auslage und sprang schließlich auf der anderen Seite herunter, rannte auf eines der Gebäude zu, die sich dahinter befanden, und verschwand ins Innere.
* * *
»Verdammt, jetzt ist der Bursche entkommen«, fluchte der Polizist, an dem Femke sich klammerte.
»Ich bin untröstlich«, stammelte Ludger Mahler betrübt, während er sich vom Boden erhob. »Es war ein Versehen, ich bin ins Stolpern geraten und gestürzt. Es tut mir sehr leid.«
»Schon gut«, sagte der andere Polizist. »Früher oder später werden wir ihn schon erwischen.«
Femke stieß ein gehässiges »Ha!« aus. »Sie werden ihn niemals zu fassen kriegen, er ist viel zu flink für euch!«
»Sie sollten sich lieber um sich selbst Gedanken machen, Mevrouw de Wit«, erwiderte einer der Beamten barsch. »Der Richter hat im Moment keine gute Laune und euch gleich zu sehen und zu erfahren, was ihr getan habt, wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass er sich gnädig zeigt.«
»Möchten die Herren, dass ich trotzdem noch mitkomme?«, fragte der Deutsche.
»Nein, ich glaube, es ist nicht mehr vonnöten.«
»In Ordnung. Ich bitte nochmals um Entschuldigung für meine Ungeschicklichkeit, die Herren.«
»Schon vergessen«, erwiderte der Polizist, der wegen Mahler gestürzt war. »Einen schönen Tag noch.«
»Den wünsche ich Ihnen ebenfalls. Ich empfehle mich.«
»Gehen wir, Mevrouw de Wit!«
Femke folgte den Anweisungen der Beamten. Für sie war am wichtigsten, dass Bimo es geschafft hatte, zu entkommen. Als sie losgingen, warf sie noch einen giftigen Seitenblick auf Ludger Mahler. Sie hatte den Eindruck, als würde der Deutsche ihr zuzwinkern.
DER NEUE POSTEN
ANJER, WESTKÜSTE VON JAVA, FOURTH-POINT-LEUCHTTURM, 1. MAI
Mit vor Stolz geschwellter Brust rückte er sich seine Mütze ein Stück zurecht, als der niederländische Contrôleur den Schlüssel zückte. Der Beamte brauchte einen Moment, aber schließlich schaffte er es, das Türschloss zu öffnen. Dann zog er den Schlüssel wieder aus dem Schloss heraus und drehte sich damit zu ihm herum.
»Hiermit übergebe ich Ihnen also offiziell die Schlüssel und damit die vertrauensvolle Aufgabe, sich ab sofort um den Leuchtturm Vierde Punt zu kümmern.« Er sprach mit feierlicher Stimme, obwohl außer ihnen beiden niemand anderes anwesend war, und reichte ihm den Türöffner aus Eisenguss. »Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser Aufgabe, Tuah.«
»Vielen Dank, Mijnheer. Ich werde Sie nicht enttäuschen.«
»Das weiß ich doch, Tuah.« Der alte Niederländer Edwin de Bruin lächelte ihn an. »Wenn jemand über den nötigen Respekt und das Verantwortungsbewusstsein für diese Stellung verfügt, dann Sie.« Er klopfte ihm auf die Schulter. »Jetzt will ich Sie nicht länger von Ihrer neuen Arbeit abhalten. Sie wissen, was zu tun ist.«
Tuah nickte. Natürlich wusste er das. Seit Wochen hatte er sich mit nichts anderem mehr beschäftigt. Er hatte die Vorschriften und sämtliche Anweisungen gelesen, die es für die Stelle des Leuchtturmwärters gab. Seine Frau Sumbi hatte sich schon beschwert, dass er für sie und seinen Sohn Ajip keine Zeit mehr übrig hatte, aber Tuah war sich sicher, dass sie jetzt, da er die Stelle tatsächlich bekommen hatte, verdammt stolz auf ihn sein würde. Er war jetzt der Leuchtturmwärter von Fourth Point oder Vierde Punt, wie die Holländer zu sagen pflegten. Der einzige Javaner, der jemals eine solch verantwortungsvolle Stellung übertragen bekommen hatte. Die anderen drei Leuchttürme an der Westküste waren mit Holländern besetzt.
Nachdem der Contrôleur gegangen war, betrat Tuah den schlanken Turm, der sich knappe vierzig Meter in die Höhe schraubte. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, die eisernen Gitterstufen im Laufschritt zu nehmen. Doch bereits auf der Hälfte war er außer Atem, sodass er die letzten Stufen im normalen Tempo erklomm. Oben angekommen, begutachtete er zunächst das Leuchtfeuer. Der Fourth-Point-Leuchtturm verfügte über eine der modernsten Beleuchtungstechniken in ganz Niederländisch-Indien. Die lange Zeit übliche Argand-Lampe war vor einem halben Jahr durch ein modernes Gasglühlicht ersetzt worden. Dieser Leuchtkörper bestand im Kern aus einem metallenen Glühstrumpf von ungefähr zwanzig Zentimeter Länge, der mittels eines Gas-Luft-Gemisches zum Leuchten gebracht wurde. Damit entfiel der lästige Dochtwechsel, der bei Leuchttürmen mit Argand-Lampen immer noch drei- bis viermal in einer Nacht fällig war. Und um die Lichtstärke noch zu verbessern, wurde das Licht von einer Fresnel-Linse gebündelt. Nachdem Tuah sich überzeugt hatte, dass die gesamte Anlage in einem einwandfreien Zustand war, trat er hinaus auf die Plattform. Der Wind wehte hier oben deutlich stärker als in Bodennähe. Zufrieden und glücklich stützte er sich auf dem Geländer ab und ließ seinen Blick über die Sundastraße schweifen. In der Fahrrinne der Meerenge, die zwischen den Inseln Sumatra und Java verlief, herrschte wie immer reichlich Schiffsverkehr. Etliche Frachter, die aus Niederländisch-Indien Kurs auf Europa nahmen und die begehrten Waren, vornehmlich Gewürze, in die Heimat der Kolonialherren transportierten. Aber auch Passagierschiffe, deren Anzahl sich seit dem Aufkommen der dampfbetriebenen Schiffe vervielfacht hatte.
Von seiner Position aus waren es bis zum südlichen Zipfel Sumatras gerade einmal dreißig Kilometer. An einem Tag wie heute konnte man alles klar erkennen. Lautes Tuten erklang, als eines der Schiffe den nahe gelegenen Hafen von Anjer verließ. Tuah nahm seine Schirmmütze ab und winkte dem Schiff damit zu. Es war die Gouverneur-General Loudon, ein Segeldampfer, der die meiste Zeit als Post- und Transportschiff diente, und zwischen dem nahen Sumatra und Java verkehrte. Erneut erscholl das Schiffshorn der Loudon zum Gruß. Tuah hatte sich niemals zuvor glücklicher gefühlt. Selbst bei der Geburt seines Sohnes nicht. Er setzte die Mütze wieder auf und sah nach Westen. In zentraler Lage befanden sich dort mehrere kleine Inseln. Eine davon war Krakatau, ebenfalls gute dreißig Kilometer entfernt. Sie fiel besonders ins Auge, weil sich ein spitzer Berg dort achthundert Meter in die Höhe reckte. Sein Vater hatte ihm viele Geschichten über diese Insel erzählt und von den drei Vulkankratern, die sich auf ihr befanden.
In einem der Krater hauste der Legende nach der Gott Orang Alijeh, der eines Tages erwachen und alle Fremden vertreiben würde. Aber die Vulkane waren lange erloschen und bis vor einigen Jahren war auf der Insel sogar eine kleine Strafkolonie eingerichtet gewesen, die aber mittlerweile wieder abgezogen war, weil die Einheimischen sich bei den Kolonialherren beschwert hatten. Denn auf Krakatau gab es einen dichten Urwald und vor allem gutes Holz, an dem sich viele der als Fischer tätigen Bewohner Javas und Sumatras gleichermaßen nur zu gerne bedienten. Die hohen Vulkanberge, die sich hoch über den Baumwipfeln erhoben, beachtete keiner von ihnen. Auch Tuah schenkte dem Eiland jetzt keine Aufmerksamkeit mehr. Er ging zurück ins Turminnere und freute sich darauf, dass es bald dunkel werden würde. Und er zum ersten Mal das Leuchtfeuer einschalten durfte.
GLÜCKSGEFÜHLE
BATAVIA
Fröhlich pfeifend betrat Ludger Mahler das kleine Gasthaus im Sunda Kelapa, dem alten Hafen, der seit der Eröffnung des neuen und größeren Hafens Tjandjong Priok kaum noch eine Relevanz hatte. Nur noch die einheimischen Fischer nutzten die alten Anleger, während die Dampfschiffe aus Europa und dem Rest der Welt im neuen Hafen festmachten. Aber Ludger schätzte die Atmosphäre in Sunda Kelapa und vor allem auch die Tatsache, dass sich hier so gut wie nie ein offizieller holländischer Beamter herverirrte. Er bestellte sich einen Kaffee und einen Rum am Tresen und setzte sich dann an einen der Tische im hinteren Teil des Gastraums.
»Die Geschäfte laufen gut, nehme ich an?«, fragte ihn ein großgewachsener Mann, der am Nebentisch gerade sein Frühstück verschlang. Im buschigen roten Bart des Kerls hingen einige Essensreste.
»Hallo Graham, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ja, ich habe gerade eine kleine Glückssträhne. Wie sieht es bei dir aus?«, fragte er den Briten.
»War schon mal besser. Ich halte mich im Moment mehr schlecht als recht mit einigen Ausflugstouren über Wasser.«
»Deine stolze Queen Anne als Ausflugsdampfer? Du machst Scherze!«
Der Schotte schüttelte den Kopf. »Leider nein. Seit meinem kleinen Disput mit dem verdammten Richter de Wit bekomme ich keine Frachten mehr zum Transportieren. Die vermaledeiten Niederländer boykottieren mich. Das geht jetzt schon seit acht Wochen so. Und um überhaupt noch etwas zu verdienen, muss ich eben einige der Besucher drüben im Hafen einsammeln und fahre mit denen ein wenig die Küste entlang. Aber es sind zu wenige, um wirklich Gewinn einzufahren. Lange kann ich das nicht durchhalten.«
»Kann ich mir vorstellen.«
»Du hast nicht zufällig ein wenig von deinem Glück für mich übrig?« Graham warf ihm einen schiefen Blick zu.
»Tut mir leid. Momentan spielen sich meine Geschäfte eher an Land ab. Aber sollte sich was ergeben, wobei ich einen tüchtigen Seemann und ein Schiff benötige, komme ich sofort auf dich zurück.«
»Verstehe. Dann hoffe ich, dass es dich bald mal wieder auf die See verschlägt, Mahler.« Graham kratzte mit der Gabel die Reste seines Frühstücks auf dem Teller zusammen, stopfte es sich in den Mund und erhob sich vom Tisch. »Bis bald, mein Freund.«
»Bis bald. Und viel Glück«, rief Ludger dem britischen Kapitän hinterher, als dieser das Gasthaus verließ. Dann trank er seinen Rum mit einem Zug aus und zog danach den Brief aus der Tasche. Er kam aus Hamburg, aber die Schrift auf dem Umschlag war nicht die seiner Schwägerin, das erkannte er sofort. Er öffnete das Kuvert und las die wenigen Zeilen. Sie waren von Leonhard, seinem Neffen.
»Oh, verflucht«, murmelte er, als er den Text gelesen hatte. »Ich freue mich, dich bald zu sehen«, wiederholte er den letzten Satz des Briefes leise.
Seine Hand ging zum Rumglas, aber das war bereits leer. Er hielt es in die Höhe und rief nach dem Gastwirt, der sofort herbeieilte und es wieder vollschenkte. Als er es an die Lippen ansetzte, hielt er kurz inne.
Vielleicht kann ich den Jungen doch gebrauchen. Ja, ganz gewiss sogar.
Ein Lächeln umspielte seine Lippen, dann trank er den zweiten Rum aus.
Einige Stunden später stieg er aus der Kutsche, die ihn vom Hafen Batavias nach Weltevreden, in die Oberstadt, gebracht hatte und stand vor dem Huis ten Bataver, dem riesigen Anwesen von Johan van Leeuwen. Wobei die Bezeichnung als Haus eine schamlose Untertreibung war. Hinter dem gusseisernen Tor, vor dem Ludger nun stand, erhob sich ein wahrer Palast. Es stand exponiert auf einem leicht ansteigenden Berghang, der das Gebäude nur umso eindrucksvoller wirken ließ, mit der grünen Wand des nahen Regenwaldes, der nur wenige Hundert Meter hinter Huis ten Bataver