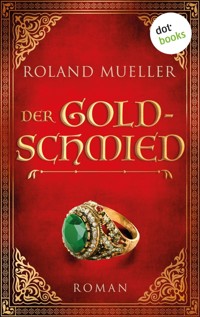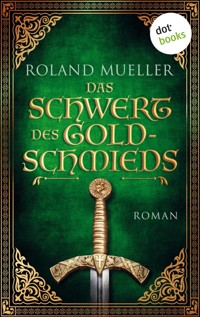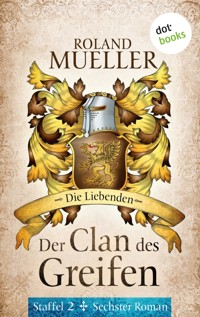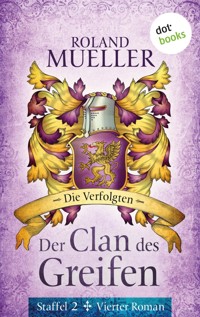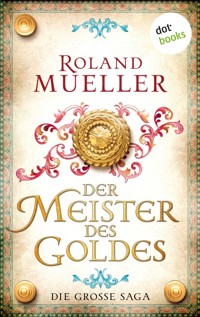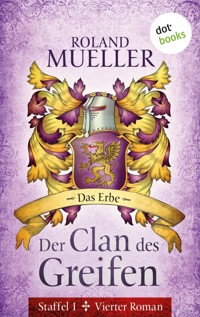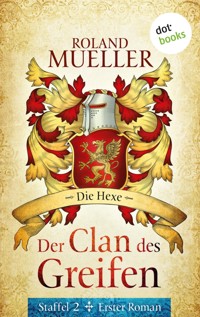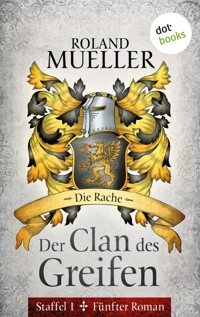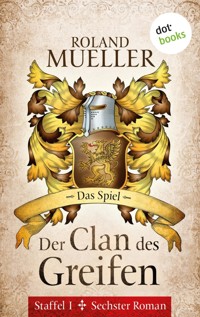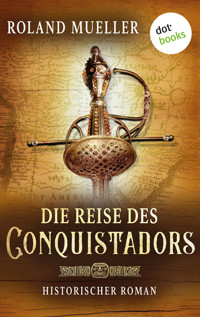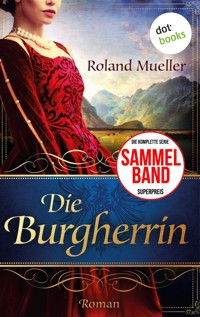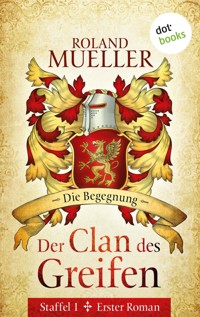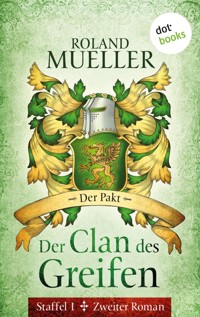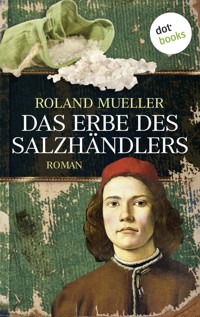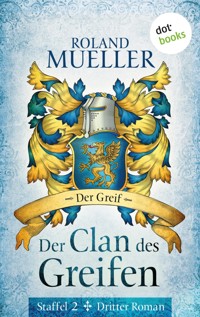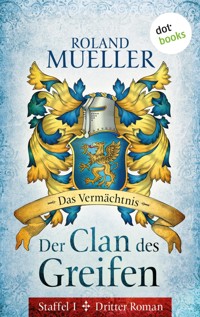
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Clan des Greifen
- Sprache: Deutsch
Mitreißend und spannend: Die sechsteilige historische Serie "Der Clan des Greifen" von Roland Mueller jetzt als eBook bei dotbooks. Südtirol im 15. Jahrhundert: Gräfin Eleonore von Greifenberg ist wegen ihrer beiden ältesten Kinder von großer Sorge erfüllt. Wolfs ungestüme Natur kommt immer mehr zum Vorschein und seine Rücksichtslosigkeit macht ihr zunehmend Angst. Die schöne Friederike hingegen ist Urs von Weil versprochen. Doch sie findet den fünfzehn Jahre älteren Mann abstoßend – der Krieg hat ihm ein Auge geraubt und zahlreiche Narben auf Gesicht und Körper hinterlassen. Wird es der jungen Frau gelingen, hinter sein verunstaltetes Äußeres zu blicken? Und wird Eleonore es vermögen, ihren Sohn zu bändigen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die sechsteilige historische Serie "Der Clan des Greifen" von Roland Mueller. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Südtirol im 15. Jahrhundert: Gräfin Eleonore von Greifenberg ist wegen ihrer beiden ältesten Kinder von großer Sorge erfüllt. Wolfs ungestüme Natur kommt immer mehr zum Vorschein und seine Rücksichtslosigkeit macht ihr zunehmend Angst. Die schöne Friederike hingegen ist Urs von Weil versprochen. Doch sie findet den fünfzehn Jahre älteren Mann abstoßend – der Krieg hat ihm ein Auge geraubt und zahlreiche Narben auf Gesicht und Körper hinterlassen. Wird es der jungen Frau gelingen, hinter sein verunstaltetes Äußeres zu blicken?
Über den Autor:
Roland Mueller, geboren 1959 in Würzburg, lebt heute in der Nähe von München. Der studierte Sozialwissenschaftler arbeitete in der Erwachsenenbildung, als Rhetorik- und Bewerbungstrainer und unterrichtet heute an der Hochschule der Bayerischen Polizei. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendbücher.
Bei dotbooks erschienen bereits Roland Muellers historische Kinderbücher Die abenteuerliche Reise des Marco Polo und Der Kundschafter des Königs und seine historischen Romane Der Goldschmied, Das Schwert des Goldschmieds, Das Erbe des Salzhändlers und Der Fluch des Goldes.
Die erste Staffel der historischen Serie Der Clan des Greifen umfasst folgende Bände:
Erster Roman: Die Begegnung.
Zweiter Roman: Der Pakt.
Dritter Roman: Das Vermächtnis.
Vierter Roman: Das Erbe.
Fünfter Roman: Die Rache.
Sechster Roman: Das Spiel.
***
Originalausgabe Januar 2015
Copyright © 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung und Titelbildabbildung: Nele Schütz unter Verwendung von shutterstock/Olga Rutko
ISBN 978-3-95520-618-5
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Der Clan des Greifen an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Roland Mueller
Der Clan des Greifen
Das Vermächtnis
Staffel I – DritterRoman
dotbooks.
Eleonore schreckte auf und lauschte mit angehaltenem Atem. Bis auf das leise Säuseln des Windes am Fenster war es still. Sie hatte geschlafen und wusste nicht, ob der Ruf, den sie vernommen hatte, Wirklichkeit gewesen war oder einem Traum entstammte. Ja, dachte sie, allmählich zu sich kommend, eine andere Erklärung gab es nicht. Sie musste geträumt haben, wenn sie auch keine Erinnerung an einen Traum hatte. So erging es ihr meistens, und wenn es einmal anders war, waren ihre Träume blutrünstig und grausam gewesen. Dann sah sie Feuersbrünste, sah ihre beiden Söhne und ihre Schwiegersöhne, alle vom Krieg gezeichnet, den sie nicht verhindert hatte. Nein, mehr noch, insgeheim hatte sie diesen Krieg gutgeheißen. Und nun lag sie in ihrem Bett und lauschte auf Stimmen. Sie lachte bitter. Eleonore von Greifenberg, die Gräfin, die gehofft hatte, die Veränderungen der Zeiten aufhalten zu können. Die ihren Stand und ihren Stolz als adelige Frau einsetzen wollte, um die drückende Schuldenlast zu vermindern. Die jedoch Hass erzeugte, einen Hass, der sie seitdem ständig umgab. Selbst die Liebe wollte sie erzwingen, und das war ihr am allerwenigsten gelungen. Gott, du Allmächtiger, die Liebe! Ja, als Wolfram, ihr seliger Mann, gestorben war, glaubte sie, nie wieder lieben zu können. Dabei hatte seitdem eine ganze Reihe von Männern um ihre Gunst gebuhlt. Allen voran Herzfeld, der Bankier und Geldverleiher. Und Hagen, von dem sie nur ahnte, dass er sie bereits seit längerem begehrte. Den sie im Gegenteil immer nur kränkte, weil sie von ihm nur forderte und verlangte und ihm nie etwas zurückgab. Es war ihr bewusst, und sie kam sich, weiß Gott, schäbig vor deswegen. Wenn auch nicht schäbiger als Anton Fugger gegenüber, jenem Augsburger Kaufmann, der mit kühlem Verstand und großem Geschick nach und nach ein Vermögen verdiente. Aber deswegen bewunderte sie ihn nicht so sehr wie wegen seiner Warmherzigkeit. Fugger machte deutlich, wie sehr er sie schätzte, und sie konnte nicht umhin zuzugeben, dass auch sie ihn mochte. Mindestens so sehr wie Hagen. Und genau damit begann das ganze Unglück. Denn sie, die Gräfin von Greifenberg, entschied sich nicht für einen von ihnen.
Leise stöhnend warf sie den Kopf auf dem Kissen hin und her. Am liebsten wollte sie an gar nichts denken, was ihr aber nicht gelang. Am Ende war es wie bei allen Gedankenspielen seit dem Ende des sinnlosen Schlachtens: Es würde ihr reichen, wenn alles so bliebe wie bisher. Das wäre das Einfachste, weil sie sich für niemanden entscheiden müsste.
»Großmutter!«
Sie war sofort wach. Das musste ihr Enkel gewesen sein. Er schlief nebenan in einer kleinen Kammer. Damit sie ihn hören konnte, hatte sie die schwere Tür zwischen den beiden Räumen entfernen und durch einen dünnen Vorhang ersetzen lassen. Leise stand sie auf. In ihrem Schlafzimmer stand auf einem kleinen Tisch an der Wand eine Kerze. Sie brannte über die ganze Nacht, bis sie in den frühen Morgenstunden von selbst verlöschte. Die Flamme war bereits ganz klein und drohte bald auszugehen. Ein Zeichen dafür, dass der Morgen nicht mehr allzu fern war. Sie griff sich einen Leuchter mit einer frischen Kerze, entzündete diese an dem winzigen Wachslicht und schlich dann auf bloßen Füßen in die Schlafkammer ihres Enkelsohnes. Im Halbdunkel erkannte sie die Bettstatt, auf der der Junge lag. Er schlief, aber er schwitzte. Sein dunkelblondes Haar klebte ihm an der Stirn, daher griff sie sich den Saum ihres Nachtgewandes und tupfte damit vorsichtig die Stirn des Kleinen. Davon erwachte er.
»Großmutter …?«
Seine Hand tastete nach der ihren.
»Bin ja da, mein Kleiner«, flüsterte sie.
»Sag, ist der Krieg zu Ende?«
»Ja, das ist er.«
»Ganz bestimmt?«
»Ja, mein Kind, ganz bestimmt.«
»Und er kommt auch nicht wieder?«
Sie zögerte mit der Antwort, schüttelte stumm den Kopf, was das Kind aber nicht sehen konnte. Dann erst antwortete sie.
»Nein, sicher nicht.«
Sie sah, wie sich die Züge des Kindes entspannten.
»Bleibst du hier bei mir, Großmutter?«
Eleonore strich ihm mit der Hand über die schweißnasse Stirn. Dann blies sie die Kerze aus, rutschte in der Dunkelheit neben ihn und zog die Decke über sie beide. Sie spürte, wie sich das Kind an sie schmiegte, und wenig später sagte ihr der ruhige Atem des Jungen, dass er wieder eingeschlafen war.
Eleonore lag noch eine ganze Weile wach und dachte daran, wie er begonnen hatte, dieser unselige Krieg …
***
Rudolf hatte schlechte Laune. Nicht nur wegen Annas ständigem Gerede, die nicht müde wurde, sich ihr weiteres Leben auszumalen. Seine Einwände dagegen schien sie nicht zu hören. Und wenn er einmal davon anfing, was er tun wollte, wenn ihn dieser Baumeister aus Ravenna aufnähme, wich sie seinen Fragen aus. So hatte er sich bald abgewöhnt, das Thema überhaupt anzusprechen. Doch seit ihm Meister Pippin einmal eine Zeichnung dieses Baumeisters gezeigt hatte, war es um Rudolf geschehen. Was für ein Entwurf! Nichts von rohen, kargen Wänden, am Ende mit gelöschtem Kalk verputzt. Nein, das Haus auf diesem Entwurf war aus gebrannten Ziegeln gemauert, mit einem besonders feinen Putz, die Fensteröffnungen mit richtigen Glasscheiben versehen. Glas, in kleine Rahmen gefasst und zu einem großen Fenster vereinigt! Welch eine kühne Idee! Am Ende schmückte eine besonders beschaffene Kalkfarbe die Hauswände, und Meister Pippin erzählte von sanft leuchtendem Gelb wie der Farbe des Ginsters, Weiß wie der Schnee im Sonnenlicht oder allerlei Ockertöne, welche dieser junge, kühne Baumeister verwendete. Im Inneren lagen Räume, wie man sie bisher nur aus den großen Burgen der Adeligen kannte: hoch, mit breiten, ebenso hohen Fenstern. Alle Wände im Inneren in hellen Farben gestrichen. In diesen Häusern herrschte das Licht. Ja, und so ein Haus baute sich schnell. Dreißig Handwerker und Gesellen, und in weniger als einem Jahr war es fertig. Nicht wie diese Kirche hier, die erst geweiht werden würde, wenn er längst nicht mehr lebte. Das Warten forderte ihm inzwischen eine Geduld ab, über die er nicht mehr verfügte. Nein, er wollte zu seinen Lebzeiten sehen, wie ein Bauwerk, an dem er mitarbeitete, fertig wurde. Und das ging nur bei den Häusern dieses genialen Baumeisters. Der endlich kommen musste, und zwar zu jeder Stunde, zu jedem Tag. Statt des Baumeisters kam jedoch der Regen, der nicht aufhören wollte. Seit knapp zwei Wochen regnete es beinahe ununterbrochen, und der graue verhangene Himmel ließ die Sonne nur noch erahnen.
»Gepriesen sei der Herr.«
Mit diesem Gruß stieg Pippin gerade die letzte Sprosse der Leiter hinauf.
»… gepriesen, ja«, entgegnete Rudolf mürrisch.
»He, was ist los mit dir?«
»Nichts, was soll sein?«
»Du bist so seltsam heute Morgen.«
»Ich bin so, wie ich bin.«
Pippin lachte.
»Nein, mein Lieber, bist du nicht. Also sag schon, warum so finster?«
Rudolf machte Anstalten zu antworten, aber Pippin hob die Hand.
»Halt, nein, sag nichts. Ich weiß, was du fragen willst. Ob er endlich da ist, nicht wahr? Dein Baumeister.«
Rudolfs Miene war auf einmal verächtlich.
»Er kommt ja doch nicht mehr.«
Pippin schüttelte den Kopf: Von seiner Nasenspitze tropfte das Regenwasser.
»Auf einmal sagst du das?«
»Der Kerl ist ein Schwätzer. Wenn es ihn überhaupt gibt.«
»Halt, nun mal langsam, mein Freund. Natürlich gibt es ihn. Du redest schließlich von Meister Ascolini.«
»Nein, ich rede von einem Kerl, der behauptet hat, er suche Gesellen für ein neues Bauwerk in der Lombardei.«
Rudolf spuckte neben sich auf die regennassen Holzbohlen. Dann hob er den sauber behauenen Stein mit beiden Händen an, hob ihn hoch und legte ihn behutsam an die Stelle, wo er einmal Teil der Kirchenmauer sein würde. Ein paar Hammerschläge rückten ihn zurecht. Dann griff er nach dem Richtholz und maß nach, ob der Stein eben lag. Er war ein genauer Arbeiter. Trotzdem änderte dies nicht seine schlechte Laune. Pippin hatte ihn bei seinem Tun beobachtet.
»Ich weiß auch nicht, wann er kommt. Aber ich weiß, dass er kommt. Er hat mir sein Wort darauf gegeben.«
»Und das glaubst du etwa?«
Rudolfs Frage hatte spöttisch geklungen. Pippin blickte ihm einen Moment lang ungläubig ins Gesicht, dann lachte er wieder.
»Ja, stell dir vor, genau das tue ich. Aber du, du bist tatsächlich besessen von diesem Mann.«
Als Rudolf darauf nichts antwortete, beobachtete Pippin, wie der Bursche den nächsten Stein setzte. Er nickte zufrieden und zog geräuschvoll die Nase hoch. Der Regen wollte nicht nachlassen, aber wenigstens war es nicht kalt. Und wenn man sich so wie sie hier oben den ganzen Tag über bewegte, begann man trotzdem bald zu schwitzen. Pippin wollte gerade eine weitere Leiter hinaufsteigen, als von unten Rufe herauftönten. Rudolf war mit der bloßen Hand über den Stein gefahren. Der Regen ließ die Oberfläche sich glatt wie Marmor anfühlen. Mit Marmor zu bauen, das wäre was, dachte er zum wiederholten Mal. Die lebendig gemaserte Oberfläche dieses Steins, der in seinen zahlreichen Farbschattierungen immer anders aussah. Als er neben dem Gerüst nach unten blickte, sah er dort Bertold stehen. Der Mann war Steinhauer wie Rudolf.
»Hast du Meister Pippin gesehen?«, rief er Rudolf zu.
»Ja, er ist hier bei mir!«
»Sag ihm, er soll runterkommen, schnell!«
Rudolf nickte und wandte sich an Pippin, der Anstalten machte, die nächste Leiter zu erklimmen.
»Warte, Bertold ruft nach dir!«
Pippin trat zurück bis an den Rand des Gerüsts.
»Was ist?«, rief er hinunter.
»Kommt schnell herunter, Meister. Ihr müsst Euch etwas ansehen.«
»Hat das nicht Zeit?«
»Nein, es eilt. Sehr sogar!«
»So, es eilt«, murmelte Pippin und nickte für Bertold deutlich sichtbar mit dem Kopf.
»Ich komme!«
Er wandte sich an Rudolf.
»Ich bleib dann gleich unten, ist ja nicht mehr so lang bis zum Mittag. Lass uns zusammen eine warme Suppe essen. Dabei können wir reden.«
Rudolf nickte nur und rührte mit der Kelle den Kalkbrei durch. Pippin schwang sich neben ihm auf die Leiter, die nach unten führte.
»Rudolf …«
»Ja …?«
»Ich sag’s dir wieder. Wär schade, wenn du fortgehen würdest.«
Bevor Rudolf darauf etwas antworten konnte, stieg Pippin die Leiter hinunter und war verschwunden.
***
Der Dunst des Kohlenfeuers, vermischt mit dem Duft nach Kohl, der von der Straße heraufzog, ließ Anton Fugger an eine Pause denken. Er versuchte sich zu konzentrieren. Aber vergeblich. Den ganzen Vormittag über hatte er das Gefühl gehabt, mit seiner Arbeit nicht sonderlich weit vorangekommen zu sein. Dabei wollte er vor dem Wintereinbruch längst wieder in Augsburg sein. Aber nun war er schon eine Woche länger hier als beabsichtigt. Gut, die Arbeit war nicht zu Ende. Verträge mussten gelesen und von seinem Schreiber noch ergänzt oder abgeändert werden. Allein der Kontrakt mit den Passinis war recht aufwendig geworden. Der Veroneser Holzhändler wollte ihm zwölf Wagenladungen bestes Lärchenholz verkaufen. Dafür hatte Fugger bereits einen Kunden in Genua. Der Weg dorthin war weit, aber zwölf Ochsengespanne sollten die Strecke in gut einer Woche schaffen können. Vorausgesetzt, das Wetter schlug endlich um. Wenn es noch kälter würde, war es nur eine Frage der Zeit, dass der Regen sich in Schnee verwandelte. Laut der Boten war es oben in den Bergen schon so weit. Fugger massierte sich mit den Fingerspitzen die Schläfen. Es war wie verhext. Eigentlich musste er fort, zurück nach Augsburg. Aber nichts trieb ihn wie sonst. Und jetzt wollte ihm nicht einmal ein klarer Gedanke gelingen. Vielleicht lag das an dem Lärm, der von der Dombaustelle herüberklang. Dieses stete Klopfen und Hämmern, das Geschrei der Maurer und Steinbrecher, dazu die lauten Gesänge der Ziegelträger den ganzen Vormittag über. Doch so, als ob jemand seine Gedanken erraten hätte, erstarb der Lärm plötzlich. Anton Fugger lauschte angestrengt, hörte aber nur noch die üblichen Geräusche der Straße, die durch die kleinen Fenster herauf in sein Kontor drangen. Kein Zweifel, der Lärm der Dombaustelle war verstummt. Dies war immer ein Zeichen dafür, dass die Handwerker sich zum Mittag einfanden. Spätestens dann ruhte die Arbeit auf der Baustelle, und Anton Fugger wusste, dass es nun etwa zwölf Uhr sein musste. Es klopfte an der Kammertür.
»Nur herein!«
Die Tür öffnete sich, und Johannes Wenzel, einer der Schreiber, stand in der Tür. Fugger wunderte sich, warum der Mann sein Barrett auf dem Kopf trug und einen Mantel um die Schultern. Als er aber die feuchtnassen Schuhe sah, die im Licht glänzten, fiel ihm ein, wo der Mann gerade gewesen sein musste. Schließlich hatte er ihn ja selbst losgeschickt und seitdem auf ihn gewartet.
»Und, hast du was für uns?«
Johannes Wenzel lächelte eifrig nickend. Er trat ein und schloss die Tür des Kontors hinter sich.
»Hier ist das endgültige Angebot.«
Er trat an den schweren Eichentisch, der Anton Fugger als Schreibtisch diente, und legte ein mehrfach gefaltetes Stück Pergament vor ihn hin. Fugger erkannte Herzfelds Siegel.
»Er ist einverstanden«, begann Wenzel, »und er lässt Euch zudem sagen, dass es nicht zu Eurem Schaden sein wird, wenn Ihr sein Angebot annehmt, Herr.«
Fugger nickte langsam. Wenzel war sein ältester Mitarbeiter und ein kluger Kopf. Er war ehrlich und loyal und verstand vom Geschäft mindestens so viel wie er selbst. Nein, diesen Mann wollte er nicht missen. Seltsam war nur, dass er ihm dies so noch nie gesagt hatte. Aber er schwor sich, es zu tun, sollte der Moment dafür günstig sein. Dies waren seine Gedanken, während er das Siegel brach und das Dokument auseinanderfaltete. Rasch überflog er die Zeilen. Die Schrift in schwarzer Tinte beschrieb ein umfangreiches Angebot an Schuldscheinen. Herzfeld hatte ihm vor wenigen Tagen fünfzig solcher Schuldverschreibungen auf einmal angeboten. Fugger war überrascht gewesen, denn dieses Geschäft hatten sie bereits im Sommer abschließen wollen. Trotz höflichem Nachfragen hatte Herzfeld dann jedoch kein Interesse mehr gezeigt. Und jetzt lag auf einmal ein Angebot vor. Aufmerksam las Fugger das Dokument, dann blickte er auf. Wenzel stand noch immer vor ihm, das Barett in der Hand.
»Was ist wohl der Grund, warum er diesen Handel nun auf einmal doch machen will?«, fragte Fugger.
»Darüber wollte ich mit Euch reden, Herr.«
»Dann spann mich nicht weiter auf die Folter. Und nimm endlich Platz.«
Wenzel lächelte und ließ sich auf einem Schemel vor dem breiten Schreibtisch nieder.
»Er will noch dieses Jahr all seine Schuldscheine abstoßen. Vom Entgelt will er einen Teil der Dombaustelle vermachen.«
»Eine Gabe an die Kirche? Warum das?«
»Es ist gottgefällig.«
Wenzel grinste nach der Bemerkung breit, und Fugger musste ebenfalls lachen.
»Johannes, du bist ein Schelm. Aber wir beide wissen, dass das allein nicht der Grund für seine plötzliche Großzügigkeit ist. Also sag mir schon, was der Kerl vorhat?«
Wenzel beugte sich, immer noch grinsend, auf seinem Platz ein wenig vor und antwortete beinah verschwörerisch: »Er will mit den Venezianern Geschäfte machen. Dazu musste er erst ein paar Mäuler schmieren, damit sie ihm einiges erzählen.«
»Und das haben sie getan, ja?«
Wenzel nickte erneut.
»Ja.«
»Ein Geschäft mit Venedig?«
»Es geht das Gerücht, dass die Stadt eine Flotte gegen die Türken senden will. Man redet von beinahe dreihundert Schiffen.«
Fugger zeigte sich sichtlich beeindruckt.
»Das weißt du sicher?«
»Ja, ziemlich sicher, sonst würde Herzfeld nicht so eine Eile an den Tag legen.«
»Viele Mäuler auf den Galeeren müssen essen«, murmelte Fugger sinnend.
Wieder nickte Wenzel dazu bestätigend, bevor er weitersprach.
»Pökelfleisch und Brot. Vor allem Brot. Herzfeld will alles an Getreide aufkaufen, was er kriegen kann. Er schickt Boten bis nach Rom. Auf der Suche nach Getreide für die Flotte.«
»Viele tausend hungrige Mäuler«, murmelte Fugger wissend.
Im selben Augenblick wurde ihm bewusst, wie wertvoll diese Information war. Sein Geschäftssinn regte sich. Niemand konnte ihn daran hindern, Herzfelds Beispiel zu folgen.
»Man sollte Geld in die Hand nehmen und ebenfalls Getreide kaufen«, sagte er.
Wenzel nickte langsam, und seine Augen blitzten schelmisch. Mit einem Gänsekiel deutete Fugger auf seinen Schreiber.
»Du hast doch noch mehr erfahren, alter Fuchs, du«, sagte er.
Der Mann straffte beide Schultern.
»Ich weiß, wo es Gerste zu einem guten Preis gibt. Und Dinkel.«
»Wie viel könnten wir kaufen?«
»Soviel wir wollen.«
»Du übertreibst.«
»Nein, Herr. Ich weiß von einem großen Vorrat. Und solange niemand mehr weiß, sind die Preise niedrig. Herzfeld will alle Schuldscheine abstoßen, um rasch Geld in die Hände zu bekommen.«
Fugger nickte verstehend, dann senkte er den Kopf und las noch einmal das Dokument. Eine Sache fiel ihm ganz besonders ins Auge, während Wenzel davon keinen Schimmer hatte. Aber gut, der Mann konnte ja nicht alles wissen. Fugger blickte wieder auf.
»Herzfeld gibt also Gulden für den Dom?«
»Ja, und mit Verlaub, Ihr solltet das auch tun, Herr.«
»Wie kommst du darauf?«
»Es ist gottgefällig.«
Wieder grinste Wenzel von einem Ohr zum anderen. Fugger lachte.
»Johannes, hör schon auf, wie ein verliebter Geck zu strahlen. Ich gebe kein Geld für dieses Gotteshaus. Und du weißt auch genau, warum.«
»Ja, Herr, aber die Leute reden schon.«
»Was kümmern mich die Leute?«
Fugger klappte den Deckel des kleinen Tintenfässchens zu. Ein winziger Tropfen spritzte auf den blanken Eichentisch. Er verrieb ihn mit der Fingerspitze und betrachtete dann die schwarz gefärbte Stelle auf seiner Haut.
»Die Leute denken, Ihr …«, begann Wenzel erneut.
»Sie sollen denken, was sie wollen.«
»Herr …«
»Solange korrupte Kerle einen Teil des Geldes in ihren eigenen Taschen verschwinden lassen, halte ich mein Geld zurück. Ich muss es schließlich erst verdienen.«
»Aber lieber Herr Fugger, jeder hier schmiert.«
»Wenzel, ich bin ein gläubiger Mensch, das weißt du. Und ich bin der Letzte, der sich Gottes Güte verschließt. Aber ich weigere mich, nur einen Gulden zu bezahlen, wenn ich nicht weiß, ob es mir nützt. Verstehst du mich? Wohin das Geld am Ende geht, ist mir gleich, wenn ich nur sicher sein kann, dass mir die Gulden etwas bringen, die ich einem dieser gierigen Kerle in den Rachen stecke.«
»Das weiß ich doch, lieber Herr, und gerade deshalb sind diese Neuigkeiten doch gar nicht so übel, meint Ihr nicht?«