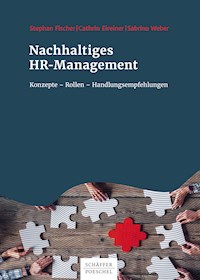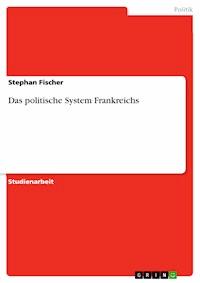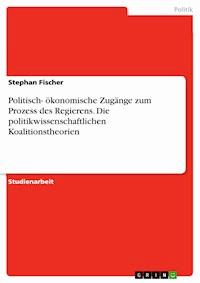Der deutsche Bundesrat zwischen Konkordanz und Konkurrenz - Vertretung der Länder oder Instrument der Parteien? E-Book
Stephan Fischer
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Politik - Politisches System Deutschlands, Note: 1,0, Technische Universität Dresden (Institut für Politikwissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Parteipolitisierung des Bundesrates ist ein in Öffentlichkeit und Wissenschaft unaufhörlich diskutiertes Thema. Häufig werden die Zustimmungsverweigerungen des Bundesrates, wenn sie nach parteipolitischen Gesichtspunkten getroffen werden, als Ursache für den oft konstatierten Reformstau in der Bundesrepublik Deutschland angesehen. Dabei war der Bundesrat nicht als Arena einer parteipolitischen Auseinandersetzung erschaffen worden. In diesem einzigartigen Organ sollten die Länder - und nicht die Parteien - an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mitwirken. Bei unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen in Bundestag und Bundesrat bietet sich aber jenen Parteien, die sich im Bundestag in der Opposition befinden, die Chance einer gestaltenden Mitwirkung durch den Bundesrat, wenn sie denn in der Lage zur Bildung einer mehrheitsfähigen Blockadefront sind. Diese Mitgestaltungsmöglichkeit ist insofern problematisch, da sie als Oppositionsparteien im Bundestag nicht in Regierungsverantwortung stehen. Die politische Entscheidungsfindung im parlamentarischen Bundesstaat ist folglich stark durch Aushandlungserfordernisse zwischen Bund und Ländern gekennzeichnet. Diese beiden Entscheidungssysteme - Aushandlungsprozesse einerseits, parteipolitische Konkurrenz andererseits - beruhen auf unterschiedlichen Handlungslogiken, die ein Mehr oder Minder an ´Politikstillstand´ produzieren können. Jenen Handlungslogiken widmet sich die vorliegende Arbeit. Mithilfe einer empirischen Untersuchung werden diese Tendenzen im deutschen Bundesstaat nachgewiesen. Folgende Sachverhalte werden vertiefend behandelt: Historische Vorläufer, Legitimationsgrundlage, Arbeitsweise des Bundesrates, Kompetenzverteilung im Bundesstaat, Gesetzgebung im Zweikammerverfahren, Politikverflechtung, ´divided government´, der Bundesrat als Vetospieler, konkurrenz- und konkordanzdemokratische Strukturelemente, Parteipolitik im Bundesrat, Auswirkungen divergierender Mehrheitsverhältnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
I Einleitung, Problemstellung und Gang der Argumentation
1. Forschungsstand und theoretische Grundlagen
II Der Bundesrat im politischen System der Bundesrepublik Deutschland
3. Historische Vorläufer des Bundesrates
4. Die Legitimationsgrundlage des Bundesrates
5. Der Bundesrat im Verfassungsgefüge der Bundesrepublik Deutschland
5. 1. Die Zusammensetzung des Bundesrates
5. 2. Die Stimmenverteilung im Bundesrat
5. 3. Präsident, Präsidium und Ständiger Beirat des Bundesrates
5. 4. Das Ausschusswesen
5. 5. Sonstige Einrichtungen
5. 6. Der Vermittlungsausschuss als gemeinsames Organ von Bundestag und Bundesrat
5. 7. Die Kompetenzverteilung im Bundesstaat als Ursache der Politikverflechtung
5. 8. Die Kompetenzen des Bundesrates im Gesetzgebungsverfahren
6. Der Bundesrat als Vetospieler
7. Die Bundesrepublik Deutschland zwischen Konkurrenz und Konkordanz
7. 1. Die konkurrenzdemokratischen Strukturelemente und das Parteiensystem in der Bundesrepublik Deutschland
7. 2. Die konkordanzdemokratischen Strukturelemente im politischen System der Bundesrepublik Deutschland
8. Der Bundesrat zwischen Konkurrenz und Konkordanz – ein Strukturbruch?
9. Die Auswirkungen divergierender Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat
III Der Bundesrat zwischen Parteipolitik und Vertretung von Länderinteressen
10. Inhaltsanalyse der Beschlussgründe des Bundesrates bei Anrufung des Vermittlungsausschusses
10. 1. Datenmaterial
10. 2. Kategorisierung der Begründungen des Bundesrates bei Anrufung des Vermittlungsausschusses
10. 3. Interpretation der Anrufungsbegründungen der 4. Wahlperiode
10. 4. Interpretation der Anrufungsbegründungen in der 14. Wahlperiode
10. 5. Interpretation der Anrufungsbegründungen der 15. Wahlperiode
10. 5. Parteipolitik im Bundesrat
IV Fazit
IV Quellennachweis
V Literaturnachweis
I Einleitung, Problemstellung und Gang der Argumentation
„Als wir im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz schufen (...), haben wir nicht geglaubt, dass die Länder im Bundesrat Parteipolitik treiben. Damals waren wir noch in der Illusion gefangen, die Länderregierungen würden sich loslösen von dem Kampf der Parteien, und wir nahmen an, dass nicht dieselben Parteivorstände oder Fraktionsvorstände, die im Bundestag ihren Einfluss ausüben, dies nun auch im Bundesrat tun würden.“[1]
Die Parteipolitisierung des Bundesrates ist ein in Öffentlichkeit und Wissenschaft seit langem diskutiertes Thema. Häufig werden die Zustimmungsverweigerungen des Bundesrates, wenn sie nach parteipolitischen Gesichtspunkten getroffen werden, als Ursache für den oft konstatierten Reformstau in der Bundesrepublik Deutschland angesehen. Dabei war der Bundesrat nicht als Arena einer parteipolitischen Auseinandersetzung erschaffen worden. Vielmehr sollten die Länder durch ihn an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mitwirken (Art. 50 GG), und nicht die Parteien. Bei unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen in Bundestag und Bundesrat bietet sich aber den Parteien, die sich im Bundestag in der Opposition befinden, die Chance einer gestaltenden Mitwirkung durch den Bundesrat, wenn sie denn in der Lage sind, eine mehrheitsfähige Blockadefront zu errichten. Diese Mitgestaltungsmöglichkeit ist problematisch, da sie als Oppositionsparteien im Bundestag ja nicht in Regierungsverantwortung stehen. Vor allem bei zustimmungspflichtigen Gesetzen kann eine beeindruckende Vetoposition aufgebaut werden. Dadurch entsteht ein Zwang zur Konsensbildung im Vermittlungsausschuss, wenn die Bundesregierung die Gefahr eines Scheiterns der von ihr eingebrachten Gesetzesvorlage minimieren will. Dieser Konsens kann häufig nicht nur durch die Berücksichtigung landesspezifischer Interessen erzielt werden, es sind ebenso die Politikvorstellungen der Oppositionsparteien zu berücksichtigen. Die politische Entscheidungsfindung im parlamentarischen Bundesstaat ist somit einerseits durch Aushandlungserfordernisse zwischen Bund und Ländern und andererseits durch den Parteienwettbewerb gekennzeichnet. Diese beiden Entscheidungssysteme beruhen auf unterschiedlichen Handlungsmustern: föderative Aushandlungsprozesse einerseits, parteipolitische Konkurrenz andererseits. Zutreffend gebraucht Manfred G. Schmidt daher den Begriff der „föderalistischen Konsensusdemokratie“[2].
Diese Problematik verweist auf ein Grundproblem des institutionellen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Die Parteienkonkurrenz sichert den Regierungsparteien im Bundestag die Möglichkeit der Umsetzung des mit Wählerauftrag ausgestatteten Regierungsprogramms durch Mehrheitsentscheid zu. Eine Konsensfindung ist „nur“ zwischen den Koalitionsparteien im Bundestag erforderlich und bei zustimmungspflichtigen Gesetzen erfolgt ein Bund-Länder-Ausgleich. Besteht dieser Konsens, so kann die parlamentarische Mehrheit im Bundestag ihr Regierungsprogramm durchsetzen und muss dafür auch die politische Verantwortung übernehmen. Werden Bundestag und Bundesrat von unterschiedlichen parteipolitischen Mehrheiten beherrscht, dann kann neben die Verhandlungserfordernisse von Bundes- und Landesebene zusätzlich die parteipolitische Dimension treten. Die bundesstaatliche Verhandlungsdemokratie erzeugt durch die ideologische Konkurrenz der Parteien einen Konsenszwang nicht nur zwischen Bundes- und Landesebene, sondern nun auch zwischen den Parteien, die sich im Bundestag als Regierung und Opposition gegenüberstehen.
Wenn die Abstimmung im Bundesrat nicht ausschließlich nach landesspezifischen Interessen, sondern ebenfalls auf der Grundlage von Parteipolitik erfolgt, dann wird die konkordanzdemokratische Prägung der Mitwirkung der Landesregierungen an der Bundesgesetzgebung durch eine parteipolitische und somit konkurrenzdemokratische Prägung überlagert. Bei parteipolitisch geprägter Zustimmungsverweigerung und anschließendem Vermittlungsverfahren können Blockadetendenzen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland entstehen, die zu einer geringeren Problemlösungsfähigkeit, einer Politik auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und einer demokratietheoretisch fragwürdigen Mitwirkung der Oppositionsparteien durch den Bundesrat führen. Der Bundesrat wird zum Blockadeinstrument der Opposition.
In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, inwieweit Parteipolitik im Bundesrat eine Rolle spielt. Um diese Frage klären zu können, werden die Anrufungsbegründungen des Bundesrates zum Vermittlungsausschuss auf ihre inhaltliche Begründung hin analysiert. Die spezifische Anrufungsbegründung dient als Indikator für die Art der Einflussnahme des Bundesrates auf den Gesetzgebungsprozess und erlaubt Rückschlüsse auf die Frage, ob eher Landesinteressen oder Parteipolitik die Arbeit des Bundesrates dominieren. Analysiert werden die Anrufungsbegründungen zum Vermittlungsausschuss in der 4., 14. und 15. Wahlperiode des Deutschen Bundestages. In der 4. Wahlperiode besaß die Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP eine parteipolitisch gleichgesinnte Mehrheit im Bundesrat. In der 14. Wahlperiode verfügte die Koalition aus SPD und Grünen nur bis April 1999 über eine Mehrheit im Bundesrat. Seit diesem Zeitpunkt herrschten uneindeutige Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat. Weder die Regierungs- noch die Oppositionsparteien besaßen eine absolute Mehrheit parteipolitisch gleichgesinnter Landesregierungen. Im Mai 2002 änderten sich die Mehrheitsverhältnisse. Seit diesem Zeitpunkt verfügten die Oppositionsparteien des Bundestages CDU/CSU und FDP bis Oktober 2005 über eine absolute Mehrheit an Bundesratsstimmen, also während der gesamten 15. Wahlperiode. Folglich werden Anrufungen des Vermittlungsausschusses bei gleichen, uneindeutigen und divergierenden Mehrheitsverhältnissen analysiert. Eine Beurteilung der Auswirkungen der unterschiedlichen parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse in Bundestag und Bundesrat wird dadurch ermöglicht.
Zunächst soll jedoch der Forschungsstand erörtert und auf die theoretischen Grundlagen eingegangen werden. Im Hauptteil der Arbeit wird der Bundesrat im Verfassungsgefüge der Bundesrepublik Deutschland verortet. Es werden die historischen Vorläufer betrachtet, die spezifische Legitimationsgrundlage vorgestellt und auf die Kompetenzen des Bundesrates im Gesetzgebungsverfahren eingegangen. Daraus abgeleitet erfolgt die Betrachtung des Bundesrates als Vetospieler im Gesetzgebungsverfahren. Da der Bundesrat zwischen konkordanz- und konkurrenzdemokratischen Strukturelementen eingeordnet werden soll, werden zunächst die Idealtypen dieser Demokratieformen dargestellt und aufgezeigt, wo diese Elemente im politischen System der Bundesrepublik anzutreffen sind, bevor die Frage gestellt wird, ob es sich bei der Verbindung dieser Elemente um einen Strukturbruch im Sinne von Lehmbruch handelt. Es werden sodann die möglichen Folgen unterschiedlicher parteipolitischer Mehrheitsverhältnisse in Bundestag und Bundesrat anhand der Theorie der legislativen Autolimitation skizziert. Eine selbst durchgeführte Inhaltsanalyse der Anrufungsbegründungen des Bundesrates zum Vermittlungsausschuss soll dann Aufschluss darüber geben, ob unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse einen Einfluss auf die Parteipolitisierung des Bundesrates haben. Im abschließenden Fazit werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst.
1. Forschungsstand und theoretische Grundlagen
Die Blockadeanfälligkeit des deutschen Föderalismus ist in der politikwissenschaftlichen Forschung ein oft diskutiertes Thema. Die Literatur zu diesem Thema ist so umfangreich, dass an dieser Stelle nur die grundlegenden Arbeiten erwähnt werden können. Die Blockadeanfälligkeit bzw. Handlungsunfähigkeit wird auf verschiedene Ursachen zurückgeführt, einerseits auf die Eigenarten des deutschen Föderalismus, andererseits auf die institutionellen Rahmenbedingungen der Entscheidungsfindung in der Bundesrepublik Deutschland. Es soll an dieser Stelle auf drei Aspekte eingegangen werden: die Politikverflechtungstheorie, die Auseinandersetzung um das Problem des Divided Government sowie das Vetospielertheorem.
Für Scharpf liegt die Ursache hauptsächlich in der spezifisch deutschen Art der Politikverflechtung begründet.[3] Die Politikverflechtung zwischen Bund und Ländern verursache „erhebliche Schwierigkeiten bei der Regelung von Verteilungsfragen. Eine Einigung ist zwar in der Regel möglich, wenn entweder Besitzstände gewahrt oder wenigstens die Gleichbehandlung aller Beteiligten gesichert werden kann. Wenn aber sachgerechte Lösungen nur durch Umverteilung zwischen den Ländern erreicht werden könnten, tendiert die Politikverflechtung zur Selbstblockade.“[4] Eine zweite Ursache für eine mögliche Handlungsunfähigkeit entsteht für Scharpf bei unterschiedlichen parteipolitischen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat. Zwar führe die bloße Existenz unterschiedlicher Mehrheiten nicht prinzipiell zu einer größeren Handlungsunfähigkeit, das Verhandlungssystem verliere seine Funktionsfähigkeit aber, „wenn eine zwischen Bundesregierung und Bundesratsmehrheit strittige Frage zum Gegenstand des öffentlich ausgetragenen Machtkampfes zwischen Regierung und Opposition wird. Dann geht es auf beiden Seiten nicht mehr um bessere oder weniger gute Lösungen in der Sache, sondern nur noch um Sieg oder Niederlage - die andere Seite in den Augen ihrer Anhänger zu demütigen oder sie in den Augen der Wähler als handlungsunfähig erscheinen zu lassen.“[5] Scharpf spielt somit vor allem auf die Profilierungsmöglichkeiten der Parteien im bikameralen Gesetzgebungsverfahren an.
Für Lehmbruch resultiert die Blockadegefahr maßgeblich aus dem Zusammentreffen der beiden unterschiedlichen Handlungslogiken von Parteiensystem und bundesdeutschem Föderalismus, also Konkurrenz auf der einen Seite, Zwang zur Kooperation auf der anderen Seite.[6] Diese Auffassung wird in der vorliegenden Arbeit geteilt, weshalb an späterer Stelle auf die Strukturbruchtheorie noch genauer eingegangen wird. Lehmbruch spricht nicht direkt von Blockadegefahr und genereller Unvereinbarkeit von Parteien- und Bundesstaatlichkeit aufgrund ihrer unterschiedlichen Handlungslogiken. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Inkongruenz der beiden Regelsysteme in „bestimmten Konstellationen zu schwerwiegenden institutionellen Funktionsstörungen führen kann.“[7] Diese treten hauptsächlich dann auf, wenn beide Regelsysteme aufeinandertreffen, nämlich im Falle unterschiedlicher parteipolitischer Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat.
Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Divided Government, also das Vorhandensein gegenläufiger Mehrheiten, steht besonders in der amerikanischen Politikwissenschaft im Blickpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen.
Zwei unterschiedliche Arten von Divided Government sind dabei zu berücksichtigen. Einerseits ist darunter eine gegenläufige parteipolitische Zusammensetzung von Regierungs- und Gesetzgebungsmehrheit zu verstehen, d.h. die an der Gesetzgebung beteiligten Institutionen sind parteipolitisch gegenläufig besetzt.
„Here, divided government refers to the absence of simultaneous same-party majorities in the executuve and legislative branches of government. In other words, the presence or absence of divided government is simply a function of a particular legislative arithmetic.“[8]
Andererseits kann unter Divided Government auch die bloße Existenz von unterschiedlichen Institutionen, die am Gesetzgebungsprozess beteiligt sind, gemeint sein. Die parteipolitische Zusammensetzung ist in diesem Fall weniger wichtig.
„More specifically, divided government corresponds to the situation where there is conflict between the executive and legislative branches of government whatever the support for the executive in the legislature.”[9]
So unterschiedlich wie die Ursachen, so unterschiedlich werden auch die Konsequenzen von Divided Government bewertet. Besonders in der amerikanischen Politikwissenschaft und im Bezug auf das amerikanische Regierungssystem werden die Folgen, die Divided Government auf die Effizienz des politischen Systems hat, unterschiedlich bewertet. Die Argumentation bewegt sich zwischen zwei Polen: Einerseits wird behauptet, dass Divided Government negative Folgen für die legislative Effizienz im amerikanischen Gesetzgebungsprozess hat. Andererseits werden diese negativen Folgen bestritten.
So wirkt sich für Sundquist Divided Government prinzipiell negativ aus. Besitzt der US-Präsident keine eigene Mehrheit im Kongress, so folgt für Sundquist daraus: „At worst, the executive and legislative branches become intent on discrediting and defeting each other´s initiatives, and the government is immobilized.”[10]
Dieser Meinung schließt sich Coleman an: „Employing a range of measures of important legislative enactments in the postwar period, I find that unified government produces greater quantities of significant enactments and is more responsive to the public mood than is divided government.“[11]
Der argumentative Gegenpol wird von Mayhew eingenommen. Dieser analysierte „investigation“ und „lawmaking“ des US-Kongress für den Zeitraum zwischen 1947/48 und 1989/90 unter den Bedingungen von gleichgerichteten und gegenläufigen Mehrheiten und kommt zu dem Schluss, „that unified as opposed to divided control has not made an important difference in recent times in the incidence of two particular kinds of activity. These are, first, high-publicity investigations in which congressional committees expose alleged misbehavior in the executive branch (…). And second, the enactment of a standard kind of important legislation (…), important laws have materialized at a rate largely unrelated to conditions of party control.”[12] Die ungleichen Ergebnisse der Untersuchungen scheinen ihren Grund weniger in einer unterschiedlichen Auffassung von Divided Government, als viel mehr in unterschiedlichen Analyseinstrumentarien zu haben.
Für die Betrachtung der Rolle des Bundesrates im Gesetzgebungsprozess ist besonders die erste Definition von Elgie, nach der Divided Government als das parteipolitische Auseinanderklaffen von Regierungs- und Gesetzgebungsmehrheit verstanden werden kann, von Bedeutung. In parlamentarischen Regierungssystemen wie der Bundesrepublik Deutschland entspricht aufgrund der anzutreffenden Koalitionsregierungen die Regierungsmehrheit auch der Parlamentsmehrheit. Minderheitsregierungen sind auf Bundesebene nicht anzutreffen, wenngleich sie prinzipiell nicht ausgeschlossen sind. Somit bedeutet Divided Government im deutschen Regierungssystem das Vorhandensein gegenläufiger parteipolitischer Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat.
Allerdings weist Roland Sturm überzeugend darauf hin, dass unterschiedliche parteipolitische Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat zwar eine notwendige Bedingung für das Auftreten von Divided Government ist, aber keineswegs eine ausreichende:
„It would be wrong to expect party-political confrontation in the Bundestag to be automatically repeated in the Bundesrat. Länder governments cannot permanently ignore Land interests. If, on certain issues, Länder follow their own interests and vote with the government, this may have the consequence of reducing the opposition´s arithmetical majority in the Bundesrat. Divided government is only politically relevant if Land governments see no problem in accepting the party line or if they consider that there is more to be gained from party-political confrontation at the federal level than from acting as advocates of their Land´s interests.”[13]
König und Bräuninger haben den Einfluss der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat auf die Politikergebnisse in der Bundesrepublik Deutschland analysiert und festgestellt, dass in der Tat Blockadeintervalle existieren, die in Abhängigkeit zu den inhaltlichen Positionen der Parteien, der Lage des Status quo und der parteipolitischen Zusammensetzung des Bundesrates stehen.[14] So zeigt König auf, dass bei unterschiedlichen Parteimehrheiten in Bundestag und Bundesrat erhebliche Effektivitätsverluste im Gesetzgebungsverfahren entstehen können, die auf abweichende inhaltliche Parteipositionen der Bundestags- und Bundesratsakteure und somit auf teilweise sehr große Blockadebereiche zurückzuführen sind.[15] Auch für Silvia sind Blockadetendenzen im Gesetzgebungsverfahren vorhanden. Da diese intervallartig auftreten und nicht permanent vorhanden sind, besteht allerdings nicht die Notwendigkeit struktureller Reformen.[16]