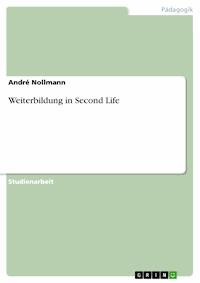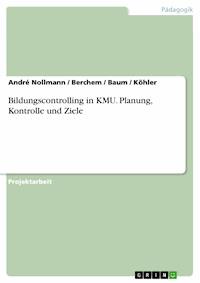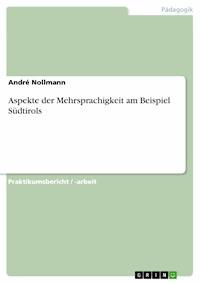Der Deutsche Qualifikationsrahmen: DQR. Eine Analyse im Aspekt der deutschen Berufsbildung E-Book
André Nollmann
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Pädagogik - Berufsbildung, Weiterbildung, Note: 2,1, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die gesamte Entwicklung des europäischen Bildungsraums basiert auf wichtigen bildungspolitischen Stationen und Ergebnissen, vorrangig die weitgehende Umsetzung des Bologna-Prozesses und der Lissabon-Strategie. Auf einige der getroffenen Beschlüsse und Papiere möchte ich kurz eingehen. Mit den genannten Stationen des Konsultationsprozesses wird sich das zweite Kapitel dieser Arbeit beschäftigen und dabei die Beschlüsse, Empfehlungen und Resultate genauer beleuchten. Im dritten Kapitel sollen neben dem Leistungspunktesystem für die Hochschulbildung (ECTS) schwerpunktmäßig das in der Entwicklung befindliche Leistungspunktesystem der beruflichen Bildung (ECVET) und ansatzweise der Entwicklungsstand des deutschen Pendants DECVET sowie mögliche Verfahren zur gegenseitigen Anrechnung der Leistungspunkte hochschulischer und beruflicher Bildung analysiert werden. Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) als Meta- und Referenzrahmen wird das Thema des vierten Kapitels sein, dabei wird auf die Konstruktion sowie die Zielsetzungen im europäischen und nationalen Kontext und das Funktionsprinzip auf europäischer Ebene eingegangen. Im darauf folgenden fünften Kapitel wird das Orientierungsinstrument Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) als das zentrale Thema der vorliegenden Arbeit interpretiert und bildungsbereichsübergreifend diskutiert. Der DQR wird, ebenso wie zuvor der EQR, bezüglich seiner Struktur, seiner bildungsbereichsübergreifenden Zielsetzung und seines angestrebten Funktionsprinzips auf nationaler Ebene analysiert, wobei hier die aktuell mäßige Quellenlage und auch der noch laufende Entwicklungsprozess, beides mit Stand Anfang Januar 2009, berücksichtigt werden müssen und nicht der Diskussionsvorschlag des Arbeitskreises DQR vom Februar 2009. Im sechsten Kapitel wird in einem differenzierten Ausblick auf die Chancen eines möglichen Deutschen Qualifikationsrahmens bezogen auf eine Neustrukturierung des Berufsbildungssystems, das Berufsprinzip und die Beruflichkeit, einschließlich einer Reformierung bzw. Erhaltung des Dualen Systems, eingegangen. Dabei werden nur zwei der wesentlichen Punkte der deutschen Berufsbildung beispielhaft analysiert ohne dabei den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Einerseits die angestrebte Outcome-Orientierung im Verhältnis zur bestehenden Input-, Prozess- und Output-Orientierung (6.1.) und andererseits die drohende Erosion des Berufsprinzips durch die aufkommende Modularisierung der Berufsbildung (6.2.).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Ausgangssituation und Zielsetzung
1.2. Methodik und Aufbau
2. Die Stationen der Europäisierung beruflicher Bildung
2.1. Die Konferenz von Lissabon
2.2. The Copenhagen Declaration
2.3. Das Kommuniqué von Maastricht
2.4. Exkurs: The Budapest Conference
2.5. Das Kommuniqué von Helsinki
2.6. The Bordeaux Communiqué
3. Die Leistungspunktesysteme der allgemeinen und der beruflichen Bildung
3.1. Das Leistungspunktesystem der allgemeinen Hochschulbildung ECTS
3.2. Das Leistungspunktesystem der beruflichen Bildung ECVET
3.3. Das Deutsche Leistungspunktesystem der beruflichen Bildung DECVET
3.4. Gegenseitige Anrechnungsmöglichkeiten
4. Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR)
4.1. Konstruktion des Metarahmens EQR
4.2. Zielsetzung im europäischen und nationalen Kontext
4.3. Funktionsprinzip auf europäischer Ebene
5. Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)
5.1. Struktur des nationalen Orientierungsinstruments DQR
5.2. Bildungsbereichsübergreifende Zielsetzung
5.3. Funktionsprinzip auf nationaler Ebene
6. Der DQR im Aspekt der deutschen Berufsbildung
6.1. Input- / Output-Orientierung versus Outcome-Orientierung
6.2. Modernes Berufsprinzip contra Modularisierung
7. Fazit und Desiderata
7.1. Zusammenfassung
7.2. Ausblick
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Anhang
Anhang I
Anhang II
Anhang III
Erklärung selbstständiger Erarbeitung
2. Die Stationen der Europäisierung beruflicher Bildung
Um den aktuellen Transformationsprozess innerhalb Europas besser einordnen zu können, müssen verschiedene Entwicklungsstufen berücksichtigt werden. Historisch gesehen zählen insbesondere auch die wirtschaftlichen Zusammenschlüsse einiger europäischer Nationalstaaten dazu. Das Fundament bildet die „Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (EGKS, auch Montanunion genannt) von 1952 mit Frankreich, Italien, der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Darauf aufbauend wurden 1957 die so genannten Römischen Verträge unterzeichnet, welche die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG, heute EURATOM) mit beinhalten. 1967 koitierten diese drei Bündnisse zu den Europäischen Gemeinschaften, welche im weiteren Verlauf mit dem Maastrichter Vertrag (1992) Teil der Europäischen Union (EU) mit all ihren Organen und Gremien wurden.
Der Fokus dieses Kapitels bezieht sich auf die Versammlungen der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates, als Organe der Europäischen Union, zur Einführung und Entwicklung eines Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR) sowie deren Beschlüsse. Diese für die europäische Bildungspolitik sehr wichtigen Treffen, mit dem Ziel der wirtschaftlichen und bildungspolitischen Zusammenarbeit in Europa, werden nachfolgend aufgeführt und analysiert. Beginnen wird die Analyse mit der Konferenz von Lissabon im Abschnitt 2.1., welche die Grundlagen auf dem Weg zu einer gemeinsamen europäischen beruflichen Bildung legt, unter anderem mit der bedeutenden strategischen Zielsetzung. Nachfolgend wird im zweiten Abschnitt (2.2.) die Kopenhagener Deklaration thematisiert, um darauf aufbauend zur Maastricht Communiqué (2.3.) zu kommen. Als kurzer Exkurs wird im Abschnitt 2.4. die Konferenz von Budapest betrachtet, um einen Einblick in eine der weiteren europäischen Konferenzen zu ermöglichen, diese soll aber als alleiniges Beispiel genügen. Desweiteren wird das Kommuniqué von Helsinki analysiert (2.5.), welches zeitlich das Erreichen der Hälfte des vollständigen Konsultationsprozesses (derzeit geplant bis 2012) symbolisiert. Abschließend zu diesem Kapitel wird im Abschnitt 2.6. The Bordeaux Communiqué beleuchtet, womit die wichtigen europäischen Stationen und der bisherige Verlauf des Konsultationsprozesses ebenfalls schließen werden.
Der weitere Konsultationsprozess soll mit der Konferenz von Brügge, Brüssel im Jahr 2010 fortgesetzt werden, wobei dann auch die Ausrichtung der neuen europäischen Strategie, sofern die EU eine weitere beschließt, zu diskutieren sein wird. Diese Diskussion sollte dann auf den Ergebnissen der bisherigen Konsultationen, der Implementierung der gemeinsamen europaweiten Instrumente, der Evaluationen und den daraus resultierenden Erfahrungen und Schlussfolgerungen basieren, um den weltweiten Herausforderungen u.a. der fortschreitenden Globalisierung wirkungsvoll entgegenzutreten und konstruktiv zu nutzen. Es gab noch eine Reihe weiterer Konferenzen zu diesem Themenkomplex, doch sind diese weitgehend zu vernachlässigen und bestätigen meist nur nochmals die zuvor getroffenen Entscheidungen.
2.1. Die Konferenz von Lissabon
Als Ausgangspunkt für die weitere bildungspolitische Entwicklung wird das EU-Gipfeltreffen in Lissabon im März 2000 betrachtet. Indem dieses Treffen den Schwerpunkt auf die berufliche Aus- und Weiterbildung legt und die persönliche Entwicklung im Arbeits- und Berufsleben auf europäischer Ebene zum Inhalt macht, wird es elementar für den folgenden Auf- und Ausbau eines gemeinsamen europäischen Bildungs- und Beschäftigungssystems. Die Repräsentanten kamen zu einer Sondertagung zusammen, um ein neues strategisches Ziel mit enormen Ansprüchen und Zielen zu verabschieden. Mit dieser Vereinbarung und im Rahmen des neuen Ziels sollen „Beschäftigung, Wirtschaftsreform und sozialer Zusammenhalt als Bestandteil einer wissensbasierten Wirtschaft gestärkt werden“ (Europäischer Rat 2000, S. 3).
Die Europäische Union hat die globalen Veränderungen und Umstrukturierungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft analysiert und zum Anlass genommen, um eigene Umgestaltungen, auch in Bezug auf die Unionserweiterungen, vorzunehmen. Dabei sollen wirtschaftliche und soziale Aspekte miteinander verknüpft sowie das europäische Gesellschaftsmodell, insbesondere in Bezug auf die heutige Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft, flexibel, sicher und innovativ gestaltet werden. Im Zuge der Umsetzung soll diesbezüglich die Europäische Union als ein einheitlicher und in sich geschlossener Repräsentant agieren, mit dem Anspruch eines sog. „Global Players“[1] und wie es das formulierte Ziel ausdrückt:
„die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum in der Welt zu machen - einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“(Europäischer Rat 2000, S. 3).
In dieser „globalen Strategie“ des Europäischen Rates werden drei Punkte in besonderer Weise betont. Diese Kernpunkte beinhalten das:
„- der Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft durch bessere Politiken für die Informationsgesellschaft und für die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie durch die Forcierung des Prozesses der Strukturreform im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und Innovation und durch die Vollendung des Binnenmarktes vorzubereiten ist;
das europäische Gesellschaftsmodell zu modernisieren, in die Menschen zu