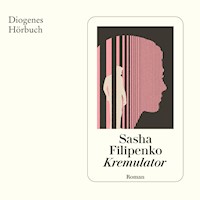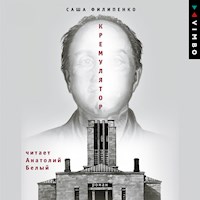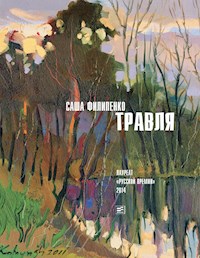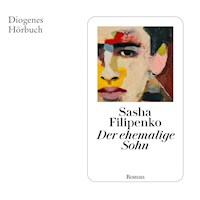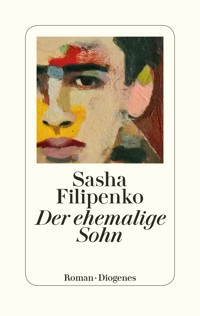
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich sollte der junge Franzisk Cello üben fürs Konservatorium, doch lieber genießt er das Leben in Minsk. Auf dem Weg zu einem Rockkonzert verunfallt er schwer und fällt ins Koma. Alle, seine Eltern, seine Freundin, die Ärzte, geben ihn auf. Nur seine Großmutter ist überzeugt, dass er eines Tages wieder die Augen öffnen wird. Und nach einem Jahrzehnt geschieht das auch. Aber Zisk erwacht in einem Land, das in der Zeit eingefroren scheint. Wie fühlt sich ein junger, lebenshungriger Mann in Belarus? Eine hochaktuelle Geschichte über die Sehnsucht nach Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sasha Filipenko
Der ehemalige Sohn
Roman
Aus dem Russischen von Ruth Altenhofer
Diogenes
Für meine Großmutter
Vorwort
Das Buch, das Sie in Händen halten, hat ein glückliches Los. Kaum war es 2014 erschienen, erhielt ich als blutjunger Schriftsteller von 29 Jahren einen der renommiertesten russischen Literaturpreise. Der Roman wurde mehrmals neu aufgelegt, als Theaterstück inszeniert, in verschiedene Sprachen übersetzt, und das alles freut mich als Autor, macht mich als Staatsbürger aber traurig …
Nach dem ›Russkaja Premija‹ für Der ehemalige Sohn wurde der Roman nicht nur gelobt, sondern es hagelte, wie üblich, auch Kritik. Der häufigste Vorwurf lautete kurz und bündig: So etwas gibt es nicht. Zum Glück oder zum Unglück haben die Ereignisse von 2020 wieder einmal gezeigt, dass ich bei meiner Beschreibung des ins Koma gefallenen Belarus ehrlich mit mir selbst und mit meinen Lesern war. Dieses Buch ist ein Versuch zu analysieren, warum mein Land eines Tages in einen lethargischen Schlaf sank, aus dem es scheinbar gar nicht wieder aufwachen wollte. Dieses Buch ist (zumindest hoffe ich das) eine Erklärung dafür, warum die Belarussen 2020 nicht mehr weiterschlafen wollten und aus ihrem Koma erwachten. Dieses Buch ist ein Versuch zu begreifen, warum wir zu ehemaligen Söhnen und Töchtern des eigenen Landes und ehemaligen Kindern der eigenen Eltern wurden. Dieses Buch ist im Grunde ein Lexikon von Anlässen, ein Wörterbuch von Gründen für die Belarussen, ihre Häuser zu verlassen.
Zum Glück für den Autor, aber zum Leidwesen der Belarussen sind ganze Seiten aus meinem Roman Wirklichkeit geworden, und es kommen immer noch mehr dazu.
Es ehrt mich, dass nicht nur Kritikerinnen und Leser auf mein Buch aufmerksam wurden, sondern auch die Staatsmacht: In den meisten Minsker Buchläden ist Der ehemalige Sohn zwar erhältlich, aber nur unter der Hand, er steht nicht in den Regalen. Und der belarussischen Nationalbibliothek wurde dringend empfohlen, das Buch nicht in den Katalog aufzunehmen.
Dieses Buch erzählt von einem Land mitten in Europa, in dem das oben Beschriebene möglich ist. Vor allem aber handelt es von der Liebe – von der Liebe, die die Kraft hat, einen Menschen zu heilen und ein ganzes Land aus dem Tiefschlaf zu wecken.
Meine inständige Hoffnung ist, dass dieses Buch in meinem Land eines Tages nicht mehr aktuell sein wird …
Sasha Filipenko
Der ehemalige Sohn
Der Frühling war fast vorbei. Die Uhrzeiger rückten auf halb neun. Wie ein Tiefflieger setzte die Sonne zur Landung an. Vereinzelt überdeckten Brücken in Rohre gezwängte Flüsse. Steigende Luftfeuchtigkeit, dampfender Schweiß. In der syphilitischen Stadt schmolz vor Hitze der Asphalt. Akrobaten stürzten ab.
Wie Saiten zogen sich die Oberleitungen. Entlang der Linien fuhren leere Trolleybusse. Die obersten Knöpfe standen offen, die Kleidung blich aus. Wasser verkaufte sich so gut wie sonst nie. In den Hauseinfahrten und Gassen hing Schwüle. Die Erde bettelte um Regen. Die erste Sonnenbräune war da, und die Alten konnten sich nicht einmal vor laufender Kamera an solche Temperaturen erinnern.
Franzisk hielt inne, rieb sich die Stirn. Mit zwei Fingern stoppte er den Zeiger des Metronoms und horchte: Im Badezimmer schleuderte die Waschmaschine, in der Küche lief wie immer das Radio. Sie spielten Ravel. Großzügig überließen die Flöten ihre Melodie der Klarinette, und die Trommel hämmerte wie Regentropfen auf die Erde. Das Spiel war bestimmt und pathetisch, wie es sich für das staatliche Radiosymphonieorchester geziemt – keine Ausreißer oder Abstriche wegen schwacher Besetzung. Franzisk stellte sein Cello auf die Zarge und ging zum Fenster. Das Metronom schlug weiter. Im Flur telefonierte die Großmutter. Seit einer Stunde. Im Hof wurde Fußball gespielt. »Es dämmert schon«, dachte Franzisk. »Wenn sie zwei gleiche Mannschaften gebildet haben, brauchen sie mich gar nicht mehr.«
Wie absichtlich machten sie keine Anstalten, nach Hause zu gehen. Franzisk hörte immer denselben Ruf: »Zurück! Zurück!« Offenbar hatte eine der Mannschaften Schwierigkeiten bei der Verteidigung. Einer ließ immer den Ball durch, ein anderer machte Fehlpässe. Da waren wahrscheinlich Wara und Paschka am Verlieren. Während er den Spielenden zuschaute, dachte Zisk, dass nur er das Wunder wiederholen könnte, das drei Tage zuvor die Red Devils vollbracht hatten.
Schwer wie ein alter Mann schnaufte der Kassettenrekorder, während er den Ton aufzeichnete. Zisk drückte auf das schwarze Quadrat, und der Apparat verstummte. Jetzt musste er nur noch das Band zurückspulen, die Aufnahme einschalten und sich unbemerkt in den Flur schleichen. Ein erprobter Trick, Zisk hatte ihn schon etliche Male angewandt. Der Rekorder übte – und Großmutter glaubte es.
Alles lief nach Plan. Franzisk hockte vor der Eingangstür, die Schlüssel in der Hand, die Schuhe gebunden – als plötzlich sein Knie verräterisch laut knackte. Das Flattern des Fächers verstummte, für einen Moment war es still. Die Großmutter entschuldigte sich bei ihrer Gesprächspartnerin und wandte sich an den Enkel:
»Du gehst hinaus? Ich glaube nicht, dass ich dich um irgendetwas gebeten habe.« Franzisk sagte nichts, die Großmutter wartete seine Antwort gar nicht erst ab. »Du solltest dich schämen, deine Mitmenschen zu hintergehen! Dass du dich auf Kassette aufgenommen hast, ist löblich. Erstens hast du die Etüde endlich fertiggespielt, worauf der Urheber stolz wäre. Zweitens kannst du jetzt deine Fehler hören. Das wirkt Wunder, mein Lieber!«
»Babuschka, warum darf ich denn nicht raus?«
»Darum!«
»Genug gepredigt, Ba! Sie hören ohnehin gleich auf. In einer halben Stunde ist es finster, ich will wenigstens noch Four Square spielen …«
»Dann wirst du eben Straßenmusikant. Viel Spaß!«
»Fußballspielen im Hof hat noch keinen zum Straßenmusikanten gemacht! Aber von der Musik den Verstand verloren haben schon viele. Kann ich bitte gehen?«
»Nein! Es sind nur noch ein paar Tage bis zur Prüfung. Und du läufst eh schon Gefahr rauszufliegen.«
»Die Prüfung ist erst nach der Notenkonferenz. Nach der Notenkonferenz schmeißen sie keinen mehr raus. Und außerdem, vielleicht bestehe ich ja mit Bravour?«
»Das wage ich zu bezweifeln. Marsch in dein Zimmer!«
»Babuschka, bei dem Wetter!«
»Das Wetter ist wirklich schön, da gibt’s nichts zu meckern. Und mit jedem Tag wird es schöner, mein Lieber. Genieß es – nach der Prüfung!«
»Und wenn mir etwas zustößt? Wenn das meine letzte Gelegenheit ist rauszugehen?«
»Du bist doch schon groß, oder nicht? Ich hätte angenommen, dass dir dieses Argument mittlerweile selbst zum Hals heraushängt. Geh jetzt bitte in dein Zimmer, und mach dir nicht so viele Gedanken, zu Hause kann dir nichts passieren. Weißt du noch, wie der große Dichter geschrieben hat: Geh nicht aus dem Zimmer raus, mach nicht diesen Fehler.«
»Der war übrigens ein Nichtsnutz. Sogar ein staatlich anerkannter!«
»Seit wann hältst du was auf den Staat? Rein mit dir, marsch!«
Franzisk schnalzte genervt mit der Zunge, schleuderte die Sportschuhe hin und ging zurück in sein Zimmer. Er knallte die Tür zu und warf sich aufs Bett, verletzt und von jugendlichem Zorn erfüllt. »Die alte Hexe spielt schon wieder die ewige Leier. Bildung … Zukunft … Kühe hüten … Was hat die überhaupt für eine Ahnung von meiner Zukunft? Die reden von Zukunft, und vor zwei Wochen ist ein Junge aus der Parallelklasse einfach mitten im Unterricht gestorben. Herzstillstand. Was hat das ganze Lernen für einen Sinn? Was sollen all diese zweistimmigen Diktate und Dreiklangketten? Wer braucht diese Fach- und Klavierprüfungen, wen interessiert dieses bescheuerte Orchester dreimal die Woche, wenn man einfach so, fünf Minuten vor der Pause, den Löffel abgeben kann?«
»Spielst du jetzt im Liegen?«, fragte die Großmutter durch einen Spalt in der Tür.
»Die Nachbarin wird sowieso gleich klopfen.«
»Dann geh halt, aber gib acht auf deine Hände.«
Das Jüngste Gericht fand jedes Jahr statt. Das musste so sein. In den letzten Maitagen verlas der strahlende, dicke Direktor in Anwesenheit der entkräfteten und verheulten Eltern die Namen jener, die sich verabschieden mussten:
»Mascherow, Kalinowski, Kostjuschko sind raus. Damit ist die 7B erledigt, kommen wir zur nächsten Klasse.«
Jedes Jahr gegen Frühlingsende fasste der Lehrkörper (in Person des Lyzeumsdirektors) denselben heiligen Gedanken:
»Die Arche des Wissens kann nicht alle aufnehmen, liebe Kollegen! Wer nachlässt, muss über Bord! Wer zurückbleibt, wird es nicht schaffen, die Welt des Wissens zu errudern! Wer untergeht, soll sich andernorts abstrampeln!«
Nach diesen linguistischen Ausschweifungen fasste der Lyzeumsdirektor, den sie wegen seiner Leibesfülle Kogel nannten, zusammen:
»Verehrte Eltern, bei uns kann man, zum Glück oder leider, kein Schuljahr wiederholen. Das habe ich Ihnen immer geradeheraus gesagt. Ljudmila Nikolajewna, schließen Sie bitte die Tür, die Kinder horchen schon wieder.«
Die, die der Grund für den Ehrentag waren, ließ man nicht in den Saal. Es gab nicht genug Stühle, es gab nicht genug Worte. Damit sie sich nicht an der Tür drängten, hatte sich der Direktor etwas Einfaches und, wie ihm schien, äußerst Findiges ausgedacht. Jedes Jahr lud er am Tag der Notenkonferenz einen Gast in die Schule ein. Wie das Amen im Gebet war es jedes Mal ein Kriegsveteran. Mit Orden immer, mit Gehstock je nachdem. Auf die Bühne in der Aula stellte man einen Tisch und eine Vase mit drei Nelken, echte oder aus Plastik (was gerade aufzutreiben war). Dann stieg der Veteran selbst auf die Bühne. Die Gymnasiasten applaudierten und kommentierten: »Schau, der trägt drunter schon den Holzpyjama … Gleich fängt er an zu labern, der alte Knacker … Erzählt auf Staatskosten olle Geschichten.«
Neben den Veteranen setzte sich die Beauftragte für Bildungsarbeit: »Entschuldigen Sie bitte, ich musste durch das ganze Schulhaus.« Der Veteran nickte verständnisvoll, hustete, zupfte seine Feiertagskrawatte zurecht und begann leise und ideologisch wasserdicht vom Krieg zu erzählen. Obwohl die Lyzeumsschüler bei diesen Helden- und Ruhmesgeschichten reihenweise einschliefen, suchte der Direktor kein neues Unterhaltungsprogramm. Er gehörte zu jener Sorte von Trainern, die ihre ganze Karriere hindurch mit immer derselben Aufstellung arbeiten. »Wozu etwas Neues erfinden? Wer braucht andere Kandidaten? Ljudmila Nikolajewna, laden wir doch diesen … na, wie heißt er denn … der letztes Jahr da war …«
Wirklich, nach neuen Kandidaten suchte niemand. Nicht ohne Grund nahmen deshalb viele Schüler an, dass es in ganz Belarus nur einen einzigen Partisanen gegeben habe. Der seine Zeit schon immer damit verbracht habe, von Schule zu Schule zu wandern und den Kindern die Ohren vollzusülzen.
Am Ende dieser Abende hob die Bildungsbeauftragte den Blick zum Porträt des Präsidenten der jungen Republik und fasste zufrieden zusammen:
»Nun, Kinder? Früher gab es Gott sei Dank den Vater aller Völker, und jetzt haben wir Gott sei Dank unseren Batka! Also müsst ihr nicht fürchten, dass uns ein Krieg droht!« Nach diesen weltbewegenden Worten sprang sie auf und rannte in Richtung Saal. Der Veteran lächelte irritiert und entfernte sich.
An jenem heißen Maitag sollte alles nach lang erprobtem Szenario ablaufen. Goldene Worte über Heldentaten, verstaubte Gedichte über soldatische Ehre. »Wir haben für die Heimat gekämpft, für eure Zukunft, niemand hat uns dazu überredet, niemand bedroht, es gab keine Sperrtruppen, wir brannten immer darauf zu kämpfen!«
An jenem fatal heißen Maitag waren weder beim Hauptdarsteller noch bei den zahlreichen Zuhörern Kommunikationsprobleme zu erwarten. Der Veteran wusste, dass er den Kindern den Auslauf raubte, die Kinder wussten, dass sie dem Veteranen Respekt zollen mussten, denn wäre er nicht gewesen, wer weiß, was jetzt überhaupt wäre. Franzisk bemalte die Rückseite der Stuhllehne vor sich und hörte mit halbem Ohr den Begrüßungsworten zu. Sein bester Freund Stassik Krukowski rubbelte verbissen an einem Fleck auf seinen Jeans. Neben ihnen wurde geflüstert, geknufft, wurden Briefchen weitergegeben. Einige stellten noch schnell die letzte Solfeggio-Aufgabe fertig, während andere verzweifelt ein Schnarchen imitierten. Mit einem Wort, die Veranstaltung verlief in der gewohnt harmonischen Atmosphäre, doch plötzlich horchte der Saal auf, und die Schüler verstummten. Der Veteran hatte etwas gesagt, was er nicht sagen durfte.
Die Bildungsmaschinerie geriet ins Stocken. Jemandem war ein Fehler unterlaufen, jemand hatte nicht genau hingeschaut. Hatte überhaupt nicht hingeschaut! Hatte einen Balken übersehen. In einem fremden Auge. Ein »falscher« Mensch war ins Lyzeum eingeladen worden. Erst jetzt sahen alle, dass er ohne Orden gekommen war und seine Erzählung einen anderen, unpathetischen Krieg betraf, den Krieg, den er erlebt hatte.
»Kinder, ich sage euch gleich direkt, dass ich nicht gegen die Deutschen gekämpft habe. Seht mal, ich habe auch keine Auszeichnungen. Mir haben sie keine gegeben. Ich bin kein Veteran im herkömmlichen Sinn. Soll ich überhaupt weitersprechen?«
Die erschrockene Bildungsbeauftragte nickte mit bebender Turmfrisur.
»Dann fahre ich fort, wenn’s recht ist. Mich lädt man nicht zu Paraden ein. Ich würde auch nicht hingehen. Es wundert mich, dass euer Geschichtslehrer, Waleri Semjonowitsch, mich eingeladen hat. Ich soll euch erzählen, wie alles war … Und wie war alles? Beschissen war es, Kinder!«
Der Saal erstarrte. Hatte die Stimme verloren. Die Stille war absolut. Die Arche der Künste war ins Strudeln geraten, der Mast gebrochen, das Segel in sich zusammengesackt. Die Kinder hatten ihren Unfug eingestellt. Franzisk hörte zu zeichnen auf. Der Fleck war verschwunden. Stass blickte sich nach allen Seiten um: Keine Welle kräuselte die Reihen, keine einzige Bewegung. Sogar jene schwiegen, deren Schwatzhaftigkeit pathologische Züge aufwies.
»Wir haben gegen alle gekämpft. Heute glaubt uns das niemand, sie sagen, so kann es nicht gewesen sein. Aber es war so, Kinder, es war so, auch wenn viele mich für verrückt halten. Grob gesagt, war es so: Morgens kämpften wir gegen die Hilfspolizei, abends gegen die Roten. Ja, genau, gegen alle. Wir haben keinen heiligen Befreiungskrieg geführt. Sind nicht von Osten nach Westen vorgedrungen oder umgekehrt. Nein. Wir standen hier. An Ort und Stelle. Im eigenen Land. Wir standen, versteht ihr, Kinder? Wir haben uns nicht auf Feldbunker gestürzt. Haben uns nicht für den kommunistischen Führer geopfert. Nein, Kinder, das war alles ganz anders! Ich kann euch nicht von Dingen erzählen, wie sie in Kriegsfilmen passieren, weil unser Krieg anders war. Unser Krieg war schmutzig, eklig und versaut, weil unser Krieg eigentlich ein Bürgerkrieg war. Weiß jemand von euch, was einen Bürgerkrieg von einem normalen Krieg unterscheidet?«
»Ja-a-a-a«, hörte man aus den letzten Reihen. »Das ist, wenn sie die eigenen Leute abmurksen.«
»Richtig, Kinder. Das war der schlimmste aller Kriege. Weil wir nicht nur gegen die Deutschen gekämpft haben, sondern auch gegen die eigenen Leute … Gegen die eigenen Leute, versteht ihr? Ich persönlich habe nie jemandem Vorwürfe gemacht. Wenn der Krieg anfängt, hast du immer die Chance, dich für eine Seite zu entscheiden oder neutral zu bleiben, oder es wenigstens zu versuchen. Ich rate euch, Kinder: Wenn irgendwann, Gott bewahre, ein Krieg beginnt, dann setzt euch hin und denkt gut nach: Für wen wollt ihr kämpfen, und ob ihr überhaupt kämpfen wollt! Die großen Onkels, die sich mit Flugzeugen frische Früchte liefern lassen, treffen die Entscheidungen, aber sterben werdet ihr – schnell und nur ein einziges Mal. Glaubt mir, ich habe gesehen, wie Menschen sterben – die haben nie ein zweites Leben. Deswegen immer, immer, immer nachdenken. Gut nachdenken. Und viel.«
»Jetzt komm ich nicht mehr mit. Für wen waren Sie denn jetzt, für die Deutschen?«, ertönte es aus den hinteren Reihen.
»Nein, Kinder, nicht für die Deutschen. Nein! Wisst ihr, ich habe das immer so gesehen: Wenn dir ihre Ideale nahe sind, wenn du die Roten hasst, wenn du an die Versprechen ihres durchgeknallten Führers glaubst, dann geh zur Hilfspolizei, warum nicht? Schlag dich auf ihre Seite, wenn du tatsächlich dran glaubst. Außerdem hatten sie eine sehr schicke Uniform, die hat mir ehrlich gesagt immer sehr gut gefallen. Ein berühmter Modeschöpfer hat sie entworfen. Ich hab immer gefunden, dass sie sehr gut aussehen, jedenfalls viel besser als wir. Aber das war das Einzige, was mir an ihnen gefallen hat. Alles andere hab ich gehasst, Kinder! Sie wollten uns umkrempeln, und das ist das Schlimmste. Man kann vieles ertragen und überleben, aber eines, Kinder, eins darf man nicht zulassen. Man darf nicht zulassen, dass man zu einem anderen gemacht wird, versteht ihr?«
»Und los geht’s …«
»Kobrin!«, rief die Bildungsbeauftragte zornig.
»Wieso gleich Kobrin? Vielleicht bin ich gar nicht da.«
»Hätte ich also zu den Roten gehen sollen, Kinder? Warum hätte ich, ein einfacher junger Belarusse, denn nicht für die Roten sterben sollen? Sie sitzen in ihren Städten, evakuieren Dichter und Musiker, erschießen meine Eltern dafür, dass diese ihre Sprache sprechen … Wirklich, warum sollte ich nicht für ihren Führer kämpfen? Für den großen Bruder? Warum sollte ich nicht mein Leben geben für einen Irren, der es nicht schafft, den Kontinent mit einem zu teilen, der genauso ein Idiot ist wie er selber? Wenn du dran glaubst, warum auch nicht? Aber ich, Kinder, ich hab denen nicht getraut. Nie.«
»Wem haben Sie denn getraut?«, fragte die Bildungsbeauftragte mit belämmertem Lächeln.
»Niemandem! Weder den einen noch den anderen. Ich hab nur an mein Zuhause geglaubt. An mein Land. An den Himmel über meinem Kopf. Ich habe darauf vertraut, dass ich allein entscheiden kann und darf, wo und wie ich leben will.«
»Und was haben Sie gemacht? Desertiert?«
»Von Ihrem hohen Ross aus nennt man das so, glaube ich. Ja. Ich bin in den Wald gegangen …«
»Sie haben sich also gedrückt?«, fragte mit hämischem Grinsen die Bildungsbeauftragte, die mit Unterstützung aus den hinteren Reihen rechnete.
»Die Deutschen hielten mich für einen Partisanen, die Partisanen und die Roten für einen Kollaborateur der Deutschen. Mein Krieg hat so ausgeschaut: am Morgen gegen die einen, am Abend gegen die anderen. Wenn Sie das ›sich drücken‹ nennen, gut, dann hab ich mich gedrückt.«
Im Saal wurde es laut. Die Schüler wollten einander etwas erklären, beweisen, diskutieren.
»Was, Sie haben allein gegen alle anderen gekämpft?«
»Natürlich nicht! Wir waren viele. Viele haben gehandelt wie ich, aber darüber spricht man heute nicht. Wir haben nicht gewonnen, und vom Krieg erzählen dürfen nur die Sieger. Mein Leben, mein Schicksal ist ein einziger permanenter Rückzug. Solche wie mich gibt es irgendwie nicht. Ich hielt mich ein paar Jahre im Wald versteckt, in den Häusern von Katholiken oder Unierten. Im Jahr 46 bin ich, so wie viele meiner Kameraden, auf einen entlegenen Hof gezogen und habe dort fast zwanzig Jahre allein gelebt. Danach kam ich manchmal in die Stadt, aber erst im Jahr 91, sechsundvierzig Jahre nach Kriegsende, habe ich über Minsk unsere weiß-rot-weiße Flagge gesehen und gewusst, dass wir gewonnen haben.«
»Lang hat diese Freude nicht gewährt«, presste die Bildungsbeauftragte leise, so dass es nur der Veteran hören konnte, durch die Zähne hervor.
Der Auftritt des Veteranen war der längste in der Geschichte des Lyzeums. Obwohl die Bildungsbeauftragte auf alle erdenklichen Arten versuchte, die Veranstaltung zu beenden, ließen die Schüler nicht locker. Über zwei Stunden löcherten sie den Veteranen. Sie fragten, schrien heraus und riefen dazwischen, forderten und staunten, bewerteten und trauten ihren Ohren nicht. Niemand musste gähnen, während er sprach, weil der Veteran nämlich ein Geheimnis preisgab. Der Veteran erzählte etwas, das niemand je erzählt hatte. Er hatte eine verbotene Tür einen Spaltbreit aufgestoßen – und die Kinder drängten ihm unaufhaltsam hinterher. Als das Gespräch vorbei war, trafen sich Franzisk und seine Freunde an ihrem Geheimplatz – in der Toilette im dritten Stock.
Ein Ort, den nicht einmal die strengsten Lehrer betraten. Ein Männerklub von Sechzehnjährigen, eine Sperrzone auf dem Territorium des Staatlichen Lyzeums der Künste. Mit Obszönitäten beschmierte Wände, zersprungene Fliesen, Kloschüsseln ohne Klobrillen und herausgerissene Notenblätter, die zerknüllt als Toilettenpapier verwendet wurden. Die Freunde ließen eine Zigarette herumgehen und besprachen die gerade erlebte Veranstaltung:
»Ich kann’s gar nicht glauben. Das ist doch regelrecht Selbstmord!«
»Stimmt! Nicht zu fassen. Gib mal die Zigarette«, bat Zisk.
»Pfui! Wie sie einen verarschen«, stellte Stass fest.
»Wie sie den eigenen Opa verarschen!«
»Haltet doch die Klappe alle beide!«, warf Kobrin ein, den schon seit dem Morgen ein Durchfall plagte. »Was soll das, dass ihr euch schon wieder auf Belarussisch unterhaltet?«
»Dürfen wir uns denn im eigenen Land nicht in unserer Muttersprache unterhalten? Müssen wir da erst dich fragen, du Furzer?«
»Dein Vater ist ein Furzer! Unterhaltet euch nur, aber entscheidet euch … Ihr wechselt die Sprachen wie die Unterhosen. Gestern die eine, heute die andere. Und morgen, wie werdet ihr morgen reden?«
»Was ist denn daran so schlimm?«, fragte Franzisk und lächelte versöhnlich von der betonierten Zwischenwand herab.
»Schau zu, dass du dir nicht in die Hosen scheißt.«
»Keine Sorge, im Unterschied zu dir hab ich mein Ei schon gelegt. Aber ich will eine Antwort von dir, warum regt dich das so auf?«
»Mich ärgert, dass das so aufgesetzt ist. Ihr denkt nicht in dieser Sprache, ihr träumt nicht in dieser Sprache, ihr könnt nicht scherzen. Gib doch zu, dass du mir noch nie einen Witz auf Belarussisch erzählt hast …«
»Da geb ich dir absolut recht. Stimmt alles. Aber das ändert nichts daran, dass ich von Zeit zu Zeit Lust habe, so zu sprechen.«
»Warum?«
»Weil ich die Sprache halt einfach irre schön finde! Weil ich damit anders bin als die anderen. Weil ich nicht die Sprache derer sprechen will, die uns als Aufseher geschickt worden sind.«
»Aber du machst Fehler, Zisk!«
»Ja! Weil ich erst am Lernen bin! Glaubst du, du machst im Russischen keine Fehler? Heute früh hast du die schöne Phrase gesagt: ›mach ich in die Schufljadka rein‹. Was soll das denn für eine Sprache sein?«
»Ist doch klar, welche …«
»Das ist vielleicht dir klar, aber eigentlich ist das vollkommener Blödsinn. Reinmachen, mein Lieber, kannst du in die Hosen, aber für Sachen nimmt man stellen oder legen.«
»Was soll diese Klugscheißerei? Du hast eine Drei in Grammatik.«
»Weil ich im Gegensatz zu dir nicht von Nastja abschreibe.«
»Ich schreibe nicht ab!«
»Kannst eh abschreiben. Von mir aus schreib den ganzen Stoff von ihr ab. Mir doch scheißegal! Weil ich im Unterschied zu dir nämlich weiß, dass es das Wort Schufljadka im Russischen gar nicht gibt.«
»Wieso gibt es das nicht, ist doch in jedem Tisch eine.«
»Ja, genau. Im Tisch, aber nicht in der Sprache.«
»Franzisk hat recht«, unterbrach Krukowski, während er seine Hose zuknöpfte, »das Wort gibt es nicht. Das heißt, jetzt schon, weil wir es benutzen, aber wir haben es nicht von den Russen, sondern von den Deutschen. Wahrscheinlich schon während der ersten Okkupation übernommen. Bei denen heißt das Schublade, hab ich gehört. Aber deine großen Brüder, für die du dich so ins Zeug legst, kennen dieses Wort nicht.«
»Ach, leckt mich doch alle am Arsch! Ich leg mich für niemanden ins Zeug. Es ist einfach doof, dass ihr auf einmal beschließt, die Sprache zu wechseln. Dumm ist das, plötzlich anders zu sprechen als alle rundherum.«
»Da will ich dich ganz schnell drauf aufmerksam machen, dass bei uns aktuell der ganze Unterricht in dieser anderen Sprache, wie du es nennst, gehalten wird.«
»Aber nicht mehr lange! Da macht euch mal keine Sorgen. Ab nächstem Jahr ist es wieder wie früher.«
»Keine Ahnung, worüber du dich da freust.«
»Über die Vernunft freu ich mich. Der Westen des Landes soll von mir aus so sprechen, aber hier haben wir uns immer auf Russisch verständigt.«
»Stimmt, hast recht, hier haben schon immer alle die Sprache unseres großen Bruders benutzt. Die starke, mächtige.«
»Was passt dir denn nicht daran?«
»Nein, ist schon in Ordnung! Wir sind ja Brudervölker. Wir sind ja der beschissene kleine Bruder. Wir sind zusammen in den Schützengräben verwest und bla-bla-bla. Nur schade, dass unser Gedächtnis so kurz ist wie dein Pimmel. Aber was kann man von uns schon erwarten? Wir sind ja die Kleinen, die Dummies, wir sind immer ein bisschen schlechter. Dass im Krieg gegen die Deutschen jeder Vierte gefallen ist, können wir alle herunterleiern, aber komischerweise haben wir alle vergessen, dass während der Schwedischen Sintflut, die unsere lieben großen Brüder im 17. Jahrhundert angezettelt haben, jeder zweite Belarusse umgekommen ist. Wir waren fünf Millionen, übrig geblieben sind zweieinhalb!«
»Franzisk, wie lang ist das her? Kommst du jetzt vielleicht auch noch mit deiner Großmutter daher?«
»Genau! Hinter der Kindereisenbahn im Park, da schau mal nach, wie viele Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschossen worden sind, nur weil sie Belarussisch sprachen! Stell dir einfach mal alle diese Menschen vor. Stell dir einfach nur vor, dass sie existiert haben, und auf einmal wurden sie hingerichtet. Erschossen von unseren lieben Brüdern. Nicht, weil sie gestohlen haben, oder gemordet, oder geraubt, sondern einfach, weil sie ihre Muttersprache gesprochen haben. Eine Sprache, in der sie wirklich gedacht haben und Witze erzählen konnten. Krukowski und mich hätten sie heute erschießen können, einfach, weil wir auf dem Scheißhaus ein bisschen geplappert haben.«
»Hätten sie können! Früher konnte man für vieles erschossen werden! Für Gedichte, für alles Mögliche. Aber das hat auch für die eigenen Leute gegolten. Das war nicht eine Frage der Sprache.«
»Was geht mich das an? Heute leben wir in einem eigenen Land, sind ein eigenes Volk. Kapierst du? Hier dürfen wir entscheiden, wie wir leben und sprechen! Da hast du also nicht recht!«
»Nein, du hast nicht recht!«
»Schon gut, ihr zwei, hört auf! Über so einen Bullshit streiten!«
»Nein, das ist wichtig«, sagte Franzisk ernst.
»Ist eh wichtig«, pflichtete Stass bei. »Aber nicht so, dass ihr euch jetzt wie die Deppen zanken müsst mit heruntergelassenen Hosen.«
»Friede?«
»Trottel!«
»Selber Trottel!«
Als die diplomatischen Beziehungen zwischen den Toilettenkabinen wiederhergestellt waren, rauchten die Jungs eine letzte Freundschaftszigarette, ließen Krieg, Geschichte und Sprache beiseite und widmeten sich einem für die Jugend nicht weniger wichtigen Thema. »Wenn ich in den Himmel komme«, begann Stassik.
»Vergiss es! Kartoffelmännchen kommen nicht in den Himmel.«
»Wieso das denn?«
»Das ist ein Axiom.«
»Weißt du …«
»Ich glaube gar nicht an den Himmel«, sagte Zisk und blies Rauch aus.
»Seien Sie so gut, das weiter auszuführen, Mister Lukitsch!«
»Ganz einfach. Angenommen, ich komme in den Himmel …«
»Dein Arsch passt nicht mal durch die Tür, wie willst du da in den Himmel.«
»Spinnst du, ich bin von uns allen der Dünnste. Jedenfalls, angenommen, ich komm in den Himmel … Aber was ist der Himmel? Alles, was geil ist: Mädels, Alkohol, und beim Fußball gewinnt deine Mannschaft. Wenn ich in den Himmel komme, muss also immer meine Mannschaft gewinnen, stimmt’s? Stimmt!«
»Na gut, nehmen wir das mal so an …«
»Angenommen! Also, meine Mannschaft gewinnt alle Pokale, in allen Ligen, aber plötzlich kommt Krukowski in den Himmel, mit seiner Liebe zu Awtosaptschast …«
»Immer noch besser als Dynamo.«
»Kann ja ich nichts dafür, dass es bei uns keine anderen Mannschaften gibt. Aber das ist nicht der Punkt. Wenn der Himmel das ist, was wir alle denken, wenn das der Ort sein soll, wo wir alle nach unserem schrecklichen irdischen Dasein die maximale Belohnung kriegen sollen, dann muss ja Krukowskis Mannschaft ebenfalls gewinnen.«
»Ja, und weiter?«
»Was heißt und weiter? Was soll der Scheiß, wenn seine und meine Mannschaft die ganze Zeit gewinnen? Jemand muss ja verlieren, sonst ist es Betrug!«
»Na, es wird eben sowohl deine Mannschaft gewinnen als auch seine. Ihr werdet nur nichts davon wissen.«
»Vergiss es. Ich will in einen Himmel, wo nur meine Mannschaft gewinnt. Sonst scheiß ich gleich drauf.«
»Geht man von deiner Logik aus, dann können nur Fans von derselben Mannschaft in den Himmel kommen …«
»Jawohl! Die Fans vom Fußballklub des päpstlichen Throns«, meinte Kobrin und zog die Spülung.
Während die Jungs auf der Toilette im dritten Stock husteten, verkündete unten die Lehrerschaft, gegen Müdigkeit und Schwüle ankämpfend, eins nach dem anderen ihre Urteile: ausmustern – Gnade walten lassen, behalten – rauswerfen. Über manche diskutierten sie, manche schlossen sie aus, ohne mit der Wimper zu zucken. Bei offenen Fenstern, zum Rauschen der Bäume besprachen sie unter anderem das Schicksal des sechzehnjährigen Kobrin (wegen furchtbaren Betragens und einer Vier in Geographie) und seines Altersgenossen Lukitsch (bei dem die Gründe auch ohne Erläuterung allen klar waren). Während Kobrin vor Nervosität den ganzen Tag schon der Durchfall plagte, konnte sich Zisk im Gegenteil einer vortrefflichen Verdauung rühmen. Er wusste, dass nichts passieren konnte, dass alles gut verlaufen würde. An solchen Tagen verspürte Zisk oft ein Gefühl der unverdienten Bevorzugung. Im Unterschied zu Dimas’ Mama, die ihr Leben lang als Zugbegleiterin gearbeitet hatte, würde seine Großmutter ganz bestimmt das richtige und entscheidende Argument finden und vorbringen. Außerdem würde sie heimlich einen grünen Schein in der Direktion vorbeibringen und einen Flakon Chanel Nº 5, wenn sie bei der Beauftragten für musikalische Erziehung eingeladen wäre. Seine einzige Sorge war, dass die Großmutter ihm nach der Notenkonferenz wieder einen Megaskandal machen würde. Sie würde reden, reden, reden; und ihn schlussendlich doch loben. Obwohl er ein Chaot war, war Franzisk der Liebling vieler Lehrer. Nicht nur, weil er eine zusätzliche Einkommensquelle darstellte (nicht alle nahmen Schmiergeld), sondern er besaß auch einen lebhaften, wachsamen Geist. Zisk paukte nie, wusste aber fast alle Daten von Schlachten, Bündnissen und Auflösungen, er schummelte nicht, ratterte aber mühelos die Stammbäume bedeutender und weniger bedeutender Familien herunter. Jedes Mal, wenn Ende Mai die Frage nach dem Ausschluss des endgültig abgesackten Lukitsch wieder aufkam, stellten sich die Lehrer für Geschichte und Literatur schützend vor ihn.
»Ich halte einen Ausschluss von Lukitsch für nicht zielführend …«
»Waleri Semjonowitsch, geben Sie doch zu, dass sie Ihnen was zugesteckt hat!«
»Da redet ja die Richtige, Natalja Sergejewna. Vielleicht ist es genau umgekehrt? Vielleicht hatten diesmal ja Sie das Glück?«
»Wieso ich? Haben Sie irgendwelche Beweise? Im Gegenteil, ich hab mich seiner Großmutter erbarmt. Ich war es, nicht Sie, die ihm eine Drei gegeben hat, obwohl er im letzten Quartal zwei Dreien und zwei Vieren hatte.«
»Kollegen, bleiben wir bei der Sache. Lukitsch hatte in diesem Quartal zwei Vieren. Wieder in Harmonielehre, und dieses Mal auch in Geschichte … Waleri Semjonowitsch, warum verteidigen Sie ihn eigentlich? Er hat in Ihrem Fach eine Vier! Was hatte er denn in den ersten Quartalen?«
»Drei Dreien …«
»Wieso haben Sie ihn eigentlich so gern? Wenn ich mir das Klassenbuch so ansehe … einen schlechteren Schüler haben Sie gar nicht …«
»Die schlechten Noten zeigen nur, dass er faul ist, aber nicht dumm …«
»Wichtig ist, dass er kann, was im Lehrplan steht, und nicht, dass er Sie mit seinen Gedankengängen beeindruckt.«
»Ich habe gedacht, bei uns geht es darum, denkende Menschen heranzuerziehen …«
»Da irren Sie sich, Waleri Semjonowitsch. Der Mensch ist an sich schon ein denkendes Wesen. Man muss das Rad nicht noch einmal erfinden, das alles wurde schon vor uns erledigt. Und wenn wir schon bei den denkenden Menschen sind … Vielleicht ist es ja, weil er Ihre zweifelhaften politischen Ansichten teilt? Mit sechzehn Jahren kann man leicht auf den Weg des Nihilismus geraten.«
»Was heißt zweifelhaft? Was meinen Sie damit?«
»Sie wissen sehr gut, was ich damit meine. Wir alle wissen, Waleri Semjonowitsch, wie frei Sie die Postulate in den Lehrbüchern interpretieren …«
»Welche denn genau?«
»Was heißt welche genau?«
»Ich frage, welche Postulate Sie meinen? Antworten Sie mir! Zuerst meckern Sie, und dann stecken Sie wie der Walzerkönig den Kopf in den Sand.«
»Ihre Kalauer, Waleri Semjonowitsch, findet schon lange keiner mehr lustig. Brauchen Sie Beispiele?«
»Ich hätte nichts dagegen …«
»Sie haben den Schülern vom 115. Bataillon erzählt, stimmt’s?«
»Es war das 118., um genau zu sein. Ja, habe ich, und was ist falsch daran?«
»Was daran falsch ist? Nein, also wirklich! Er fragt noch, was daran falsch ist? So eine Frechheit! Was jedes Kind weiß, Waleri Semjonowitsch, und jedes Kind auch in Zukunft wissen muss, dass nämlich das Dorf von den Deutschen niedergebrannt worden ist und nicht von Ihrem Bataillon, wie Sie behaupten. Waren Sie etwa dort? Haben Sie ihnen die Kerze gehalten?«
»Sehr witzig. War auch nicht mein Bataillon. Aber das ist nicht der Punkt. Kann ich Ihnen eine einzige Frage stellen? Nur eine Frage: Was für Deutsche?«
»Wie meinen Sie, was für Deutsche?«
»Ich frage Sie, welche Deutschen das Dorf niedergebrannt haben sollen?«
»Die ganz normalen … die hier waren … das wissen doch alle.«
»Alle? Wie alle? Alle, die gelebt haben? Die gekämpft haben?«
»Ja!«
»Alle wissen, dass die Front damals weit weg von hier verlief. Hier war bestenfalls ein Deutscher pro Dorf oder sogar pro Bezirk. Die Hilfspolizei gab es, aber das waren unsere eigenen Leute, Balten und Ukrainer, was haben die Deutschen damit zu tun? Das hab ich den Schülern erklärt. Sonst nichts. Ich erzähle Fakten, nicht die durchgekauten Märchen unserer Schriftsteller. Die Deutschen haben Dörfer niedergebrannt. Das ist eine Tatsache, die ich nicht verharmlosen will. Aber ich bin für historische Gerechtigkeit. Andere Dörfer haben sie in Brand gesteckt, aber nicht dieses. Dieses wurde von Ukrainern angezündet! Dass man an der Stelle ein Denkmal gebaut hat und es jetzt unbequem ist, die Wahrheit auszugraben, ist nicht meine Schuld.«
»Sie, mein Lieber, sollen erzählen, was im Lehrbuch steht. Sie sind Lehrer! Sie müssen vermitteln! Sie werden dafür bezahlt, dass Sie den Schülern helfen, sich den Stoff anzueignen. Nicht mehr und nicht weniger. Sie brauchen nichts Eigenes hinzuzufügen. Ich wiederhole, Waleri Semjonowitsch, Sie sollen erklären, was im Lehrbuch steht! Und im Lehrbuch steht – so wie in allen anderen Quellen auch –, dass es die Deutschen waren, die das Feuer gelegt haben. Das ist eines der wichtigsten Kapitel in der Geschichte unseres Landes. Verstehen Sie? Ein historisches Heiligtum. Das ist wie unser Wappen, wie die Flagge, unter der unsere Großväter gekämpft haben! Das ist fast unser Ein und Alles!«
»Aber es gibt sichere Beweise.«
»Das kann der Staat besser beurteilen. Sie sind ein einfacher Lehrer, und mit Fragen zu unserer Geschichte sind kompetentere Leute befasst. Wenn Sie schon so eine Leuchte sind, Waleri Semjonowitsch, warum arbeiten Sie dann nicht an der Akademie der Wissenschaften? Sie klingen fast so, als ob es uns unter den Deutschen besser ergangen sei als unter unserer Regierung.«
»Unter Ihrer! Meine ist es nicht.«
»Unterbrechen Sie mich nicht! Die Eltern beschweren sich, weil Sie den Kindern erzählen, dass die Deutschen Schulen gegründet haben, dass sie alle mit Schokolade gefüttert haben, verstehst du, während unsere Brüder, mit denen wir zusammen in den Schützengräben verwest sind, die ärgsten Barbaren gewesen sein sollen. Wenn man Ihnen so zuhört, dann ist das Massengrab nördlich unserer Stadt wohl auch auf sie und nicht auf die Deutschen zurückzuführen …«
»Welche Deutschen denn 1937 …«
»Lassen wir das! Sie haben Ihre Position klargemacht, Waleri Semjonowitsch, danke. Setzen Sie sich, aber achten Sie bitte auf Ihre Worte. Wir schätzen Sie als Pädagogen, und ich persönlich fände es schade, wenn wir uns wegen Ihrer seltsamen Weltanschauung von Ihnen trennen müssten. Ihre Meinung können Sie ja bei den Wahlen äußern. Da können Sie sich in der Wahlkabine selbstverwirklichen. Aber hier sind wir nicht im Zirkus. Und auch nicht im Parlament! Wir sind hier im Lyzeum. In einem sehr berühmten Lyzeum! Also, zurück zu Lukitsch. Gibt es noch jemanden, der für ihn Partei ergreifen will?«