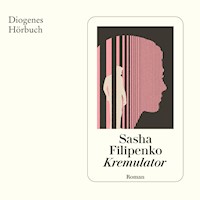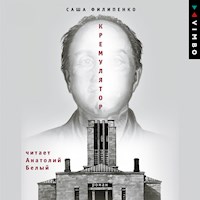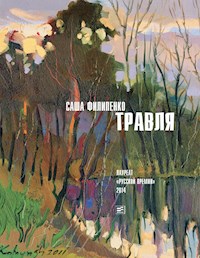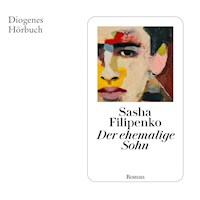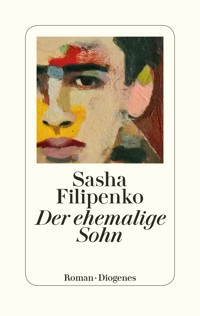11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Journalist, der zu viel weiß. Ein Sohn, der seinen Vater verrät. Ein Oligarch, der keine Gnade kennt. Ein korrupter Schreiberling ohne jeden Skrupel. Medien, die auf Bestellung einen Ruf ruinieren. Sasha Filipenko erzählt die Geschichte des idealistischen Journalisten Anton Quint, der sich mit einem Oligarchen anlegt. Worauf dieser den Befehl gibt, Quint fertigzumachen. Die Hetzjagd ist eröffnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sasha Filipenko
Die Jagd
Roman
Aus dem Russischen von Ruth Altenhofer
Diogenes
Die Sonate (ital. sonare – klingen)
ist eine Gattung der Instrumentalmusik
sowie eine musikalische Form,
genannt Sonatenhauptsatzform.
Sie wird für kammermusikalische Besetzungen
oder Klavier komponiert.
Einleitung
Am Nachmittag spielen sie im Garten ein Quiz. Als Thema geben die Nachhilfelehrer Russland vor, neunzehntes, zwanzigstes Jahrhundert. Begleitet von Zikaden erklingen Mussorgski, Tschaikowski und Cui. Die höchste Punktezahl erreicht Lisa. Sie hat nur DieToteninsel mit den Sinfonischen Tänzen verwechselt. »Rachmaninow hätte es durchgehen lassen«, scherzt der Pädagoge, den sie über den Sommer ins Ausland geholt haben. Silber geht an Pawel. Er hat den Bojarenchor und DieLiebe zu den drei Orangen nicht erkannt. Der Älteste und der Jüngste, Alexander und Anatoli, geben ihre Blätter leer ab. Sascha kommt gerade erst vom Training, Tolja kann sich nicht vom Handy losreißen.
Gegen acht setzen sie sich zum Abendessen. Aus den Boxen plätschern die Moskauer Nächte. Der Störkoch serviert Meeresfrüchte. Pawel rühmt sich, er sei in Antibes gewesen und habe Monsieur Guillaume drei Flaschen zu je sechstausend abgeschwatzt. Alexander schweigt. Tolja spielt. Mama sagt, man solle nicht feilschen, denn die Franzosen – diese Drehorgelspieler mit ihrem Stock ihr wisst schon, wo – sagen dann womöglich, die Russen seien alle Halsabschneider.
Nach dem Essen setzen sie sich vor den Fernseher. Der große Flachbildschirm steht gleich hier draußen. Die Kabel schlingen sich um den Gartenschlauch. Über dem Bildschirm kreist eine Biene.
Sie hören dem Vater schweigend zu, aufmerksam wie sonst nie. Papa prognostiziert den unvermeidlichen Zusammenbruch der Konsumgesellschaft, konstatiert die Ineffizienz der Demokratie und besteht auf der Notwendigkeit, die Welt auf Basis orthodoxer Prinzipien zu verändern. Auf eine Frage der Journalistin (einer äußerst hübschen und fatal dummen Interimsgeliebten eines Ministers) verkündet Papa, er fürchte keine Sanktionen, verfüge über keinerlei Immobilien im Ausland, sein einziger Reichtum sei das heilige Russland. Die Kinder lachen. Mamas Miene verdüstert sich.
Den nächsten Tag verbringen sie auf dem Meer. Dunkelblaue Wellen, zum Horizont hin verblassend. Mal hier, mal da, als drückten sie Paste aus einer Tube, hinterlassen Jachten lange weiße Bänder. Lisa und Pawel liegen auf dem Deck und beobachten die Flugzeuge im Anflug auf Nizza. Lisa zählt die Jets, Pawel übernimmt die »Habenichtse« – Airbusse und Boeings.
»Weißt du, warum sich der Papst jedes Mal bekreuzigt, wenn er aus einem Flugzeug steigt?«
»Nein, warum?«
»Na, müsstest du mit Alitalia fliegen, würdest du dich auch bekreuzigen!«
Mama und Alexander chillen auf dem Hubschrauberlandeplatz der Jacht. Der kleine Tolja kämpft gegen Computermonster. Drei Liegen durchkreuzen das gelbe H. Mama trägt einen Hut, dessen Krempe Saturn alle Ehre gemacht hätte, Sascha eine Radsportkappe mit aufgestelltem Schirm.
Auf der benachbarten Jacht bemüht sich ein neofaschistischer Abgeordneter um Bräune und lässt sich dabei von einem berühmten Schriftsteller bespaßen. Die Kinder des Literaten und ihre Nannys laufen auf der Jacht hin und her. Der Schriftsteller bemüht sich um Geld. Der Abgeordnete hat im Grunde nichts dagegen, zieht aber ein gewisses Vergnügen aus dem linguistischen Gezappel des Autors. Das Meer trägt den Schall gut weiter.
»Mein Gott, wenn er nicht gleich was springen lässt, geb ich ihm was!«
»Hast du gelesen, was sie heute über uns schreiben?«
»Ja …«
Alexander meint einen Text, der erst vor wenigen Stunden im Netz erschienen ist. Nach dem superpatriotischen Auftritt des Vaters hat ein bekannter Journalist einen Blogbeitrag mit Informationen zu einigen (wenn auch unbedeutenden) Konten und küstennahen Häusern online gestellt. Zudem sind die aktuellen Ausbildungsplätze von Lisa, Pawel und Anatoli angeführt, mit korrekter Nennung der zwei Lycées und der Schule in Paris. Dass Alexander in der untersten Fußballdivision Frankreichs spielt, verschweigt der Autor aus irgendeinem Grund.
»Glaubst du, Vater wird für seine Worte bezahlen müssen?«
»Eher wird der drankommen, aus dessen Feder das stammt.«
Exposition
Hauptsatz
Der Hauptsatz ist ein wichtiges Element der Exposition. Er bildet die Grundlage des folgenden Konflikts und der weiteren Entwicklung. Und während die Familie Slawin auf dem Sonnendeck liegt, trägt uns die Melodie in die Zukunft, wo wir erstmals das Motiv der Jagd hören.
Als die Grube fertig ausgehoben ist, lässt der Bagger den Pfahl hinab. In das frische Grab ergießt sich der Nebel wie Milch in eine Tasse. Ringsum Stille. Keine Häuser, keine Stromleitungen. Lakonische Unendlichkeit: dunkler Wald und graue Wolken.
Folgende Regeln: immer maximal zwei Hunde auf einmal. Der Bär ist mit einer Hinterpfote am Pfahl fixiert. Die Krallen sind ungeschliffen, die Eckzähne auch. Die Meute hat gewonnen, wenn Meister Petz auf dem Rücken liegt oder erwartungsgemäß verreckt.
»Blenden wir ihn doch wenigstens! Bei so viel Schonung zerfetzt uns der alle Hunde!«
»Nein!«
Der Chef ist dagegen. Regeln sind Regeln. Thermosflaschen in unseren Händen, in den beschlagenen Jeeps die Hunde. Zeit anzufangen.
Sie lassen das erste Paar los. Der Besitzer bleckt die Zähne, reibt sich die Hände, denkt, der Bär sei am Ende. Kretin. Er hat keine Ahnung, wozu ein gehetztes Tier fähig ist. Dabei hätte er es wissen können, denn der Gast ist Ermittler in besonders wichtigen Fällen. Mit Verhören kennt er sich wahrscheinlich besser aus.
Die Stille reißt ab. Die Hunde bellen, stürzen sich auf den Bären und weichen gleich wieder zurück. Krümmen die Rücken und knurren. Ihr Fell sträubt sich. Wir haben Gänsehaut. Nicht, dass wir das noch nie gesehen hätten, aber die ersten Minuten sind immer so. Überwältigend grausig. Das gefesselte Tier brüllt dumpf. Es stellt sich auf die Hinterbeine, kann aber nicht angreifen. Alles, was es heute tun kann, ist langsam und qualvoll zu sterben. Der Chef grinst.
Der Fleischwolf fängt an, sich zu drehen. Der Kampf nimmt Schwung auf. Die erste entzweigerissene Hündin jault auf. Blut spritzt, Gedärme quellen heraus. Die Eingeweide sind rosa, viel heller als das Blut. Wir lächeln, weil es so ein guter Teddy ist. Wir mögen dieses Tier – schade nur, dass es bald sterben wird. Vor den Mastiffs bitten wir sogar um seine Begnadigung, doch der Chef erlaubt es nicht …
Meister Petz wird gegen Mittag verscharrt. Für Präparatoren gibt es hier nichts mehr zu tun. Der Bär ist zerfetzt bis auf die Knochen. Irgendwie schade um ihn … War ein gutes Tier, eine Kämpfernatur …
Wir steigen wieder ins Auto, schalten das Radio ein. Lew Leschtschenko singt:
Langsam werden alle Tribünen leer,
Die Zeit der Wunder verhallt,
Lebe wohl, unser lieber Teddybär,
Kehr zurück in den Märchenwald.
Weine nicht, einmal lächle uns noch zu,
Denk an uns, wenn die Tage vergehen,
Dann werden auch unsere Träume wahr,
wünsch uns allen ein Wiedersehen.
In diesem Abschnitt lernen wir Mark Smyslow kennen, einen berühmten Cellisten, der uns dieses Musikstück vorspielt.
Über dem Bahnhof in der Stadt der Mode spannt sich eine dreihundertfünfzig Meter hohe Kuppel. Ein Machtsymbol des Mussolini-Regimes, das mit der Zeit eine an Schönheit grenzende Patina angenommen hat. Wir laufen den Bahnsteig entlang. Der Zug wird gleich losfahren. Ich mit Cello und Buch, Fjodor mit Koffer und einer Fünfliterflasche Wein, die sie hier Bambino nennen. Gott allein weiß, wofür er die braucht.
Der Freund hält kaum Schritt mit mir – schon auf dem Konservatorium hatte Fedja den Spitznamen Zentner. Schließlich rennt Fedja in mich hinein. Die Flasche fällt auf den Bahnsteig, und Rotwein ergießt sich über den Beton.
– Mark, ich kann nicht mehr! Ich fall gleich tot um! Ich bitte dich – gönn uns eine Pause!
– Ich hätte ja nichts dagegen – aber der Zug …
Mailand–Lugano. Nur eine Stunde Fahrt. Stichprobenartige Passkontrollen, ein Stückchen Comer See vor dem Fenster. Eine Herausforderung für das Gleichgewichtsorgan, wenn die Waggons sich auf Schweizer Territorium in den Kurven neigen.
Zentner plappert irgendetwas, ich schweige. Der Freund versucht vergeblich, ein Gespräch anzufangen. Keine Lust zu reden. Ich muss wieder daran denken, was mir mein Bruder erzählt hat, und reiche Fedja mein iPad. Fünf aufgerufene Seiten, fünf niederschmetternde Berichte. Ich lasse meinen letzten Auftritt in Lugano Revue passieren. Einen Monat ist es her, seit man mich die größte Enttäuschung des Jahres genannt hat. Die Kritiker fanden, ich sei überbewertet, Bach tue ihnen leid. Alle stimmten überein, die Sonate sei zu langsam, zu bedeutungsschwer und absolut planlos gespielt worden. Stimmt alles, nur ahnten die Kritiker wohl kaum, was sich an jenem Tag ereignet hatte.
Einige Takte, die uns an die Côte d’Azur zurückbringen.
Beim Sonnenbaden auf der Jacht denkt Alexander an Sébastien, einen jungen Angestellten des Chagall-Museums in Nizza. Sascha spürt, er ist verliebt. Vorige Woche hatte er im Wunsch, sich zu öffnen und das Objekt seiner Begierde zu beeindrucken, Sébastien in das Landhaus seiner Familie nahe Juan-les-Pins eingeladen. Er nahm seinen Gast an der Hand und zeigte ihm ein Bild von Chagall. Selbstverständlich das Original.
»Woher habt ihr den?«
»Hat Papa angeschleppt.«
»Ist dein Vater Sammler?«
»Nicht ganz – er war mit einem berühmten Politiker in der gleichen Klasse.«
»Ist das ein Beruf?«
»In Russland schon.«
»Und er kann sich solchen Luxus leisten?«
»Offiziell gehört das Bild Mama.«
»Was ist die von Beruf?«
Sascha spürte, dass die Wahrheit über seine Familie ihm wohl kaum Bonuspunkte verschaffen würde. Doch der Wunsch nach Ehrlichkeit gegenüber dem jungen Mann, der alle seine Matches besuchte, durchkreuzte alle weiteren Ausflüchte.
»Stell dir einen Urwald vor. Darin steht seit Sowjetzeiten ein Pflegeheim. Das Grundstück ist viel wert, aber die Alten kriegt man nicht so leicht weg. Man kann natürlich einen Brand vortäuschen, aber … Jedenfalls, da gibt es einen – übrigens wohnt er zwei Villen von uns entfernt –, der schickt sein treues Gefolge los, und die finden in dem Heim die Pest oder die Vogelgrippe. Die Institution, die ein halbes Jahrhundert bestanden hat, wird geschlossen. Die Alten und Invaliden müssen umziehen, das Gebäude wird abgerissen, der quasi infizierte Wald abgeholzt. An der Stelle des Hauses wird eine gewaltige Baugrube ausgehoben. Darin vergraben sie einen Riesenberg Müll – in unserem Land ist das Problem der Abfallentsorgung bis dato nicht gelöst. Dann wird die Erde nivelliert, und wo früher das Pflegeheim stand, auf der Müllhalde, werden Wohnhäuser für die Elite gebaut – der Wald steht übrigens unter Naturschutz. Meine Mama verdient bei jeder Etappe mit. Das ist eine ihrer vielen Einkommensquellen. Papa hat als Staatsbediensteter nicht das Recht, auf diese Art Geld zu machen. Jetzt weißt du, woher wir den Chagall haben.«
Sébastien, Mitglied der kommunistischen Partei Nizzas, reagiert nicht mehr auf Saschas Anrufe. Drei Tage schon. Sascha betrachtet die Wolken und denkt, mit der Wahrheit hätte er warten sollen. Die Wahrheit will nie jemand wissen, höchstens Menschen mit Gewissen, die keine Ahnung haben, wie man damit lebt. Die Wahrheit bringt nur Kummer. Sascha spürt, dass die Wahrheit immer zu viel ist.
Bei Sonnenuntergang kommen sie zu Hause an. Im Garten vibrieren Insekten. Wie der Behang einer Vogelscheuche klingeln Mutters goldene Armreifen im Wind. Lisa jammert, sie wolle nach Paris, Pawel steht vor dem Spiegel und stellt den Kragen mal auf, mal legt er ihn wieder um. Tolja hat den obersten Boss gekillt und steigt ins nächste Level auf. Sascha will nach Nizza, aber aus der ersehnten Aussprache mit dem Freund wird nichts – der Vater ruft an. Die Mutter hört ihm eine Minute lang zu, dann rollt über ihre bronzene Wange eine Träne.
»Sascha, lass unsere Sachen packen. Wir fahren nach Moskau, Vater möchte uns präsentieren.«
»Ich fahre aber nicht – ich hab ein Spiel!«
»Du fährst mit – Vater hat gesagt, er organisiert einen Transfer für dich …«
Der Moment, in dem erstmals in der Sonate die Stimme von Anton Quint erklingt, Journalist und frischgebackener Vater.
Anton betritt sein Arbeitszimmer, setzt sich an den Schreibtisch. Computer, Hefte, Figürchen von Dalí und Picasso, die er aus San Sebastián mitgebracht hat – alles kommt ihm neu und seltsam vor. Erst jetzt bemerkt er, dass er noch immer die Überzieher aus dem Geburtshaus an den Schuhen trägt. Anton schüttelt den Kopf über seine eigene Zerstreutheit. Er klappt den Laptop auf und tippt:
Das ist mein erster Text, den ich nicht für die Öffentlichkeit schreibe. Diese Worte sind für Dich, meine Liebe. Du wurdest vor wenigen Stunden geboren. Mama und ich haben noch nicht mal einen Namen für Dich. Mir gefällt Lera, Mama Anastassija. Der Geburt nach zu schließen, hast Du einen starken Charakter – Du wolltest einfach nicht zur Welt kommen.
Wenn Du eines Tages diesen Text liest, wirst Du nie im Leben denken, dass Dein Vater Journalist ist. Mir ist jetzt nicht nach Schreiben zumute. Das alles ist so schwer zu fassen! Ich habe das Gefühl, sogar das Sprechen lerne ich in diesem Augenblick neu. Alle Wörter der Welt bekommen einen ganz anderen Sinn. Ich weiß auch gar nicht, was ich Dir schreiben soll, meine Süße. Alles fühlt sich so warm und so ungewohnt an. Na ja, ich laufe mit einem idiotischen Grinsen herum, das schon …
Heute habe ich Dich zum ersten Mal im Arm gehalten. Das war unbeschreiblich! Mein ganzer Körper hat gekribbelt, als ob Ameisen über ihn liefen. Ich hab Dich so sehr lieb! Ich hätte nicht gedacht, dass man solche Gefühle haben kann. Kaum zu glauben, dass dieses Meer, das mich gerade erfüllt, überhaupt Platz hat in meiner Brust.
Dein lieber Papa hat natürlich losgeheult. Die Schwester im Geburtshaus hat gesagt, die Väter heutzutage seien auch nicht mehr das Wahre. Zu sensibel geworden. Ich bat sie ein paarmal, Dich wenigstens noch ein Minütchen halten zu dürfen, aber die Alte schnaubte, ich hätte noch Zeit genug. Dabei halte ich Dich so gern im Arm, ich glaube, das könnte ich mein ganzes Leben lang tun.
Jetzt bin ich zu Hause. Ganz allein. Es ist still. Diese Wände haben noch nie Deine Stimme gehört. Du kommst erst morgen. Auf Dich warten schon Dein Bettchen und Dein erster Teddybär.
Na dann, süße Träume, mein Schatz! Schlaf gut, und ich (sag ich Dir im Geheimen) arbeite noch ein wenig. Nicht einmal Mama weiß davon – ich habe eine Idee für eine Erzählung, die möchte ich so schnell wie möglich aufschreiben!
Noch ein paar Akkorde, deren Sinn sich uns erst etwas später erschließen wird.
Das Gerichtsverfahren wurde, wie alle bedeutsamen Verfahren jener Zeit, live übertragen. Ich verzichte auf eine umständliche Exposition und springe gleich zu dem Moment, in dem der Staatsanwalt sein Verhör fortsetzt:
»So, wenn Sie mir nun bitte erläutern wollen, was Ihr Blogeintrag zu bedeuten hatte.«
»Nichts.«
»Sie wollen uns weismachen, dass Sie einfach so, ohne jeden Hintergedanken, eine leere Nachricht veröffentlicht haben?«
»Ja.«
»Das heißt, wir sollen Ihnen glauben, dass ein Autor mit dreihunderttausend Followern einen leeren Post veröffentlicht, ohne damit etwas bezwecken zu wollen?«
»Genau.«
»Wollen Sie uns für blöd verkaufen?«
»Keineswegs. Vielmehr scheint mir, dass ich nicht der Einzige bin, der leere Nachrichten versendet. Unser Imperator spricht in Worten, die nichts bedeuten, sein Gefolge denkt sich Gesetze aus, die keinen Sinn ergeben, unsere Journalisten …«
»Kommen Sie zur Sache! Ich frage Sie noch einmal, was hat Sie motiviert, in Ihrem Blog einen Eintrag zu veröffentlichen, der kein einziges Zeichen enthielt?«
»Ich wollte einfach sehen, wohin das führt.«
»Nun ja … Ich hoffe, Ihre Neugierde ist nun befriedigt. Euer Ehren, darf ich jetzt in meiner Rolle als Strafverteidiger pausieren und, nunmehr als Ankläger, die Geschädigten in den Saal rufen?«
»Bitte schön.«
Hier ist anzumerken, dass zum Zeitpunkt dieses Gerichtsprozesses in dem Land, in dem er stattfand, bereits zehn Jahre vorher eine Justizreform in Kraft getreten war. Das Ziel: Der Personalbestand in der Prozessordnung sollte optimiert werden. Das Ergebnis: Die Rolle des Staatsanwalts und des Verteidigers wurde von ein und demselben Subjekt wahrgenommen. Diese Entscheidung war mit einer deutlichen Stimmenmehrheit getroffen worden und stieß vor allem auf starken Zuspruch der Richter, deren Arbeitsalltag, wie sie meinten, so »noch viel fabelhafter« wurde.
In der Rolle der Geschädigten trat eine Gruppe gläubiger Menschen auf, deren Gefühle verletzt worden waren. Sie marschierten mit Plakaten in den Saal und sagten ihre einstudierten Phrasen auf, was dem Fernsehpublikum zweifellos gefiel.
»Was haben Sie gefühlt, als Sie diesen Post lasen?«
»Wir fühlten uns angegriffen!«
»Was genau an dieser Nachricht hat Sie angegriffen, sie enthält ja bekanntlich keinen einzigen Buchstaben.«
»Genau das hat uns ja so verletzt! Wir waren erschüttert über die Spitzfindigkeit, mit der der Autor des vorliegenden, wenn Sie gestatten, Textes sich über uns lustig machen wollte. Dieser Mensch dachte wohl, wenn er eine leere Nachricht publiziert, dann verstehen wir nicht, dass er sich gezielt über uns lustig macht, aber wir lassen uns nicht für dumm verkaufen, Euer Ehren! Wir haben sofort verstanden, dass dieser Schuft unseren Glauben verspottet!«
»Sprechen Sie weiter …«
»Zugegeben, wir haben lange überlegt – ist es dieser Rüpel überhaupt wert, verklagt zu werden? Immerhin sind wir ganz dem Geistigen zugewandte Leute. Wir hätten es erdulden und dem Dreckskerl sogar verzeihen können. Doch letztlich haben wir beschlossen, dass das ganze Unheil und die Tragödie darin bestehen, dass nicht nur unsere Gefühle verletzt worden sind, sondern die Gefühle von Millionen Gläubigen, die im Unterschied zu uns nicht für sich einstehen können. Bei dieser Klage geht es nicht nur um unsere Kränkung, sondern vielmehr um eine Reaktion aller wahren Patrioten im Glauben!«
»Sagen Sie bitte, was haben Sie gefühlt, als Sie sahen, dass Tausende Menschen diese leere Nachricht zu teilen begannen?«
»Ach … gar nicht auszudrücken … Das hat uns erst recht getroffen … Zugegeben, das war eigentlich die schwerste Heimsuchung, schwerer sogar als der Post selbst! Wenn es nur von einem Menschen kommt, dann ist es ja noch erträglich, denn dieser Mensch ist entweder ein Dummkopf oder ein Schuft, der Geld aus dem Westen bekommen hat. Doch etwas ganz anderes ist es, wenn sich die wahren Gläubigen der Verschwörung eines ganzen Rudels von Hyänen gegenübersehen. Wir hegen keine Zweifel daran, dass jeder, der den Post gelikt oder weiterverbreitet hat, an diesem Verbrechen mitbeteiligt ist.«
»Diese Entscheidung obliegt dem Gericht!«
»Ja, natürlich, Euer Ehren, verzeihen Sie! Und doch, wenn Sie gestatten, dann möchten wir, bevor die Online-Abstimmung beginnt und die Fernsehzuschauer über die Höhe der Strafe entscheiden, noch auf den Zynismus hinweisen, mit dem diese Provokation vorgenommen wurde. Ich denke, niemand geht davon aus, dass diese Tat zufällig begangen worden ist. Indem er diese Nachricht publiziert hat, wollte sich der Autor nicht nur über Gläubige mokieren, was man ja noch verzeihen könnte, weil wir alle hier gute und kluge Menschen sind. Aber was das Gemeinste ist – der Autor wollte in den Herzen jener Menschen Leere säen, deren Glaube noch schwach verwurzelt ist. Dieser Schlag richtet sich nicht nur gegen Gläubige, sondern vor allem gegen unsere Jugend, gegen unsere Zukunft, die uns die Länder des Westens wegnehmen wollen. Nur wird dieser Trick mit uns nicht funktionieren, Euer Ehren! Wir sind es, die es diesen Missgeburten besorgen werden!«
»Einspruch! Niemandem werden Sie es hier, wie Sie sich ausdrücken, besorgen! Unsere Zuschauer werden ein eigenständiges Urteil fällen, ob dieses Verbrechen mit Tod durch Erhängen oder durch Erschießen bestraft werden soll! Ich als Mensch, der Gesetzestreue geschworen hat, werde nicht zulassen, dass Revanchisten sich der Justitia bemächtigen oder gar der öffentlichen Meinung!«
»Verzeihung, Genosse Staatsanwalt …«
»Nichts da, ›Verzeihung‹! Ich lasse es nicht zu! Hören Sie? Ich lasse es nicht zu! Ich habe Ihnen jetzt aufmerksam zugehört und mehrmals aus Ihrem Mund die Worte ›Verzeihung‹, ›Vergebung‹, ›verzeihen‹ gehört, während unser Gericht doch berühmt ist für seine Präzision, Objektivität und Unbeirrbarkeit! Und ich dulde hier keine Subversion und keine Akzentverschiebung! Ich sehe, wie Sie eine harte Bestrafung verlangen, doch gleichzeitig tolerieren Sie diese nichtsnutzigen Wörtchen von Vergebung, Verständnis und – man schämt sich, es auszusprechen – Liebe! Das hier ist ein Gericht, keine Seifenoper! Ich warne Sie: Achten Sie auf Ihre Sprache! Und noch etwas. Ich denke, die Schuld des Täters ist bewiesen. Hier kann es keine zweite Meinung geben, damit ist alles klar. Mehr noch, ich plädiere dafür, die erschwerenden Umstände nicht zu vergessen – der Autor hat diesen Post für alle zugänglich geschaltet und somit sein Teilen ermöglicht, womit er andere Menschen zur Verbreitung von Leere verleitet hat … Aber das nur am Rande. Interessant ist vielmehr etwas anderes! Wo verläuft die Grenze zwischen dem Verbrechen des Urhebers und jenem der Menschen, die diese Scheußlichkeit geteilt haben? Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass jeder, der diese Nachricht geteilt hat, automatisch zu ihrem Urheber wird. Mehr noch, da nicht der Text als solcher vervielfältigt wurde, sondern die Leere, hat jeder, der auf ›Teilen‹ geklickt hat, nicht nur das Begonnene weitergeführt, sondern etwas Neues erschaffen. Hier liegt ein Verbrechen vor, das von einer ganzen Personengruppe verübt worden ist. An dieser Stelle will ich jenen Fernsehzuschauern, die unsere Sendung nicht so oft sehen, erklären, dass ein Verbrechen, das von einer Personengruppe verübt worden ist, als schwerwiegendere Gesetzesübertretung gilt als ein Verbrechen, das nur von einem Subjekt begangen wurde. Angesichts dessen bin ich der Meinung, dass alle zu bestrafen sind, die die Nachricht geteilt haben. Selbstverständlich ist zu beachten, dass auf den Subjekten, die dieses Verbrechen begangen haben, Verantwortung unterschiedlichen Grades lastet. Daher schlage ich vor, den Autor der leeren Nachricht zu zwei Höchststrafen zu verurteilen, und alle, die gelikt und geteilt haben, zu einer.«
»An sich ist mir Ihre Sicht der Dinge sympathisch, werter Herr Staatsanwalt, zumal wir noch vier Minuten live auf Sendung sind, aber als Richter irritiert mich eines: Sie schlagen vor, jeden, der auf den Like-Button geklickt hat, zur Verantwortung zu ziehen …«
»Jeden, Euer Ehren!«
»Unterbrechen Sie mich nicht! Aber was ist mit denen, die diesen Post, sagen wir, unabsichtlich gelikt haben?«
»Unabsichtlich gibt es nicht, Euer Ehren! Selbst wenn man annimmt, dass einer unter den zweihunderttausend Verdächtigen den Post unabsichtlich gelikt hat, dann hatte dieser Bürger immer noch ausreichend Zeit, sein Like zurückzunehmen. Außerdem liegt mir ein USB-Stick mit Informationen zu zweihunderttausend Nutzern vor, die alle die Buttons ›Like‹ und ›Teilen‹ gedrückt und danach absolut nichts unternommen haben, um daran noch etwas zu ändern.«
»Gab es Personen, die ihre Likes gelöscht haben?«
»Ja, Euer Ehren, ungefähr zwanzig.«
»War auf diese Druck ausgeübt worden?«
»Verzeihen Sie mein Lächeln, Euer Ehren, aber Sie wissen ja selbst nur zu gut, dass Druck in unserem Land verboten ist! Ich habe, um ehrlich zu sein, schon lange keine so kühne Dummheit mehr gehört.«
»Achten Sie auf Ihre Ausdrucksweise – ich bin nicht verpflichtet, Sie in der nächsten Saison wieder zu engagieren.«
»Entschuldigen Sie vielmals, Euer Ehren, ich bin einfach etwas verwundert über Ihre Frage. Selbstverständlich haben diese Menschen aus freien Stücken gehandelt, nachdem ihnen bewusst geworden war, dass ihr Teilen dieser Nachricht religiöse Gefühle verletzen könnte.«
»Sind diese Leute zur Verantwortung gezogen worden?«
»In keinster Weise, Euer Ehren.«
»Gut, mir wird souffliert, dass wir nun zu einer Werbeeinschaltung übergehen und angesichts der gerade erst bekannt gewordenen Umstände noch mindestens eine Stunde auf Sendung sein werden. Unsere Fernsehzuschauer erinnere ich daran, dass bereits jetzt die Abstimmung beginnt, im Rahmen derer jeder von Ihnen die geeignete Vorbeugungsmaßnahme gegen den Urheber der leeren Nachricht auswählen kann. Ebenso weise ich darauf hin, dass alle Schuldsprüche kostenlos sind; wenn Sie einen Freispruch möchten, dann finden Sie die Höhe der Gebühr für ein solches Urteil in der Tariftabelle Ihres Anbieters. Bleiben Sie dran!«
Es spricht der Interpret.
Noch auf dem Bahnsteig erfahren wir, dass der See über die Ufer getreten ist. Die kleinen Bootsstege liegen unter Wasser. Auf den Wellen treiben Katamarane. Die Uferpromenade ist überschwemmt. Das Auto, das uns abholen soll, ist irgendwo stecken geblieben. Mit einem Blick auf unsere Schuhe rät uns ein Angestellter der Seilbahn, die den höher gelegenen Bahnhof mit dem See verbindet, per Taxi in die Stadt zu fahren. Ich bin dagegen, weil ich mich erinnere, dass es vom Bahnhof zum Hotel nicht weit ist, doch Fedja sagt »sì«. Die Fahrt dauert eineinhalb Minuten. Der Taxifahrer lächelt. Zentner blättert dreißig Franken hin.
Diesmal hat man mir ein großes Hotelzimmer gegeben. Mit Blick auf den See und die Berge. Vor mir liegt die schönste und traurigste Landschaft, die ich je gesehen habe.
In meinem Kopf klingt DerSchwan von Saint-Saëns. Den spiele ich meistens als Zugabe. Immer, nur nicht an jenem Abend – an jenem Abend bin ich von der Bühne gerannt.
Zentner schickt eine Nachricht: Warte in der Lobby. Ich stelle das Cello auf die Zarge und gehe hinunter. Hinaus auf die Straße. Nur für eine Minute. Im über die Ufer getretenen Luganer See versinkt alles. Ich muss jetzt allein sein. Letzter Durchlauf. Das mache ich immer so, vor jedem Auftritt. Das gesamte Programm, vom Anfang bis zum Schluss. Unbedingt ohne Instrument. Der rechte Arm ersetzt mir das Griffbrett: Ich lege die Hand auf die Schulter und lasse die Finger der linken Hand vom Ellbogen bis zu den Fingerknöcheln tanzen. Das Cello nehme ich erst vor dem Betreten der Bühne zur Hand. Für das heutige Konzert besteht übrigens kein Grund zur Sorge. Solche Erschütterungen werden nicht wieder vorkommen. Heute Abend werde ich glänzen.
Sie haben sich entschieden, die Reise nach Russland mit Humor zu nehmen. Alle außer Alexander. Sascha ist zornig. Die nächsten Tage verbringt er damit, den Präsidenten seines Klubs zu beknien, ihn nicht zu verkaufen.
»Machst du Witze? So viel kriegen wir für keinen anderen Spieler! Dieser Transfer geht in die Klubgeschichte ein! Endlich können wir das Stadion renovieren!«
»Ist Ihnen klar, dass Sie mich meinem eigenen Vater verkaufen?«
»Wie denn nicht, wer sonst würde für dich eine solche Summe lockermachen?«
»Sie lassen zu, dass ich zur Lachnummer werde!«
»Aber wieso denn? Sieh es mal von der anderen Seite: Du wirst in der obersten Liga spielen, dein Vater besorgt dir da bestimmt einen Platz! Und schneller, als du schauen kannst, spielst du in der Nationalelf!«
»Ich scheiß auf Russland. Ich will für Frankreich spielen!«
»Höchstens Pétanque, mein Lieber!«
Wegen Papas (einigermaßen überraschenden) Verbots, den Jet zu benutzen, fliegen sie First Class. Pawel schlägt vor, alle Tickets aufzukaufen. Lisa gefällt diese Idee äußerst gut – Lisa liebt es, alles zu kaufen. Das Flugzeug ist nur zur Hälfte besetzt, und trotzdem irritiert sie die Anwesenheit fremder Menschen, vor allem von Russen. Alexander sucht in der L’Equipe Nachrichten über seinen Transfer, Mama bringt den Stewardessen Manieren bei.
Während der Landung fällt Mama plötzlich der Kleine ein. »Wo ist Tolik?« – »Er ist hier, keine Sorge«, sagt die Nanny.
Sie landen weich. Nach der Passkontrolle taxieren sie die Grenzbeamten.
»Hast du den gesehen, Sascha?«
»Bei denen hat wohl die Evolutionsgeschichte eine Pause gemacht.«
»Ob sie diesen Miesepetern extra verbieten zu lächeln?«
»Dafür kannst du sicher sein, dass du in Russland bist. Du siehst diese Schnauzen und weißt sofort – willkommen in der Großmacht!«