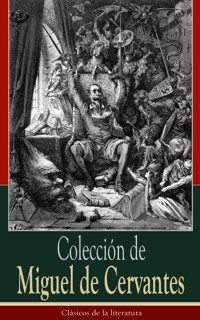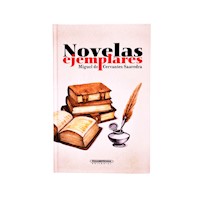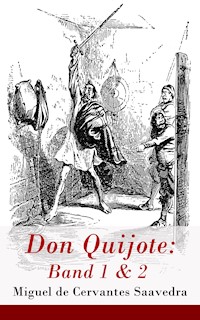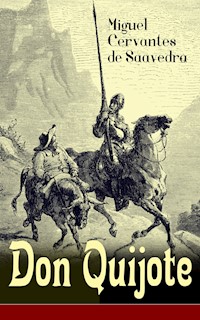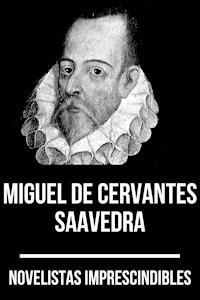Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phoemixx Classics Ebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der eifersüchtige Estremadurer und andere Novellen Miguel de Cervantes Saavedra - Vor etlichen Jahren verließ ein junger Edelmann einen Flecken in Estremadura und zog wie ein zweiter verlorener Sohn in verschiedenen Gegenden von Spanien, Italien und Flandern umher, worüber er in die Jahre kam und sein Vermögen zusetzte. Am Ende seiner vielfachen Reisen, als bereits seine Eltern tot waren, und sein Vermögen größtenteils durchgebracht, begab er sich nach der großen Stadt Sevilla, wo er Gelegenheit genug fand, das Wenige, was ihm noch geblieben war, zu vergeuden.Wie er sich in dieser großen Geldnot sah, und auch nicht viele Freunde hatte, nahm er seine Zuflucht zu einem Mittel, zu dem so manche andere Verschwender in dieser Stadt zuletzt greifen. Er beschloß nämlich, nach Indien zu gehen, diesem Zufluchtsorte der Verzweifelten in Spanien, dieser Freistätte der Bankrottierer, diesem Hafen der Mörder, diesem Schutz und Schirm der Gauner, dieser Lockspeise der Buhlschwestern, wo viele in ihren Hoffnungen sich betrogen finden und nur wenige ihre Lage wirklich verbessern. Wie daher eine Flotte nach Terra Firma abging, ward er mit dem Befehlshaber derselben einig, schnürte sein Bündel, versah sich mit Mundvorrat, schiffte sich in Cadiz ein und sagte Spanien Lebewohl. Die Flotte lichtete die Anker, und zur allgemeinen Freude schwellte ein sanfter und günstiger Wind die Segel, so daß er in wenig Stunden das Land ihren Blicken entrückte und ihnen die weiten Flächen des großen Vaters der Gewässer, des Ozeans, zeigte. Unser Reisender war nachdenklich und erwog die vielen und mannigfaltigen Gefahren, die er in den Jahren seiner Wanderung bestanden, und die schlechte Wirtschaft, die er sein ganzes Leben hindurch geführt hatte, und das Ergebnis seiner Betrachtung war der feste Vorsatz, seine Lebensweise zu ändern, mit dem Vermögen, das ihm Gott bescheren würde, anders hauszuhalten und vorsichtiger als bisher mit den Weibern umzugehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PUBLISHER NOTES:
✓ BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE:
LyFreedom.com
Der eifersüchtige Estremadurer
Vor etlichen Jahren verließ ein junger Edelmann einen Flecken in Estremadura und zog wie ein zweiter verlorener Sohn in verschiedenen Gegenden von Spanien, Italien und Flandern umher, worüber er in die Jahre kam und sein Vermögen zusetzte. Am Ende seiner vielfachen Reisen, als bereits seine Eltern tot waren, und sein Vermögen größtenteils durchgebracht, begab er sich nach der großen Stadt Sevilla, wo er Gelegenheit genug fand, das Wenige, was ihm noch geblieben war, zu vergeuden.
Wie er sich in dieser großen Geldnot sah, und auch nicht viele Freunde hatte, nahm er seine Zuflucht zu einem Mittel, zu dem so manche andere Verschwender in dieser Stadt zuletzt greifen. Er beschloß nämlich, nach Indien zu gehen, diesem Zufluchtsorte der Verzweifelten in Spanien, dieser Freistätte der Bankrottierer, diesem Hafen der Mörder, diesem Schutz und Schirm der Gauner, dieser Lockspeise der Buhlschwestern, wo viele in ihren Hoffnungen sich betrogen finden und nur wenige ihre Lage wirklich verbessern. Wie daher eine Flotte nach Terra Firma abging, ward er mit dem Befehlshaber derselben einig, schnürte sein Bündel, versah sich mit Mundvorrat, schiffte sich in Cadiz ein und sagte Spanien Lebewohl. Die Flotte lichtete die Anker, und zur allgemeinen Freude schwellte ein sanfter und günstiger Wind die Segel, so daß er in wenig Stunden das Land ihren Blicken entrückte und ihnen die weiten Flächen des großen Vaters der Gewässer, des Ozeans, zeigte. Unser Reisender war nachdenklich und erwog die vielen und mannigfaltigen Gefahren, die er in den Jahren seiner Wanderung bestanden, und die schlechte Wirtschaft, die er sein ganzes Leben hindurch geführt hatte, und das Ergebnis seiner Betrachtung war der feste Vorsatz, seine Lebensweise zu ändern, mit dem Vermögen, das ihm Gott bescheren würde, anders hauszuhalten und vorsichtiger als bisher mit den Weibern umzugehen.
Auf der See herrschte fast völlige Windstille, während dieser Sturm bei Philipp von Carrizales vor sich ging (so heißt nämlich derjenige, der den Stoff zu dieser Erzählung hergegeben hat). Auf einmal erhob sich der Wind, und wütete so heftig gegen die Schiffe, daß sich niemand auf seinem Sitze halten konnte, und so war auch Carrizales genötigt, seiner Gedanken sich zu entschlagen und sich bloß mit den Gefahren der Reise zu beschäftigen. Diese lief so glücklich ab, daß sie ohne irgendeinen Unfall in den Hafen von Carthagena einliefen. Und um uns nicht bei dem aufzuhalten, was außer unserem Zwecke liegt, bemerken wir bloß, daß Philipp, wie er nach Indien ging, ungefähr achtundvierzig Jahre alt war, und in den zwanzig Jahren, die er dort zubrachte, sich durch Fleiß und Betriebsamkeit ein Vermögen von mehr als anderthalbhunderttausend Krontalern erwarb.
Wie er sich nun reich und glücklich sah, erwachte in ihm die Sehnsucht, die allen so natürlich ist, nach seinem Vaterlande zurückzukehren und ungeachtet der vorteilhaften Aussichten, die er hatte, sein Geld zu vermehren, verließ er Peru, wo er ein so großes Vermögen erworben hatte, setzte es in Gold- und Silberbarren um, ließ es, um sich keinen Ungelegenheiten auszusetzen, registrieren und kehrte nach Spanien zurück. Er stieg in San Lucar ans Land und langte, ebenso reich an Geld wie an Jahren, in Sevilla an. Er erhielt ohne Schwierigkeit seine Schätze, und wollte jetzt seine Freunde aufsuchen, die aber alle mit Tode abgegangen waren. Er beschloß darauf, nach seiner Heimat zu reisen, ob er gleich bereits Nachricht hatte, daß auch dort ihm der Tod keinen Verwandten übriggelassen habe. Wenn ihn früher, wie er in den dürftigsten Umständen nach Indien ging, mancherlei Gedanken bestürmten und ihn mitten auf den Wogen des Meeres keinen Augenblick Ruhe gelassen hatten, so bestürmten sie ihn jetzt nicht minder auf dem festen Lande, obwohl aus einer verschiedenen Ursache. Denn wenn ihn damals die Armut nicht schlafen ließ, so raubten ihm jetzt seine Schätze die Ruhe; denn Reichtum ist für den, der nicht an seinen Besitz gewöhnt ist, noch ihn zu gebrauchen weiß, eine ebenso drückende Last, als es Armut für den ist, der beständig damit zu kämpfen hat. Sorgen verursacht das Gold und Sorgen der Mangel daran. Doch dem Einen wird durch einen mäßigen Besitz abgeholfen, während die andern mit den Schätzen wachsen.
Carrizales betrachtete seine Barren nicht mit den Augen eines Filzes – denn in den wenigen Jahren, wo er Soldat gewesen war, hatte er gelernt, freigebig zu sein –, sondern er ging mit sich zu Rate, was er eigentlich damit anfangen sollte. Denn ließ er sie ganz, so waren sie ein toter Schatz für ihn, und behielt er sie im Hause, so dienten sie Habgierigen zum Köder und Dieben zur Lockspeise. Die Lust war ihm bereits vergangen, zu dem unruhigen Handelsgeschäfte zurückzukehren, und er glaubte bei seinen Jahren Geld genug zu haben, um für seine Lebenszeit auszureichen. Er wünschte wohl, in seiner Heimat zu leben, und indem er sein Geld auslieh, sein Alter ruhig und ungestört dort zuzubringen, um nun soviel wie möglich Gott zu leben, nachdem er mehr als er sollte der Welt gelebt hatte. Doch auf der andern Seite erwog er die große Armut, die in seinem Geburtsorte herrschte, und daß er sich dort allen den Zudringlichkeiten aussetzen würde, mit denen Arme ihren reichen Nachbar zu bestürmen pflegen, zumal wenn niemand anders im Orte ist, zu dem sie in der Not ihre Zuflucht nehmen können.
Dann wünschte er auch, jemanden zu haben, dem er einmal nach seinem Tode sein Vermögen hinterlassen könnte. Er fühlte darum seiner Kraft an den Puls und glaubte noch das Ehejoch tragen zu können. Aber schon bei dem bloßen Gedanken ans Heiraten befiel ihn eine solche Angst, daß sein Entschluß davon wie der Nebel vom Winde verging. Denn auch in seinem ehelosen Stande war er der eifersüchtigste Mensch von der Welt und bei dem bloßen Gedanken ans Heiraten ward er dergestalt von Eifersucht geplagt, von Argwohn beunruhigt und von Grillen geängstigt, daß er ein für allemal beschloß, das Heiraten aufzugeben.
Wie er hierüber mit sich einig war, und noch über seine künftige Lebensweise schwankte, führte ihn sein Schicksal eines Tages durch eine Straße, wo er an einem Fenster ein Mädchen von dreizehn bis vierzehn Jahren erblickte, die so reizend und einnehmend war, daß der alte Carrizales, unvermögend Widerstand zu tun, seine Altersschwäche der Jugend Leonorens (so hieß das schöne Mädchen) gefangen gab. Er konnte sich nicht enthalten, augenblicklich tausenderlei Betrachtungen anzustellen. Das Mädchen, dachte er, ist schön, und nach dem Äußeren des Hauses zu urteilen, kann sie nicht reich sein. Sie ist noch Kind, und ihre Jugend kann mich vor Argwohn sicherstellen. Ich will sie heiraten, einsperren und nach meinen Grundsätzen erziehen; so wird sie keine andere Denkungsart bekommen als die, welche ich ihr beibringe. Ich bin noch nicht so alt, daß ich die Hoffnung aufgeben müßte Erben zu bekommen. Ob sie etwas mitbringe oder nicht, kann nicht in Anschlag kommen; denn der Himmel hat mir genug beschert, und Reiche müssen nicht nach Geld, sondern nach Neigung wählen. Denn gegenseitige Neigung verlängert bei Eheleuten das Leben, und Abneigung verkürzt es. Wohlan! das Los ist geworfen, und das ist das Mädchen, das mir der Himmel bestimmt hat.«
Nach diesem Selbstgespräch, das er nicht ein-, sondern hundertmal bei sich wiederholte, redete er einige Tage darauf mit Leonorens Eltern und erfuhr, daß sie zwar arm, aber von Adel seien. Er machte sie mit seiner Absicht, seiner Person und seinem Vermögen bekannt, und warb sehr angelegentlich um die Hand ihrer Tochter. Sie baten sich Bedenkzeit aus, damit sie nähere Erkundigungen über ihn einziehen könnten, und auch er von ihrem Adel sich in dieser Zeit überzeugen könne. Man nahm Abschied voneinander, erkundigte sich beiderseits, fand alles bestätigt, und Leonore ward die Braut des Carrizales, nachdem er ihr vorher zwanzigtausend Dukaten als Leibgedinge verschrieben hatte; in solche Liebesflammen war die Brust des eifersüchtigen Alten versetzt.
Doch kaum war er den Heiratsvertrag eingegangen, als er plötzlich tausend wütende Anfälle von Eifersucht bekam und ohne irgendeinen Anlaß mit ängstlicheren Grillen sich plagte als je zuvor. Den ersten Beweis von seiner eifersüchtigen Gemütsart gab er dadurch, daß er von keinem Schneider an Leonoren das Maß zu den vielen Kleidern wollte nehmen lassen, die er ihr zugedacht hatte. Er suchte deshalb eine andere Person auf, die ungefähr Leonorens Wuchs und Größe hätte, und fand ein armes Mädchen, nach deren Maß er ein Kleid machen ließ. Da es Leonoren paßte, so ließ er danach die übrigen Kleider machen, und zwar so viele und kostbare, daß sich Leonorens Eltern überglücklich schätzten, einen Schwiegersohn gefunden zu haben, der ihnen und ihrer Tochter so gut aushelfen könnte. Sie selbst war ganz betroffen beim Anblick so prächtiger Kleider; denn der Putz, den sie in ihrem ganzen Leben an sich gesehen hatte, bestand in einem Raschrock und in einem Fähnchen von Taft.
Der zweite Beweis, den Philipp von seiner Eifersucht gab, war, daß er sich nicht eher vermählen wollte, als bis er ein Haus besonders dazu eingerichtet hätte. Er kaufte eins für zwölftausend Dukaten in einem vorzüglichen Quartiere der Stadt, an dem fließendes Wasser und ein Pomeranzengarten war. Alle Fenster, die auf die Straße gingen, oder sonst im Hause waren, ließ er so weit zumauern, daß das Licht nur von oben hereinfiel. In das Kutschentor (das nach der Straße geht) ließ er einen Stall für eine Mauleselin bauen und darüber einen Strohboden und ein Kämmerchen für den Stallknecht, einen alten, verschnittenen Neger. Die Mauern des Hofs ließ er so hoch aufführen, daß man beim Hereintreten nur die Wände und den Himmel erblickte, und aus dem Kutschentor ging ein Drehfenster in den Hof. Er schaffte reichen Hausrat an, und seine Tapeten, Sofas und Baldachins waren dem vornehmsten Manne angemessen. Ebenso kaufte er vier weiße Sklavinnen, die er im Gesicht brandmarken ließ, und zwei Negerinnen, die das Spanische schlecht sprachen. Er kam mit einem Koch überein, daß er ihm das Essen bringen und einkaufen sollte; doch durfte er nicht im Hause schlafen, und überhaupt nicht weiter, als bis an das Drehfenster kommen, durch welches er die Speisen hereinzureichen hatte.
Nachdem er diese Anstalten getroffen hatte, gab er einen Teil seines Vermögens an verschiedenen und sicheren Orten auf Zinsen; einen anderen legte er in die Bank, und etwas behielt er für vorfallende Ausgaben. Ebenso ließ er sich einen Hauptschlüssel für alle Zimmer im Hause machen und hatte alle Vorräte unter Verschluß, die man für das ganze Jahr zu der schicklichsten Zeit einzukaufen pflegt.
Nachdem er alle diese Einrichtungen getroffen hatte, begab er sich zu seinen Schwiegereltern, um seine Braut heimzuführen. Die Eltern gaben sie ihm unter vielen Tränen; denn es schien ihnen, als solle sie zu Grabe getragen werden.
Die kindische Leonore wußte nicht einmal, wie ihr geschah. Sie weinte mit ihren Eltern, bat sie um ihren Segen, sagte ihnen Lebewohl, und umringt von ihren Sklavinnen und Mägden, ging sie an der Hand ihres Gemahls nach seiner Wohnung. Beim Eintritt in dieselbe hielt Carrizales an alle eine lange Rede, schärfte ihnen die Bewachung Leonorens ein, und verbot ihnen, auf keinerlei Art und Weise irgend jemanden durch die zweite, innere Tür einzulassen, selbst nicht einmal den verschnittenen Neger. Doch ganz besonders trug er Leonorens Bewachung und Pflege einer klugen und gesetzten Dueña auf, die er gewissermaßen als ihre Hofmeisterin annahm. Zugleich bestellte er sie zur Aufseherin über alles, was im Hause vorging, und gab ihr das Regiment über die Sklavinnen und zwei Mädchen von Leonorens Alter, die er ebenfalls angenommen hatte, damit sie Leonoren zur Unterhaltung dienten. Er versprach allen eine so gute Behandlung und ein so gutes Leben, daß sie ihre Einsperrung gar nicht fühlen sollten; auch wollte er sie jeden Feiertag, ohne Ausnahme, zur Messe gehen lassen, doch so früh, daß sie kaum das Tageslicht zu sehen bekämen.
Die Mägde und Sklavinnen versprachen, allen seinen Befehlen gern und willig nachzukommen; die junge Frau zuckte die Achseln, verneigte sich und sagte, sie habe keinen andern Willen, als den ihres Herrn und Gemahls, dem sie stets gehorsam sein werde.
Wie der gute Estremadurer diese Vorkehrungen getroffen und sich in sein Haus zurückgezogen hatte, begann er, soweit es ihm möglich war, die Früchte der Ehe zu genießen, die Leonoren bei ihrer Unerfahrenheit weder einladend noch zuwider waren. Sie vertrieb sich die Zeit mit ihrer Dueña und den Mädchen und Sklavinnen; und diese suchten sich für ihre Einsamkeit durch Näschereien zu entschädigen, und selten verging ein Tag, an dem sie nicht tausenderlei Dinge zugerichtet hätten, denen Honig und Zucker die Würze geben. Alles, was sie dazu brauchten, stand ihnen im Überflusse zu Gebote, und ihr Herr gab es ihnen auch sehr willig und gern, weil er hoffte, daß sie über dieser Unterhaltung und Beschäftigung nicht Zeit haben würden, an ihre Einsperrung zu denken.
Leonore ging mit ihren Mägden auf gleichem Fuße um und nahm auch dieselben Zeitvertreibe vor; ja, in ihrer Unschuld machte sie wohl Puppen und nahm andre Spiele der Kinder vor, die von ihrer Unverdorbenheit und Jugend zeugten. Das alles machte dem eifersüchtigen Eheherrn große Freude, und er glaubte das glücklichste Los gewählt zu haben, das sich nur denken lasse, und daß weder List noch Bosheit der Menschen auf irgendeine Weise imstande sei, seine Ruhe zu stören. Er dachte darum auf weiter nichts, als wie er seiner Gemahlin eine Freude machen könne, und erinnerte sie beständig, jeden Wunsch, den sie haben möchte, ihm nur zu sagen, denn sie könne auf seine Erfüllung rechnen.
Wenn sie in die Messe ging, was, wie gesagt, in der Morgendämmerung geschah, stellten sich ihre Eltern auch ein und sprachen in der Kirche mit ihrer Tochter im Beisein ihres Gemahls, der seine Schwiegereltern so reich beschenkte, daß sie darüber den Kummer einigermaßen vergaßen, den ihnen die Einsperrung ihrer Tochter verursachte.
Wenn Carrizales des Morgens aufgestanden war, so erwartete er den Koch, der abends zuvor durch das Drehfenster den Küchenzettel für den nächsten Tag erhalten hatte. War dieser dagewesen, so ging er gewöhnlich zu Fuße aus, nachdem er die innere und äußere Tür verschlossen hatte, zwischen welchen sich der Neger befand. Er ging seinen wenigen Geschäften nach, kam bald wieder, schloß sich ein und vertrieb sich die Zeit damit, daß er seine Gemahlin liebkoste und seinen Mägden schmeichelte, die ihn auch alle wegen seines leutseligen und gefälligen Betragens, besonders aber wegen der Freigebigkeit, die er gegen sie bewies, recht lieb hatten. So verging das Jahr ihres Noviziats, und sie taten Profeß in dieser Lebensart, und beschlossen, es zeitlebens fortzusetzen. Das wäre auch geschehen, wenn nicht der schlaue Feind des menschlichen Geschlechts es gehindert hätte, wie nun erzählt werden soll.
Jetzt sage mir einmal einer, der vor andern klug und vorsichtig zu sein glaubt, was für bessere Maßregeln der alte Philipp zu seiner Sicherheit hätte treffen können, da er nicht einmal ein männliches Tier in seinem Hause duldete? Kein Kater verfolgte hier die Mäuse, keine Rette hörte man bellen; alle seine Haustiere waren weiblichen Geschlechts. Carrizales machte sich am Tage Gedanken, und des Nachts floh ihn der Schlaf; er war die Wache, die um sein Haus die Runde hielt, und der Argus der Geliebten. Nie kam eine Mannsperson über die Schwelle der Haustür. Mit seinen Freunden sprach er auf der Straße. Die Bilder auf den Tapeten, die seine Zimmer und Säle schmückten, stellten bloß weibliche Wesen, Blumen und Landschaften dar. Sein ganzes Haus hatte den Geruch der Ehrbarkeit, Zucht und Eingezogenheit; und selbst in den Märchen, welche seine Mägde in den langen Winterabenden am Kamine erzählten, kam keins vor, das irgend etwas Anstößiges enthalten hätte, weil er selbst unter den Zuhörern war. Das Silberhaar des Greises war in Leonorens Augen gediegenes Gold; denn die erste Liebe prägt sich dem Herzen des Mädchens, wie das Siegel dem Wachs ein. Ihre ängstliche Bewachung schien ihr eine kluge Vorsicht, und sie dachte und glaubte, allen Neuvermählten gehe es wie ihr. Ihre Gedanken schweiften nie außer den vier Pfählen ihres Hauses, und ihr Herz wünschte nichts anderes, als was ihr Gatte wollte. Bloß an den Tagen, wo sie zur Messe ging, bekam sie die Straßen zu seh’n, und das geschah so früh, daß es erst auf dem Heimwege hell genug war, sie in Augenschein zu nehmen. Nie sah man ein Kloster so gut verwahrt; nie Nonnen in strengerer Eingezogenheit, noch goldne Äpfel so wohl gehütet. Und doch konnte er es auf keine Weise verhüten, daß ihn das gefürchtete Unglück traf, oder daß er wenigstens glaubte, davon betroffen zu sein.
Es findet sich in Sevilla ein Schlag von Müßiggängern und Taugenichtsen, die man gewöhnlich lustige Brüder nennt. Es sind junge Leute aus allen Ständen und selbst aus den reichsten Familien – leere, geschniegelte und honigsüße Herrchen, von deren Kleidung, Lebensweise, Denkungsart sowie von den Gesetzen, die sie untereinander befolgen, viel zu sagen wäre, was wir aber aus guten Gründen unterlassen. Einer von diesen Stutzern (die sich selbst untereinander Freimänner und die neuvermählten Ehemänner Kreuzträger nennen) richtete zufällig sein Augenmerk auf das Haus des vorsichtigen Carrizales, und weil er es immer verschlossen fand, ward er neugierig, zu wissen, wer es bewohne. Er spürte so eifrig und sorgfältig nach, daß er alles erfuhr, was er wissen wollte: die Denkungsart des Alten, die Schönheit seiner Gattin und die Art und Weise, wie sie bewacht ward. Das alles machte ihn begierig, zu sehen, ob nicht eine so wohl bewachte Festung durch List oder Gewalt zu erobern sei. Er besprach sich mit zwei Freimännern und einem Kreuzträger darüber, und seine Freunde beschlossen, die Sache ins Werk zu richten; denn nie fehlt es zu solchen Streichen an Ratgebern und Helfershelfern.
Sie waren verlegen, wie ein so schwieriges Unternehmen auszuführen sei; doch nachdem man die Sache vielfach überlegt und besprochen hatte, kamen sie dahin überein, daß Loaysa (so hieß der Freimann) unter dem Vorwande, auf einige Tage verreisen zu wollen, sich den Augen seiner Freunde entziehen sollte. Das geschah, und Loaysa zog reine, leinene Hosen und ein saubres Hemd an, aber darüber einen so zerlumpten und zusammengeflickten Kittel, daß kein Bettler in der ganzen Stadt ihn schlechter trug. Er schor seinen schwachen Bart ab, legte auf das eine Auge ein Pflaster, schnallte den einen Fuß in die Höhe, und hinkte auf Krücken so natürlich, daß es ihm der elendste Krüppel nicht gleichtat.
In diesem Aufzuge setzte er sich jeden Abend um die Vesperzeit vor die Haustür des Carrizales, wenn bereits das ganze Haus verschlossen, und der Neger, Namens Luis, zwischen beiden Türen eingesperrt war. Hier holte Loaysa eine kleine Zither hervor, die ziemlich schmutzig war und an der einige Saiten fehlten, und spielte, weil er etwas musikalisch war, einige lustige Liederchen, die er mit verstellter Stimme sang, um sich nicht zu verraten. Er sang auch einige närrische Romanzen von Mohren und Mohrinnen mit soviel Anmut, daß alle Vorübergehenden ihm zuhörten, und er beständig bei seinem Gesange von Knaben umringt war. Der Neger Luis hielt inzwischen das Ohr an die Tür und hörte mit unverwandter Aufmerksamkeit seiner Musik zu: er hätte einen Arm darum gegeben, wenn er hätte die Tür öffnen und mit mehr Gemächlichkeit zuhören können; denn die Neger sind sehr musikalisch. Wollte Loaysa seine Zuhörer los sein, so hörte er auf zu singen, steckte seine Zither ein und hinkte auf seinen Krücken fort.
Vier- oder fünfmal hatte er dem Neger eine Musik gebracht (denn diesem galt es eigentlich, weil Loaysa glaubte, daß der Neger derjenige sei, bei dem man anfangen müsse, das Gebäude zu untergraben), so glückte ihm auch schon sein Anschlag. Denn als er eines Abends, wie gewöhnlich, an die Tür kam und seine Zither stimmte, merkte er, daß der Neger bereits die Ohren spitze. Er legte daher seinen Mund an die Türschwelle und sagte leise: »Kannst du mir wohl ein wenig Wasser geben, Luis, denn ich verschmachte vor Durst und kann nicht singen.«
»Nein,« versetzte der Neger, »denn ich habe keinen Schlüssel zu dieser Tür, und es ist auch kein Loch da, wodurch ich es Euch reichen könnte.«
»Wer hat denn den Schlüssel?« fragte Loaysa.
»Mein Herr,« erwiderte der Neger, »der eifersüchtigste Mensch von der Welt. Wenn er wissen sollte, daß ich hier mit jemandem spräche, so wär’s um mein Leben geschehen. Doch wer seid Ihr denn, daß Ihr mich um Wasser bittet?«
»Ich bin ein armer Krüppel, der mit einem Fuße lahmt«, versetzte Loaysa, »und der sein Brot von guten Leuten um Gotteswillen erbettelt. Daneben unterweise ich einige Mohren und andre arme Leute im Zitherspiel, und habe bereits drei Negersklaven dreier Ratsherren soweit gebracht, daß sie zu jedem Tanze, in jeder Schenke aufspielen können, und sie haben mich gut gelohnt.«
»Ich wollt’ Euch noch weit besser lohnen,« sagte Luis, »wenn ich nur bei Euch Unterricht nehmen könnte. Doch das ist nicht möglich; denn wenn mein Herr am Morgen ausgeht, schließt er die vordere Tür, und wenn er nach Hause kommt, tut er’s ebenfalls und läßt mich zwischen beiden Türen eingekerkert.«
»Bei Gott! Luis,« versetzte Loaysa, der den Namen des Negers bereits wußte, »wenn du es möglich machen könntest, daß ich dir einige Abende Unterricht erteilte, so wollt’ ich keine vierzehn Tage brauchen, um dich soweit zu bringen, daß du an jeder Ecke ohne Scheu aufspielen könntest. Denn du mußt wissen, daß ich eine ganz besondere Gabe im Unterrichten besitze; und überdies hab’ ich mir sagen lassen, daß du viel Talent zur Musik besitzest, und soviel ich merke und aus deiner Diskantstimme abnehmen kann, mußt du sehr gut singen.«
»Ich singe nicht schlecht,« erwiderte der Neger; »doch was hilft’s? Ich kenne kein anderes Lied, als das vom »Stern der Venus« und »Auf der grünen Wiese« und »An den Stäben eines Gitters fest sich haltend, voll Verwirrung«, was jetzt sehr gemein ist.«
»Alle diese Lieder sind nichts,« sagte Loaysa, »gegen die, welche ich dir lehren kann; denn ich weiß alle Romanzen von dem Mohr Abindarraez und seiner Dame Jarifa, und alle, die von der Geschichte des großen Sofi Tomuni-Bey handeln, nebst denen der göttlichen Sarabande, die selbst die Portugiesen in Staunen setzen. Ich teile das alles auf eine so leichte Art mit und habe eine so gute Methode, daß du dich gar nicht anzustrengen brauchst, und eh’ du drei bis vier Maß Salz verzehrt hast, ein ganzer Spieler auf jeder Art von Zither sein sollst.«
»Was hilft das alles,« seufzte der Neger, »wenn ich nicht weiß, wie ich Euch ins Haus bringen soll.«
»Dafür weiß ich ein Mittel,« sagte Loaysa; »sieh nur, daß du den Schlüssel deines Herrn bekommst, und ich will dir Wachs geben, worin du den Bart abdrückst. Denn weil ich dich einmal lieb gewonnen habe, so soll mir ein Schlosser, der mein Freund ist, einen Nachschlüssel machen, und ich kann dann abends zu dir kommen und dich besser unterrichten als den Priester Johann von Indien. Denn es wäre doch schade, wenn eine Stimme wie die deinige zugrunde gehen sollte, weil ihr die Begleitung der Zither fehlt; denn du mußt wissen, Bruder Luis, die beste Stimme von der Welt verliert, wenn sie nicht von irgendeinem Instrument, sei’s nun Zither, Klavier, Orgel oder Harfe begleitet wird. Doch für deine Stimme schickt sich die Zither am besten, und sie ist auch das leichteste und wohlfeilste Instrument.«
»Das hätte wohl meinen Beifall,« versetzte der Neger, »aber es ist nicht ausführbar, weil die Schlüssel nie in meine Hände kommen können; denn am Tage legt sie mein Herr nicht aus der Hand, und des Nachts liegen sie unter seinem Kopfkissen.«
»Nun, so befolge einen andern Vorschlag, Luis,« sagte Loaysa, »wofern du anders Lust hast, ein tüchtiger Spieler zu werden; denn wenn dir’s daran fehlt, so kann ich mir die Müh’ ersparen, dir einen Rat zu geben.«
»Ob ich Lust habe?« versetzte Luis; »ich will alles tun, was irgend menschenmöglich ist, wenn ich’s nur dahin bringe, ein Zitherspieler zu werden.«
»Wenn das ist,« sagte Loaysa, »so schaffe nur etwas Erde unter der Tür weg, und ich will dir Hammer und Zange geben, womit du des Nachts die Nägel sehr leicht aus dem Schlosse ziehen kannst. Ebensoleicht können wir die Platte wieder annageln, daß niemand es gewahr werden soll, daß sie abgerissen gewesen ist; und wenn ich erst mit dir auf deinem Heuboden eingeschlossen bin, oder wo du sonst dein Nachtlager hast, dann will ich mir deinen Unterricht so angelegen sein lassen, daß du mir zu Ehren und dir zu Frommen es noch weiter bringen sollst, als ich dir gesagt habe. Wegen unsres Unterhalts mach dir keine Sorge. Ich will für uns beide Mundvorrat mitbringen, der über eine Woche ausreicht; denn ich habe Schüler und Freunde, die mich nicht Not leiden lassen.«
»Das Essen«, versetzte der Neger, »darf uns keinen Kummer machen; denn an der Portion, die mir mein Herr gibt und an den Überbleibseln, die mir die Sklavinnen geben, hätten noch zwei andre genug. Bringt nur besagten Hammer und Zange; ich will schon unter der Tür einen Zugang machen, durch den sie hereingehen, und ihn dann wieder mit Ton verschmieren. Denn wenn ich auch ein paar Schläge tun muß, um die Platte loszubringen, so schläft doch mein Herr so weit von dieser Tür, daß es sonderbar oder sehr unglücklich für uns gehen müßte, wenn er’s hören sollte.«