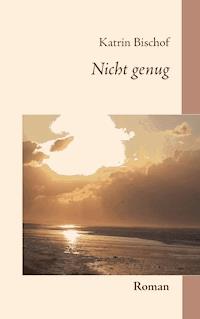12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KUUUK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Er“, ambitionierter Läufer, Anfang 60, Hochschuldozent für das Fach Übersetzen, trifft auf jene bedeutungsvolle „Sie“, Naike Behning, eine außerordentlich begabte Studentin. Sofort fühlt „Er“ sich unwiderstehlich von ihrer dominant-selbstsicheren Aura angezogen. Das bringt sein fragiles Gleichgewicht ins Wanken. Denn es überlagern sich in seinem Inneren sowieso schon jene Beziehungsaltlasten aus Jahrzehnten sowie der ständige Ärger mit seiner aktuellen, zudem so komplizierten Partnerin namens Angela. Die neu auf der Bildfläche erschienene junge Naike konfrontiert den „Enklavenmann“ – einen dereinst traumatisierten Menschen, der mit zwischenmenschlichen Beziehungen seine ganz speziellen Probleme hat – nun erbarmungslos mit all seinen ungelösten Konflikten. Das sorgt für einige Unordnung auch in ihrem Leben. Zugleich ist sie aber tief beeindruckt und überdeutlich angezogen von der Weltgewandtheit und Intellektualität des viel älteren Mannes. Da entwickelt sich ganz konsequent eine seelenverwandte und erotisch aufgeladene Mann-Frau-Beziehung. Jedoch: Die beiden Hauptpersonen verzweifeln immer wieder, weil keine Seite weiß, was die andere eigentlich will. Grenzüberschreitungen und Zerwürfnisse, neue Annäherungen – ein großes Hin und Her, welches man beim Lesen mit durchlebt. Wer, was, wie? Eine Psychogramm wird in diesem klugen Roman fein und fast sezierend Schnitt für Schnitt entwickelt: Mann und Frau sind in ihren eigenen Verstrickungen und den sich dauernd abspielenden Missverständnissen scheinbar sehr verfangen. Und: Es gibt noch eine Besonderheit dieses Romans. Alles hier wird von der Schriftstellerin Katrin Bischof in der Erzählrolle des Mannes beschrieben – jenes so aufregende und doch auch gern verdammt komplexe Mann-und-Frau-Beziehungsleben, dem sich Abermillionen im Alltag immer wieder neu stellen müssen. Zwei Leben also, die gegeneinander „zu übersetzen“ sind – samt der garantierten Unverständnisse. Daraus wurde ein changierender Roman, der uns vollkommen ins Geschehen hineinzieht. Man kann nicht dagegen an, wird selber zum Bestandteil der geschilderten Anziehungs- und Abstoßungswirrnisse. Am Ende muss eine Entscheidung gefällt werden. Aber welche? Katrin Bischof ist eine Frau der Sprache, die heute als Deutsche in den Niederlanden lebt. Sie stammt ursprünglich aus der Hansestadt Stade an der Unterelbe, wo sie 1971 geboren wurde. Später studierte sie Germanistik und Slawistik an der Universität Kiel, arbeitete dann als Fremdsprachensekretärin und Übersetzerin. Es folgte noch ein weiteres Studium der „Internationalen Fachkommunikation“ an der Universität Hildesheim. Seit Dezember 2008 ist Katrin Bischof freiberuflich als Fachübersetzerin tätig. Englisch, Französisch, Niederländisch überträgt sie ins Deutsche. Technik und Wissenschaft, Medizin und Marketing sind ihre wichtigsten Fachgebiete. Darüber hinaus schreibt sie anspruchsvolle Romane.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
INFO | TITEL
Katrin Bischof
Der Enklavenmann
Roman
K|U|U|U|K
Verlag
mit 3 U
INHALT
„Er“, ambitionierter Läufer, Anfang 60, Hochschuldozent für das Fach Übersetzen, trifft auf jene bedeutungsvolle „Sie“, Naike Behning, eine außerordentlich begabte Studentin.
Sofort fühlt „Er“ sich unwiderstehlich von ihrer dominant-selbstsicheren Aura angezogen. Das bringt sein fragiles Gleichgewicht ins Wanken. Denn es überlagern sich in seinem Inneren sowieso schon jene Beziehungsaltlasten aus Jahrzehnten sowie der ständige Ärger mit seiner aktuellen, zudem so komplizierten Partnerin namens Angela.
Die neu auf der Bildfläche erschienene junge Naike konfrontiert den „Enklavenmann“ – einen dereinst traumatisierten Menschen, der mit zwischenmenschlichen Beziehungen seine ganz speziellen Probleme hat – nun erbarmungslos mit all seinen ungelösten Konflikten. Das sorgt für einige Unordnung auch in ihrem Leben. Zugleich ist sie aber tief beeindruckt und überdeutlich angezogen von der Weltgewandtheit und Intellektualität des viel älteren Mannes.
Da entwickelt sich ganz konsequent eine seelenverwandte und erotisch aufgeladene Mann-Frau-Beziehung. Jedoch: Die beiden Hauptpersonen verzweifeln immer wieder, weil keine Seite weiß, was die andere eigentlich will. Grenzüberschreitungen und Zerwürfnisse, neue Annäherungen – ein großes Hin und Her, welches man beim Lesen mit durchlebt.
Wer, was, wie? Eine Psychogramm wird in diesem klugen Roman fein und fast sezierend Schnitt für Schnitt entwickelt: Mann und Frau sind in ihren eigenen Verstrickungen und den sich dauernd abspielenden Missverständnissen scheinbar sehr verfangen.
Und: Es gibt noch eine Besonderheit dieses Romans. Alles hier wird von der Schriftstellerin Katrin Bischof in der Erzählrolle des Mannes beschrieben – jenes so aufregende und doch auch gern verdammt komplexe Mann-und-Frau-Beziehungsleben, dem sich Abermillionen im Alltag immer wieder neu stellen müssen.
Zwei Leben also, die gegeneinander „zu übersetzen“ sind – samt der garantierten Unverständnisse. Daraus wurde ein changierender Roman, der uns vollkommen ins Geschehen hineinzieht. Man kann nicht dagegen an, wird selber zum Bestandteil der geschilderten Anziehungs- und Abstoßungswirrnisse. Am Ende muss eine Entscheidung gefällt werden. Aber welche?
DIE AUTORIN
IMPRESSUM
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek erfasst diesen Buchtitel in der Deutschen Nationalbibliografie. Die bibliografischen Daten können im Internet unter http://dnb.dnb.de abgerufen werden.
Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen und Medien – auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere neuartige Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors / der Autorin bzw. des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
HINWEIS: Deutsch ist überaus vielschichtig und komplex. Der Verlag versucht, nach bestem Wissen und Gewissen alle Bücher zu lektorieren und zu korrigieren. Oft gibt es allerdings mehrere erlaubte Schreibweisen parallel. Da will entschieden werden. Zudem ergeben sich immer wieder Zweifelsfälle, wozu es oft auch keine eindeutigen Antworten gibt. Schlussendlich haben auch die Autorinnen und Autoren ureigene Sprachpräferenzen, die sich dann bis in die Kommasetzung, Wortwahl und manche Schreibung wiederfinden lassen können. So wurden in diesem Roman bisweilen Kommata – man sagt auch: Kommas – nach einer sehr kurzen direkten Rede mit voller Absicht weggelassen. Bitte behalten Sie das beim Lesen in Erinnerung.
Coverentwurf: © Klaus Jans
Lektorat: KUUUK
ISBN E-BOOK 978-3-939832-77-5
Erste Auflage E-BOOK Dezember 2014
KUUUK Verlag und Medien Klaus Jans
Königswinter bei Bonn
K|U|U|U|K – Der Verlag mit 3 U
www.kuuuk.com
Alle Rechte [Copyright] © KUUUK Verlag – [email protected] und © Katrin Bischof
TEIL 1
1.
Jetzt, im Nachhinein, frage ich mich, ob Naike Behning für mich jemals eine Studentin wie alle anderen war.
Im Nachhinein ist das schwer zu sagen. Ich weiß nicht mehr, ob sie mir auffiel, gleich in der ersten Stunde. Höchstwahrscheinlich nicht.
Seit über fünfundzwanzig Jahren bin ich nun schon an einer deutschen Fachhochschule in der Übersetzerausbildung tätig. Ich versuche, Studenten zu vermitteln, dass Übersetzen mehr bedeutet, als einen Text in Wortbröckchen zu zerhacken, diese durch den Fleischwolf eines Wörterbuchs zu drehen und auf diese Weise eine Masse zusammenzurühren, deren Konsistenz schon auf den ersten Blick die Übersetzung verrät.
Auch nach über fünfundzwanzig Jahren habe ich noch immer Zweifel an meiner grundsätzlichen Eignung für die Lehrtätigkeit. Wenn die in den USA gängige Auffassung zutrifft, nach der jeder bei entsprechender Motivation alles lernen kann, bin ich schuld, wenn Studenten scheitern. Nach dieser Auffassung gibt es keine hopeless cases, nur bad teachers. Ich habe diese Auffassung wohl stärker verinnerlicht, als für mich gut ist. Vielleicht zögere ich deswegen jedes Mal so lange, bevor ich mir eingestehe, dass jemand ein hoffnungsloser Fall ist.
Aber es gibt sie, diese Unglücklichen, bei denen sogar ich mich geschlagen geben muss. Selbst wenn es ihnen im dritten Anlauf doch noch irgendwie gelingt, sich über die gewaltige Hürde des Vordiploms hinwegzuhieven, bleibt beim Lesen ihrer Übersetzungen immer der Eindruck, dass sich da jemand mit brachialer Gewalt durch ein undurchdringliches Dickicht gekämpft hat, in dem er weder Weg noch Steg kennt. Die Hoffnungslosen straucheln schon auf der ersten, elementarsten Stufe. Sie sind verloren in den grammatischen und lexikalischen Tücken der fremden Sprache, die mitunter ja durchaus einem Dschungel voll verborgener Fußangeln, in die Irre führender Locksignale und trügerischer Mimikris ähnelt. Das Entmutigende ist, dass die Hoffnungslosen sich an keinem Punkt zu fragen scheinen, ob die eingeschlagene Richtung überhaupt die richtige sein kann. Es fehlt ihnen dieser gewisse Instinkt, der Gefahr meldet. Warnzeichen werden nicht wahrgenommen. Was man nicht weiß, kann es auch nicht geben, das scheint die Marschroute zu bestimmen. Und so stapfen sie unverdrossen weiter drauflos. Was am Ende dabei herauskommt, ist im besten Fall eine sachlich halbwegs korrekte Inhaltswiedergabe. Wie gesagt: im besten Fall.
Jeder dieser – zum Glück seltenen – hoffnungslosen Fälle geht mir sehr nahe. Gerade diese Studenten geben ihr Bestes, versäumen keine einzige Stunde, stecken immer und immer wieder Niederlagen ein, nur um am Ende dann doch aufgeben zu müssen. Ich leide mit ihnen mit. Aber eben nicht unter ihnen. Nein – es sind die vielen, vielen Mittelmäßigen, die mich mit ihrer Borniertheit und Apathie auch nach so vielen Jahren noch immer wieder an den Rand der Verzweiflung bringen.
Ich unterrichte das Übersetzen vom Englischen ins Deutsche, eine Kombination, ohne die kein technischer Übersetzer heute mehr bestehen kann. Um mich kommt niemand herum. Meine Übungen sind Veranstaltungen mit Anwesenheitspflicht. Schon oft habe ich gewünscht, es wäre nicht so. Allein das Herumgeben und Kontrollieren von Anwesenheitslisten ist mir zuwider, und wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich nur Studenten, die freiwillig kommen, weil sie davon überzeugt sind, in meinen Kursen etwas Sinnvolles lernen zu können. Aber das wären mit Sicherheit eben nicht all diese Mittelmäßigen, denen oft gar nicht bewusst ist, wie bitter nötig gerade sie es haben, regelmäßig zu erscheinen.
Was mich an ihnen vor allem so aufbringt, ist diese passive Konsumhaltung. Sie sitzen da, schweigen, sehen mich an und warten auf das, was ihnen vorgesetzt wird. Und vor allem natürlich darauf, dass ich ihnen am Ende sage, was falsch und was richtig ist. Sie sind zufrieden, wenn sie ihren Schein bekommen, das ist im Grunde alles, was sie interessiert. Ihren Gesichtern ist abzulesen, dass sie weder eine Ahnung haben, was ich eigentlich von ihnen will, noch Lust, groß darüber nachzudenken.
Am angestrengtesten bemühen sich die Mittelmäßigen noch darum, nicht aufzufallen. Sie sind immerhin so höflich, sich nicht anmerken zu lassen, wenn ich sie langweile. Langeweile nehmen sie hin; lieber sind sie gelangweilt, als sich über das durchschnittliche Maß hinaus anstrengen zu müssen.
Naike Behning war eine Studentin, die Langeweile nicht hinnahm. Das war das erste, was mir an ihr auffiel: Ihr ungeniertes, provozierendes Gähnen, wenn ich mich zu lange bei einem Thema aufhielt, von dem sie fand, dass wir es ausreichend bearbeitet hatten.
Als ich ihr Gähnen zum ersten Mal bemerkte, war ich irritiert, wie es wohl die meisten Kollegen an meiner Stelle auch gewesen wären. Ich bedachte sie mit einem Seitenblick und einem freundlich-scherzhaften Kommentar. Sie zuckte nur die Schultern. Kurz darauf gähnte sie wieder, diesmal besonders ausdauernd und unüberhörbar laut.
Nach einigen Wochen ertappte ich mich dabei, dass ich ihren Gesichtsausdruck im Auge behielt. Das Gähnen kam nie ohne Vorwarnung. Schon einige Zeit davor zeichnete sich ihr Überdruss deutlich ab. Ich gewöhnte mir an, dann rasch fortzufahren. Irgendwann machte ich dann sogar einmal eine sarkastische Bemerkung, in der Richtung: Aha, es sei Zeit, sich dem nächsten Punkt zuzuwenden, da die Studentin Naike Behning offensichtlich unterfordert sei und im nächsten Moment anfangen werde zu gähnen. Sie schaute mich an, mit gerunzelter Stirn, und dann kamen sie, diese Worte, die alles mit einem Schlag veränderten: „Das haben Sie uns jetzt schon drei Mal erzählt.“
Unzählige Male habe ich später an diese Worte zurückgedacht, das eine Mal mit Bewunderung für ihre Unerschrockenheit, das andere Mal mit Ärger über ihre Aggressivität und Respektlosigkeit – je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade war. Damals aber war ich so elektrisiert von dieser unerwarteten Attacke, dass ich darauf gar nichts zu antworten hatte. Und wie auch immer ich später über diesen Moment noch dachte: Es war der Anfang unserer Geschichte.
In der Folgezeit fing ich an, sie bewusst anzusehen, und verstieß damit gegen die wichtigste Regel, die ich mir selbst auferlegt hatte. Sie bestand darin, die Unterschiede nicht allzu genau wahrzunehmen. Once you see the difference you’re lost.
Dieser Verstoß wog umso schwerer, als ich ja sogar bemüht war, das durch Konvention erzwungene Ansehenmüssen meiner Studentinnen auf ein Minimum zu reduzieren. Meine Blicke schweifen einfach zu leicht ab. Vor allem bei steigenden Temperaturen im Sommersemester kann das sehr qualvoll werden. Auf Schritt und Tritt sehe ich mich den exponierten Brüsten, Bäuchen und Schenkeln meiner Studentinnen gegenüber. And I’m haunted by all those shapes. Noch Tage später erinnere ich mich an das üppige, von leuchtend buntem Stoff umspannte Dekolleté der Studentin aus Kamerun, die vergangene Woche in meiner Sprechstunde war, oder an den glatten, piercinggeschmückten Nabel der olivhäutigen Französin aus meiner Dolmetschübung.
Das Dilemma liegt auf der Hand. Wendet man den Blick allzu offensichtlich ab, ist man verklemmt; schaut man allzu offensichtlich hin, lüstern. Beides legt den Schluss nahe, dass man seine Triebe nicht unter Kontrolle hat. Und das ist ein Ruf, den niemand an sich haften haben will, schon gar nicht, wenn er an einer Hochschule überwiegend junge Frauen unterrichtet.
In unserer westlichen Kultur wird von Männern erwartet, dass sie in der Lage sind, die auf sie einstürmende erotische Provokation nicht auf sich persönlich zu beziehen. Meine jüngeren Kollegen scheinen damit auch keine Schwierigkeiten zu haben. Sie kennen die Spielregeln und finden es selbstverständlich, permanent unter Beschuss zu stehen. Einige der Kollegen, die eher meiner Generation angehören, haben dagegen ähnliche Probleme wie ich; auf jeden Fall vermute ich das. Es verstört sie, dass die meisten Studentinnen andauernd sexuelle Verfügbarkeit signalisieren, ohne dabei einen Adressaten erkennen zu lassen.
Unterschiedlich ist nur die Art und Weise, wie sie reagieren. Manche Kollegen benehmen sich wie eitle Gockel und werden zu komischen, manchmal auch zu tragischen Figuren. Andere schützen sich durch übertrieben korrektes Auftreten, durch Spleenigkeit oder durch eine Unbeholfenheit im Umgang mit Studentinnen, die schon fast an Feindseligkeit grenzt.
Ich selbst laufe. Das ist ein Sport, in dem ich noch gut mithalten kann, zumindest in meiner Altersklasse. Die Einsamkeit des Langstreckenläufers hat etwas Erhabenes. Und obwohl mir Arroganz sonst fern liegt, muss ich zugeben, dass ich mir etwas darauf einbilde, Mitglied in dieser exklusiven Community zu sein, in die man sich nicht einkaufen kann wie in einen teuren Tennisverein. Und da ist noch etwas: Laufen hilft dabei, die latent lauernde Virilität in Schach zu halten. In diesem Punkt hat Angela tatsächlich Recht gehabt. Sie war ja von Anfang an der Meinung, dass ich nun einmal eine Suchtpersönlichkeit sei, in jeder Hinsicht und damit auch in dieser, und Laufen daher eine therapeutische Wirkung auf mich ausüben würde. Vielleicht ist das meine einzige Chance; immer weiter zu laufen, bis dieses Kapitel für mich endgültig abgeschlossen ist.
Auch meine Studenten lade ich oft dazu ein, mit mir laufen zu gehen. Das ist immer ein guter Anknüpfungspunkt und entkrampft die Beziehungen. Ich möchte ihnen auf einer menschlichen Ebene begegnen, als eine Art buddy, zu dem sie kommen können, wenn sie jemanden brauchen, der ein offenes Ohr für ihre Probleme hat: Studentin so und so hat bedauerlicherweise keine Zeit, dreihundert Wörter bis zum nächsten Mittwoch zu übersetzen, weil sie am Wochenende ihre Küche streichen muss. Oder konnte eine Zeitlang nicht zu meiner Veranstaltung kommen, weil der Tod ihrer Großmutter sie so mitgenommen hat. Meinetwegen; ich bin gerne entgegenkommend, auch dann, wenn ich ihre Entschuldigungen nicht besonders überzeugend finde. It’s so nice to be nice. Meistens gebe ich ihnen, was sie wollen, bevor sie mir mit ihrem Wimperngeklapper kommen. Das bringt mich in Verlegenheit, und ich will nicht, dass sie glauben, auf diese Weise etwas bei mir erreichen zu können.
Ich erfahre auch manches über ihre boyfriends – oder girlfriends, das allerdings wesentlich seltener, denn männliche Studenten gibt es in diesem Studiengang verschwindend wenige. Bei manchen wechseln die Partner in rascher Folge; ihre Romanzen werden anscheinend genauso unbekümmert begonnen, wie sie beendet werden. Andere sind schon seit der Schulzeit mit demselben ersten Freund oder derselben ersten Freundin zusammen und erzählen mir mit größter Ernsthaftigkeit, dass sie ihn oder sie nach dem Studium heiraten und eine Familie gründen werden. Die Sorglosigkeit, mit der die einen von einer kurzlebigen Liebelei zur anderen eilen, verstört und fasziniert mich genauso wie die Selbstverständlichkeit, mit der die anderen ihre Beziehungen pflegen und sie für unangreifbar halten. Beide approaches sind mir immer fremd gewesen.
Manche Einblicke, die sich mir eröffnen, berühren mich tiefer, als mir lieb ist. Erst vor einigen Wochen brach die verheiratete ukrainische Studentin, der ich schon seit Monaten außerhalb meiner offiziellen Sprechstunden bei ihren spanisch-deutschen Übersetzungen half, in meinem Büro in Tränen aus und vertraute mir an, dass sie ein Verhältnis mit einem meiner Kollegen habe. Ihr Leben sei ein Chaos, weswegen sie nicht in der Lage gewesen sei, den Text von vergangener Woche zu bearbeiten. Als ich sie das nächste Mal sah, fragte ich sie, ob es ihr inzwischen wieder besser gehe. Sie lächelte gequält und sagte, sie sei schwanger geworden; am Sonntag vor drei Wochen sei es passiert. Von wem sie schwanger geworden war, ob von ihrem Ehemann oder meinem Kollegen, sagte sie nicht. Beide Möglichkeiten schienen mir so beunruhigend, dass meine Gedanken noch lange danach immer wieder zu der Studentin, ihrem Ehemann und meinem Kollegen abirrten.
Vielleicht hat Rudolf ja Recht. Er wirft mir vor, mein Interesse an den Sorgen meiner Studenten sei nicht „normal“, ja schon fast „krankhaft“. Ich müsse eine Grenze ziehen, meint er, sonst könne ich die notwendige Distanz zu ihnen nicht einhalten, und an meinen Status denken. Und wie ich in meinem Alter noch Interesse für die Probleme von knapp dem Teenageralter Entwachsenen aufbringen könne, sei ihm ohnehin unverständlich. Bemerkungen dieser Art irritieren mich, was sie an sich nicht sollten, da sie ja vor allem etwas über Rudolf selbst aussagen.
Grenzziehungen sind mir schon immer schwer gefallen, insbesondere dann, wenn mir jemand weismachen will, dass sie notwendig seien aufgrund von Unterschieden in Status oder Alter. Ich habe noch nie eingesehen, warum Mitgefühl und Anteilnahme etwas mit Status und Alter zu tun haben sollen. Und ja, ich gebe es zu, sicher schmeichelt es mir auch, dass ich für manche Studenten eine vertrauenswürdige Ansprechperson bin, obwohl ich schon beinahe ihr Großvater sein könnte. But so be it – solange das die Rolle ist, die sie für mich vorgesehen haben, droht keine Gefahr.
In den letzten Jahren hatte ich Strategien entwickelt, die mich von Anfechtungen weitgehend abschirmten. Ich lief, ich bemühte mich, meine Studentinnen nicht anzusehen und ihnen allen mit unterschiedsloser Liebenswürdigkeit zu begegnen. Meine Schutzhaut war dünn, aber sie hatte gehalten. Bis Naike Behning mir ins Gesicht gähnte und aufhörte, für mich eine Studentin wie alle anderen zu sein.
2.
Vor diesem Moment hätte ich schon überlegen müssen, wenn mich jemand gefragt hätte, wie sie aussah, und dann vermutlich so etwas geantwortet wie braunhaarig, schlank und mittelgroß, ein Passepartout, das auf unzählige andere Studentinnen genauso zutraf.
Naike Behning war keine dieser Schönheiten im konventionellen Sinne, die einem sofort ins Auge fallen. Attraktiv an ihr war gerade, dass ihr daran auch offensichtlich gar nichts lag. Naike Behning war vor allem eines: So unbekümmert authentisch, dass es mir den Atem verschlug. Nimm mich so, wie ich bin, oder lass es bleiben, das war die Botschaft, die sie aussendete, auch wenn ihr das selbst (wie ich heute denke) möglicherweise nicht einmal bewusst war. Aber auch das war Teil ihres Charmes.
Das Auffälligste an ihr war sicher das Haar – sehr dunkel, lang und unruly –, das ihr in dichten Wellen über den Rücken fiel. Trotz schmalknöcheliger Handgelenke, fein modellierter Knie und deutlich ausgeprägter Fesseln hatte sie nichts Fragiles an sich; dazu waren ihre Taille zu stabil und ihre Schultern zu breit. Die Augen – groß, rund und von unbestimmter Farbe, grünbraun vielleicht wie der Kern einer Sonnenblume – dominierten ein Gesicht, das einem weniger durch gefällige Hübschheit als durch wache Intelligenz in Erinnerung blieb.
Ihr Gang war entschlossen und zielstrebig, als ob sie immer genau wusste, wohin sie wollte und was sie dort zu tun hatte – und als ob sie es nicht schätzte, auf ihrem Weg dorthin aufgehalten zu werden. Und so wie sie ging, so sprach sie auch, das hatte ich ja bereits am eigenen Leib erfahren dürfen. Ich hätte gewarnt sein müssen. Aber ach, es hat mich Zeit meines Lebens zu Frauen hingezogen, die wussten, was sie wollten, oder wenigstens diesen Eindruck machten.
Ich bemerkte, dass ich auf ihre Schritte horchte, wenn ich vor Veranstaltungsbeginn im Raum war und die Studenten nach und nach hereinkamen. Ich versuchte, von der Art, wie sie gekleidet war, auf ihre Stimmung zu schließen. Und ich fing an, ihr Gesicht wie einen Kompass zu lesen, der mir die Marschrichtung vorgab.
Dann kam der Tag, an dem sie sich freiwillig für die Übersetzung eines Textes meldete, der mehrere Fachtermini des amerikanischen Rechtssystems ohne begriffliche Entsprechung im Deutschen enthielt. It was a pretty hard case to crack.
An sich hatte ich vorgehabt, ihre Übersetzung wie immer im Plenum besprechen zu lassen. Da Beiträge anderer Teilnehmer diesmal jedoch gänzlich ausblieben, lief das Ganze sehr bald auf ein exklusives Zwiegespräch hinaus. Es waren einige Fehlleistungen in ihrem Text, nicht viele, und weit weniger, als ich erwartet hatte. Sie diskutierte vehement mit mir über jedes Detail und ließ nicht eher locker, bis sie selber einsah, warum ihre Lösung noch verbesserungsfähig war. Nun endlich zeigte sich das, was ich hinter ihrer beherrschten Lässigkeit schon längst vermutet hatte: die andere, impulsive Seite.
„Wären Sie so freundlich, Ihre Fassung noch einmal zu überarbeiten und uns zur Verfügung zu stellen?“, beendete ich die Debatte schließlich.
Sie nickte verdrießlich. „Natürlich.“
Ich nahm ihren Verdruss nicht persönlich. Sie mochte es nicht, wenn die Qualität ihrer Arbeit nicht so war, wie sie es selbst von sich erwartete. Mittelmaß, Durchschnittlichkeit, das war nichts für sie. Sie gehörte zu den Menschen, die perfekt sein wollen.
Eine Woche später reichte sie eine überarbeitete Fassung ihrer Übersetzung ein, an der es nicht das Geringste mehr auszusetzen gab. Sie nickte nur knapp, als ich ihr das mitteilte, als hätte sie nichts anderes erwartet, aber das kurze, befriedigte Aufleuchten in ihren Augen sah ich doch.
Nach der Übung kam sie zu mir. „Ich habe den Text letztes Wochenende mit meinem Vater durchgearbeitet“, sagte sie. „Der ist Jurist. Deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass es jetzt in Ordnung sein würde.“
„Da haben Sie sich ja richtig viel Mühe gemacht“, entgegnete ich mit meinem freundlichsten Lächeln.
Zum ersten Mal sah ich nun auch sie lächeln. „Eine schwierige Aufgabe ist es wert, dass man sich Mühe macht.“ Das war ihre Erwiderung. Diese Worte hätten sehr überheblich klingen können, wenn sie nur Pose gewesen wären. Aber sie meinte sie tatsächlich genau so, wie sie sie sagte.
Von diesem Tag an kreisten meine Gedanken immer häufiger um sie. Ich versuchte, mehr über sie zu erfahren. Aber wen konnte ich fragen? Andere Studenten? Nein. Zu den meisten meiner Kollegen hatte ich keinen näheren Kontakt, sie wären nur misstrauisch geworden. Der einzige, der in Frage kam, war Rudolf, der sie ganz sicher kannte, da ihre Drittsprache Russisch war und sie mehrere seiner Kurse besucht haben musste. Rudolf und ich gingen seit Jahren fast täglich zusammen laufen, wir hatten unseren allerersten Marathon gemeinsam bestritten, da wusste man manches voneinander.
Als wir das nächste Mal unsere Laufstrecke abarbeiteten und wir uns lange genug darüber unterhalten hatten, ob all die in den Läuferforen angepriesenen Wunderpillen denn nun tatsächlich nützten, ob man mit Kompressionsstrümpfen lächerlich aussah und ob Intervalltraining auch mal wieder sein musste, hielt ich die Gelegenheit für gekommen.
„Was hältst du eigentlich von Naike Behning?“
„Naike Behning?“ Rudolf zog überlegend die Stirn in Falten. „Intelligent, ehrgeizig, weit überdurchschnittlich. Stell dir vor, sie hatte überhaupt keine Vorkenntnisse in Russisch und will jetzt schon, nach zwei Semestern, die Sprachkompetenzklausur schreiben. Und die wird sie auch bestehen, zumindest den Teil, für den ich verantwortlich bin. Warum fragst du?“
Rudolf behauptete, dass er sich im Umgang mit Studentinnen nicht von Sympathie oder Antipathie leiten lasse. Was zähle, sei allein die Leistung. Ich nahm ihm das natürlich nicht ab. Auch dabei handelte es sich lediglich um einen simplen Schutzmechanismus. Rudolf will die Unterschiede genauso wenig sehen wie ich.
Rudolf trug Scheußlichkeiten wie geblümte Hemden unter farbenfrohen Strickpullovern mit Norwegermuster und zu kurze grellgelbe Jeans und Tennissocken. Mit diesem Aufzug hielt er sich die Studentinnen vom Leib. Ob bewusst oder unbewusst, die Abwehrstrategie funktionierte; in meiner Umgebung gab es keine Frau, die nicht voller Mitleid und Schaudern die Augen verdrehte, sobald die Rede auf Rudolfs Outfit kam. Rudolf wirkte wie ein kleiner, von seiner Mutter verlassener Junge, der nun irgendwie allein zurechtkommen musste, ebenso tief unglücklich, verunsichert und bockig zugleich. Der Unterschied war nur, dass diese Mischung bei einem erwachsenen Mann von Ende vierzig nichts Rührendes mehr an sich hatte.
Rudolfs Frau hatte ihn zwar noch nicht verlassen, aber dass die Ehe nur noch bestand, weil es, wie Rudolf sich ausdrückte, „steuerlich gesehen vorteilhaft“ war und er ansonsten nach der Pfeife seiner Frau tanzte, wusste das ganze Institut. Seine Frau war eine ehemalige Studentin. Ich hatte ihn von vornherein gewarnt. Als er sie kennen lernte, hatte sie ihm kategorisch mitgeteilt, dass sie mit ihm laufen gehen werde, aber nur um sechs Uhr morgens oder eben gar nicht. Rudolf hatte sich darauf eingelassen. Damit war das weitere Muster vorgegeben.
„Nur so. Sie ist wirklich sehr tüchtig. Und extrem sympathisch.“
„Finde ich auch.“
Wir erreichten den ersten Hügel. Es ging steil bergan. Rudolf konzentrierte sich auf das Atmen, und wir redeten nicht mehr, bis wir oben angekommen waren.
„Sie hat ja schon ein Studium abgeschlossen“, fuhr Rudolf dann fort, als wir wieder bergab trabten. „Französisch und Deutsch für das gymnasiale Lehramt.“
„Ah ja? Woher weißt du das?“
„Sie war bei mir in der Studienberatung, um mich zu fragen, wie sie möglichst schnell ihr Diplom kriegt. Da hat sie es mir erzählt.“
Rudolf nimmt es sehr genau mit Details dieser Art. Er hat auch ein phänomenales Gedächtnis dafür, während mir gerade die Formalia meist sofort wieder entfallen, sobald ein Student den Raum verlassen hat.
Ich musste mich einen Moment sammeln, bevor ich den nächsten Anlauf nahm.
„Sie sagte neulich zu mir, eine schwierige Aufgabe sei es wert, dass man sich Mühe mache.“
Rudolf lachte skeptisch auf.
„Das hat sie gesagt?“
„Ja. Eine ungewöhnliche Frau.“
Im selben Augenblick bereute ich auch schon, das gesagt zu haben. Rudolf warf mir einen seiner strafenden Blicke zu.
„Du wirst doch nicht am Ende eine Schwäche für Naike Behning haben?“
„Schwäche ... Ach wo“, sagte ich ungehalten. „Sie ist eine ausgezeichnete Studentin. Ich meinte damit, dass es mehr von der Sorte geben sollte. Unverfälschte intrinsische Motivation, alert ... Du weißt schon.“
Rudolfs Informationen passten zu dem Bild, das ich von ihr hatte. Ich hatte schon länger vermutet, dass sie ein paar Jahre älter war als die durchschnittliche Studienanfängerin. Das selbstsichere Auftreten, diese extreme Zielstrebigkeit – das war schon etwas anderes als die üblichen Zweit- und Drittsemester, die einen bisweilen wirklich noch an frisch aus dem Ei geschlüpfte Küken erinnerten. Aber dennoch lagen viele Jahre zwischen uns. Um nicht zu sagen: Jahrzehnte.
Nicht nur ihr und mein Alter beschäftigten mich, sondern auch mein Äußeres. Ich laufe, das erwähnte ich ja schon. Gewichtsprobleme wie andere Männer in meinem Alter kenne ich nicht. Im Gegenteil, ich wirke schnell abgezehrt, wenn ich – was oft vorkommt – nicht regelmäßig esse. An sich ist das ja nur von Vorteil. Mich packt jedes Mal wieder das Mitleid, wenn ich manche meiner gleichaltrigen (oder sogar viel jüngeren) Kollegen vor mir den Korridor entlangwatscheln sehe, jene Unglücklichen, an denen die Folgen des für diese Kultur so charakteristischen ständigen Schweinefleischkonsums sichtbar werden. Wirklich bedauernswert finde ich die noch ganz jungen Studentinnen, mit ihren hervorquellenden, in zu enge Kleidungsstücke gezwängten Fettpolstern, traurig herabhängenden Doppelkinnen und Haltungsfehlern. Am liebsten würde ich diesen Studentinnen verordnen, mehrmals die Woche laufen zu gehen.
Aber darüber wollte ich ja jetzt nicht reden ... Ich weiß, wenn ich erst einmal aufs Laufen zu sprechen komme, schweife ich leicht ab, und das ist, worauf Angela mich auch immer wieder hinweist, lästig für die Nichtläufer, die es in meiner Umgebung ja auch noch gibt. Aber es fällt mir schwer, nicht vom Laufen zu sprechen, denn eigentlich steht doch so gut wie alles in irgendeiner Verbindung dazu, in meinem Leben jedenfalls. So please bear with me.
Einmal stellte ich mich vor den Spiegel, nur in meinen engen Laufhosen, und musterte mich eingehend von Kopf bis Fuß. Ich bin mittelgroß, umgerechnet einen Meter sechsundsiebzig, wie das draft board damals befunden hatte, und habe kaum noch Haare auf dem Kopf, aber das ist etwas, womit ich schon seit vierzig Jahren gut leben kann, anders als mein eitler jüngster Sohn, der sehr viel Geld für teure Haarwässerchen ausgibt, aus Angst, einmal so zu enden wie ich. Mein Gesicht ist hager, die Haut liegt sehr straff über den hohen Wangenknochen. Um die Augen herum und in die Stirn haben sich tiefe, müde Furchen gegraben, man sieht, dass ich zu viel der Sonne ausgesetzt war, und auch das Rauchen hat seine Spuren hinterlassen. Meine Hände und Füße sind klein, und ich wirke (vor allem bekleidet) eher untergewichtig. Eine Läuferfigur eben, kein Gramm Fett zu viel. Ich bin nicht stattlich, aber athletisch gebaut. Breite Schultern, schmale Hüften. Meine Oberschenkel sind kräftig, fest, muskulös, ebenso die Waden. Frauen schauen mich an, wenn ich ihnen beim Laufen entgegenkomme. Und sie schauen mir nicht immer unbedingt ins Gesicht.
Ich stand also vor dem Spiegel, reckte, dehnte und beäugte mich, und durch das lähmende Gefühl der Lächerlichkeit drang so etwas wie vage Hoffnung.
Ich war noch kein alter Mann. Maybe there was a little chance that she would prefer me to the handsome guys.
3.
Jeden Donnerstagnachmittag von sechzehn bis siebzehn Uhr dreißig hielt ich die allgemeinsprachliche Übersetzungsübung für die Stufe B ab, und zumindest nach außen hin geschah vorerst nichts.
Nicht, dass ich das erwartet oder auf irgendeine Weise versucht hätte, etwas wie eine Annäherung herbeizuführen. Nein, daran dachte ich gar nicht. Es war schon so fast zu viel für mich. Allein das Bewusstsein, dass ich die nächsten anderthalb Stunden in ihrer unmittelbaren Nähe verbringen würde, räumlich getrennt von ihr nur durch ein oder zwei Tischreihen, brachte mich an den Rand der Hysterie. Jedes Mal, wenn ich den Raum betrat, in dem sie auf mich wartete, fürchtete ich einen kurzen, ohnmachtsähnlichen Augenblick lang, dass es mich überwältigen würde. Vielleicht würde ich vor den versammelten Studenten in hysterisches Gelächter ausbrechen; vielleicht aber auch in Tränen.
Gleichzeitig steigerte sich mein auch so schon ungesund ausgeprägter Hang zur Selbstbeobachtung während dieser anderthalb Stunden ins Obsessive. Unbefangen habe ich Studenten noch nie entgegentreten können. Aber an diesen Donnerstagabenden war der Zensor in mir so dermaßen übersensibilisiert, dass ich nicht einmal mehr Daumen und Zeigefinger zusammenführen konnte, um ein Stück Kreide aufzunehmen, ohne mir dieser bedeutungslosen Geste peinlich bewusst zu sein. Das war extrem belastend und obendrein auch ganz sinnlos, wie ich selbst sehr wohl wusste.
Sie hat mich später einmal gefragt, ob ich während dieses Sommersemesters schon vorgehabt hätte, sie anzusprechen.
„Nein“, sagte ich. „Hatte ich nicht.“
„Warum nicht?“ Sie sah mich mit dem Ausdruck äußerster Aufmerksamkeit an, den ich inzwischen so gut an ihr kannte.
„So einfach war das nicht ... Du verstehst wohl, so etwas macht man nicht so ohne Weiteres.“
„Hattest du Angst?“, wollte sie wissen.
Ja, die hatte ich allerdings.
Es war sehr heiß in diesem Sommer. Ich absolvierte mein Laufprogramm wie jeden Tag, ging schwimmen und trainierte bis zur Erschöpfung im Fitnessraum. Meine Schlafstörungen hatten mich wieder fest im Griff; da half auch Baldrian in der dreifachen Dosis nicht mehr. Oft fiel ich abends wie zerschlagen ins Bett, konnte aber lange nicht einschlafen. Dann lag ich ruhelos da, starrte durch das weit offen stehende Fenster in den nächtlichen Himmel und lauschte auf die Geräusche, die von der Straße ins Schlafzimmer hineindrangen. Musikfetzen aus Autoradios, die in einem Augenblick verklungen waren; Stimmengewirr und das Klirren von Gläsern aus der Kneipe schräg gegenüber; sommertrunkenes Frauenlachen; das Klackern von hohen Absätzen auf den Bürgersteigen. Noch schlimmer war, dass ich beinahe jede Nacht um zwei oder drei Uhr morgens wieder wach war – hellwach. Ich las dann, so lange, bis ich über meinem Buch noch einmal einnickte. Wenn ich morgens aus meinem leichten, von wirren Traumfetzen zerrissenen Halbschlaf hochschreckte, fühlte ich mich wie gerädert.
Angela erklärte mir eines Morgens, dass sie es nicht mehr aushalte, neben mir zu schlafen. Das ständige Herumgewälze und Geseufze mache sie verrückt, sagte sie.
„Also gut“, sagte ich. „Dann werde ich eben drüben schlafen.“
„Drüben“ – das war die Wohnung im Haus nebenan, die mit der Zeit immer mehr zu meinem Refugium geworden war, meine „Höhle“, wie Angela sagte. Angela und ich mieten zwei Wohnungen in Häusern, die direkt nebeneinander liegen, ein Relikt aus der Zeit, als wir noch beide am selben Ort arbeiteten und die Option des Zusammenziehens daher im Raum gestanden hatte. Damals hatte sich dieser Kompromiss angeboten, weil wir uns beide einig gewesen waren, dass es einer Beziehung gut tut, sich (theoretisch jedenfalls) jederzeit aus dem Weg gehen zu können.
Getrennte Wohnungen sind eine gute Sache, finde ich. Und zwar auch jetzt noch, da sich die Situation geändert hatte und wir uns nur noch während der Semesterferien und an den Wochenenden sahen. Noch besser hätte ich es allerdings gefunden, wenn unsere Wohnungen ein paar Häuser oder sogar einige Straßen weit auseinanderliegen würden. Ob es in der Praxis einen großen Unterschied gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber es hätte sich anders angefühlt.
„Aber so habe ich es doch gar nicht gemeint!“ Auf Angelas Gesicht zeichnete sich Bestürzung ab.
„Wie denn sonst?“, fragte ich.
„Musst du denn gleich wieder so – extrem reagieren?“
„Warum denn extrem, du hast ja ganz Recht. Es ist doch nur vernünftig, wenn ich nach drüben ziehe, damit du deine Ruhe hast, bis ich wieder besser schlafe.“
„Du bist mir ein wenig zu bereitwillig“, sagte sie scharf. „Gerade so, als käme es dir eigentlich ganz gelegen. Und dabei haben wir im Augenblick doch sowieso nur noch die Nächte am Wochenende zusammen.“
„Ich hätte mich also etwas sträuben müssen, ich verstehe. Soll ich das jetzt noch nachholen?“
Angela setzte sich auf die Kante ihrer Seite des Bettes. „Komm doch mal her“, sagte sie.
„Warum?“
„Komm bitte mal her.“
Ich näherte mich dem Bett und setzte mich auf die andere Seite. „Und was nun?“
Sie sah mich mit diesem inquisitorischen Blick an. „Ist irgendetwas mit dir?“
Was sollte ich darauf schon antworten. Ich fuhr mir mit der Hand über das Gesicht. „Was sollte denn sein?“
„Das frage ich dich. Ich habe das Gefühl, du ziehst dich von mir zurück.“
„Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ich bin nur ... überarbeitet. Und schlafe schlecht. Aber das weißt du ja.“
Sie streckte die Hand aus und strich mit der Handfläche langsam über meine Wange. „Und sonst ist nichts?“
Die weiche Innenseite ihrer Hand lag an meinem Kinn. Ich hätte den Kopf drehen und ihr einen Kuss in die Handfläche geben können. Früher habe ich das oft getan. Es war ein kleines Ritual der Zärtlichkeit zwischen uns. Manchmal saßen wir uns dann gegenüber, ich hielt ihre Hand fest, wenn sie sie zurückziehen wollte, und liebkoste mit meinen Lippen ihre Handfläche.
Nun drehte ich zwar den Kopf, aber meine Lippen ließen ihre Hand vorbeistreifen.
Sie ließ die Hand sinken. Ich schaute zu Boden.
„Bist du sicher, dass nicht doch irgendetwas ist, das du mir sagen solltest?“
Ich schüttelte stumm den Kopf.
„Ich weiß, dass es sinnlos ist, dir etwas aus der Nase ziehen zu wollen. Aber dir sollte bewusst sein, wie stark es mich gerade in meiner augenblicklichen Situation belastet, wenn du die Kommunikation mit mir verweigerst.“
Angela hatte vor zwei Jahren eine Professur in einer anderen Stadt angenommen, die ihr nervlich sehr viel abverlangte. Ort, Dotierung und inhaltlicher Schwerpunkt der Stelle waren nicht das, was sie sich gewünscht hatte, aber Professuren im Bereich Archäologie waren zurzeit so dünn gesät, dass ihr keine andere Wahl geblieben war. Darüber hinaus war das Arbeitsklima an der Universität geprägt von undurchschaubaren Intrigen. Die Kollegen warfen ihr Knüppel zwischen die Beine und standen ihr, wie sie beklagte, feindselig gegenüber. Die ständige Anspannung nahm sie ungeheuer mit. Auch sie konnte oft nicht schlafen.
„Aber was das Ausweichen angeht, bist du ja schon immer ein Meister gewesen“, fuhr sie fort. „Was du nicht erzählen willst, das erzählst du auch nicht.“
Ich fragte, ob ich dazu jetzt etwas sagen sollte.
Angela stand auf und wandte sich zum Gehen. „Ich bitte dich lediglich darum, dir vor Augen zu halten, dass ich auf deinen Rückhalt gerade jetzt noch mehr als sonst angewiesen bin.“
Selbstverständlich fühlte ich mich schuldig. Sie machte eine anstrengende Zeit durch und brauchte meine Unterstützung. Und ich war in dieser Lage eher keine Hilfe. Erst neulich hatte die Therapeutin, die bei Angela eine Supervision durchführte, anfragen lassen, was ich (der Partner) eigentlich tue, um ihr beizustehen. Angela hatte es mir mit vorwurfsvoller Miene weitergegeben.
Ich musste an einen Abend am vergangenen Wochenende zurückdenken. Wir waren zusammen im Wohnzimmer nebenan, ich korrigierte Übersetzungen, sie hatte lange am Schreibtisch gesessen und die Vorlesung vorbereitet, die in der Woche darauf anstand. Irgendwann gähnte sie, reckte sich und kam zu mir herüber.
„Ich kann nicht mehr. Bin ich verspannt!“
Sie setzte sich neben mich auf das Sofa und lehnte ihren Kopf an meine Schulter. „Bist du fertig?“
Ich nickte. „Ja ... gleich.“
Sie rückte ein Stück von mir ab und sah zu, wie ich die letzten zwei Übersetzungen bearbeitete.
„Und nun?“ Ich packte meine Unterlagen zur Seite und sah sie an. „Was sind deine weiteren Pläne?“
„Pläne ... Vielleicht hast du ja einen Vorschlag.“
„Wenn du willst, könnte ich dich massieren.“
Normalerweise machte ich das sehr gut. An diesem Abend aber merkte ich selbst schon nach kurzer Zeit, dass ich nicht bei der Sache war. Meine Hände führten zwar die gewohnten Bewegungen aus, aber ich konnte einfach nicht die Konzentration aufbringen, die für eine gute Massage notwendig ist. Ich führte mechanische Griffe aus, zu mehr reichte es nicht. Nach zehn Minuten drehte Angela sich um und schaute mich halb verwundert, halb verärgert an.
„Du machst es nicht gut.“
Ich suchte nach einer Entschuldigung, aber mir fiel nichts ein, was ich hätte erwidern können.
„Du bist anderswo mit deinen Gedanken. Distanziert. Glaubst du, ich merke das nicht?“
Sie richtete sich kopfschüttelnd auf und zog ihre Strickjacke wieder über. Dann ging sie wortlos aus dem Zimmer.
Ich hatte natürlich an sie denken müssen. Am Donnerstag der vorigen Woche war es drückend heiß gewesen, und sie hatte ein jadegrünes, kurzes Kleid und hochhackige Riemchensandalen angehabt. Ich hatte wieder die kleinen, dunklen Flecken vor Augen gehabt, die sich unter ihren Brüsten gebildet hatten, an denen der Stoff des Kleides wie eine zweite Haut klebte, und die warmen Reflexe, die die schräg einfallenden Strahlen der Nachmittagssonne in ihr Haar setzten. Die ganzen anderthalb Stunden über hatte ich mir vorgestellt, wie es wäre, nachher, wenn die Sonne unterging, mit ihr an den See schwimmen zu gehen und sie im dunklen Wasser zu umarmen.
Als die Übung zu Ende war, schritt sie in Richtung Parkplatz davon, frisch und leichtfüßig trotz der Hitze, und ich blieb zurück und fragte mich, was sie an diesem vor Sommerdüften vibrierenden Abend wohl vorhatte. Ich war allein schwimmen gegangen, spät abends, als die Dunkelheit schon über dem See lag und niemand mehr da war.
Das Sommersemester ging seinem Ende zu. Ich tat gar nichts; was hätte ich auch tun sollen. Wenn ich auf etwas wartete, dann sicherlich nicht darauf, dass irgendetwas geschah. Allenfalls darauf, dass es aufhörte, dieses quälende Bedürfnis, einer für mich unerreichbaren Frau näherzukommen, das mir den Schlaf raubte.
Damals, zu diesem Zeitpunkt, hätte es wohl noch „aufhören“ können – vielleicht wäre es vorbeigegangen, wenn nichts geschehen wäre. Vielleicht hätte ich in den drei Monaten Semesterferien, die vor ihr und mir lagen, so viel Abstand gewonnen, dass ich ihr danach wieder neutral hätte gegenübertreten können. Ein paar Träume noch, das wäre es dann aber auch gewesen.
Aber im Moment war ich weit davon entfernt, beim Aufwachen gleichmütig die Achseln zu zucken und zur Tagesordnung überzugehen. Noch verstörten mich diese Träume viel zu sehr, als dass ich mir hätte einreden können, ich sei im Begriff, über diese Leidenschaft hinwegzukommen.
4.
Drei Monate waren immerhin eine ganze Weile. Ich hatte vor, Anfang September in die USA zu fliegen und meine Kinder zu besuchen. Davon versprach ich mir einiges.
In der letzten Stunde verteilte ich die Hausarbeitsthemen und entließ den Übersetzungskurs Stufe B mit den üblichen Hinweisen in die Semesterferien.
„Sie haben drei Texte zur Auswahl, die mit dem in Zusammenhang stehen, was wir in diesem Kurs gemeinsam bearbeitet haben. Zwei Wochen haben Sie Zeit, dann sollten Sie Ihre fertige Arbeit abgeben. Bitte denken Sie daran, zwei Wochen. Ich bekomme jetzt noch Hausarbeiten vom vorletzten Semester, also wäre es schön, wenn Sie alle es diesmal in diesem Zeitrahmen schaffen. Manchmal muss man die Leute auch vor sich selber schützen.“
Ich nahm mir vor, mich jetzt, da ich keine Kurse mehr zu geben hatte und mir meine Zeit frei einteilen konnte, mehr um die Beziehung zu Angela zu bemühen. Ein paar Tage lang versuchte ich, aufmerksamer als in der letzten Zeit zu sein, sie zu umsorgen und ihr manches abzunehmen, wie Kopierarbeiten oder Literaturrecherche. Bis spät in die Nacht hinein saßen wir zusammen über ihrer Arbeit, feilten an Vorträgen, die sie zu halten hatte, und arbeiteten Strategien gegen die Machenschaften aus, die gegen sie im Gange waren. Wenn sie nicht schlafen konnte, kochte ich ihr Tee, den ich ihr ans Bett brachte. Ich las ihr Märchen zur Beruhigung vor. Manchmal half ihr das beim Einschlafen. Aber das änderte nichts daran, dass all die Sorgen schon seit Langem mit in unserem Bett lagen.
An einem Abend hatte ich die Idee, als Überraschung für Angela ein Essen im Wok zuzubereiten. Ich habe früher oft chinesisch gekocht und bin nicht ganz schlecht darin. Nachmittags hatte ich im Internet nach Rezepten gesucht, bestimmt fast eine Stunde lang, und war extra zu dem Asia-Laden gefahren, der vor Kurzem im Stadtzentrum aufgemacht hatte. Mit einem Wort: Ich scheute keine Mühen.
Angela hatte bereits auswärts zu Mittag gegessen und keinen großen Appetit mehr.
„Macht nichts“, sagte ich. „Dann eben das nächste Mal.“
„Hättest du nicht anrufen können?“
„Du warst doch unterwegs.“
„Ich besitze ein Handy, wie du weißt.“
„Ja, also ... daran habe ich gar nicht gedacht.“
„Du denkst leider nie an etwas, wenn es darum geht, dich mit mir abzustimmen!“
„Ich kann Handys nun mal nicht ausstehen, wie du weißt. Deswegen denke ich auch nicht an sie.“
„Das ist lächerlich, und du wirst kaum von mir erwarten, dass ich ernsthaft mit dir darüber diskutiere.“
Ich packte die Essstäbchen aus und sagte in unbeschwertem Ton: „So, ich fange jetzt an zu essen. Du offenbar nicht. Auch gut.“
„Da sind wieder Unmengen von Knoblauch drin, nicht?“
„Ja. Zehn Zehen.“ Ich hatte vor dem Essen zwei Bier auf nüchternen Magen getrunken und war verwegen gestimmt.
„Du weißt doch, dass ich morgen früh diese Besprechung habe, oder?“
„Ja und?“
„Manche stören sich an Knoblauchausdünstungen, weißt du.“
„Ah ja? Was sind das für Leute? Ich hatte damals diese jüdische Professorin, die aus Deutschland geflohen war und mehr als vierzig Angehörige in deutschen Konzentrationslagern verloren hatte. Die sagte immer, die knoblauchhassenden Deutschen hätten die Juden auch wegen deren cuisine vernichtet.“
„Jetzt lenk bitte nicht vom eigentlichen Thema ab. Ich möchte nur, dass du einsiehst, wie rücksichtslos es von dir war, nicht an meine terminlichen Verpflichtungen zu denken!“
„Schön, liebste Gela, dann rufe ich jetzt Rudolf an und frage ihn, ob er nicht zu uns rüberkommen möchte. Vielleicht weiß ja er meine Bemühungen zu schätzen.“
Ich hatte nicht ernsthaft vor, Rudolf anzurufen (der sowieso kein großer Freund von chinesischem Essen war), aber ich ging trotzdem zum Telefon und nahm den Hörer ab. Das Freizeichen ertönte. Dann ein Krachen und Splittern hinter mir. Angela hatte die Teller mit voller Wucht vom Tisch gefegt.
Ich ließ den Telefonhörer sinken. Angela stand inmitten der Scherben und schrie etwas. Ich lief zu ihr und packte ihre Handgelenke. Einen Moment lang rangelten wir miteinander, sie versuchte wild, sich von mir loszumachen, ich hielt sie fest. Die ganze Zeit über schrie sie weiter – es gelang mir, nicht auf das zu hören, was sie schrie – , dann hörte sie auf zu schreien und fing stattdessen an zu weinen. Sie stand weinend da, während ich die weit verstreuten Scherben und die überall herumliegenden Brocken meines Essens zusammenkehrte. Schließlich bekam sie Migräne und musste sich hinlegen. Später verloren wir beide kein Wort mehr über den Vorfall.
Das Kochen ließ ich daraufhin aber wieder sein.