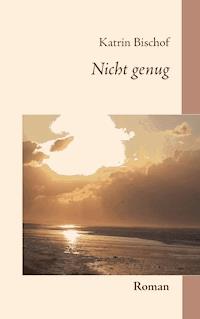Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wendepunkte": Jeder von uns hat sie schon erlebt - scheinbar ganz undramatische Situationen, in denen plötzlich nichts mehr so ist wie vorher. Die Beziehungen schlagartig und für immer verändern und den Beteiligten mehr über sich selbst und ihre Grenzen verraten, als ihnen vielleicht lieb ist. Die zehn in diesem Band enthaltenen Erzählungen handeln von eben diesen "Wendepunkten". Mit scharfem Blick eröffnet die Autorin Einblicke in das Innenleben ihrer Figuren und legt dabei so manche Untiefe bloß. Manchmal komisch bis skurril, dann wieder rührend und sogar tragisch - Freunde intelligenter Unterhaltung werden bei diesen Erzählungen voll auf ihre Kosten kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Marina
Inhaltsverzeichnis
Das Leben ist einfach geil
Durchreise
Pfingstbesuch
Rashomon
Freitag
Samstag
Sonntag
Katja davaj
Letzte Begegnung
Ein Heiligabend
Reset
Wiedergänger
How I left your father
Das Leben ist einfach geil
»Das Leben ist einfach geil«, stellt Ilona fest. »Findest du nicht auch?«
Ilona hat mich zum Essen beim Italiener eingeladen, aus Anlass meiner bestandenen Probezeit. Es ist ein lauer Maiabend, und wir haben uns nach draußen an den Tisch unter der breitgefächerten Topfpalme gesetzt. Eben gerade hat sie mir angeboten, ab jetzt Ilona und du zu ihr zu sagen.
Da sitzt sie, schmal, man sieht ihr die frühere Leichtathletin noch an, mit erdbeerblondem Haar, milchig-makelloser Haut und einigen wenigen, neckisch dahingetupften Sommersprossen auf dem spitzen, feinen Näschen. Sie lehnt sich mit genüsslichem Seufzen zurück und legt die Hand auf ihren Babybauch, der sich unter der silbergrauen, weich fließenden Bluse mit den Glockenärmeln und dem gerade eben nicht zu tiefen V-Ausschnitt dezent wölbt. Sie ist eine elegante Schwangere, selbst im siebten Monat noch.
Das Leben ist also einfach geil. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie diese fünf Worte dahinwirft, stürzt mich in eine kleine Betretenheitskrise. So etwas hätte ich nicht einmal als Siebzehnjährige gesagt, geschweige denn gedacht, als ich noch gar keine Ahnung davon hatte, wie sich Enttäuschung eigentlich anfühlt.
»Es hat so seine Momente … in denen man zumindest das Gefühl hat, dass alles so, wie es ist, schon irgendwie seine Richtigkeit hat«, sage ich zögernd und knete an meiner Papierserviette herum. Gerade jetzt kommt mir das erbärmlich wenig vor. Geil ist was anderes.
»Ach komm.« Ilona prustet belustigt. »Mehr erwartest du nicht?«
»Wer so viel Glück hat wie du, hat gut reden«, wende ich ein.
Bei Ilona scheint alles so einschüchternd perfekt. Sie ist erfolgreich als selbständige Grafikdesignerin, sie hat vor acht Jahren ihren Traummann kennengelernt - schon bei der ersten Begegnung wusste sie, dass er der Richtige war -, und nun ist das Wunschkind unterwegs, das gleich im ersten Anlauf per künstlicher Befruchtung gezeugt wurde. Dass es makellos sein wird, steht außer Zweifel. Ilona hat selbstverständlich alle Untersuchungen machen lassen, die bei Erstgebärenden über fünfunddreißig angeraten werden; sie nimmt nur noch Biokost zu sich und ruht regelmäßig; sie macht die empfohlene Gymnastik; sie liest alle Fachbücher, derer sie habhaft werden kann. Bisher verläuft die Schwangerschaft prächtig.
Und außerdem ist Ilona dazu auch noch die einzige gutaussehende Rothaarige, die ich kenne.
»Das hat nichts mit Glück zu tun.« Sie lächelt triumphierend. »Das ist eine Einstellungssache. Man bekommt das, womit man sich zufrieden gibt.«
»Also, ich wäre schon sehr zufrieden, wenn ich ein Kind hätte.« Ich versuche, scherzhaft zu klingen. »Aber das allein reicht offensichtlich nicht, damit sich eines einstellt.«
»Ach, hast ja noch Zeit«, sagt sie und pickt sich den letzten Champignon von der Antipasti-Platte. »Bevor ich sechsunddreißig war, hatte ich überhaupt keinen Bock auf Kinder.«
Martin und sie, erzählt sie, hätten nie zu denjenigen gehört, die nur deswegen ein Kind bekommen, weil man das nun mal so macht. Sie hätten sich rundum komplett gefühlt, auch zu zweit, nicht defizitär. Aber dann habe sie sich irgendwann gedacht, dass ein Kind das sei, was in ihrem erfüllten Leben noch fehlte, nach der beruflichen Selbstverwirklichung und der großen Liebe und all den Reisen nach Australien und Vietnam und Südafrika. Als Tüpfelchen auf dem i sozusagen. Das große, ultimative Abenteuer.
Mein Leben ist ebenfalls erfüllt, allerdings vor allem von dem Bewusstsein, dass es genau so, wie es ist, gerade nicht weitergehen darf, jedenfalls nicht mehr allzu lange. Ich bin nur drei Jahre jünger als Ilona, aber alles, was bei ihr perfekt ist, ist bei mir prekär. Ich bin Berufsanfängerin mit sehr wackligem Status, bisher nichts weiter als eine Schwangerschaftsvertretung mit Halbtagsstelle und auf ein Jahr befristetem Vertrag. Ein fester Partner ist ebenfalls Fehlanzeige, alles, was ich vorzuweisen habe, ist ein On-Off-Lover, mit dem mich (da mache ich mir nichts vor) in erster Linie körperliche Anziehung verbindet. Bock auf ein Kind habe ich auch. Aber der Materialisierung dieses Wunsches bin ich, seit ich ihn verspüre, noch keinen Schritt näher gekommen. Das ist der wundeste Punkt von allen.
Während ich noch grübele, hat Ilona offenbar noch etwas gesagt, dass ich nicht mitbekommen habe.
»Eigentlich habe ich Kinder früher nicht ausstehen können«, fährt sie gerade fort. »Ich finde, Kinder sind wie Hunde: Die meisten sind ganz schrecklich, aber es gibt ein paar, die total niedlich sind.«
Ich frage sie, warum sie so sicher sei, dass ihr eigenes Kind zu den niedlichen gehören würde.
»Na ja …« Sie kichert ein bisschen; das macht sie auch manchmal, wenn sie mit Kunden am Telefon spricht und ihnen erklärt, warum sie ihnen zusätzlichen Aufwand in Rechnung stellen muss. »Ich meine, immerhin ist das eigene Kind doch ein Teil von einem selbst, und sich selbst findet man ja gut. Und den Mann hat man sich schließlich ausgesucht, also findet man den ja wohl auch irgendwie gut, darum denke ich, dass man das eigene Kind schon mögen wird.«
Nicht einmal ihre Selbstzufriedenheit kann ich Ilona vorwerfen. Wenn ich ihr Leben hätte, würde ich sicher auch so reden. Der Erfolg gibt ihr Recht.
»Ich bin jedenfalls total froh, dich gefunden zu haben«, sagt Ilona in diesem Moment und legt mir die Hand auf den Arm. »Wie ist es denn, hast du dich schon nach einer Wohnung umgeschaut?«
Das ist die Gelegenheit. Ich fasse mir ein Herz.
»Ich habe eine Wohnung gefunden«, sage ich. »Nächste Woche erfahre ich, ob ich sie bekomme. Allerdings …« Ich stocke.
»Ja?«, macht sie aufmunternd.
»Der Vermieter sähe es gerne, wenn ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorlegen könnte.«
Ilona zuckt zurück, als hätte ich ein unfeines Wort in den Mund genommen. »Nein, also darauf kann ich mich jetzt nicht festlegen. Für mich ist es schon ein großer Schritt, dass ich überhaupt jemanden einstelle.«
»Okay«, sage ich. »Dann müssen eben meine Eltern für mich bürgen.«
Sie sieht mich entschuldigend an. »Mehr als ein befristeter Vertrag geht wirklich nicht. Du könntest ja schwer krank werden, oder schwanger. Das kann ich mir mit meinem Ein-Frau-Unternehmen nicht leisten. Ich bin sicher, du verstehst das.«
»Und, wie ist sie denn so als Chefin?«, fragt Marion mich zwei Tage später bei unserer Kaffeepause.
»Ganz okay.« Ich nicke. »Sie bemüht sich, immer nett zu sein.«
Was ich sage, stimmt. Ilona gibt sich wirklich Mühe. Bisher hat sie nur zweimal einen Aussetzer gehabt. Das eine Mal war, als ich aus Versehen die falsche Version eines Angebots abgespeichert habe, das dann an den Kunden rausging. Das zweite Mal hat sie mir lang und breit vorgerechnet, wie viel ich sie koste.
»Wird es dir nicht langsam zu anstrengend, weiter hier zu arbeiten?«, will Marion wissen.
»Natürlich.« Ich zucke die Schultern. Es ist mir längst zu anstrengend, und satt habe ich es auch, immer noch jeden Samstag- und Sonntagvormittag zum Putzen im städtischen Krankenhaus antanzen zu müssen, aber ohne den Job komme ich mit meiner halben Stelle bei Ilona kaum über die Runden. »Ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, wenn ich Stunden abgebe oder kündige.«
Marion nickt und vertieft sich wieder in die Werbebeilage der Wochenzeitung. Ihre Schwester hat zwei kleine Kinder und ist Witwe. Ihr Mann hat sich letztes Jahr aufgehängt. Er war seit drei Jahren arbeitslos gewesen und trank zunehmend. Marions Schwester hatte ihn vor die Wahl gestellt: Therapie oder Scheidung, und da hat er den Ausweg gewählt, der ihm, im Vergleich zu den beiden anderen Optionen, wohl noch am wenigsten Angst machte. Marion hat ihrer Schwester den Job im Krankenhaus zugeschustert, aber ihr Vertrag ist befristet und muss alle halbe Jahre verlängert werden. Nun hofft Marion, dass, wenn ich gehe, ihre Schwester meine Stelle übernehmen kann. Ich war die letzte, die damals noch einen unbefristeten Vertrag gekriegt hat.
»Manchmal denke ich, warum bin ich eigentlich nicht im Reisebüro geblieben«, sinniere ich. »Jetzt hab ich ein Diplom und gehe immer noch putzen. Ich meine, als ich noch Studentin war, fand ich das ja völlig okay… Aber jetzt wäre es schön, wenn ich nach vier Jahren Studium keinen Nebenjob mehr bräuchte, um mir eine eigene Wohnung leisten zu können.«
Marion lässt die Zeitung sinken. »Du kriegst die Wohnung also?«
Ich nicke. Dank der Bürgschaft meiner Eltern kriege ich sie.
»Und, wie ist sie?«
»Klein. Sehr klein. Aber bei meinen Eltern, das ging nicht mehr.«
Sie nickt bedächtig. »Das ist auch nichts, in deinem Alter wieder bei den Eltern zu wohnen, was.«
Bei Marion sage ich immer mehr, als ich eigentlich vorhatte.
»In meinem Alter kommt man sich gescheitert vor«, gestehe ich, »wenn man wieder ins elterliche Nest zurückgekrochen kommt. Obwohl man eigentlich längst sein eigenes haben sollte.«
Ich denke daran, dass ich es mit neunzehn kaum noch abwarten konnte, die Flügel auszubreiten und davonzufliegen. Auch meine Eltern waren sehr froh darüber, dass ich keine Anstalten machte, zum Nesthocker zu werden. Ich hatte hochfliegende Pläne, auch wenn ich heute, fünfzehn Jahre später, nicht mehr genau weiß, welche das waren. Sicher wollte ich die Welt verbessern und vor allem alles anders machen als meine Eltern. Ja, das auf jeden Fall. Damals, glaube ich, redete ich immerzu davon, dass ich nicht heiraten und keine Kinder wollte, sondern bloß einen Liebhaber, der einmal im Monat vorbeikam und mich ansonsten in Ruhe ließ. Mir wird schmerzlich bewusst, wie sehr mein heutiges Leben meinen damaligen Vorstellungen inzwischen ähnelt. Vielleicht hat Ilona Recht; vielleicht muss ich mich mental umprogrammieren.
»Sie gibt dir bestimmt bald eine volle Stelle«, sagt Marion tröstend. »Wenn das Baby erstmal da ist. Wirst schon sehen. Die wird schon noch merken, dass sie ohne dich gar nicht mehr kann.«
Zurzeit suchen Ilona und Martin nach einem Namen für das Kind. Es wird ein Mädchen werden. Natürlich soll es nicht irgendeinen Namen bekommen. Zeitlos muss er sein, wohlklingend, und vor allem stilvoll.
Stilvoll muss überhaupt alles sein. Als ich erzähle, dass ich nun eine Wohnung hätte, in der Südstadt, rümpft Martin die Nase.
»Kann man denn da überhaupt wohnen?« Es ist keine wirkliche Frage; dazu dieses affektierte, kleine Kopfschütteln, das ich an ihm nicht mag. »Das hat doch keine Klasse.«
Ich hätte beinahe gesagt, dass ich mit einer Halbtagsstelle nun mal keine größeren Sprünge machen kann, aber ich habe keine Lust auf das, was spitze Bemerkungen wie diese nach sich ziehen.
Mit Martin bin ich sowieso lieber auf der Hut. Ich traue ihm nicht. Nicht, dass er unfreundlich ist, ganz im Gegenteil. Aber seine Freundlichkeit wirkt nicht herzlich, sondern lauernd. Wenn er Fragen stellt, dann aus Neugier, nicht aus Anteilnahme. Manchmal wartet er das Ende meiner Antwort nicht ab. Er fängt an, zerstreut auf seinem Stuhl herumzurutschen, und seine Augen wandern schon wieder ruhelos weiter, an mir vorbei. Außerdem behält er mich immer im Blick, wenn Ilona sich nachmittags für eine Stunde hinlegt und ich allein mit ihm bleibe. Ein paar Mal schon hat er so Bemerkungen gemacht, die darauf hindeuteten, dass er sich Sorgen macht, ob ich auch nicht zu wenig arbeite. Natürlich sollten sie spaßig klingen; aber bei solchen Sachen reagiere ich leicht überempfindlich.
Was mich nervt, ist, dass er bei jeder Gelegenheit heraushängen lassen muss, was für ein anteilnehmender, sorgender Ehemann und werdender Erstvater er ist. Vielleicht macht er das, weil er fünfundzwanzig Jahre älter als Ilona ist (das einzige, was sie an ihm nicht toll findet, wie Ilona mir gegenüber einmal erwähnt hat) und zeigen will, dass er im Unterschied zu den Männern seiner Generation kein Problem damit hat, Gefühle zu zeigen. Vielleicht bin ich auch nur neidisch, kann sein. Aber muss er denn wirklich zu Ilona hingehen, wenn sie sich über den Schreibtisch beugt, um demonstrativ von hinten ihren Bauch zu umarmen und sie in den Nacken zu küssen, während ich dabei bin. Schließlich hocken die beiden den ganzen Tag zusammen in diesem Zimmer, nur ein paar Schritte voneinander entfernt an ihrem jeweiligen Schreibtisch, da brauchen sie doch nun nicht gerade turteln, wenn ich zugucken muss.
Ich beschließe, Martins Anwurf mit einem Schulterzucken zu erwidern.
»Man ist schnell im Grünen, raus aus der Stadt«, sage ich. »Und es gibt einen schönen Park mit See ganz in der Nähe.«
Martin sagt, dass er eigentlich nur die Bahnhofsgegend kenne, die scheußlich sei.
»Fast alle kennen nur die Bahnhofsgegend«, sage ich.
»Aber ist es da nicht wirklich total schlimm?«, fragt Ilona, die gerade dazukommt.
»Hoher Ausländeranteil, vor allem Türken, ganze Straßenzüge mit Arbeitslosigkeit weit über dem Durchschnitt, sozial abgehängt«, schüttelt Martin die Fakten aus dem Ärmel. An diesem Stadtteil zeige sich die bis heute andauernde Integrationsunfähigkeit und politisch gewollte Undurchlässigkeit der konservativen deutschen Gesellschaft in ihrem vollen Ausmaß. In ein Ghetto seien die Menschen gezwungen worden, aus dem heraus kaum jemand wieder herauskomme. Da würden Potentiale vernichtet, Lebensläufe vorausbestimmt und Schicksale besiegelt.
Martin ist Journalist und schreibt Artikel für eine linke überregionale Wochenzeitung, Kommentare, genauer gesagt, deren Überschriften einen gleich auf der ersten Seite anspringen. Er ist ein Meinungsäußerer, und die Meinung, die er äußert, ist die der liberalen, Grün wählenden, besser verdienenden und akademisch gebildeten Menschen, die eigentlich zum Establishment gehören, aber sich das nicht so recht eingestehen wollen. Ilona und er wohnen natürlich im »richtigen« Teil der Stadt, dort, wo sich eben diese Menschen zusammenpulken, als würde ein Magnet sie dorthin ziehen. Die Atmosphäre hier ist so ein bisschen flippig-alternativ. Nicht schnöselig, nein, nein; wer das will, zieht woanders hin (auch das hat diese Stadt zu bieten); aber doch beruhigend bürgerlich. Eben das Gewissen beruhigender Nonkonformismus light.
Die Südstadt dagegen geht gar nicht. Multikulti außerhalb der Mittelschichtskomfortzone ist nicht hip, sondern schlicht assig.
Ilona muss jetzt noch einmal los, sich eine weitere Krippe ansehen. Die Dichte der Kinderbetreuungseinrichtungen in diesem Viertel ist hoch, aber sie unterscheiden sich von Qualität und Anspruch her erheblich. Und die Wartelisten sind lang. Also geht sie jetzt schon einmal sondieren. Am liebsten wäre ihr ein Platz in der Krippe, in der die Kinder von Anfang an durch muttersprachlich spanische Erzieherinnen betreut werden. Für die müsste man natürlich noch mal zweihundert Euro drauflegen, aber das sei es ihr wert.
»Sieh mal, das ist ein Vorteil«, sage ich. »Wenn ich ein Kind hätte, würde es in der Südstadt gleich Türkisch lernen. Ohne dass ich deswegen zweihundert Euro im Monat extra drauflegen müsste.«
Beide gucken sekundenlang irritiert. Dann beschließen sie, doch besser zu lachen.
Mir wird in diesem Moment klar, dass es mir überhaupt nichts ausgemacht hat, ins sozial abgehängte Ghetto zu ziehen. Und ich es möglicherweise auch dann getan hätte, wenn ich mir etwas Stilvolles hätte leisten können.
»Übrigens«, sagt Ilona noch, bevor sie geht, »ich habe da noch ein paar Möbel, die wir nicht mehr brauchen. Vier Stühle, einen Glastisch, einen Garderobenständer und ein Sofa. Alles gut in Schuss. Wenn du was davon gebrauchen kannst … Schenk ich dir gerne. Zum Einzug in die neue Wohnung.« Sie lächelt strahlend. Ich mag die treuherzigen Fältchen, die sich dabei um ihre Augen legen.
Eine Gehaltserhöhung ist zwar nicht in Sicht. Aber immerhin habe ich eine Chefin, der es sehr wichtig ist, dass sie trotzdem von mir gemocht wird.
Marion behält Recht. Zur Geburt des Babys, das übrigens den Namen Lisa Moana erhalten hat, bekomme ich die volle Stelle. Ilona hat zu viel Angst, dass ich gerade jetzt gehe.
Außerdem kriege ich ein Büro ganz für mich allein, in einem Gebäude ein paar Häuser weiter. Ilona hat den Raum günstig von einem Bekannten gemietet. Sie meint, dass ich dort ungestörter arbeiten könnte, jetzt wo Lisa Moana ihren Alltag so durcheinander wirbelt. Dreimal in der Woche gehe ich zu Ilona rüber und esse mit ihr Mittag, sie kocht dann für mich mit. Das hat sie so haben wollen, damit wir uns besprechen können und ich mich nicht abgeschoben fühle.
Ich fühle mich trotzdem abgeschoben. Außer ihr und Martin sehe ich während der langen Arbeitstage keinen Menschen mehr. Kollegen sind nicht immer nett. Aber immerhin sorgen sie dafür, dass man nicht ständig im eigenen Saft schmort und sich für bedauernswert hält.
Anfang Oktober treffe ich Ilona alleine an, als ich mittags zu ihr komme. Sie sitzt auf ihrem weißen Sofa neben dem Schreibtisch und stillt Lisa Moana, als ich die Tür aufschließe. Klingeln soll ich nicht, das Baby könnte ja schlafen, darum hat sie mir einen Schlüssel gegeben.
Lisa Moana liegt wie ein schlaffer Wurm auf dem Stillkissen, das über Ilonas Schoß drapiert ist. Sie ist eingeschlafen; eine Hand liegt noch immer besitzergreifend auf Ilonas Busen. Ilona versucht, sie vorsichtig abzuschütteln, ohne dass sie wach wird. Sie maunzt, als sie in ihrer Babyschale abgelegt wird, die auf Ilonas Schreibtisch neben ihrem Computer steht. Aber sie schläft weiter. Lisa Moana ist ein hübsches Baby, eines der ganz wenigen, die mich nicht an grotesk gestopfte Würste oder Reptilien der weniger knuddeligen Sorte erinnern, sehr klein und zart mit klar definierten Gesichtszügen. Außerdem hat sie fröhlich-knallblaue Augen und einen gleichmäßig runden, hellblond beflaumten Kopf. Schon sehr niedlich.
Ilona seufzt, schiebt ihren Still-BH zurecht und fragt, ob ich eine Tasse Tee möchte. Sie greift nach einer Zweihundertgrammtafel Vollmilch-Mandel-Schokolade, bricht sich eine Rippe ab und schlägt die Zähne hinein.
»Das Stillen«, sagt sie kauend, »das zehrt vielleicht. So eine Tafel Schokolade haue ich am Tag mühelos weg. Du auch ein Stück?«
Martin sei heute Morgen weggefahren, erzählt sie weiter, auf einen Kongress, und komme erst Sonntagabend wieder. »Ich hoffe, dass ich das schaffe, so ganz alleine«, fügt sie kleinlaut hinzu.
Ich frage mich, ob meine allzeit vor Siegesgewissheit strotzende Chefin jetzt tatsächlich von mir hören will, dass sie es schon schaffen werde, ihr eigenes Kind drei Tage lang allein zu betreuen. Mir scheint, dass man darum nicht so viel Aufhebens machen muss. Aber ich will lieber nicht das große Wort schwingen, denn mit Kindern habe ich ja nun mal keinerlei persönliche Erfahrung.
»Wie läuft es denn mit deinem Freund?«, fragt Ilona. Sie meint den On-Off-Lover, wie mir nach einigen Sekunden dämmert. Ich sehe mich veranlasst, den Status unserer Beziehung richtig zu stellen.
»Wer weiß«, meint sie, »vielleicht kriegt der irgendwann ja doch noch mal Lust auf Familie.«
So ein Kind sei schon toll, fährt sie fort. Das Beste, was sie je gemacht habe. Auch wenn es irre anstrengend sei. Martin und sie hätten vor, nächstes Jahr, bevor sie vierzig werde, noch ein Geschwisterchen für Lisa Moana zu bekommen. Übrigens liege es an Martin, dass es nicht auf natürlichem Wege klappe, vertraut sie mir an. Weil der sich vor dreißig Jahren habe sterilisieren lassen. Voreiligerweise, weil er Kinder damals uncool gefunden habe. Sie schnaubt ein wenig ärgerlich.
»Und deswegen muss ich jetzt all die Hormone nehmen, das ist nicht ohne, kann ich dir sagen. Ganz abgesehen davon, dass wir den ganzen Spaß auch noch selbst bezahlen dürfen.«
»Warum keine Adoption?«, frage ich.
Ilona schüttelt den Kopf. »Das haben wir ausgeschlossen. Genauso wie eine Behinderung. Das Risiko muss kalkulierbar bleiben.«
Bevor ich gehe, eröffnet Ilona mir noch, dass sie am Montag eine Fotografin bestellt habe, die Bilder von uns beiden machen solle, für die Website. Sie habe sich überlegt, dafür eine hellblaue Bluse anzuziehen. Ob ich einverstanden sei, in derselben Bluse fotografiert zu werden.
»Hellblau?« Ich schaue unglücklich. Wenn es eine Farbe gibt, die mir so gar nicht steht, ist es Hellblau.
»Gut, such dir selbst etwas aus«, sagt Ilona schnell. »Aber eine Bluse sollte es schon sein. Und kein Weiß oder Schwarz. Okay?«
An meinem Geburtstag Ende April finde ich auf meinem Schreibtisch einen Janosch-Geburtstagsteller, darum herum bunte Papierschlangen, darauf ein Stück selbstgebackener Rosinenkuchen, in dem eine Kerze steckt. Neben der Computertastatur liegt ein Umschlag. Darin sind ein Gutschein über zwanzig Euro von der Cocktailbar »Havanna« und ein unbefristeter Arbeitsvertrag, gültig ab dem ersten Mai, der nur noch auf meine Unterschrift wartet.
Ilonas Stimme am Telefon ist honigweich vor Genugtuung.
»Und, was sagst du?«, fragt sie begierig.
Über ein Jahr sei ich nun schon bei ihr, erklärt sie, nachdem ich danke gesagt habe, und sie wolle mir mit dem unbefristeten Vertrag ihr Vertrauen aussprechen. Mittlerweile sei ich eine vollwertige Mitarbeiterin. Darum habe sie auch noch ein Extra-Leckerli für mich: eine Gewinnbeteiligung von zwei Prozent. Das stehe selbstverständlich auch im Vertrag, falls ich es noch nicht gelesen hätte.
Ich schäme mich ein bisschen. Wenn sie wüsste, dass ich im letzten halben Jahr nach anderen Stellen Ausschau gehalten habe und sogar zwei Vorstellungsgespräche hatte.
»Und, feierst du heute Abend mit deinem Freund?«, fragt Ilona.
»Ich weiß nicht«, sage ich. »Vielleicht gehen wir ja einen Cocktail trinken.«
»Na dann, viel Spaß«, sagt Ilona.
Vier Monate später bin ich schwanger. Vom On-Off-Lover. Unerwartet, unbeabsichtigt, unverhofft. Auch wenn es für Ilona natürlich anders aussehen muss.
Ich sage es ihr, als sie aus ihrem Urlaub in Spanien zurückkommt. Einen Augenblick lang verliert sie sichtbar die Fassung, ganz und gar. Das Näschen zittert vor ungläubiger Wut.
»Was hast du dir dabei gedacht«, ruft sie, und ihre Stimme schraubt sich gleich eine ganze Oktave höher. »Du wusstest doch, dass Martin und ich es diesen Herbst noch einmal probieren wollten! Das kann ich jetzt fürs Erste voll vergessen!«
Ich stehe mit unglücklich hängenden Armen da und bringe sinnlose Rechtfertigungen vor. Es sei ein Unfall gewesen und ich selbst ganz perplex. Und im Übrigen, stammele ich dann auch noch, sei ich noch nicht einmal sicher, ob ich das Kind überhaupt haben wolle.
Ilona hat sich wieder so weit im Griff, dass sie nach diesem Strohhalm nicht greift.
»Wir kriegen das hin«, sagt sie mit entschlossen gerecktem Kinn. »Irgendwie.«
Ihre erste Idee dazu, wie dieses »Irgendwie« aussehen könnte, ist ein Auflösungsvertrag. Ich soll kündigen. Schließlich könne ich mich ja selbständig machen, das hätte ich doch ohnehin vorgehabt, und darauf laufe es in unserem Job ja sowieso hinaus, früher oder später.
»Jetzt?« Mehr muss ich nicht sagen. An diesem einen, vorwurfsvollen Wort zerknickt ihr hoffnungsvoller Vorstoß wie eine Papierschwalbe an einem Betonpfeiler.
»Warum nicht jetzt?« Sie sieht aus, als würde sie am liebsten mit dem Fuß aufstampfen. »Du kriegst doch sogar Arbeitslosengeld!«
»Nicht, wenn ich selbst kündige.« Ich bedauere wirklich, ihr nicht entgegenkommen zu kommen; ich würde es so gern. »Tut mir leid.«
Zwei Wochen später eröffnet sie mir, dass sie einen Antrag gestellt habe, mich außerordentlich kündigen zu dürfen. Unter bestimmten Umständen sei das möglich. »Zum Beispiel, wenn mir durch deine Schwangerschaft der finanzielle Ruin droht«, setzt sie zuversichtlich hinzu.
Ich quittiere diese Mitteilung mit einem unbeteiligten, höflichen Nicken. Überhaupt ist die Atmosphäre zwischen uns schon absurd freundlich. Ich komme weiterhin zum Mittagessen, und Martin und Ilona benehmen sich sehr wohlerzogen. Sie erkundigen sich danach, wie es dem Baby und mir gehe und ob der On-Off-Lover und ich uns auch freuten. Ilona redet außerdem oft davon, wie es sein wird, wenn ich erst einmal selbständig bin, gibt mir viele gute Ratschläge und versichert, dass alles prima gehen werde; ich erfüllte nicht nur alle Voraussetzungen, sondern könne natürlich auch auf jede Menge Aufträge von ihrer Seite rechnen. Da könne überhaupt nichts schief gehen.
Das Schreiben der zuständigen Behörde erhalten wir beide am selben Tag. Ein drohender finanzieller Ruin habe nicht festgestellt werden können, heißt es darin. Eine außerordentliche Kündigung komme somit nicht in Frage.
Mit einem flauen Gefühl im Magen betrete ich am nächsten Morgen mein Büro. Mein Computer läuft schon; sie muss vor mir da gewesen und ihn eingeschaltet haben. Auf dem Bildschirm ist ihre Website geöffnet. Ihr Foto lächelt mich an. Da, wo das Foto von mir (in der wunschgemäß angezogenen Bluse) bis gestern noch war, klebt jetzt ein rosa Haftnotizzettel. Ich solle den Schlüssel zu ihrer Wohnung in den Briefkasten werfen, bis heute Abend. Aller weiterer Kontakt werde ab sofort nur noch per EMail erfolgen.
Ich sage mir, dass ich darüber stehen sollte. Dass diese kindische Rachsucht doch nur ihre Hilflosigkeit zeigt. Dass sie um sich schlägt wie ein verwundetes Tier. Was man dann halt so sagt, um eine Kränkung wegzubalsamieren. Aber es funktioniert nicht. Es schmerzt trotzdem, dass sie mich zu ihrer Feindin erklärt hat. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Ich will, dass sie das Richtige von mir denkt.
Meine Frauenärztin, bei der auch Ilona Patientin ist, legt mir nahe, mich krankschreiben zu lassen. In meinem Fall sei eine Indikation zweifelsfrei gegeben; Stress infolge der hohen psychischen Belastung. Ich müsse an das Baby denken. Aber ich lehne ab.
Sie schüttelt bekümmert den Kopf. »Ihre Loyalität in Ehren«, sagt sie seufzend, »aber sind Sie sicher, dass Ihre Arbeitgeberin diese Loyalität auch verdient?«
Ich zucke die Schultern. »Das hat nichts mit Loyalität zu tun«, sage ich.
Sie schaut mich mit verständnislos hochgezogenen Augenbrauen an. »Womit dann?«, fragt sie.
An einem Donnerstag kurz vor Weihnachten ruft Ilona bei mir im Büro an, das erste Mal, seit sie mich verstoßen hat. Es ist früher Nachmittag.
»Ich weiß, du solltest eigentlich gleich frei haben«, sagt sie. Ihre Stimme klingt widerwillig und angespannt. »Aber ich habe in einer halben Stunde einen Arzttermin mit Lisa Moana. Ein Notfall. Sie hat seit gestern Abend schon hohes Fieber.«
Es wäre kein Drama, zu bleiben, aber die Art und Weise, wie sie damit ankommt, passt mir nicht. Ich frage, was denn mit Martin sei.
»Der kann auch nicht, sonst würde ich ja nicht dich fragen«, sagt sie gereizt. Im Hintergrund höre ich Lisa Moana kreischen. »Also, was ist, bleibst du? Ich habe jetzt keine Zeit für langes Palaver, mein Kind ist krank.«
Ich bleibe. Das Kind kann schließlich nichts dafür.
Eine Dreiviertelstunde später klingelt das Telefon wieder. Am Apparat ist eine Frau von einem Maklerbüro. Sie will Ilona sprechen. Ilona muss in der Aufregung vergessen haben, die Rufumleitung auf ihr Handy einzustellen. Ich frage, ob ich etwas ausrichten könne.
Die Frau sagt, dass es um die Verschiebung des Wohnungsbesichtigungstermins morgen Vormittag um zehn gehe. Ob es auch gegen vierzehn Uhr passe. Falls nicht, solle Ilona sie doch bitte zurückrufen.
Ich notiere sorgsam alles, den Namen der Frau und des Maklerbüros und natürlich die Adresse des Objekts, um das es sich dreht.
Am nächsten Morgen warte ich auf Ilonas Anruf. Er kommt gegen halb elf.
»Also gut«, sagt sie. »Was muss ich tun, damit du aus meinem Leben verschwindest?«
»Ich will ein erstklassiges Arbeitszeugnis«, antworte ich.
»Okay. Kriegst du.«
»Und eine Abfindung«, schiebe ich hinterher.
Das hat sie von mir nicht erwartet; einen Augenblick herrscht Stille am anderen Ende. »Wie viel?«
Die Wohnung wird als großzügiger, sanierter Altbauklassiker angepriesen. Sie ist einhundertvierzig Quadratmeter groß, hat einen edlen Dielenfußboden, schöne, hohe Stuckdecken, einen Kamin, eine Loggia, zwei Balkons und einen Garten im Innenhof. Sie soll fünfhunderttausend Euro kosten.
»Zehntausend«, sage ich.
»Bist du übergeschnappt?«, schrillt sie.
»Ich habe mir das Haus angesehen«, sage ich und versuche, höflich, aber bestimmt zu klingen. »Zehntausend.«
»Fünf«, sagt sie.
»Siebenfünf«, sage ich.
Durchreise
Bislang war alles wie vorgesehen gelaufen.
Die Aeroflot-Maschine aus St. Petersburg war pünktlich in Hamburg gelandet. Transfer zum Flughafengebäude, Passkontrolle, Gepäckausgabe – alles hatte reibungslos geklappt. Hastig, ohne sich auch nur einen Moment unnötig aufzuhalten, strebte Helen nun dem Ausgang zu. Die schwere Tasche schlug ihr immer wieder gegen die Beine, als sie die anderen Reisenden beinahe im Laufschritt überholte. Die Menschen in der Wartehalle nahm sie kaum wahr. Auf sie würde ja niemand warten, das wusste sie; nicht hier jedenfalls.
Sie hielt Ausschau nach dem Weg zu den Bussteigen. Wenn sie schnell genug loskam, erwischte sie vielleicht sogar gerade noch den Intercity, der in einer halben Stunde vom Hauptbahnhof fuhr.
Und dann sah sie Georg, ganz vorn, direkt neben der Absperrung.
Helen blieb stehen.
Dort stand er also, blasser als sonst, mit diesem angestrengten, vorwurfsvollen Gesichtsausdruck, den sie in letzter Zeit so oft an ihm gesehen hatte, und einer rosa Rose in der Hand.
Oh nein, dachte sie. Nicht auch das noch.
Etwas wie plötzliche Wut stieg in ihr hoch. Woher nahm er sich das Recht, hier zu stehen und auf sie zu warten? Es gab keinen Weg an ihm vorbei, und das wusste er auch genau. Er sah aus, als hätte er schon vor Stunden hier Stellung bezogen und kein Auge von der Tür gelassen, durch die sie kommen musste.
Helen biss die Zähne zusammen und ging durch die Absperrung.
»Das ist aber eine Überraschung«, sagte sie. »Was machst du hier?«
Georgs Lippen waren bleich und spröde, und er hatte bläuliche Schatten unter den Augen. Seine Haut spannte sich sehr straff über den vorstehenden Wangenknochen. »Ich dachte, du würdest dich vielleicht freuen, wenn dich jemand abholt und zum Bahnhof bringt.«
»Das ist ja lieb von dir.« Es war nicht lieb, was er hier machte. Alles andere als das. Aber schon schämte Helen sich auch wieder für ihre Wut auf ihn.
»Aber deswegen hättest du doch nicht herkommen müssen! Ich meine – ich fahre jetzt zum Hauptbahnhof und nehme den nächsten Zug nach Münster, ich bin auf der Durchreise, das hatte ich dir ja gesagt.«
Er nickte. »Weiß ich. Aber ich dachte, ich komme trotzdem und bringe dich zum Zug.«
»Na gut. Dann lass uns aber gehen, ich habe es wirklich eilig.«
Georg nahm ihre Tasche.
»Ist die Rose für mich?«
Er nickte wieder. »Für dich, schöne Frau.«
»Wie lieb von dir.«
Sie ging neben Georg her, Richtung Ausgang, und überließ es ihm, den richtigen Bussteig zu finden. Der Septemberhimmel über Hamburg war grau.
Erst als sie an der Bushaltestelle standen, sah sie ihn wieder an.
»Du siehst schlecht aus.«
»Wieso?«
»Als würdest du zu wenig essen. Und zu wenig schlafen.«
»Nein, nein, mir geht’s gut.« Sein Tonfall war zu fröhlich. Helen wusste, dass er log. »Außer, dass ich dich vermisse.«
Natürlich. Das hatte ja kommen müssen.
»Du solltest mich aber nicht vermissen.« Munter wollte sie klingen, heiter und unbekümmert. Als liefe das hier auf eine ganz alltägliche, in keiner Weise beunruhigende Konversation hinaus.
»Warum nicht?«
Fast hätte Helen gesagt: Weil du mich fertig machst damit, begreif es endlich.
Stattdessen sagte sie: »Weil es besser für dich wäre, endlich einen Schlussstrich zu ziehen.«
Das hatte schon nicht mehr so munter, heiter und unbekümmert geklungen. Sie kriegte es nie hin, auch diesmal nicht.
Georg schüttelte den Kopf. »Warum sollte das besser für mich sein?«
»Man muss sich nun mal irgendwann damit abfinden, dass etwas zu Ende ist.«
»Ist es denn zu Ende?«
Helen erwiderte nichts darauf; der Bus hielt an der Haltestelle. Sie stiegen ein.
Georg saß ihr gegenüber und wartete. Sie war wieder dran.
»Du weißt doch, dass es zu Ende ist. Schon seit langem.«
»So lange ist es nun auch wieder nicht her, dass wir …«