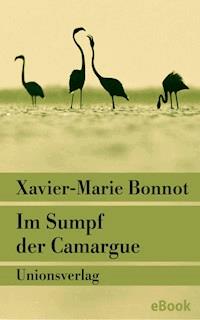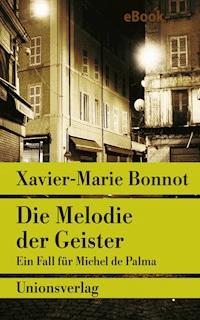11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Calanques vor Marseille, tiefe Küsteneinschnitte, türkis glitzerndes Wasser, schroffe Felsen und versteckte Buchten. Doch etliche Meter unter der Wasseroberfläche liegt noch eine ganz andere Welt: jahrtausendealte Unterwasserhöhlen, an deren Wänden prähistorische Felszeichnungen prangen. Der Archäologe und erfahrene Taucher Rémy Fortin erforscht die Höhlenmalereien, als er panikartig auftaucht und dabei schwerste Verletzungen erleidet. Seine letzten Fotos zeigen gigantische Stalagmiten, eine rätselhafte Hirschkopfstatue und den Schatten einer riesigen Gestalt. Hauptkommissar Michel de Palma, der »Baron« von Marseille, begibt sich auf eine prähistorische Spurensuche und stößt auf ungeklärte Morde, die einem uralten Ritual folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Archäologe Rémy Fortin erforscht vor der glitzernden Küste der Calanques die Unterwasserhöhlen und ihre urzeitlichen Felszeichnungen, als er schwer verunglückt. Seine letzten Fotos zeigen eine rätselhafte Hirschkopfstatue. Hauptkommissar de Palma begibt sich auf prähistorische Spurensuche und stößt auf Morde, die einem uralten Ritual folgen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Xavier-Marie Bonnot (*1962 in Marseille) studierte Soziologie, französische Literatur und Geschichte. Nach Tätigkeiten als Regisseur veröffentlichte er 2002 den ersten Kriminalroman um den Polizeikommandanten Michel de Palma. Die Reihe wurde mehrfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Xavier-Marie Bonnot.
Gerhard Meier (*1957) studierte Romanistik und Germanistik. Seit 1986 lebt er bei Lyon, wo er literarische Werke aus dem Französischen und aus dem Türkischen (Hasan Ali Toptas, Orhan Pamuk, Murat Uyurkulak) überträgt. 2014 wurde er mit dem Paul-Celan-Preis ausgezeichnet.
Zur Webseite von Gerhard Meier.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Xavier-Marie Bonnot
Der erste Mensch
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Gerhard Meier
Ein Fall für Michel de Palma
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2013 bei Actes Sud, Arles.
Originaltitel: Premier Homme
© by Xavier-Marie Bonnot, 2013
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit der Agence litteraire Astier-Pécher.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: EyeEm (Alamy Stock Photo)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-30994-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 07:55h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER ERSTE MENSCH
PrologErster Teil — Das Irrenhaus1 – Der 23. Juli 1970 war ein brennend heißer …2 — Marseille, vierzig Jahre später3 – In de Palmas Alfa Romeo Giulietta Baujahr 59 …4 — Strafanstalt Clairvaux, 4. Dezember5 – Rémy Fortin war in stabilem Zustand in den …6 – De Palma wohnte ganz in der Nähe der …7 – Der Mond warf lange Schatten auf die milchigen …8 – Der Mistral hatte sich in der Nacht gelegt …9 — Strafanstalt Clairvaux, 7. Dezember10 – Professor Palestro war kein glücklicher Mensch. Auch kein …11 – Das Einkaufszentrum Centre Bourse sah aus wie ein …12 – Pauline Barton tauchte nie allein. An jenem Morgen …13 – Das Schnellboot der Polizei drehte mitten in der …14 — Strafanstalt Clairvaux, 14. Dezember15 – Der Dirigent hob den Taktstock. Das Licht der …16 – Am nächsten Tag fuhr Pauline wieder nach Quinson …17 — Villejuif, 20. DezemberZweiter Teil — Der verwundete Mann18 – Waffe in den Gürtel! Drei Schritte, stehen bleiben …19 – Der Morgen graute. Thomas Autran war müde …20 – Clairvaux war erst mal nur eine lange Steinmauer …21 – Es war keine Stimme. Es war eine Spannung …22 – Am Gitter des Paul-Guiraud-Krankenhauses in Villejuif hingen Spruchbänder23 – Drei Polizeifahrzeuge verstellten die Straße und ließen nur …24 – Das Haus stand hinter einem Felsen, der wie …25 – Der Baron suchte im Autoradio der Giulietta nach …26 – Die Sprechstunde Dr. Caillols fand donnerstags zwischen vierzehn …27 – Nach den Villenvierteln von Plan-de-Cuques im Nordosten von …28 – Vor seiner Umwandlung in eine ultramoderne Bibliothek war …29 – Steif erhob Dr. Caillol sich hinter seinem Schreibtisch …30 – Kommen Sie mit.« Die Wärterin war eine gedrungene …31 – Für Besprechungen hatte de Palma nichts übrig …32 – Donnerstags hielt Dr. Caillol bis zwanzig Uhr Sprechstunde …Dritter Teil — Das Haus der Verrückten33 – De Palma zeigte an der Absperrung seinen Polizeiausweis …34 – Endgültig den Geist aufgegeben hatte das Autoradio der …35 – Christine Autrans Wohnung lag am Boulevard Chave …36 – De Palma fummelte am Radio herum, seit er …37 – Die Hausnummer 31 der Rue de Chine lag …38 – Ich möchte alles sehen, was er hier zurückgelassen …39 – Bei hohem Wellengang umschiffte die Archéonaute die Insel …40 – Ein Evangelist mit Krawatte verteilte vor der Kirche …41 – Die Kassette, die de Palma in Ville-Evrard von …42 – Aus kalten Augen verfolgte Christine Autran jede Geste …43 – Das von der Polizei eingesetzte Warnsystem hatte schließlich …44 – Was genau machen wir hier?« Die Route Départementale …45 – Mit einem starken Fernglas auf dem vorgewölbten Bauch …46 – Von den Vollzugsbehörden bekam man immer erst im …47 – Delphine weinte. Am Vortag hatte sie das Kommissariat …48 – Die erste Vision war frappierend. Ein Blitz …49 – Wenn du erst mal im Eingang bist …50 – Dr. Dubreuil war in der Bibliothek des Krankenhauses …51 – Zwei Tage später traf ein Schreiben aus Ville-Evrard …52 – Der letzte Mensch, der mit dem Hirschkopfmenschen zu …53 – Die Finger von Hélènes Mutter kneteten ein zerknülltes …EpilogZitatnachweisMehr über dieses Buch
Über Xavier-Marie Bonnot
Über Gerhard Meier
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Xavier-Marie Bonnot
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Meer
Zum Thema Geschichte
Für Frédéric, der die Geheimnisseunserer alten Erde entschlüsselt hat.
Für Michel, den Gelehrten …
Charaktere und Handlung dieser Geschichte sind meiner Fantasie entsprungen.
Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden Personen sind rein zufällig.
»Aber in welchem Mythus lebt der Mensch heute?«
»Im christlichen Mythus, könnte man sagen.«
»Lebst du in ihm?«, fragte es in mir.
»Wenn ich ehrlich sein soll, nein! Es ist nicht der Mythus, in dem ich lebe.«
»Dann haben wir keinen Mythus mehr?«
»Nein, offenbar haben wir keinen Mythus mehr.«
»Aber was ist denn dein Mythus? Der Mythus, in dem du lebst?«
C. G. JUNG, Erinnerungen, Träume, Gedanken
Prolog
Der erste Abdruck prangte auf einem steinernen Faltenwurf, wenige Meter vor einer großen, sich ins schwarze Wasser neigenden Platte. Eine Kinderhand. Das Zeichen von Urmann.
Der Taucher erschauerte. Ihm schnürte sich die Kehle zu. Eine weitere Hand wogte vor seinen Augen, und noch eine, alle im Negativ. An einigen fehlten Finger, andere waren rot durchgestrichen.
Weiter vorn war der Fels von kurvigen, verflochtenen Linien durchzogen. Felsbilder tauchten auf, dann fantastische Formen. Ein halb menschliches, halb tierisches Wesen war in den Stein geritzt. Tiefe Kratzer durchzogen den langen ziselierten Körper, nicht aber den Vogelschädel und die hirschartigen Läufe.
Das so lang Gesuchte endlich vor sich zu sehen, erschütterte den Taucher, stürzte ihn in den Abgrund der Zeit, den Urgrund aller Mythen, als Homo sapiens sich auf seinen langen, unaufhaltsamen Weg machte. Er spannte seinen Fotoapparat und drückte ab. Ein Mal, zwei Mal … Dann schritt er weiter, bis die niedrige Decke ihn zum Bücken zwang. Da sah er auf dem glänzenden Boden etwas liegen. Er schoss ein erstes Foto, trat näher heran, drückte noch mehrmals ab.
Da plötzlich hörte er es.
Ein trauriges Singen. Kaum vernehmbare Worte, wie ein dahingemurmeltes, heiseres Gebet, das immer rascher wurde, von Wand zu Wand flog. Dann Stille. Nur das schwere Tropfen auf dem rostigen Boden.
Plitsch, platsch, plitsch, platsch …
Der Taucher hielt den Atem an. Angstschauer durchfuhren ihn. Er riss den Taucheranzug auf, als müsste er sein heftig pochendes Herz befreien.
Zu seiner Linken drang ein nasser Felsenirrgarten in tiefste Dunkelheit vor. Die feuchte Luft schmeckte säuerlich nach Kamille.
Der Taucher machte seine Lampe aus und kauerte sich auf den Boden.
Das Singen hob wieder an. Klang näher diesmal. Furchteinflößender.
Der Taucher bemühte sich um eine rationale Erklärung. Ihm zitterten die Hände. Er war ja nicht zum ersten Mal in einer Unterwasserhöhle. Durch eine Steinorgel konnte der Wind bis ins Innerste der Erde hinunterpfeifen.
Doch wehte an dem Tag nicht die leiseste Brise.
Als er die Lampe wieder anknipste, brach die Melodie augenblicklich ab. Wieder nur der kalte, unerschütterliche Rhythmus der vom Gewölbe herabfallenden Tropfen. Plitsch, platsch, plitsch, platsch … Wie eine ewig tickende Uhr.
Nun wurde es dem Taucher zu unheimlich. Er hastete zu seiner Ausrüstung am großen Brunnen, lud sich die Pressluftflaschen auf, wobei er sich in seiner Panik beim Anlegen von Schwimmflossen und Maske ungeschickter anstellte als sonst.
Und bemerkte nicht, gleich hinter ihm, die platschenden Schritte und den riesigen Schatten.
Erster Teil
Das Irrenhaus
Die Menschen der Vorzeit haben uns nur verstümmelte Nachrichten hinterlassen. Am Ende eines langen Rituals, bei dem sie eine gebratene Bisonleber auf einer mit Ocker bemalten Rindenschale darboten, mögen sie irgendeinen Stein auf dem Boden niedergelegt haben. Die Gesten, die Worte, die Leber und die Schale sind verschwunden; und kommt uns kein Wunder zu Hilfe, so können wir den Stein nicht von den übrigen Steinen in seiner Umgebung unterscheiden.
ANDRÉ LEROI-GOURHAN,Die Religionen der Vorgeschichte
1
Der 23. Juli 1970 war ein brennend heißer Tag. Quer durch die Haute-Provence waren Hunderte von Hektar Wald in Flammen aufgegangen. Der Regen ließ auf sich warten, und Tag um Tag verbrannte und verdurstete die Natur.
An der Ausgrabungsstätte von Quinson sah man die Luft über den Gräben flimmern. Als am späten Nachmittag die Sonne hinter den schwarzen Bergen verschwand, die das Tal der Durance säumten, wehte von den Anhöhen der Verdonschlucht ein milder, fast frischer Wind herab.
Da stellte sich der Tod ein.
Der Tod in einer grünen Limousine, die auf der kurvenreichen Straße zur Verdonschlucht ockerroten Staub aufwirbelte.
Pierre Autran konnte das nicht wissen, und es fiel ihm auch nichts auf. Er sah auf die Uhr und rief zu Professor Palestro: »Feierabend!«
Sorgsam lehnte er Kelle, Schaber und Pinsel an ein großes Sieb. Pierre Autran war in jeder Hinsicht ein Mann von Maß und Ordnung. Bei Sonnenuntergang war es unweigerlich Zeit für ein Bier. Die eiskalten Bierdosen warteten im Kühlschrank am anderen Ende der Fundstätte. Autran ließ sich nicht lange bitten. Staub und Sonne waren seiner legendären Nüchternheit Herr geworden.
Die Ausgrabung fand auf einem mit Zistrosen durchsetzten Garrigue-Plateau statt. In einiger Entfernung stieg das Terrain zu grauen Felsen hin an. Zwischen grünen Mulden und roten Erdstreifen zog sich ein Pfad hindurch und verschwand schließlich hinter kaum mannsgroßen Kermes-Eichen, die zur Baume-Bonne-Höhle führten.
Pierre Autran setzte sich auf den Rand einer Schubkarre voller Schutt und hielt Palestro ein Kronenbourg hin.
»Prost!«
Palestro war um die dreißig, ein hoch aufgeschossener Kerl mit hängenden Schultern, stets in Kakihose und mit einem alterslosen Stoffhut auf dem Kopf. Er gehörte dem Institut für Urgeschichte der Universität Aix-en-Provence an. Autran war in etwa gleich alt, aber kräftiger. Er war einer jener schnürstiefelbewehrten freiwilligen Helfer, die gern an Steinen herumschrubben, weil sie damit heiligen Dienst an der Forschung tun. Das Team hatte verdammt gute Arbeit geleistet! Die schnurgerade angelegten Gräben wirkten wie eine Riesentreppe und drangen bis zum Gravettien-Zeitalter in die Erde vor.
Innerhalb eines Monats hatte sich die Stätte erheblich vergrößert. Palestro hatte beantragt, weiter oben graben zu lassen, an einer teilweise zugeschütteten Öffnung am Fuß eines Felsens, die ein Jagdunterschlupf aus der Altsteinzeit sein konnte. Assistenten zogen Schnüre, und regelmäßig kam zur Überprüfung ein Vermessungsingenieur vorbei. Schicht um Schicht rückte der raue Boden Fitzelchen Geschichte heraus. Seit vierhunderttausend Jahren lebten hier Menschen!
Der Doktorand Jérémie Payet konnte sich von seiner Arbeit an den tieferen Schichten noch nicht losreißen. Er kniete vor einer Böschung und fuhr mit dem Pinsel über eine dunklere Linie knapp über dem Boden. Er war wohl der eifrigste von allen, ein richtiger Entdecker! Und hatte schon eine Menge gefunden.
Autran nahm einen Schluck Bier und fuhr sich mit der Zunge über die vom Staub aufgerissenen Lippen.
»Dann verlässt du uns also morgen«, sagte Palestro.
»Tja. Bisschen traurig bin ich schon.«
»Ach was, komm einfach nächstes Jahr wieder. Erfahrene Leute wie dich brauchen wir immer. Und du kannst auch mal so vorbeischauen.«
»In einem Jahr, wer weiß, wo ich da bin.«
Palestro warf seine Bierdose in das Blechfass, das ihnen als Mülleimer diente. »Wegen deiner Kinder, meinst du?«
»Ja. Die fehlen mir.«
»Du musst sie mir mal vorstellen!«
Autran holte seine Brieftasche heraus. In einem Ausweisfach steckte ein etwas blasses Foto seiner Zwillinge Thomas und Christine. »Das da ist Christine«, sagte er und hielt Palestro das Foto hin.
»Ein hübsches Mädchen!«
»Und noch dazu talentiert und wissbegierig.«
»Und der Junge heißt Thomas, ja?«
»Ja. Acht Minuten nach seiner Schwester geboren.«
Aus dem Teenagergesicht stach ein dunkler, gequälter Blick heraus. Das entsetzliche Leuchten in den Augen zeugte von einer Krankheit, die sein Vater nie erwähnte. Thomas fürchtete sich noch immer vor der Nacht, vor Dunkelheit und Schatten. Manchmal schrie er und schlug derart um sich, dass er fixiert und mit Medikamenten ruhiggestellt werden musste. Er begeisterte sich für die Urgeschichte und für Autoren wie Leroi-Gourhan, Breuil oder de Lumley.
»Warum nimmst du sie nicht mal mit zu einer Ausgrabung?«
Autrans Gesicht verfinsterte sich. Er sprach fast nie über seine Familie, zum einen aus Zurückhaltung, aber wohl auch, weil es da dunkle Geheimnisse gab, die ihn verstummen ließen.
Von Quinson her erklang das Angelusläuten. Die dumpfen Glockentöne hallten von den Kalkfelsen wider und verloren sich über den hellen Wassern des Verdon. Da stand Jérémie Payet auf einmal ruckartig auf. »Kommt mal her!«
Palestro und Autran gingen in großen Schritten zu ihm hin. Payet deutete auf einen braunen Streifen zwei Meter unter dem Erdboden. »Da, im Gravettien!«
In der Lehmkruste steckte ein langer schwarzer Gegenstand. Jérémie Payet bückte sich und pinselte ihn ab. »Eine Figur, gar kein Zweifel!«
»Ein schöner Fund«, sagte Autran. »Bravo, Jérémie!«
»Ganz außerordentlich!«, lobte auch Palestro und starrte die Figur an.
Dann schob er den Studenten umstandslos beiseite und pinselte den Gegenstand gute zehn Minuten lang Millimeter für Millimeter weiter heraus. Manchmal hielt er kurz inne, legte an die etwa zwanzig Zentimeter lange Figur ein schwarzgelbes Lineal an und schoss ein Foto. Die Füße waren grob geformt, der Körper wohlproportioniert, und in Brusthöhe sah man durch ein Loch ins Innere.
»Sieht aus wie ein Mammut-Stoßzahn«, sagte Payet.
»Ich denke, da hast du recht«, erwiderte Palestro. »Hier sieht man gut, dass es Elfenbein ist.«
Der Kopf wirkte rätselhaft. Das Kinn wies die Form einer Hirschschnauze auf. Über der Stirn ragte ein hoher, tief eingeschnittener Kopfputz empor, wie ein Geweih.
»Ich glaube, wir haben es hier mit einem Hirschkopfmenschen zu tun«, sagte Palestro. »Ein gehörnter Hexer. Halb Mensch, halb Tier.«
Jérémie Payet ging zur Hütte und kam mit einer rechteckigen Box zurück. Palestro bettete den Hirschkopfmenschen auf ein Wattekissen und schloss den Deckel.
Da hörten sie ein Hupen und blickten alle drei auf.
Pierre Autran schirmte mit der Hand die Augen ab, um besser zu sehen. »Das ist für mich«, sagte er.
Der Tod blieb vor dem Gitter des Ausgrabungsorts stehen, in einem metallicgrünen Mercedes 300, den Pierre Autran ein halbes Jahr zuvor gekauft hatte. Seine Frau fuhr ihn. Er klopfte sich den Lehm von der Hose, setzte seine Sonnenbrille auf und ging zu der Limousine hinunter.
Eigentlich hätte weder sein Auto dort sein sollen noch seine Frau.
2
Marseille, vierzig Jahre später
Seit drei Tagen fegte der Mistral wie ein Irrer durch die Straßen der Stadt. Der Himmel war von kalter Reinheit. Blau und hart stand er über den sich zum Meer hin verneigenden Felskämmen. Nach dem Windgetobe waren Schneefälle nie da gewesenen Ausmaßes vorhergesagt. Der Dezember verhieß eiskalt zu werden, doch solcherlei Prophezeiungen ignorierte man in Marseille schon lange.
Im zweiten Stock des Polizeipräsidiums schrillte seit einer guten Weile das Telefon.
»Ich geh ran!«, rief Michel de Palma und blies auf den Kaffee, den er dem Automaten abgetrotzt hatte.
Er hetzte durch den Gang und hob ab.
»Ich möchte bitte Inspektor de Palma sprechen.«
»Hauptkommissar heißt das jetzt, und zwar schon ziemlich lange. Am Apparat.«
»Schön, Sie endlich zu hören! Ich war schon am Verzweifeln.«
Eine zittrige Frauenstimme. De Palma setzte sich hin und streckte die langen Beine aus. Er war müde und allein. Jetzt bloß keine Neurotikerin, die auf Nervenkitzel aus ist. »Was wollen Sie von mir?«
»Haben Sie heute Morgen Zeitung gelesen?«
»Nein. Tu ich nie.«
Die Frau hielt kurz inne. Durch den Hörer war ein Motor zu vernehmen. Ein Bootsdiesel, vermutete de Palma.
»Ich leite die Ausgrabungen in der Le-Guen-Höhle, und da … Also vor zwei Tagen hat ein Mitarbeiter von mir, Rémy Fortin, einen Unfall gehabt, und zwar einen schweren.«
De Palma zuckte zusammen. »In der Höhle, sagen Sie?«
»Ja. Das heißt, eher am Ausgang.«
»In was für einer Tiefe?«
»Etwa achtunddreißig Meter.«
»Ein Dekompressionsunfall?«
»Ja, angeblich.«
»In der Le-Guen-Höhle zu tauchen ist gefährlich, das müssen Sie doch wissen! Wie heißen Sie?«
»Pauline Barton.«
Er kritzelte den Namen auf seine Zigarettenschachtel. »Und Sie meinen, ein reines Unglück war das nicht?«
»Genau. Erklären kann ich es auch nicht, aber seit dem Unfall lese ich noch mal alles, was damals geschrieben worden ist, nach den furchtbaren Sachen, die da um die Höhle passiert sind, und ich sage mir, dass das nicht alles Zufall sein kann. Erinnern Sie sich an die Geschichte?«
»Und ob. Der Fall Autran. Thomas und Christine. Vor zehn Jahren war das.«
Thomas Autran, der Sohn von Pierre Autran, war vom Team de Palmas verhaftet worden. Er hatte drei Frauen niedergemetzelt, vielleicht sogar mehr. Ganz war der Fall nie aufgeklärt worden. Neben jedem seiner Opfer hatte Thomas Autran einen Negativabdruck seiner Hand hinterlassen, nach Art der Magdalénien-Menschen, die so ihre Höhlen schmückten.
Weder bei der Polizei noch vor dem Richter hatte Autran gestanden. Das Schwurgericht Aix-en-Provence ließ ihn in lebenslänglicher Nacht verkümmern und hatte eine Sicherheitsverwahrung von dreiundzwanzig Jahren draufgepackt. Seine Zwillingsschwester war zum Zeitpunkt der Taten Professorin für Urgeschichte an der Universität der Provence. Wegen Mittäterschaft wurde sie zu zwölf Jahren verurteilt. Das Schwurgericht zeigte sich gnädig.
De Palma informierte sich nebenbei rasch über Neues aus der Welt der großen Serienmörder. Kein Ausbruch zu verzeichnen, auch keine Fahndung. Nichts über die Autran-Zwillinge. Überhaupt hatte er seit Jahren nichts mehr von der Le-Guen-Höhle und den Autran gehört. Das verhieß nichts Gutes.
»Wir müssen uns treffen, so gegen siebzehn Uhr«, sagte er in unmissverständlichem Ton.
»Äh, gut. Ich bin in den Calanques, in Sugiton.«
»Ich komme da hin. Sie bringen mich dann übers Meer wieder nach Marseille.«
Ohne sich zu verabschieden, legte de Palma auf und warf seinen Kaffeebecher in den Papierkorb. Der Tag fing ja gut an. Von der Kathedrale ertönten drei volle, klingende Schläge, und der Mistral wirbelte Papierfetzen und Plastiktüten bis zu den Fenstern des Präsidiums hinauf.
Ein Anblick, bei dem man übers Schicksal ins Grübeln kommen konnte. Warum ausgerechnet die Le-Guen-Höhle? Und ausgerechnet ein mysteriöser Unfall?
Eine Stunde lang telefonierte de Palma herum. Vom Kulturdezernat wurde ihm bestätigt, dass in der Höhle derzeit Grabungen stattfanden. Küstenwache und Seenotrettungsdienst berichteten übereinstimmend von einem Tauchunfall am Eingang zur Le-Guen-Höhle, in achtunddreißig Metern Tiefe. Rémy Fortin sei in besorgniserregendem Zustand aufgefunden und nach Marseille in eine Dekompressionskammer des Krankenhauses Timone verbracht worden.
Fortin war innerhalb weniger Sekunden aus beinahe vierzig Metern Tiefe an die Wasseroberfläche emporgetaucht. Durch den zu schnellen Aufstieg war es in Blut und Muskelgewebe zu einer Gasübersättigung gekommen, und es hatten sich gefährliche Blasen gebildet.
»Dass der überhaupt noch lebt, ist ein Wunder!«, hatte der Rettungsarzt gesagt.
De Palma war grundsätzlich misstrauisch, und gegenüber Wundern erst recht. Taucher vom Kaliber eines Rémy Fortin verloren nicht so ohne Weiteres die Beherrschung. Aber da unten konnte eben alles Mögliche passieren. Den seltsamsten Wesen begegnete man da, vom verirrten Menschenfresser-Hai über liebesbedürftige Delfine bis hin zu Wahnsinnigen wie Thomas Autran. De Palma verspürte auf einmal ein dringendes Bedürfnis nach einer Zigarette, hatte aber keine Lust, bis in den Hof hinunterzugehen, um bei dem Sturm mit den letzten Nikotinsüchtigen des Präsidiums seine Gitane zu rauchen.
Als er im Büro auf und ab ging, fiel sein Blick auf das Rundschreiben des neuen Kripochefs. Der Mann machte den Kampf gegen das Bandenwesen zu seiner obersten Priorität, die Rückkehr des Rechtsstaats in die nördlichen Viertel der Stadt zum Kreuzzug. Allein vier Luden waren innerhalb eines Jahres über den Jordan gegangen. Schlimmer noch war der Bandenkrieg, den sich einzelne Viertel lieferten, etwa La Rose und La Castellane. Sechs junge Kerle niedergemetzelt, einfach so, mit einer Kalaschnikow. De Palma zerriss das Schreiben und warf es in den Papierkorb.
Da ging die Tür auf und Karim Bessour steckte den Kopf herein. De Palma zuckte zusammen.
»Ach, du bist ja da, Baron!«, rief Bessour verwundert aus.
»Wo soll ich sonst sein?«
Bessour runzelte die Stirn. Mit seiner schlaksigen Gestalt und dem hageren Gesicht wirkte er immer, als zöge er gleich in den Krieg.
»Du weißt doch, der Umtrunk, wegen meiner Beförderung.«
Zu dem Anlass hatte Bessour ein weißes Hemd angezogen, mit zu kurzen Ärmeln für seine endlos langen Arme, und die blaue Krawatte hing ihm schief herunter.
»Stimmt, du wirst ja Kommissar. In deinem Alter! Du wirst uns noch mal Kripochef …«
»Lass die Scherze!«
»Nein, bestimmt. Du hast was drauf. Solche wie du sind hier dünn gesät.«
»Hast mir alles du beigebracht, Baron!«
»Tja, leider!« De Palma wurde ernst. »In drei Wochen ist hier Schluss für mich. Dann ist es aus mit dem Baron.«
Von Wehmut wollte sich Bessour nicht übermannen lassen. Um abzulenken, schielte er auf die Uhr.
»Ich komme mir hier manchmal vor wie in einem Beichtstuhl«, fuhr de Palma dennoch fort. »Ein Beichtstuhl ohne Pfarrer. Lauter arme Sünder habe ich vor mir. Das Handgelenk, immer das linke, an den Ring da gefesselt. Und dann wird gejammert, wie unschuldig sie doch alle sind. Hin und wieder auch eine Frau. Und am Anfang ein paar zum Tode verurteilte. Einen hat es tatsächlich auch erwischt. Den werde ich nie vergessen, mit seinen Glubschaugen hinter der eckigen Brille. Wie der geheult hat und gefleht und geschrien …«
»Immerhin hast du ein paar große Fälle gehabt. Du bist nicht umsonst der Baron!«
Um dem bedrückenden Gespräch zu entkommen, schnappte de Palma sich den Karton, den er vom Gemüsehändler um die Ecke geholt hatte. »Ich räume jetzt meine Sachen auf.« Er entriegelte die Schubladen und schüttete den Inhalt direkt in den Karton. Ein Haufen Kram regnete herab: Visitenkarten, alte Radiergummis, zerdrückte Patronen, angenagte Stifte, Durchschlagpapier voll nutzlos gewordenem Text. Mit dreißig Jahren Kripo war letztendlich nicht viel Staat zu machen.
»Du hast immerhin noch drei Wochen runterzureißen«, scherzte Bessour.
De Palma schlüpfte in seine Jacke und steckte die Dienstwaffe in das Holster. »So, ich muss. Ich treffe mich mit einer Prähistorikerin, und zwar nicht gerade um die Ecke.«
»Ach ja?«
»In Sugiton wäre ein Taucher beinahe abgesoffen, da muss ich jetzt hin.«
»Soll ich mit?«
»Von wegen, du lässt hier die Korken knallen!«
De Palma legte drei Finger auf die Schulter, um die Tressen anzudeuten, auf die Bessour nun Anspruch hatte. Der ging auf die Spitzen seines Vorgesetzten grundsätzlich nicht ein. Im Übrigen wusste er, dass de Palma vor Hierarchie, Autorität und Uniformstreifen nicht den geringsten Respekt hatte.
»Ein Unfall in Sugiton? Davon habe ich, glaube ich, in der Zeitung gelesen. In der Le-Guen-Höhle, oder?«
»Am Eingang. In achtunddreißig Metern Tiefe.«
»Und das war also kein Unfall?«
»Keine Ahnung, Junge. Bei der Le-Guen-Höhle bin ich aufs Schlimmste gefasst, verstehst du?«
»Ja.«
»Wieso? Steht in der Zeitung so was?«
»Äh, ich glaube schon.«
»Das hat mir gerade noch gefehlt!«
Bessour machte sich davon. De Palma hatte was gegen Umtrunke, ob sie nun zum Einstand, zum Ausstand, zur Beförderung oder zu sonst was gegeben wurden.
3
In de Palmas Alfa Romeo Giulietta Baujahr 59 war das Autoradio rechts neben den drei großen runden Chromanzeigen angebracht, direkt unter dem schlicht aufs Armaturenbrett geklebten Rückspiegel. Zum Einstellen der Sender musste man mit viel Fingerspitzengefühl den rechten Knopf drehen, sonst war man gleich viel zu weit. Der Baron traute sich an den alten Kasten schon längst nicht mehr heran, und auch sonst durfte ihn niemand berühren. Seit Jahrzehnten war in dem legendären Coupé der Zeiger auf den Klassiksender France Musique eingestellt, auf UKW, und von da rührte er sich nicht weg.
Beim Herausfahren aus der Tiefgarage des Polizeipräsidiums rauschte es kurz im Radio, dann ertönten, in Mono, die letzten Takte der großen Arie von Radames. Aida, erster Akt.
Ergerti un trono
Vicino al sol …
De Palma erkannte die Stimme Plácido Domingos, das Jahr der Aufnahme, nämlich 1974, und nach dem spektakulären hohen b erwartete er den Auftritt von Amneris und damit die verzaubernde Stimme Fiorenza Cossottos. Stattdessen ergriff jedoch ein Musikwissenschaftler das Wort. Aha, eine Sendung über die großen Helden des Opernrepertoires. De Palma hörte nur mit halbem Ohr zu. Sowieso würde der Tunnel zwischen den früheren Docks und dem Timone-Viertel den guten Mann eine ganze Weile verstummen lassen.
Eine halbe Stunde ging es noch durch die Viertel dahin, die sich an die steilen Abhänge des Mont Saint-Cyr und des Col de la Gineste schmiegten, bis hin zu den allerletzten Häusern.
An den Ausläufern des Calanque-Massivs war Marseille zu Ende. Jenseits einer verrosteten Schranke zog sich ein schmaler Weg zum Sugiton-Pass hoch, flankiert von windgebeugten Flaumeichen und von den Kiefern, die nach verheerenden Waldbränden neu gepflanzt worden waren. Nach einem Engpass ging es schluchtartig zu einer kleinen Bucht hinunter. Vom hellen Meeresboden hoben sich die dunklen Flecken der Neptungräser ab. In achtunddreißig Metern Tiefe konnte man durch einen schlauchartigen Gang ins Innere des Berges hinaufgelangen, in die Le-Guen-Höhle, einen trockenen Höhlenraum mit prähistorischen Malereien und Zeichnungen.
Die Stille wurde von einem Schrei zerrissen. Über Sugiton hob sich ein Habichtsadler in die Luft, auf der Suche nach Aufwinden entlang der Felsen.
De Palma ging rasch den Pfad hinunter und erreichte bald den Felsvorsprung, der den Tauchern als Schaltstelle an Land diente. Kurz darauf tauchte Pauline Barton aus dem Wasser auf und winkte ihm zu.
Fachleute vom Amt für Unterwasserarchäologie machten sich um eine wasserdichte Kiste herum zu schaffen, die an einer Trosse emporgezogen wurde. Pauline hievte sich an Bord der Archéonaute und verschwand für ein paar Minuten. In abgewetzten Jeans, einer orangefarbenen Fleecejacke und mit einem Handtuch auf dem Kopf kehrte sie zurück.
»Hallo, Monsieur de Palma. Schön, dass Sie gekommen sind.«
Sie hatte einen festen Händedruck, trug keinen Ehering und war ungeschminkt. Das viele Tauchen und die beißende Sonne hatten Furchen in ihrem länglichen Gesicht mit den funkelnden grauen Augen hinterlassen.
»Gibt es was Neues von Rémy Fortin?«, fragte de Palma.
»Die Ärzte sind nicht gerade zuversichtlich. Kommen Sie doch an Bord, dann können wir uns besser unterhalten. Oder werden Sie leicht seekrank?«
De Palma lächelte. »Ich stamme aus einer Seemannsfamilie.«
Die Archéonaute war an die dreißig Meter lang, und ihr spitz zulaufender Vordersteven teilte die Wellen wie eine Messerklinge. Unter der Bullaugenlinie war der blau-weiß-rot gestreifte Rumpf voller Roststellen.
Pauline Barton lud de Palma in die Kajüte ein. An einem Pressholztisch standen zwei mit rissigem Kunstleder überzogene Sitzbänke.
»Wie genau ist die Sache passiert?«, fragte der Baron ohne Umschweife.
»Dekompressionsunfall. Eine Stickstoffblase ist ihm direkt ins Gehirn gedrungen. Er ist immer noch im Koma und schwebt in Lebensgefahr.«
»Und warum glauben Sie nicht, dass es ein Unfall war?«
Pauline warf einen Blick zur Brücke der Archéonaute. Sie wollte sichergehen, dass niemand lauschte. »Rémy ist mit Abstand der beste Taucher von uns. So leicht gerät der nicht in Panik. Als ich dahin gekommen bin, wo er seine Tarierweste aufgeblasen hat, schwebten noch Aufschlämmungen im Wasser.«
Die Mikropartikel aus Ton, mit denen Unterwassergänge in der Regel bedeckt waren, konnten bei der leisesten falschen Bewegung aufgewirbelt werden und das Wasser vollkommen undurchsichtig machen; ein von Tauchern gefürchtetes Risiko.
»Rémy hat eine Taucherflosse verloren«, sagte Pauline leise. »Und das Tauchseil ist durchgeschnitten worden.«
De Palma holte einen Notizblock aus der Jackentasche. »Kennen Sie eigentlich die Geschichte der Le-Guen-Höhle?«, fragte er.
Die Frau starrte ihn an. »Na hören Sie mal, und ob ich die kenne. Ich arbeite seit ein paar Jahren hier.«
»Nein, Entschuldigung, ich meine die jüngste Geschichte.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
De Palma drehte sich zur Brücke um. Der Bootsmann verließ gerade seinen Posten. Sie waren allein in dem Teil des Schiffes.
»Sagen Ihnen die Namen Christine und Thomas Autran etwas?«
»Wer was mit Urgeschichte zu tun hat, kennt auch Christine Autran! Der große Liebling, ach, was sage ich, die Geliebte von Palestro. Ich habe sie als Professorin gehabt und alles von ihr gelesen. Brillant, muss ich sagen. Und natürlich habe ich von der furchtbaren Sache in der Höhle gehört. Ich habe damals bei Ausgrabungen im Ariège gearbeitet. Vom Bruder weiß ich allerdings nichts.«
Pauline Barton hatte den Unfall der Küstenwache gemeldet. Der Diensthabende, ein eingebildeter alter Beamter, hatte sie nicht ernst genommen, als sie von einem möglichen Hinterhalt sprach. Er verfasste ein Protokoll im Telegrammstil, gespickt mit juristischen Phrasen aus vormoderner Zeit. Doch Pauline ließ sich davon nicht abschrecken und ging bei sich zu Hause ins Internet. In mehreren Artikeln über die Affäre der Autran-Zwillinge stieß sie auf den Namen de Palma. Schließlich überwand sie ihre Aversion gegen die Polizei und rief bei der Kripo an.
De Palma zögerte kurz, bevor er nachhakte. »Glauben Sie, dass Rémy Fortin vor seinem Unfall über irgendetwas erschrocken ist?«
»Ja.«
»Und woraus schließen Sie das?«
»Na, ihm fehlte doch eine Flosse. Und sein Messer hat er auch verloren.«
»Was für ein Messer?«
»Er hatte immer ein Tauchermesser dabei, an den Unterschenkel gebunden. Warum hat er das gezückt?«
»Um das Tauchseil abzuschneiden!«
»Aber warum hat er es dann verloren?«
Sie musste immer das letzte Wort haben. Aber de Palma ließ nicht locker. »Sie meinen also, er hat das Messer vor seinem Unfall benutzt, vermutlich zur Verteidigung. Es kann doch aber auch sein, dass er sich mit einem Fuß im Taucherseil verheddert und sich loszumachen versucht. Dabei verliert er die Flosse, und dann schneidet er das Seil durch. Auch ein Problem mit dem Druckventil könnte er gehabt haben und dadurch in Panik geraten sein.«
»Das glauben Sie doch selber nicht! Auf dieser Höhle liegt ein Fluch!«
»Da gebe ich Ihnen allerdings recht!«
Ein junger Mann kam herein und stellte weiße Dosen auf den Tisch. Er mochte Student sein oder einer der vielen Freiwilligen, die bei Ausgrabungen oft mitmachten. De Palma fotografierte ihn geistig ab, typisches Gehabe eines alten Polizisten, der gelernt hat, jedem erst mal zu misstrauen.
»Das sind wertvolle Kohleproben«, sagte Pauline. »Bestimmt über dreißigtausend Jahre alt. Die durchlaufen jetzt eine ganze Batterie von Tests. Das ist die zweite Serie, interessanter als die erste.«
Gerührt blickte sie auf die schwarzen Kohlestücke, die dem Laien so gar nichts verrieten. In der Fachpresse würde es zu den Datierungen und den topografischen Aufnahmen ausführliche Artikel geben. In der Zeitschrift Geschichte war Pauline gewissermaßen ein Star, und das genoss sie auch.
»In drei Wochen gehe ich in Pension«, sagte de Palma. »Ich weiß also wirklich nicht, ob ich Ihnen weiterhelfen kann. Ich bin ein Kommandant, der die Waffen niederlegt, weiter nichts!«
»Sie können viel für mich tun«, entgegnete Pauline. »Und zwar, weil Sie wissen, dass Rémy nicht einfach einen Unfall hatte. Dabei habe ich Ihnen noch gar nicht alles verraten.«
Auf einmal dröhnte es aus dem Maschinenraum herauf, und mit Getöse setzte sich das Schiff in Bewegung. Der Bootsmann manövrierte das Gefährt aus der Sugiton-Calanque heraus, wobei die Schiffsschraube im ruhigen Meer einen brodelnden Halbkreis zeichnete.
»Es gibt nämlich Fotos«, sagte Pauline. »Die hat Rémy vor dem Unfall gemacht. Der Apparat ist völlig intakt geblieben. Rémy hatte ihn in die wasserdichte Kiste gelegt.«
»Kann ich die Fotos sehen?«
»Dazu müssen Sie mit ins Labor.«
Sie fuhren am Cap Morgiou vorbei, dessen Grate die letzten Sonnenstrahlen abbekamen. Weiter vorn zeichnete sich dunkler die Merveille-Spitze ab.
Der Student setzte sich zu ihnen in die Kajüte. »Ganz schön kalt draußen«, sagte er.
»Ziemlich normal für Mitte Dezember, oder?«, versetzte Pauline.
Trotz der vom täglichen Tauchen hinterlassenen Spuren war ihr Gesicht von einer Schönheit, die de Palma betörte. Er hatte etwas übrig für Frauen, die sich auf Verrücktheiten einlassen, wie etwa darauf, im Winter in das kalte Wasser der Calanques hinabzutauchen, um Kohlestücke aus dem Cro-Magnon zu bergen.
Hinter dem Cap Croisette wurde die riesige Bucht von Marseille vom Mistral durchpflügt. Die von Backbord heranrollenden Wellen setzten der Archéonaute ordentlich zu. Das Meer schien von unberechenbaren Schatten bevölkert, die aus den weißen Kämmen auftauchten und in den dunklen Wellentälern wieder verschwanden. Am Château d’If zog, ganz Stahl und Strahlen, die massige Ibn Zayyed vorbei, ein tunesisches Fährschiff unterwegs nach La Goulette.
Die Archéonaute legte an der Zollstation an, gleich neben dem quadratischen Turm des Fort Saint-Jean. De Palma sprang auf den Kai und wartete, bis auch Pauline Barton von Bord ging. Durch die Passage Sainte-Marie drängte die Dünung herein und schlug an die mit roten Algen bedeckten Felsen der Festungsmauer. Ein alter in seinen Mantel eingemummter Maghrebiner hatte am Kai zwei Angelschnüre ausgelegt.
»Na, beißt was?«, fragte de Palma.
»Kaum«, erwiderte der Alte und wischte sich einen Tropfen von der haarigen Nase. »Zu kalt.«
»Manchmal beißen hier Barsche an.«
»Inschallah!«
Das Labor für Urgeschichte war in den grauen früheren Marinegebäuden im Oberteil der Festung untergebracht. Davor lagerten Bohlen und Baugerätschaften. Die Renovierungsarbeiten zogen sich in die Länge.
Pauline Barton und de Palma betraten den Raum mit den Objekten aus der Le-Guen-Höhle. Auf einem metallgrauen Kasten lag ein kieferloser Schädel.
»Nehmen Sie sich einen Stuhl und schieben Sie ruhig alles beiseite, was Sie stört«, sagte Pauline.
Überall häuften sich Akten und wissenschaftliche Publikationen. An einer Pinnwand aus Kork hing ein Foto einer Negativhand. Ohne Daumen.
»Sehen Sie, dieses Foto interessiert mich«, sagte der Baron, »und ich erkläre Ihnen auch, warum. Damit Sie so richtig begreifen, müssen wir auf den Fall Autran zurückgehen.«
Er zeigte Pauline das noch am ehesten präsentierbare Tatortfoto aus der Akte Autran. Beim Anblick der seltsamen Signatur, die der Täter neben den Frauenleichen hinterlassen hatte, verzog sie angewidert das Gesicht. Es war jeweils ein Blatt Papier mit genau dem gleichen Abdruck, der hier an der Wand hing, doch schien ihr das nicht aufzufallen.
»Ich habe nie begriffen, was diese Negative für einen Mann wie Thomas Autran genau zu bedeuten haben«, sagte de Palma.
»Ob das wirklich einen Sinn hat, weiß ich auch nicht, aber für ihn wahrscheinlich schon. Seine Schwester hatte bemerkenswerte Artikel über die symbolische Bedeutung dieser Hände geschrieben, auch wenn es nur Theorien waren, die erst verifiziert werden müssen. Sie ist von Medizinmännern ausgegangen, die sich in solchen Höhlen bestimmte Substanzen geholt haben sollen.«
»Was für Substanzen?«
»Zum Beispiel die sogenannte Mondmilch. Das ist eine Kalzitablagerung auf Höhlenwänden und Stalaktiten, eine Art Kalziumkonzentrat. Wenn man das zu einem Pulver zerstößt, ist es ein ziemlich wirksames Mittel gegen bestimmte Krankheiten, vor allem bei Knochengeschichten. Und bei schwangeren Frauen soll es den Milcheinschuss fördern. Heute weiß man über Kalzium gut Bescheid, aber damals …«
Christine Autran hatte behauptet, in der Le-Guen-Höhle seien magische Handlungen vollzogen worden, und sie könne sich auch vorstellen, die Schamanen des Magdalénien hätten ihren Patienten Mondmilch und andere Substanzen verabreicht. Von da war es nur noch ein Schritt bis zu der Vermutung, das Pulver besitze magische Kräfte, und den Schritt hätte sie wohl auch getan, wenn ihr nicht doch noch ein Rest an universitärer Zurückhaltung verblieben wäre.
Pauline Barton ging durch den Raum und öffnete einen Metallschrank. »Ich muss Ihnen jetzt was zeigen.« Sie kam mit einem Tablet zurück und legte es auf den Schreibtisch. »Da, schauen Sie mal.«
Sie schaltete das Gerät ein und arbeitete sich zu den Fotos vor. Auf den ersten beiden sah man in der Totale eine weite Höhle mit relativ niedriger Decke. Die dritte Aufnahme zeigte riesige Stalagmiten, und auf einem Felsen waren zwei Negativhände abgebildet.
»Sehen Sie den Schatten dahinten?«, fragte Pauline. »Der beschäftigt mich am meisten.«
Im hinteren Höhlenteil war deutlich eine riesige Gestalt zu sehen, mit zwei Armen, zwei Beinen und einem überproportional großen Körper.
»Vergessen Sie nicht«, mahnte de Palma, »das kann auch ein Silhouetteneffekt sein, durch den Blitz. Bei all den Stalaktiten und bizarren Formen in der Höhle. Da kommt man sich leicht vor wie im chinesischen Schattentheater, und je nach Beleuchtung tauchen die absurdesten Gestalten auf.«
»Mag sein. Aber ausgerechnet das war sein letztes Foto. Zuvor hat er ganz andere Aufnahmen gemacht.«
Sie zeigte ein neues Foto. An einem glänzenden Stalagmit lehnte ein zweigförmiger Gegenstand von etwa zwanzig Zentimetern Länge.
»Was ist das?«, fragte de Palma.
»Würde ich selber gerne wissen.«
Sie wählte wieder ein Foto aus und vergrößerte es, bis deutlich zu sehen war, dass es sich um eine kleine Statue handelte.
»Haben Sie noch andere Aufnahmen davon?«
»Ja, sechs insgesamt.« Sie ließ auf dem Bildschirm nebeneinander die Fotos erscheinen, lauter Nahaufnahmen. »Wissen Sie, ich glaube, wir haben da eine der ältesten Menschendarstellungen überhaupt vor uns! Eine Art Tiermensch, vermutlich aus der Spitze eines Mammutstoßzahns geschnitzt, oder aus einem Hirschgeweih. Im Jungpaläolithikum findet man viele davon, genauer gesagt im Gravettien.«
Sie wählte eine Profilaufnahme aus und vergrößerte sie wieder. Hals und Brust der Figur waren sehr fein gearbeitet. Der untere Gesichtsteil sah wie eine Tierschnauze aus, die Augen waren nur angedeutet. Aus der Stirn traten mehrere Hörner heraus. »Das ist bestimmt ein Hirschkopfmensch. Ein magisches Wesen. Solche Feinheiten traut man den Menschen aus dem Gravettien erst mal gar nicht zu.«
»Das ist also eine bedeutsame Figur? Ich meine, vom Symbolischen her?«
»Selbstverständlich. Da steckt was Magisches drin. Und was Mythisches. Im antiken Griechenland haben wir den Gott Aktaion, der von Artemis in einen Hirsch verwandelt wird. Und bei den Kelten gibt es Cernunnos, den gehörnten Gott, der ein Hirschgeweih trägt. Eine uralte Figur also, die von jeder Zivilisation neu aufgewärmt wird, bis der jüdisch-christliche Mythos die Oberhand gewinnt. Früher haben die Forscher darin eine Art Teufel gesehen. Hirsche wurden übrigens mal als die Könige der Tierwelt angesehen. Denken Sie bloß an die vielen Geweihe, die bei Jägern im Esszimmer hängen. Da spielt immer auch die Magie der Jagd mit hinein. Christine Autran hat geschrieben, dass Schamanen Hirsche oder Rentiere anriefen, um sich ihre Kraft anzueignen.«
»Wie ist sie darauf gekommen?«
»Weil man in allen bemalten Höhlen solche Tiere antrifft. Aber das ist natürlich nur ein Deutungsversuch.«
»Und diese Figur da?«
Pauline hielt kurz den Atem an. »So eine habe ich noch nie gesehen. Und auch nie von einer gehört.«
»Also ist sie sehr wichtig!«
»Und ob! Extrem wichtig. Warum hätte Rémy sie sonst fotografiert?«
»Und sind Sie auch sicher, dass sie echt ist?«
»Als Wissenschaftlerin muss ich das verneinen, denn ich habe sie ja nicht untersucht. Aber im Vertrauen auf Rémy behaupte ich: ja. Unbedingt.« Sie schaltete das Tablet aus und räumte es in eine Schublade. »Diese Objekte sind die ältesten menschlichen Darstellungen. Bei Felsbildern sind ansonsten Tiere die häufigsten Motive, und zwar bei Weitem.«
»Glauben Sie, der Hirschkopfmensch stammt aus der Le-Guen-Höhle?«
»Gute Frage. Ich denke nicht.«
»Und warum nicht?«
»Weil er sichtlich restauriert worden ist. In dem Zustand findet man keine Figuren. Meistens sind sie unter meterweise Erde oder Tropfstein begraben.«
Sie holte einen dicken Band aus dem Regal, eine umfangreiche Studie zu den Figuren, die in Brassempouy entdeckt worden waren, einem winzigen Dorf im Département Landes. Auf alten Fotos posierten zwei Männer mit Schnurrbart und runder Brille vor auf Schaufeln gestützten Straßenbauarbeitern. Sie arbeiteten an zwei Schichten aus dem Paläolithikum: der Hyänen-Galerie und der Papst-Höhle, die etwa hundert Meter voneinander entfernt waren.
»Die Papst-Höhle ist Ende des 19. Jahrhunderts von Pierre-Eudoxe Dubalen untersucht worden, einem ortsansässigen Gelehrten, und dann von Edouard Piette. Die haben natürlich nicht so gegraben wie heute, sondern eher ruckzuck mit dem Schubkarren. Allzu viel Schaden hat Piette aber nicht angerichtet. Er hat mehrere Fragmente von Frauenfiguren entdeckt, darunter die Venus von Brassempouy, die bisher älteste Darstellung eines menschlichen Gesichts. Fünf Zentimeter hoch und drei Zentimeter breit. Die Kopfproportionen haben aber nichts Menschliches an sich. Niemand hat so einen Schädel! Man muss einem Künstler eben seine Fantasie lassen. Stirn, Nase und Augenbrauen sind reliefartig gearbeitet, aber Mund ist so gut wie keiner vorhanden. Wenn man die Venus anschaut, meint man, irgendwann trotzdem Lippen zu erkennen. Augen sind wirklich keine da, nur eben die Brauen. Und trotzdem lächelt dieses Gesicht. Heute ist die Venus im Archäologischen Museum in Saint-Germain-en-Laye ausgestellt.«
»Gibt es eine Theorie über die Bedeutung solcher Figuren?«
»Da zerbrechen sich die Forscher den Kopf. Vor allem bei den Frauenfiguren. Manche meinen, da werden Jungfrauen dargestellt, so wie die Muttergottes. Andere behaupten, es handle sich um Priesterinnen. Aber eigentlich weiß man es nicht. Am ehesten kommt man noch mit ethnografischen Vergleichen weiter. Bei den Tungusen in Sibirien haben sich noch in jüngster Zeit Schamanen bei Prophezeiungs- oder Heilungszeremonien als Hirsche verkleidet. In Analogie zur heutigen Zeit behaupten daher manche Forscher, es handle sich bei den Figuren um Schamanengegenstände. Einigkeit herrscht aber bei Weitem nicht, wie meistens bei solchen Themen.«
De Palma blieb eine Weile stumm, ganz in eine Erinnerung versunken. Christine Autran hatte nämlich einen langen Artikel über die geheimnisvollen Zeichen des Gravettien und des Magdalénien veröffentlicht.
Und der Titel lautete: Die Zeit der Zauberer.
* * *
»Papa, meinst du, ich werde wieder gesund?«
»Ganz bestimmt, Junge. Mit dem nötigen Willen überwindet man alles.«
»Wille! Was kann der Wille gegen den Wahnsinn ausrichten?«
Thomas hat schon Anfang Herbst eine Krise durchgemacht. Damals ist er ins Krankenhaus eingeliefert und in eine Gummizelle gesperrt worden. Um sich zu beruhigen. Er begriff nicht, was das sollte.
Warum in eine Zelle?
Warum allein?
Am Boden eine Matratze, darauf eine blau-rot karierte Decke. Und ein lächerlicher Teddybär, so wie der im Fernsehen, der immer auf einer Wolke davonfliegt. Er hasst die Sendung, denn die Musik macht ihm Angst.
Die gelben Wände glänzen ein wenig von dem monotonen Neonlicht, das von der Decke scheint, durch einen mit zinnoberrotem Papier bedeckten Halbkreis hindurch. Die weißliche Neonröhre spiegelt sich in der Mitte, sodass das Fenster von unten aussieht wie ein Durchfahrtsverbotsschild.
Thomas versucht einzuschlafen, kann aber den Blick nicht von dem Verbotsschild abwenden. Von dem Schild, an dem niemand vorbei darf. Das ihm das Leben unmöglich macht.
Hinausgehen verboten! Er weint.
Die Bedeutung der Schilder hat ihm sein Vater beigebracht. Wenn sie die Avenue du Prado hinaufgehen, spielen sie immer, wer als Erster die Straßenschilder sieht. Vor dem Durchfahrtsverbot hat Thomas am meisten Angst. Das hat er dem Doktor erzählt, aber dem Doktor ist das egal.
Ein paar Tage nach seiner Krise hat Thomas die geschlossene Abteilung verlassen. Er hat ein wachsbleiches Gesicht, keine Augen, keinen Mund, Arme wie aus Marmor und graue Adern unter der durchsichtigen Haut.
Seine Mutter konnte sich nicht überwinden, ihn zu besuchen. Seine Mutter liebt ihn nicht mehr.
»Papa, meinst du, ich werde wieder gesund?«
»Ganz bestimmt, Junge. Mit dem nötigen Willen überwindet man alles.«
Papa sitzt auf dem Bettrand und streicht ihm mit seinen kräftigen Fingern über die Haare.
»Ich habe letzte Nacht was Komisches geträumt«, sagt Thomas.
»Willst du es mir erzählen?«
Thomas setzt sich auf und lehnt sich an das dicke Kopfkissen. Draußen pfeift der Wind durch die großen Eichen im Park.
»Ich habe geträumt, dass ich an einem endlosen Meer war. Da waren ganz dürre Bäumchen am Strand … Und dünnes, goldenes Gras … Und kalt war es. Die Felswände haben ganz glatt ausgesehen. Mitten auf dem Strand hat ein nackter Mann ein riesiges Feuer geschürt. Ich bin näher hingegangen, und der nackte Mann hat mich zuerst angelächelt, aber dann hat er mich ganz fest geschlagen. Ich bin zu Boden gestürzt, und meine Seele ist aus meinem Körper davongeflogen.«
Thomas senkt den Blick. Quer über die Stirn hat er eine dicke, hässliche Falte. Sein Vater nimmt seine Hand und drückt sie beruhigend.
»Dann hat der nackte Mann mir einen Körperteil nach dem anderen abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Alles ist verbrannt, und der Körper von Thomas hat geprasselt. Eine dicke Rauchwolke ist zum Himmel hinaufgestiegen. Dann hat der nackte Mann gesagt: ›Jetzt bist du zu Staub geworden. Kannst du die Staubkörnchen zählen? Kannst du deine Körperteile zählen und dein Fleisch befühlen?‹ Dann ist ein Wind aufgekommen und hat den Staub ins hohe Gras geblasen.«
»Dein Körper ist also verbrannt!«, ruft sein Vater verwundert aus.
»Ja. Und dann ist der nackte Mann in der Asche herumgetanzt und hat dazu gesungen. Dabei ist die Asche aufgewirbelt worden, und auf einmal hat sie sich wieder zusammengeklumpt, und mein Körper ist neu erstanden. Nur der Kopf hat gefehlt, den hatte der nackte Mann in der Hand, aber es war nur ein nackter Schädel. Der nackte Mann hat das Fleisch wieder hinzugefügt, aber die Augen hat er herausgerissen und sie durch die Augen des Felsenvogels ersetzt.«
»Des Felsenvogels!«
»So hat ihn der nackte Mann genannt. Und dann hat er gesagt: ›Jetzt wirst du die Wahrheit von allem sehen.‹«
»Und dann?«
»Dann hat er mir das Trommelfell durchbohrt und gesagt: ›Jetzt wirst du die Sprache von allem verstehen. Von allen Tieren. Und allen Pflanzen.‹«
4
Strafanstalt Clairvaux, 4. Dezember
Von den dicken Gefängnismauern hallte das Läuten aus den Werkstätten wider. Der Arbeitstag ging zu Ende, eintönig und kalt.
Thomas Autran streckte die Hände zwischen die Gitterstäbe und prüfte seine Armmuskeln unter der dünnen, haarlosen Haut. Mehrfach ballte er die Fäuste und spannte die kräftigen Fingersehnen an. Vor einiger Zeit hatte er sein tägliches Trainingspensum auf drei Stunden Liegestützen und Klimmzüge in seiner Zelle sowie zwei Stunden im Fitnessraum erhöht.
Außerhalb des Riesenknastes war die Landschaft von Raureif überzogen. Autran starrte auf die Felder jenseits der Landstraße. Die zehn Jahre Haft. Die eisigen Morgen. Die Arbeitsräume. Die mit dem Herstellen von Leinenschuhen und dem Zerlegen von Elektroschrott vertane Zeit. Der eng begrenzte Hof. Die Wachtürme, die aussahen wie die Brücken von Kriegsschiffen. Die rohen Silhouetten der mit Präzisionsgewehren ausgerüsteten Wärter.
Der Gefängnishof war menschenleer. In der Mitte des Hauptgangs stand ein kleines Denkmal für die Märtyrer von Clairvaux; zwei mit goldenen Lettern beschriftete Granitplatten zu Ehren des Wärters Guy Girardot und der Krankenschwester Nicole Comte, die während einer blutigen Geiselnahme von den Gefangenen Claude Buffet und Roger Bontems getötet worden waren. Mai 1972.
Aus Clairvaux bricht man nicht aus. Nie und nimmer. Hochsicherheitsgefängnis.
Eingesperrt ist Thomas Autran seit jeher.
Die Klappe in der Tür ging auf.
»Thomas Autran, Lesesaal?«
»Ja, Chef.«
Die Zellentüren standen in der Regel offen, und die Häftlinge konnten sich frei bewegen. Die meisten hatten lebenslänglich. Autran aber war ein »Gefangener mit besonderem Aufsichtsbedarf«. So was mochten die Wärter gar nicht. Autran hatte selbst verlangt, weggesperrt zu werden. Eingebuchtet. Eingemauert in eiskalte Einsamkeit. Der Lesesaal war seit zehn Jahren jeden Tag zur gleichen Stunde seine einzige Zuflucht. Die große Welt hinter den Worten. Das große Bild, weiter noch als hundert Kontinente. Noch nie ist aus Clairvaux jemand ausgebrochen!
Riegel wurden zurückgeschoben. Im weißen Türrahmen erschien die Gestalt des Wärters. Ein blonder Kerl mit schlecht sitzender Uniform.
»Na, Autran, gehen wir?«
»Ja, Chef.«
Im Lesesaal von Trakt B standen zwischen niedrigen Bücherregalen mehrere Resopaltische. Von der Krankenstation war eine kleine Ausstellung zum Thema Aids organisiert worden: Plakate über Vorbeugung und ein paar Zeitschriften. In jeder Ecke stand ein Korb mit Präservativen. Martini, der Häftling von Zelle 18, stopfte sich eine Handvoll davon in die Hosentasche.
»Was willst du denn damit?«, grölte Gilles, ein mit Medikamenten ruhiggestellter Lebenslänglicher.
»Dich mal so richtig ficken, du Tunte!«
Gilles hob die Faust wie einen Hammer.
»Ruhig, Gilles, ganz ruhig«, sagte der Wärter beschwichtigend. »Und du, Martini, verdrück dich, ab in die Zelle.«
»Schon gut, Chef.«
Thomas Autran bemühte sich, die Szene zu ignorieren. Er starrte auf seine Lektüre.
»In die Zelle, Martini!«
Gilles stand ruckartig auf, warf dabei seinen Stuhl um und pfefferte seine Bücher durch den Lesesaal. Autran presste die Kiefer zusammen. In seinem Gehirn knisterte es vor lauter Kurzschlüssen. Wie jeden Tag ging er zu dem Ständer mit den Zeitungen und Zeitschriften. Le Monde ging in seinen Schlagzeilen auf die Opfer der Kältewelle und den G20-Gipfel ein. Auf dem Titelblatt von Paris Match prangte Alain Delon mit einer jungen Frau, die sich an ihn schmiegte, und auf einem kleinen Bild war der Obdachlose zu sehen, der an der Place de la Concorde im Schnee erfroren war.
Autran ließ seinen Blick von Titel zu Titel schweifen und blieb schließlich bei der Zeitschrift Geschichte hängen.
Le-Guen-Höhle
Ausgrabungen durch schweren Unfall beeinträchtigt
In der Heftmitte war der Höhleneingang abgebildet. Im Artikel stand:
Ob die schreckliche Tragödie, der Rémy Fortin zum Opfer gefallen ist, wohl je aufgeklärt wird? War es ein Dekompressionsunfall? Oder einfach Panik? In achtunddreißig Metern Tiefe kann auch das kleinste Problem fatale Auswirkungen haben.
Thomas las nicht weiter. Ihm schwirrten die Sinne. Als wäre ihm ein gewaltiger Schlag auf den Magen versetzt worden. Ihm zitterten die Hände, und alles um ihn her verschwamm. »Das ist das Zeichen!«, murmelte er.
»Was für ein Zeichen?«
Thomas riss die Augen auf und erkannte den Wärter mit dem Hühnergesicht vor sich.
»Was nicht in Ordnung, Autran?«
»Nein, nein, alles bestens, Chef.« Seine Stimme war erstickt, kaum vernehmbar. Wie bei einem kranken Kind. Er wartete ab, bis der Wärter sich wieder seiner Lektüre zuwandte. Die Überwachungskamera war in seinem Rücken und konnte nicht erfassen, was er mit den Händen tat. Langsam riss er die Seiten in der Heftmitte heraus, eine nach der anderen, und steckte sie sich unters Hemd.
»Das ist das Zeichen …«
5
Rémy Fortin war in stabilem Zustand in den Aufwachraum im obersten Stock der Uniklinik Timone verbracht worden. Die Stickstoffblasen, die auf sein Gehirn gedrückt hatten, hatten sich aufgelöst, allerdings nicht, ohne Schäden zu hinterlassen: Fortin war fast vollständig gelähmt. Er konnte hören, aber nicht antworten, ja nicht ein einziges Wort herausbringen und erst recht keine Zeichen geben.
Die Besuchszeit endete um Punkt acht Uhr abends, und de Palma musste seine ganze Überzeugungskraft aufbieten, um dennoch in die Intensivstation gelassen zu werden.
»Dürfen wir etwas zu ihm sagen?«
»Alles, was in Richtung Stimulus geht, ist gut für ihn«, erwiderte der Chefarzt. »Er kann nur die Lider bewegen.«
Sie kamen durch einen langen Gang. Die Patienten warteten auf ihr Abendessen, und es roch penetrant nach schlechter Suppe und zerkochtem Fleisch. Vor Zimmer 87 blieb der Chefarzt stehen.