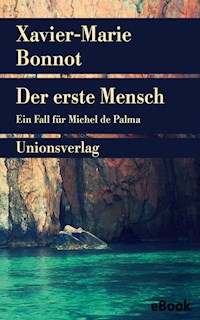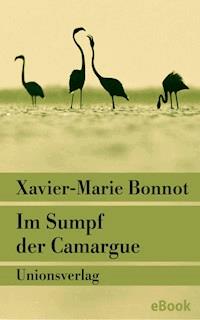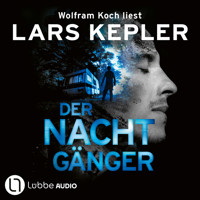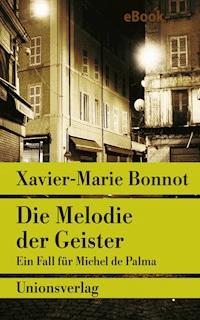
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Marseiller Polizeikommandant Michel de Palma, auch »Baron« genannt, soll Licht in den Fall des Mordes an Dr. Delorme bringen, der tot an seinem Schreibtisch aufgefunden wurde, vor ihm aufgeschlagen Freuds Werk Totem und Tabu. Sechzig Jahre zuvor hat der Wissenschaftler in Neuguinea den Einheimischen Schädel und Totenmasken abgekauft. Warum fehlt in Delormes Villa einer dieser Schädel? Während die Ermittlungen laufen, kommt es zu weiteren Verbrechen an Ethnologen und Kunsthändlern. Hat Michel de Palma es mit einem manischen Mörder zu tun? Seine Untersuchungen führen den opernbegeisterten, unbeugsamen, unberechenbaren Ermittler in die Tiefen der Marseiller Unterwelt, aber auch nach Neuguinea und in die internationale Kunsthandelsszene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Marseiller Polizeikommandant Michel de Palma, auch »Baron« genannt, soll Licht in den Mord an Dr. Delorme bringen. Warum liegt Freuds Werk Totem und Tabu geöffnet vor dem toten Wissenschaftler? Gibt es eine Verbindung zu dessen früheren Reisen nach Neuguinea? Der »Baron« taucht ab in die Tiefen der Marseiller Unterwelt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Xavier-Marie Bonnot (*1962 in Marseille) studierte Soziologie, französische Literatur und Geschichte. Nach Tätigkeiten als Regisseur veröffentlichte er 2002 den ersten Kriminalroman um den Polizeikommandanten Michel de Palma. Die Reihe wurde mehrfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Xavier-Marie Bonnot.
Gerhard Meier (*1957) studierte Romanistik und Germanistik. Seit 1986 lebt er bei Lyon, wo er literarische Werke aus dem Französischen und aus dem Türkischen (Hasan Ali Toptas, Orhan Pamuk, Murat Uyurkulak) überträgt. 2014 wurde er mit dem Paul-Celan-Preis ausgezeichnet.
Zur Webseite von Gerhard Meier.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Xavier-Marie Bonnot
Die Melodie der Geister
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Gerhard Meier
Ein Fall für Michel de Palma
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Le Pays oublié du temps im Verlag Actes Sud, Arles.
Originaltitel: Le Pays oublié du temps (Arles, 2011)
© Xavier-Marie Bonnot, 2011
Vermittelt durch die Agence littéraire Astier-Pécher
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: peeterv
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30871-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 03:02h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE MELODIE DER GEISTER
Prolog — Sepikbecken, Neuguinea, 1936Wir sind gleich da«, sagt KaïngaraErster Teil — Das Haus der Männer, Siebzig Jahre später1 – Aus dem Sakkoärmel ragte eine Hand. Eine kalte …2 – Wie gehts, Baron?«, redete Jean-Louis Maistre seinen Freund …3 – Eines Tages brachte eine Frau zwei prächtige Adler …4 – Die Luft riecht nach rostigem Metall. Es ist …5 – Der elektrische Türöffner klackte. Nach ein paar Schritten …6 – Bei den Tchambuli wurde für nötig erachtet …7 – Früh am Morgen, als de Palma im Gang …8 – … Ethnographen hat der Westen wohl hervorgebracht …9 – Zollinspektor Gérard Marlin richtete sein Fernglas auf den …10 – Nachdem die Erde erschaffen war, wurden die Bäume …11 – Paul Brissone, »Paulo«, hatte es erwischt. Auf der …12 – Die Spelunke, die Paul Brissone betrieben hatte …13 – Die Silhouette von Bessour warf einen schmalen Schatten …14 – Der Bischof wohnte im Schlachthofviertel, in einem vierstöckigen …15 – Das da habe ich auf dem Dachboden gefunden.« …16 – Dr. Bernheim war einer der besten psychiatrischen Sachverständigen …17 – Über die Porte d’Arenc gelangte man ins Hafengebiet …18 – Aus der Wohnung von Ange Filippi, dem ehemaligen …19 – Michel trat in den kalten Schatten der Kirche …20 – Fünf nackte, mit weißer Farbe angemalte Männer sitzen …Zweiter Teil — Das von der Zeit vergessene Land21 – An klaren Morgen sieht man am Himmel Ozeaniens …22 – Seit zwei Tagen schob auflandiger Wind Wolken vor …23 – Marseille, Oktober 197624 – Wachtmeister Stéphane Martini, dreiundfünfzig, und Leutnant Frédéric Faure …25 – Eines Tages hat einer von uns aus einem …26 – 20. Oktober 193627 – Bis jetzt konnte ich mich verstecken. Ich habe …28 – Mit der Handtasche auf den zusammengepressten Knien saß …29 – Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Mörder Ihres Großvaters …30 – Vierzehn Tage später31 – Die Regierung hat mich hierhergeschickt, damit ich euch …32 – Die Spirit of Sepik vollführte einen lang gezogenen …33 – Was uns die Reisen in erster Linie zeigen …34 – Der Weg war lang und nicht gerade sicherMehr über dieses Buch
Über Xavier-Marie Bonnot
Über Gerhard Meier
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Xavier-Marie Bonnot
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Ethnologie
Es waren keine Lebenden.
Es mussten unsere Ahnen sein, zurück aus dem Land der Toten.
Wir wussten nichts von der Außenwelt.
Wir dachten, wir seien die einzigen Menschen.
Wir dachten, unsere Ahnen seien dorthin gegangen, weiß geworden und zu Geistern verwandelt
zurückgekommen.
So erklärten wir uns den weißen Mann.
Unsere Toten waren zurück.
Ein Urbewohner von Neuguinea über seine
erste Begegnung mit einem Weißen.
Aus dem Dokumentarfilm First Contact von
Bob Connolly und Robin Anderson, 1983
Prolog
Sepikbecken, Neuguinea, 1936
Wir sind gleich da«, sagt Kaïngara.
Robert Ballancourt nickt und lässt den Blick über das schleimige Wasser schweifen. Die lange Piroge gleitet lautlos dahin.
»Nur noch ein paar Minuten, Robert.«
Grau mäandert der Sepik durch den dichten, feuchten Busch. Die heiße Luft riecht erstickend nach Wasserhyazinthen und verrotteten Algen. Hin und wieder tönt aus der Waldmasse der heisere Schrei eines Kakadus.
»Der Fluss ist gefährlich hier. Zu viel Strömung.«
Kaïngara kennt die Fahrrinnen zwischen den gichtigen Mangrovenfingern und den Schilfgürteln. Bei jedem seiner regelmäßigen Paddelstöße reckt sich seine Brust, und die harten Muskeln spannen sich unter der kupfernen Haut.
»Siehst du diese Wirbel da?« Er deutet auf das gelbliche Wasser. »Da sind die Geister unserer Vorfahren.«
Ansonsten ist Kaïngara wortkarg und zeigt nur lächelnd seine großen elfenbeinweißen Zähne.
»Die Geister der Vorfahren?«
»Ja, die noch nicht nach Hause gefunden haben. Hier sind viele Wirbel, man muss aufpassen, dass man nicht einen Geist sieht oder hört.«
»Warum?«
»Man riskiert sonst sein Leben …«
Kaïngara wirft einen sorgenvollen Blick auf das lehmige Ufer. Aus einem Hinterhalt könnte ein Pfeilregen auf sie herniedergehen. Vorne hält Robert Ballancourt sich krampfhaft am schmalen Bootsrand fest. Den beigen Stoffhut hat er sich tief über die wasserblauen Augen gezogen. Die Hose und das helle Leinenhemd sind mit Schlammspritzern übersät. Seit drei Tagen gärt es in seinen Kleidern, er schläft im ungesunden Dunst des Dschungels, über sich den Baldachin des schwülen Himmels, von Fledermäusen umflattert. Das Hochland hat seinen Blick fiebrig werden lassen.
»Yuarimo ist in dieser Richtung«, ruft Kaïngara, aufrecht spähend. »Da vorne! Morgen sind wir da.«
Sie sind an der Mündung des Flusses Yuat. Hinter Betelpalmen lugt ein seltsam spitzes Dach hervor. Weiter hinten das Haus der Männer mit der riesigen Schutzfigur über dem Eingang, die nach allen Seiten wilde Blicke wirft. Eine so prächtige hat Ballancourt noch nie gesehen.
»Die Leute in diesem Dorf kennen den weißen Mann«, sagt Kaïngara.
Er wirkt nun entspannter. Mit Lanzen und mit Pfeil und Bogen bewaffnete Krieger beobachten die Eintreffenden stumm. Sie sind nackt bis auf die koteka, die langen Penisfutterale, die quer über ihre Bäuche ragen. Einer von ihnen tritt vor. Seine Haut ist gegerbt wie altes Leder.
»Mir scheint, sie haben uns erwartet«, sagt Ballancourt.
»Ja, Neuigkeiten verbreiten sich schnell im Busch.«
Die Piroge stößt zum Anlegen in eine Zunge aus rotem Schlamm. Die im Wasser planschenden Kinder rennen zu den Hütten und schrecken dabei die schwarzen Schweine auf, die zwischen den Palmen stöbern.
Der Mann mit der gegerbten Haut tut einen Schritt auf sie zu.
»Ein Big Man«, sagt Kaïngara mit furchtsamem Blick. »Mit ihm müssen wir reden.«
Auf dem Haupt des alten Mannes wellt sich spärliches weißes Haar. Unter der adrigen Stirn lassen die Augen sich nichts entgehen. In seiner Nasenscheidewand steckt ein Eberhauer, der herabhängt wie ein Schnurrbart. Alle anderen Männer bleiben im Hintergrund stehen, misstrauisch und neugierig zugleich, mit ziemlich wilden Blicken. Ihre muskulösen Oberkörper weisen zahlreiche Kampfnarben auf, kleine sternförmige Wunden von Pfeilen mit Widerhaken und lange Messerschnitte. Der Big Man wendet sich an Kaïngara. Aus seinen Pupillen blitzt es gefährlich, und er spricht im selbstbewussten Ton eines Kriegsherrn.
»Sie freuen sich, dass du zum Kaufen kommst. Sie haben dir viel anzubieten, sagen sie.«
»Frag sie, ob wir ins Haus der Männer dürfen.«
Kaïngara überlegt, bevor er das übersetzt. Er weiß, wie heikel es ist. Nur Eingeweihte dürfen jene Stätte betreten. Nach unendlich langer Bedenkzeit bedeutet der Alte ihnen, zu folgen. Das Haus ist ein weitläufiger, rechteckiger Pfahlbau. Die Pfosten sind wie Totems geschnitzt, für jeden Clan einer. Vor dem Eingang hängt ein Vorhang aus getrockneten Gräsern herab. Im Innern ist jeder Pfeiler und jeder Querbalken mit Fantasiefiguren und verschlungenen Leibern dekoriert.
Die Männer haben sich stumm auf den Boden oder auf Bänke gesetzt. Der Big Man tritt mit großen grünen Blättern in der Hand vor und weist auf einen Schemel. Er sieht Ballancourt an, will ihm etwas zeigen.
»Was ist das?«, fragt dieser.
Zögerlich übersetzt Kaïngara.
»Der Schemel des Redners … Er steht für den Urahnen. Man benützt ihn, um die Probleme des Dorfes zu besprechen oder die Namen der Clans zu vergeben. Er ist außerordentlich wichtig. Ein vor dem Schemel getaner Schwur gilt in alle Ewigkeit.«
Der Big Man scheint rituelle Worte zu sprechen und moduliert seine dünne Stimme, als deklamierte er Verse. Hin und wieder schlägt er kurz und heftig auf den Schemel.
»Wenn das Dorf beschließen musste, ob es gegen ein anderes Dorf Krieg führen sollte«, übersetzt Kaïngara weiter, während er dem Big Man nickend lauscht, »befragte man den Schemel.«
Der Big Man sieht Ballancourt kurz an und legt auf dem Schemel drei Blätter nieder. »Befahl der Urahn zum Beispiel ›Geht auf Kopfjagd!‹, standen im Haus der Männer alle auf und nahmen Lanzen von den Hängebänken. Es herrschte große Aufregung. Die Kopfjagd konnte beginnen.«
Das geschnitzte Gesicht des Schemels scheint von einem Geheimnis verschlossen. Zwei in der Mitte gespaltene Porzellanmuscheln blicken wie kleine Mandelaugen in die Welt der Lebenden. Auf dem Schädel thront eine Krone aus Beuteltierfell. Nase und Mund laufen in einem langen Schnabel aus. Die Schnitzereien der Schemelbeine erinnern an Vogelfüße und bilden den Leib des Urahnen. Auch der Oberteil ist mit Muscheln, Schweinezähnen, Haaren und Blättern geschmückt.
Ballancourt klopft sich mit dem Hut den Staub von der Hose, was bei den Männern, die ihn beobachten, ein belustigtes Lächeln hervorruft. »Verkauf mir diesen Schemel!«
»Unmöglich«, erwidert der Big Man. »Ich erkläre dir gern, wozu er dient, doch ihn verkaufen? Niemals.«
»Ich gebe dir diese Schillinge. Da, alle! Es sind über zwanzig.«
»Nein, Fremder.«
Ballancourt hält ihm große, blinkende Münzen hin. »Das ist viel Geld.«
Der Blick des Big Man hellt sich auf. Ein Lächeln huscht über seinen zahnlosen Mund, dann wird die Miene sogleich wieder abweisend.
»Nein.«
Der Big Man dreht die Handflächen zum Himmel empor. Dem Blick Ballancourts weicht er aus.
»Nein.«
»Das ist ein Sakrileg«, flüstert Kaïngara. »Aber wenn du willst, sind noch andere Sachen da.«
Gleich beim Betreten des Hauses sind Ballancourt die an rituellen Haken aufgehängten Köpfe aufgefallen. Besonders einer ist von morbider Schönheit und zieht den Forscher in seinen Bann. Der Schädel ist nackt und glatt, wie lackiert, die Augenhöhlen mit brauner Paste gefüllt, in die zwei runde asymmetrische Augen gedrückt wurden. Dem Kopf sind grobe Züge aufgeschminkt.
»Der ist nicht aus diesem Dorf«, erläutert Kaïngara. »Es ist der Schädel eines Feindes, der nach einer Schlacht enthauptet wurde. Eine Trophäe …«
Ballancourts Blick verrät wohl, was in ihm vorgeht, denn der Big Man tritt näher an ihn heran und mustert ihn mit einem interessierten Lächeln.
»Und der da?«, fragt Ballancourt und deutet auf einen weit raffinierter gestalteten Schädel.
»Das ist der Kopf eines Ahnen«, erwidert Kaïngara direkt. »Vermutlich ein Big Man von ähnlicher Bedeutung wie dieser hier. Ein besonders schönes Exemplar.«
Das eine Auge ist spiralförmig gearbeitet, das andere besteht aus einem vollkommen runden Loch. Von den Nasenflügeln und den Mundwinkeln winden sich schwärzliche Pinselstriche, dünn wie Tätowierungen, bis hinauf zur Stirn. Kaïngara erklärt, dass sie die Wirbel des Sepik symbolisieren, jenen Ort, an dem die Geister wohnen. Die Schädelrückseite ist mit dichtem, schwarzem Lockenhaar ausgestattet.
»Nie habe ich etwas gesehen, aus dem derart das große Geheimnis des Todes spricht«, sagt Ballancourt und neigt dabei leicht seine hohe Gestalt zu dem Big Man. »Prächtig. Wie viel will er dafür?«
»Tabakstangen, für das ganze Dorf. Glas, wie du es in der Piroge hast, und eisernes Werkzeug. Es ist sehr teuer.«
Der alte Mann vollführt eine Geste, die Ballancourt nicht zu deuten weiß, und wiederholt mehrfach sonderbar röchelnd das gleiche Wort.
»Er sagt, dass er dir für drei eiserne Beile zusätzlich diesen Kopf hier gibt.«
Es ist ein Schädel mit patinierter Stirn, geschmückt mit Federn und weißen Muscheln. In der Nase sind in braunes Harz kleine rote Perlen gedrückt.
»Der ist sehr schön. Sag ihm, dass ich einverstanden bin und es mich ganz besonders freut, diesen Schädel in Frankreich auszustellen. Sag ihm, er ist für ein großes Museum.«
»Ein Museum?«
»Ja, eine Art großes Haus der Männer, in dem jedermann die Reichtümer der Welt bewundern kann.«
Stirnrunzelnd überlegt Ballancourt. Diese Schädel müssten eigentlich im Haus der Geister verbleiben, wo sie ruhen und über die Ernten und die Krieger wachen. Sie sind jenem allerheiligsten Raum entnommen worden, damit Reisende sie hier kaufen können.
»Woher stammt dieser Kopf?«, fragt er.
Der Big Man hat die Frage verstanden und wendet das Gesicht ab. »Aus einem anderen Dorf. Er will nicht sagen, aus welchem«, sagt Kaïngara leise.
»Warum nicht?«
»Schwer zu sagen. Es ist tabu, verstehst du. Die Geister der Ahnen leben in diesen Köpfen fort. Sie wohnen darin.«
Ballancourt nimmt den Schädel, den ein junger Mann ihm reicht, in die Hände. Als er den Kiefer spürt, hat er das Gefühl, eine heilige Grenze überschritten zu haben.
»Erzähl mir, wie du auf Kopfjagd gehst«, sagt er.
Kaïngara muss bei der Frage schmunzeln und übersetzt sofort.
Der Big Man verschwindet kurz und kehrt mit einem langen Dolch zurück, den er vor Ballancourt schwingt. »Wir verwenden solche Bambusmesser«, sagt er mit fast überschlagender Stimme. Gestikulierend geht er um Ballancourt herum. »So schneide ich dir mit mehreren Schnitten den Kopf ab. Einmal ganz herum.«
Der Big Man klemmt sich den Dolch zwischen die Beine, umfasst den Schädel Ballancourts und zieht daran herum, bis der Forscher ganz zerzaust ist und verlegen lächelt, weil die Männer amüsiert zusehen und in der Gruppe der Kinder gekichert wird.
»So wird das gemacht. Es ist ganz einfach. Dann binde ich mir den Schädel um den Hals und bringe ihn ins Dorf. Drei Tage lang wird dann gefeiert und getanzt.«
Ballancourt stellt sich vor, wie der blutige Kopf vor der Brust des Big Man baumelt, und er hört die Schlachtrufe, die Klagen der Frauen, das Zischen der Pfeile.
»Hast du viele Köpfe abgeschnitten?«
Als der Big Man die Übersetzung Kaïngaras vernimmt, stößt er einen kleinen Schrei aus und schlägt sich auf die Knie. »Mehrere Dutzend.«
Ein bewunderndes, furchtsames Raunen geht durch die Reihen der Männer, die am Boden kauernd mit geflochtenem Stroh gegen die Fliegen und die gefräßigen Mücken anwedeln. Ballancourt deutet auf den Ahnenschädel.
»Besitzt ein abgeschnittener Kopf eine bestimmte Macht?«
Der Big Man schließt die rotumrandeten Augen und atmet tief ein.
»Für sie schon«, antwortet Kaïngara. »Durch diese Macht kann der Geist sein Umherirren beenden und nimmt wieder menschliche Gestalt an. Der Big Man sagt, er verkauft dir den Schädel, weil die Missionare uns verbieten, solche Gegenstände zu besitzen. Wir sollen sie zerstören.«
Neugierig tritt eine Frau heran. Ihr kleiner Junge klammert sich an ihr Bein und sieht Ballancourt aus großen Augen an. Der Big Man steht inmitten der Stammesältesten, einen großen Bogen und lange Schilfpfeile in den Händen. Er lächelt nicht mehr, sein Gesicht ist ernst, seine Worte feierlich.
»Hier«, übersetzt Kaïngara, »das gehörte dem Mann, dessen Kopf du nun besitzt, sein Bogen und seine Pfeile. Jeder hier rühmte seine Tapferkeit. Er war der Beste von uns. Seine Waffen gehören nun dir.«
»Wie hieß dieser Krieger?«, fragt Ballancourt.
Verlegen wenden die Männer den Blick ab. In der Ferne, zwischen den auf schwachbrüstigen Pfählen errichteten Häusern, werden die Vogelschreie von einem seltsamen Gesang übertönt. Es sind klagende Frauen. Der Clan trauert. Ein bedeutender Mann ist gestorben.
»Müssen wir nun weg?«
»Ja«, erwidert Kaïngara düster.
In der Nacht werden zwei Krieger die Frauen ablösen und auf heiligen Flöten spielen, langen Holzrohren, die einen schrillen, verzaubernden Ton erzeugen. Die Stimme der Geister.
Sie verlassen den Yuat und biegen in den lebhafteren Sepik ein. Rasch zieht die Piroge im Abenddunkel dahin. Am erdigen Ufer bewegen sich Gestalten und verschwinden in der einsetzenden Finsternis. Inmitten der Wirbel und Strudel scheinen Gesichter auf, die sich sogleich wieder in den Tiefen des Flusses verflüchtigen.
Vom Ufer aus beobachtet ein Krieger die Fremden. Seine Kopfbedeckung aus karminroten und goldfarbenen Paradiesvogelfedern zittert im leichten Wind. Sein Gesicht hat er mit grellen gelben und roten Streifen bemalt, der Körper ist mit rauchgeschwärztem Schweinefett eingerieben. Drohend hebt er seine Lanze und stößt Verwünschungen aus.
»Was ruft er?«, fragt Ballancourt.
»Wer?«
»Na, der Mann dort am Ufer, zwischen den zwei großen Sagopalmen, mit der großen Geldschneckenkette um den Hals. Hörst du ihn denn nicht?«
»Nein.«
Mit seinen Jägeraugen sucht der Führer das Ufer ab. Nichts kann ihm entgehen.
»Ich sehe niemanden.«
»Dann schau besser hin. Jetzt läuft er am Ufer entlang.«
»Da ist niemand, Robert. Niemand.«
Kaïngara stößt das Paddel ins schwarze Wasser und zieht es mit aller Kraft durch, als wollte er fliehen.
»Mach die Augen zu, Robert. Wer einen Geist sieht, über dem schwebt ein großes Unglück.«
Ballancourt schließt die Augen. Trotz der Hitze fröstelt ihn.
Erster Teil
Das Haus der Männer, Siebzig Jahre später
1
Aus dem Sakkoärmel ragte eine Hand. Eine kalte, verkrümmte Hand. Vom Alter langsam vertrocknet.
Verwirrt trat Michel de Palma zwei Schritte zurück. Der Mann war in seinem Sessel zu Tode gekommen. Sein Gesicht steckte unter einer herzförmigen Maske aus roten Pflanzenfasern. Die Farbe war verblichen. Zwei weiße, weit aufgerissene, unwirkliche Augen stachen daraus hervor, durch eine schwarze Scheidewand voneinander getrennt. Aus dem rautenförmigen Mund hingen weiße Fäden.
»Was ist dein Tod?«, fragte sich de Palma laut.
Eine ganze Wand wurde von einem riesigen Glasschrank eingenommen, in dem weitere Masken aufgereiht waren, Gesichter mit zackigen Mustern, mit schrägen Augen, so schmal wie Knopflöcher. Eine leere Stelle zeigte den Platz der Maske an, die auf dem Gesicht des Verstorbenen saß. Daneben auch Waffen, Dolche etwa, wohl aus Knochen gefertigt, und ein Dutzend kleine Figuren. Im Staub ein runder Fleck. Eine Figur muss verschwunden sein, dachte de Palma.
Auf dem Schreibtisch vor dem Toten ein aufgeschlagenes Buch: Totem und Tabu, von Sigmund Freud. Ein ganzer Absatz war unterstrichen:
Eines Tages taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie und brachten zustande, was dem Einzelnen unmöglich geblieben wäre. Vielleicht hatte ein Kulturfortschritt, die Handhabung einer neuen Waffe, ihnen das Gefühl der Überlegenheit gegeben. Dass sie den Getöteten auch verzehrten, ist für den kannibalen Wilden selbstverständlich. Der gewalttätige Urvater war gewiss das beneidete und gefürchtete Vorbild eines jeden aus der Brüderschar gewesen. Nun setzten sie im Akte des Verzehrens die Identifizierung mit ihm durch, eigneten sich ein jeder ein Stück seiner Stärke an. Die Totemmahlzeit, vielleicht das erste Fest der Menschheit, wäre die Wiederholung und die Gedenkfeier dieser denkwürdigen, verbrecherischen Tat, mit welcher so vieles seinen Anfang nahm, die sozialen Organisationen, die sittlichen Einschränkungen und die Religion.
Die Unterstreichungen waren alt, wohl mit einem Füllfederhalter ausgeführt, dessen Tinte ins Sepiafarbene verblichen war. Die Ausgabe stammte von 1920.
De Palma ging noch einmal durch, was sich in der Nacht abgespielt hatte; Bereitschaftsdienst im zweiten Stock des Polizeipräsidiums von Marseille, ein Anruf in der Zentrale.
»Geben Sie mir die Kriminalpolizei.«
Der Anruf kommt aus einer Telefonzelle. Eine Männerstimme mit starkem Marseiller Akzent. »Ich verbinde Sie mit der Hauptwache«, erwidert die Telefonistin kühl.
»Nein, nicht die Hauptwache! Ich will die Kriminalpolizei, die Mordkommission! Und zwar sofort, ist das klar?«
Die Telefonistin zögert.
»Wirds bald? Mach schnell, du Schlampe!«
Die Telefonanlage nudelt digital die ersten Takte der Kleinen Nachtmusik herunter. Mit den Füßen auf dem Schreibtisch mampft de Palma ein Stück Pizza fertig. Die Nacht ist lau und ruhig. Er genießt die Stille in der menschenleeren Abteilung, liest in einem Handbuch der Navigation und hört dazu Mahlers Kindertotenlieder.
In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie getragen hinaus,
Ich durfte nichts dazu sagen!
Er ist bei den Positionslichtern, Steuerbord grün, Backbord rot. Er muss das alles auswendig können, wenn er wirklich einmal aufs Meer hinauswill. Davon träumt er schon immer. Die Gewalten des Ozeans, in den Schoten heulende Winde.
Das Telefon der Mordkommission klingelt.
»Ich verbinde Sie mit jemandem, der anscheinend etwas Ernstes mitzuteilen hat.«
»Gut. Falls die Nummer angezeigt wird, notieren Sie sie, ja?«
»Schon erledigt.«
Ein kurzes Bip, dann schnauft jemand ins Telefon. Man hört Autos vorbeirauschen. Der Mann muss an einer viel befahrenen Straße stehen.
»Kriminalpolizei, Kommissar de Palma, was kann ich für Sie tun?«
»Wurde aber auch Zeit, Chef.«
Der Mann spricht abgehackt. Panik liegt in seiner Stimme. Michel richtet sich auf und rückt einen Schreibblock ans Telefon.
»Wer sind Sie?«
»Das ist furzegal! Jetzt hören Sie mal zu, Chef, da ist ein Typ bei sich zu Hause, dem haben sie übel mitgespielt. Mausetot ist der Kerl.«
»Moment, geben Sie mir mal …«
»Rue Notre-Dame-des Grâces. Die Hausnummer habe ich vergessen. Das Tor ist offen. Ein großes Haus mit grünen Fensterläden, ganz am Ende der Straße, am Meer, gar nicht zu verfehlen.«
»Können Sie bitte wiederholen?«
»Einen Scheißdreck werd ich! Ich habe mit der Sache nichts zu tun, ja? Kapieren Sie das, der Typ, der Sie da anruft, hat nichts getan. Ich hab das bloß entdeckt. Ich bin ein Einbrecher, aber kein Mörder.«
Die nächtliche Stimme legt auf. De Palma hat kein gutes Gefühl. Er kennt die Straße, die auf eine von Felsen begrenzte kleine Bucht hinausgeht. Er steht auf und will sich genüsslich strecken, doch er ist nervös. In dem Sessel hat er nur wenig geschlafen. Kein Traum, auch kein Albtraum, allein das Nichts der Nacht. Die Melodie der Kindertotenlieder geht ihm nicht aus dem Kopf.
In diesem Wetter, in diesem Braus,
Sie ruh’n als wie in der Mutter Haus,
Von keinem Sturm erschrecket,
Von Gottes Hand bedecket.
Michel parkt den Clio der Kriminalpolizei am Ende der Rue Notre-Dame-des-Grâces. Der Tod ist schon da, schnaubt ihm in den Rücken. Michel kennt ihn und zögert die Begegnung hinaus. Sein Blick schweift über die Bucht.
Es ist ein heißer Tag gewesen. Die Sonne spätherbstlich sanft wie eine Safrankugel. Die Luft ist erfüllt von Meeresausdünstungen. Unten schwappen die Wellen an die zerklüfteten Felsen und lassen den Duft von Salz und vertrockneten Algen hochsteigen. Dahinter ist die Bucht stockdunkel, bis zu den zitternden Lichtern von Madrague und Les Goudes.
Es ist ein Haus im Kolonialstil, weder von der Straße her einsehbar noch von dem Fußpfad entlang der Küste. Dahinter ein Labyrinth aus Gässchen und verwunschenen Eckchen, winzige auf Stein gedeihende Gärten, ein Restaurant mit drei Michelin-Sternen, von Fischerhütten umgebene Villen. Bis fast zum Meer hinunter erstreckt sich dieser Wirrwarr an Steinwegen und Terrassen.
De Palma holt sich aus dem Kofferraum eine Taschenlampe. Das Tor steht offen. Hausnummer 38. Bleich stehen die messingfarbenen Ziffern aus der Mauer heraus. Wie zur Beruhigung fährt Michel mit dem Finger darüber. Er zieht seine Smith & Wesson Bodyguard. Das Herz pocht ihm bis hinauf in die Halsschlagader.
»Hoffentlich geht kein Alarm los«, sagt er sich. »Ich hasse diese Dinger.«
»Darum hat sich dein Einbrecher schon gekümmert«, erwidert seine innere Stimme.
Von dem kleinen Park rund ums Haus sieht man aufs Meer hinaus. Neben dem bohnenförmigen Swimmingpool duftet ein riesiger, wohl mit Heideerde verwöhnter Rhododendron.
De Palma leuchtet die Hausfassade an. Der Strahl fällt wie ein Blitz auf eine Scheibe im Erdgeschoss, als funkelten zwei Feueraugen los. Der Kommissar erschrickt. Wenn bei ihm Furcht aufkommt, bekämpft er sie in der Regel dadurch, dass er das Einmaleins aufsagt oder etwas Mitreißendes, Kriegerisches aus Verdis Troubadour summt.
Schrecklich strahlt des Feuers Glut …
Über der steinernen Freitreppe steht die zweiflügelige Haustür aus Metall und Glas halb offen. Rechts davon glänzt im Schein der Maglite ein Schild.
Dr. Fernand Delorme
Neurochirurg
Mitglied der Internationalen Gesellschaftfür Neurochirurgie
»Hm, originell, der bringt sein Schild innen an«, sagt de Palma laut, um sich über seine Einsamkeit hinwegzutäuschen.
»Früher war es draußen«, erwidert die innere Stimme.
»Woher weißt du das? Kanntest du Dr. Delorme etwa?«
»Einer der besten Epilepsiespezialisten. Eine weltweit anerkannte Koryphäe.«
Die Eingangshalle ist mit großen zinnoberroten Tonfliesen ausgelegt, die in der Mitte eine Rosette bilden. Zwei steinerne Treppen links und rechts laufen im ersten Stock vor einer Doppeltür zusammen. De Palma spannt den Pistolenhahn und öffnet einen der beiden Türflügel. Ein getäfeltes Vestibül führt zu einer von Bücherregalen eingerahmten Tür. Mit einem Taschentuch in der Hand drückt de Palma auf die Klinke. Drinnen tastet er nach dem Schalter, und Licht erfüllt den Raum. Der Tote liegt mit nach vorne gesackten Schultern in seinem Schreibtischsessel.
De Palma sah sich noch einmal das Buch von Freud an. Zufall oder Inszenierung? Der Verweis auf den Kannibalismus kam womöglich nicht von ungefähr. Mit ähnlichen Fällen hatte er schon zu tun gehabt, doch waren sie äußerst selten.
»Totem und Tabu«, murmelte er.
Er sann der Bedeutung der beiden Wörter nach. Bei dem einen kam ihm ein mythisches Wesen in den Sinn, ein schützender Geist, mit dem zweiten war ein absolutes Verbot gemeint. Etwas Heiliges.
»Wer das Tabu verletzt, wird mit dem Tod bestraft«, sagte die innere Stimme. »Das weißt du doch.«
»Ja. Es ist ein Mensch oder ein Tier, das man nicht berühren darf, da ihm große, gefährliche Macht innewohnt.«
Von irgendwoher klang grabeshaft ein Ton, eine hingehauchte Musik. Die Maske auf dem Gesicht des Toten hatte sich bewegt, die Figuren in der Vitrine sich verdüstert.
Da tönte wieder ein Pfeifen durch die Stille. De Palma lief es eiskalt den Rücken hinunter. Er hob die Pistole in Augenhöhe und ging langsam in die Richtung, in der er den Ton vermutete.
In einem weitläufigen Salon im linken Flügel des Hauses hingen die ockerfarben tapezierten Wände voller Masken jeglicher Größe, mit runden, großen, schwarzen Pupillen. Auf drei großen Gemälden waren von einem grauen Schleier vernebelte Gesichter abgebildet. De Palma legte die Lampe auf einem Regal ab und horchte lang in die Nacht. Nichts. Nur in der Ferne die an die Felsen schlagenden Wellen.
Auf einem kleinen Nussbaummöbel stand ein silbern gerahmtes Schwarzweißfoto: ein Schoner in voller Fahrt, die Focksegel gebläht wie lauter Bäuche.
Durch die Sträucher im Garten fuhr frühmorgendlicher Wind. An den Stamm einer großen Zeder hatte es Laub geweht. Es sah aus, als hätte jemand darin gewühlt. Als de Palma wieder gehen wollte, vernahm er wieder einen seltsamen Laut, nur ein paar Schritte hinter sich. Eine Art Atem, irgendwo hinter einem Möbel oder einer Zwischenwand. Eine Präsenz. Die schlafenden Figuren erwachten grimassierend.
Da konnte niemand sein. Er hatte das ganze Zimmer abgesucht. Niemand.
Das Blasen wurde deutlicher, wie der klagende Ton einer Panflöte. Von weiter oben schienen die piepsigen Laute zu kommen, aus einer höheren Etage.
De Palma stieg langsam die Treppe hinauf, mit dem Rücken stets zur Wand, den Revolver auf das Stockwerk darüber gerichtet. Der Flötenton wurde lauter. Eine urwüchsige Musik, dünn, klagend, monoton.
Oben links eine erste Tür. De Palma stieß sie krachend mit dem Fuß auf und leuchtete hinein. Der Flötenton brach ab. Auf einem langen Regal stand eine Sammlung mit altem Spielzeug, Porzellanpuppen mit bleichen Gesichtern und Blechautos in schreienden Farben. Ein Teddybär starrte mit seinen Glasaugen zur Decke empor.
»Bestimmt hat hier seit den dreißiger Jahren niemand mehr geschlafen«, sagte de Palma laut.
Da setzte die Melodie wieder ein, schneller diesmal, als keuchte der Spieler in ein langes Rohr. De Palma ging zur zweiten Tür und drückte langsam die Klinke. Sofort verstummte die Musik.
Er versuchte sich vorzustellen, wie draußen der Park verlief. Das Zimmer ging auf die große Zeder hinaus, deren Äste bis ans Fenster heranreichten.
Der letzte Ton war aus diesem Zimmer gekommen, da war er sich ganz sicher. Er riss die Tür auf. Das Zimmer war winzig klein und leer. Ein Fensterladen schlug bei jedem Windstoß an die Wand. Die Scheibe war zerbrochen, und auf dem Boden lagen Scherben. De Palma lief zum Fenster und beugte sich hinaus. Selbst ein außergewöhnlich geschmeidiger Mensch hätte nicht innerhalb so kurzer Zeit verschwinden können. Durch die Zedernäste hindurch waren die Inseln und die Lichter der Küste auszumachen.
Die Musik kam wieder von woanders her, diesmal von weiter unten, aus dem Salon, womöglich von dem Schreibtisch her, an dem der Tote lag.
»Das ist bloß der Wind, der bläst irgendwo im Haus in ein Rohr hinein«, posaunte de Palma, um sich Mut zu verschaffen.
Augenblicklich verstummte die Flöte, doch sie war immer noch spürbar, als verberge sie sich in irgendeiner Ecke des Hauses.
De Palma stürzte die Treppe hinunter, rannte durch den Garten und schwang sich in das Zivilfahrzeug der Kriminalpolizei. »Da muss glaube ich die Kavallerie ran«, keuchte er und machte das Licht im Wagen an.
Das Walkie-Talkie lag im Handschuhfach.
»Pétanque von Solex!«
Erst Stille, dann ein Krächzen.
»Solex bitte sprechen.«
»Michel de Palma, Kriminalpolizei …«
Draußen steuerte ein Schoner unter vollen Segeln auf das Tor der Welt zu. Der Kapitän fuhr hart am Wind, auf Steuerbordbug. Weiß schäumte es am Vordersteven. Ein junger Matrose war zur ersten Mars hinaufgeklettert und schwenkte zum Abschied seine Mütze, als widmete er seine Fahrt der gesamten Bucht.
2
Wie gehts, Baron?«, redete Jean-Louis Maistre seinen Freund beim Spitznamen an.
De Palmas Gesicht war bleich und verknautscht. »Wie es einem so geht, wenn man mitten in der Nacht eine Leiche findet.«
In dem fahlen Licht sah Maistre aus, als hätte er schon wieder zugenommen. Seine grauen Äuglein lachten aus noch feisteren Hamsterbacken heraus.
»Keine Verletzungsspuren. Ich denke, er ist am Kopf …«
»Das sehen wir dann schon«, unterbrach ihn der Baron.
»Ich habe mein Handy im Auto gelassen«, sagte Maistre und ging hinaus. De Palma blieb in dem Zimmer sitzen und ließ sich wahrscheinliche Erklärungen für diesen Mord durch den Kopf gehen. Das Freud-Zitat mochte sich auf einen früheren Patienten beziehen. Gut möglich, aber vielleicht zu einfach.
Maistre kam zurück und zog sich den baumelnden Gürtelholster hoch. »Wie war das noch mal mit dem Anruf?«
»Eine junge Stimme, ziemlich zittrig«, sagte de Palma und fischte sich eine Gitane heraus, die erste des Tages. »Vermutlich ein Junkie oder ein Alki. Die haben immer so ein Klirren in der Kehle. Womöglich ein Einbrecher, der in einem Anfall von Bürgersinn meinte, es wäre besser, seinen Fund zu melden.«
»Oder der die Schuld von sich abwälzen will …«
»Du nimmst immer nur das Schlechteste an.«
»Um diese Uhrzeit darf ich das.«
»Und warum ruft er gerade die Kripo an?«
»Das ist ein Ganove, also weiß er, dass wir weniger blöd sind als die anderen.«
»Dann müssen wir uns geschmeichelt fühlen.«
Merkwürdig auch die Inszenierung des Verbrechens. Welche Rolle spielte die Maske? In den Bücherregalen standen Prachtbände über papuanische Kunst. Dr. Delorme hatte offensichtlich Objekte aus Neuguinea gesammelt.
Irgendetwas stimmte nicht.
»Wie kommt es, dass bloß eine Figur fehlt?«, fragte Maistre.
»Genau. Warum nicht gleich alles?«
»Die Wege von Mördern sind unerforschlich.«
Ansonsten wenig Konkretes. Ein bläuliches Licht verbreitete sich im Raum. Die Sonne ging auf, und jenseits der Bucht zeichnete sich der gedrungene Gipfel des Marseilleveyre-Massivs ab. Maistre forderte die Spurensicherung an.
In den Regalen waren einige Bücher sichtlich umgestellt und die alphabetische Reihenfolge des Dr. Delorme mehrfach missachtet worden. In der untersten Reihe stand ein dicker lederner Oktavband heraus. De Palma schlug ihn auf. Die Seiten mit den vergilbten Rändern waren mit einer feinen, nervösen Schrift bedeckt. Die erste Seite war gedruckt:
Kapitän Fortuné Meyssonnier
Logbuch der Marie-Jeanne
Rahschoner, zweihundert Tonnen
Zu Anfang wurde die Marie-Jeanne beschrieben.
Unsere Marie-Jeanne ist ein großes Mädchen. Bei den fürchterlichsten Winden, die ich kenne, war sie vor Island zum Fischen unterwegs. Ein Reeder aus Paimpol hat sie erstanden und sie an M. Ballancourt weiterverkauft. Sie misst hundert Fuß zwischen den Loten und weist wie die meisten Schiffe ihrer Gattung nur ein Marssegel auf. Sie ist ein herrlicher Segler. Ihr Besitzer hat sie herausgeputzt. Mit ihrem weißroten Rumpf und den falschen Stückpforten sieht sie aus wie ein Kaperschiff.
Wir legen noch diese Woche ab, wenn alles gut geht. Gestern haben wir bei Windstärke 6 die gesamte Segelgarderobe ausprobiert. Selten habe ich einen so wendigen Segler gesehen wie unsere Marie-Jeanne. Vor Planier habe ich von drei Männern das Marssegel setzen lassen, was nicht länger als vier Minuten gedauert hat. Für die Manöver im Südpazifikwind verheißt das nur Gutes. Die Besatzung ist perfekt, lauter schneidige Burschen. Der Bootsmann war früher bei den Messageries Maritimes, so wie ich. Die lange Reise zu den Antipoden hat er schon einmal angetreten, ich kann mich auf ihn verlassen. Noch zwei Matrosen hat er angeheuert, Korsen wie er, die aus demselben Dorf des Cap Corse stammen.
Auf den Kais herrscht viel Betrieb. Lausbuben aus dem Viertel Saint-Laurent stibitzen Orangen, die beim Entladen auf den Boden purzeln. Es ist schon ziemlich heiß. Abends steigt dichter Dunst aus der Bucht empor und verhüllt die Jungfrau Maria der Notre-Dame de la Garde. Bei Sonnenuntergang sieht man kaum noch ihr güldenes Gewand, so glutrot färben sich die Wolken. Selbst die alten Gebäude am Kai und die Häuser, die sich am Hügel von Accoules staffeln, sehen dann ganz unwirklich aus …
De Palma schlug das Logbuch wieder zu, bückte sich vor das Regal und inspizierte die Staubspuren zwischen den Ledereinbänden. »Das Buch ist erst vor Kurzem herausgenommen worden«, sagte er, als Maistre den Raum betrat.
»Sicher?«
»Ganz sicher. Notier das bitte … Beweisstück Nummer 4.«
»Du denkst, das hat mit dem Mord etwas zu tun?«
»Ich denke, dass ich an keinen Zufall glaube.«
Maistre senkte den Blick. Er hatte einen galligen Geschmack im Mund. »Ich brauche jetzt einen Kaffee und ein Croissant«, sagte er.
»Weiter oben an der Corniche ist eine Bar, die früh aufmacht. Gehen wir da hin.«
»Zu spät. Der Chef.«
Der Leiter der Kripo, Kommissar Eric Legendre, stürmte herein, flankiert von Inspektor Bessour. »Tag, Michel.«
De Palma nickte den beiden zu. »Eine seltsame Inszenierung, Chef, sieh dir das mal an.«
Legendre atmete schwer. Durch sein zu enges Sakko wirkte der kleine Mann noch gedrungener. Karim Bessour war das genaue Gegenteil von ihm: Sprinterfigur, scharfes Profil, fiebriger Blick, abgewetzte Jeans, Sportanorak und an der rechten Hand ein Touareg-Ring. Geschmeidig trat er beiseite und ließ die Kollegen von der Spurensicherung durch, die eine Bahre dabeihatten.
»Du ziehst ja ein Gesicht, Chef«, sagte Maistre und schielte auf die rote Krawatte des Kommissars, die ganz schief über dem karierten Hemd hing. »Da steckt doch was dahinter? Hat sich etwa der Direktor schon gemeldet?«
»In der Tat. Man könnte meinen, der schläft nie. Und hat überall Ohren. Gerade hat er mich angerufen. Dieser Delorme war angeblich mit der halben Stadt befreundet und mit der anderen Hälfte verfeindet.«
»Wir wissen noch gar nicht, ob es überhaupt Delorme ist.«
»Meinetwegen, aber das ist nun mal sein Haus, und der Direktor hat ein Auge auf uns. Und dann hat er noch gemeint, dass wir erfolgsmäßig in letzter Zeit eher Scheiße am Arsch haben. Wortwörtlich hat er das gesagt.«
»Wie elegant!«
Legendre rückte sich den Krawattenknoten zurecht.
»Seit Anfang des Jahres kriegen wir aber auch lauter Mistfälle«, warf Bessour ein und fuhr mit der Spitze seiner Dreistreifenschuhe über den Boden.
Draußen manövrierte der Kombi der Spurensicherung hin und her, um einem Krankenwagen Platz zu machen. An den Fenstern erschienen die ersten Gesichter. Eine Frau mit schlaffer Miene beugte sich im Morgenmantel über ihre Balkonbrüstung.
»Nehmen wir ihm das Ding da ab«, sagte ein Mann von der Spurensicherung. »Kommt ihr mal?«
Zwei Kollegen stellten sich links und rechts von dem Toten auf und hoben vorsichtig die Maske an. Das Gesicht erschien, schadhafte Zähne im offenen Mund. In den Augen schien ein Restchen Leben zu flackern. Michel sah weg, als er auf der Stirn das winzige Loch genau zwischen den Augen erblickte.
»Durchschuss des Stirnbeins«, sagte der Experte trocken. »Höchstwahrscheinlich Kaliber .22. Da bleiben verlässliche Spuren im Schädel. Die Kugel ist drinnen steckengeblieben, normal bei Kaliber .22. Keine Pulverspuren.«
Maistre sah auf die Schwarzweißaufnahme in der Vitrine, die einen Mann in den Fünfzigern zeigte, hohe Stirn, spärliches Haar, durchdringender Blick hinter kleinen metallumrandeten Gläsern. Der Mund war zu einem leisen Lächeln verzogen. Kein Zweifel, bei dem Toten handelte es sich um Dr. Delorme.
De Palma nahm Maistre beiseite und sagte: »Mir war vorhin ganz unheimlich.«
»Unheimlich?«
»Ja, da war irgendwas in dem Haus. Als würde sich da … ein Geist herumtreiben.«
Maistres Augenbrauen zogen sich fragend zusammen.
»Alles in Ordnung mit dir, Michel?«
De Palma blickte sich um, ob nicht jemand zuhörte. »Hör zu, ich habe eine Flöte gehört, dann war sie weg … und auf einmal wieder da.«
»Jemand hat also Flöte gespielt, während du hier im Haus warst?«
»Ja. Ich habe überall gesucht, aber niemand gefunden.«
»So so.«
»Mach dich nicht lustig über mich. Ich weiß doch, was ich gehört habe.«
Maistre wagte seinem Freund nicht in die Augen zu blicken, aus Angst, ihn zu beleidigen, doch war das schon geschehen.
De Palma ging in den Garten hinaus. Ihm ging das Freud-Zitat durch den Kopf, das er soeben sichergestellt hatte. Es bezog sich auf den Ödipuskomplex und den Ursprung der Menschheit.
Ein Seewind kam auf.
Auf dem Parkplatz der Universitätsklinik Timone war kein Platz mehr frei. Das Gerichtsmedizinische Institut befand sich in einem entlegenen Flügel des Krankenhauses. De Palma fuhr einfach aufs Gras, und Maistre legte eine Visitenkarte des Innenministeriums aufs Armaturenbrett.
»Bringen wirs hinter uns!«
Die Leiche lag schon auf dem Stahltisch, nackt und skeletthaft dürr, mit angewinkelten Knien.
»Die Kugel ist nicht wieder ausgetreten«, sagte Dr. Mattei. »Wir finden sie wohl in guterhaltenem Zustand. Ich warte noch auf die Röntgenbilder.« Ganz fahl wirkte im Neonlicht des Obduktionsraums die graumelierte Mähne des Arztes, die er mit Gel immer diskret nach hinten frisierte. Seine feuchte gewölbte Stirn glänzte fast genauso wie die chirurgischen Instrumente auf dem Rolltisch aus rostfreiem Stahl.
»Jetzt sag doch mal, Doktor Tod«, fing de Palma an, »was du von diesem Loch da hältst. Mir kommt es wahnsinnig klein vor.«
Dr. Mattei fuhr mit dem latexbewehrten Zeigefinger über die kleine Öffnung. Das Blut war zu einer braunen Korolla geronnen. »Kaliber .22 vermutlich«, sagte er mit zugekniffenen Augen. »Es sei denn, es ist irgend so eine Kriegsmunition. So was Perverses, das in den Körper eindringt und sich drinnen dreht wie ein Kreisel. Das Einschussloch ist winzig klein, aber die Wunden furchtbar. Absolut tödlich.«
Von nebenan drang das Kreischen einer chirurgischen Säge herüber. Über seinem Wanst band sich Dr. Mattei den Schürzenknoten neu.
»Mit den Kindern alles in Ordnung, Jean-Louis?« Das hatte er so an sich, dass er mitten bei der Obduktion solche Fragen stellte.
»Die sind schon groß«, erwiderte Maistre gezwungen lächelnd. »Und aus dem Haus.«
»Tja, so kommt es eben. Ich habe gehört, dass sie was Anständiges studieren.«
Als Maistre gerade antworten wollte, ging die Flügeltür auf und ein hagerer Assistent, ovale Brille auf eckiger Nase, kam mit Röntgenbildern herein. »Ich kapier überhaupt nichts mehr!«, rief er aus. Mit seinen kralligen Händen hängte er die Bilder am Leuchtschirm auf. Vier Schädelaufnahmen, drei von vorne und eine im Profil. »Keine Kugel drin!«
»Was erzählst du da?«, rief Dr. Mattei aus und sah erstaunt die beiden Polizisten an.
Der Assistent zog kopfschüttelnd einen Filzstift aus dem Kittel und deutete damit auf das Einschussloch. »Kein Ausschussloch«, sagte er und deutete einen imaginären Schusskanal an. »Man sieht, dass der Frontallappen beschädigt wurde, und hier sind deutliche Spuren einer Hirnblutung.«
Stumm trat Dr. Mattei heran. Mit durchdringendem Blick wechselte er zwischen den Aufnahmen hin und her. »So was habe ich noch nie gesehen«, murmelte er.
An dem Profilbild blieb sein Blick schließlich hängen. »Was ist denn das da?«, rief er aus.
Der Assistent umkreiste mit dem Filzstift etwas, das wie eine vielleicht zehn Zentimeter lange, dünne Nadel aussah und sich in die Gehirnmasse gebohrt hatte. De Palma und Maistre sahen über die Schultern der beiden Gerichtsmediziner hinweg.
»Bah, wir machen einfach auf und sehen nach!«
Dr. Mattei zog den Rolltisch an die Leiche heran. »Ich nehme an, ihr wollt sofort Bescheid wissen, oder?«, sagte er zu den Polizisten.
»Äh, ja«, erwiderte de Palma.
Dr. Mattei setzte das Skalpell an und zog einen halbkreisförmigen Schnitt durch die Kopfhaut. Dann zog er sie ab und legte den nackten Schädel frei. Nun kam die Säge um Einsatz. De Palma wandte sich ab.
Nach einer Weile sah der Gerichtsmediziner wieder auf die Röntgenaufnahmen, mit sorgenvoller Stirn. Dann machte er weiter. Minutenlang hörte man nur das Klingen der Zangen, Messer und Scheren, die Dr. Mattei auf dem Rolltisch ablegte.
»Ich glaube, es ist ein Splitter«, sagte er auf einmal und legte eine dünne, blutige Nadel in eine stählerne Schale. Dann stellte er die Schale unter ein Mikroskop. De Palma und Maistre flankierten ihn. »Sieht aus wie Holz«, fuhr Mattei fort. Die Schweißperlen auf seiner Stirn liefen über seine Falten ab. Er blinzelte mehrfach, bevor er die Augen auf die Muscheln des Mikroskops legte.
»Tatsächlich, Holz«, murmelte er ein paar Sekunden später. »Ich würde sogar sagen, Bambus, oder so was in der Richtung.«
»Bambus!«, rief Maistre aus.
Dr. Mattei richtete sich mit zweifelnder Miene auf. »Das ist das einzige mir bekannte Holz, das so lange, dünne Splitter produziert. Aber ich kenne nicht alle Holzarten. Bei Weitem nicht.«
Der Assistent machte mehrere Aufnahmen von dem Splitter, zwei davon, nachdem er gereinigt war und schon die Holzfasern sichtbar wurden.
»Mal sehen, was er im Magen hat«, sagte Dr. Mattei. »Noch Fragen, die Herren?«
Maistre schüttelte den Kopf und steckte sein Notizbuch in die schwarzbraune Mappe. »Nein.«
Der Assistent bedeckte den Hinterkopf Dr. Delormes mit einem blauen Tuch. Dessen Gesicht, das feine Lächeln, die entspannte Haut, das alles wirkte auf einmal irreal.
Als de Palma und Maistre wieder auf dem Parkplatz waren, drangen Sonnenstrahlen durch die Wolken. Maistre dachte an seine Kinder. Das Leben ohne sie war nicht einfach. Er rief sie oft an, und jedes Mal spürte er, wie sie ihm weiter entglitten.
»Ich mach uns ein bisschen Musik an«, sagte der Baron.
»Aber bitte keine Oper.«
»Was willst du denn hören?«
»Du weißt schon.«
»Ich soll doch nicht etwa The Clash auflegen? Dann hören wir volle Dröhnung I Fought the Law und kurven dazu mit Blaulicht und Tatütata zwischen den Autos durch?«
»Warum nicht?«, fragte Maistre seufzend.
»Für einen Polizeibeamten gibt es nichts Besseres als Opern. Da kriegt der einsame Wolf ein bisschen Poesie ab. Wenn in der Grünen Minna Opernarien Pflicht wären, gäbe es bestimmt weniger Übergriffe.«
»Aber bloß keinen Wagner!«
»Vor allem nicht bei der Bereitschaftspolizei …«
Der Baron klappte die Sonnenblende mit der Aufschrift »Polizei« herunter und setzte das Blaulicht auf das Dach.
»Lass mich in der Avenue de la Capelette raus«, sagte de Palma. »Den Rest gehe ich zu Fuß.«
»Du willst heim?«
»Ja.«
»Dabei wollte ich dich zur Pastis-Zeremonie einladen.«
»Tut mir leid, du musst die Messe ohne mich abhalten. Ich werde versuchen, ein wenig zu schlafen.«
In der Avenue de la Capelette roch es nach Pfeffer. Bis hin zum Viertel Pont-de-Vivaux und zu den Schlafstädten von Saint-Loup am Fuß des Massif de l’Etoile quälte sich eine Autoschlange im Schritttempo dahin.
De Palma ging bewusst langsam, um dieses Viertel, in dem er seine Kindheit verbracht hatte, so richtig auf sich wirken zu lassen. Die Häuser hier waren niemals neu verputzt worden, und dieses Langsame, dieses Stehenbleiben der Zeit empfand er als beruhigend. Uralte, nie weggewischte Kreidemalereien: ein pfeildurchbohrtes Herz, Initialen dazu … Versprechen ewiger Liebe …
Hinter der Kirche Saint-Jean räumten Bagger die hohen Steinmauern weg, die das Areal mit den Werkstätten und Manufakturen umgaben: ein rechteckiges und trotz der Sonne düsteres Universum. In den Sechzigerjahren hatte Michel dort aus Lastwagen heruntergefallene Schwefelstückchen aufgesammelt und sie in der Schule in der Rue Laugier gegen Achate eingetauscht, klammheimlich stets, weil er überzeugt war, der Lehrer in seinem grauen Kittel habe bestimmt etwas gegen solche Machenschaften.
Die Tür zur Bäckerei-Konditorei Louis XV stand offen, sodass den Passanten der Duft warmen Brotes in die Nase stieg. Eva, die neue Verkäuferin, war eine Kindheitsfreundin des Barons, fünf Jahre jünger als er. Mit einer Kundin, auf deren braunem Dekolleté ein riesiger Seidenschmetterling prangte, redete sie gerade über Frisuren. Der Baron sog den Geruch von Mehl und Schokolade ein und fahndete dabei nach Bildern aus seiner Jugend.
»Na, Michel, wie gehts?«, fragte Eva.
»Gut, und dir?« Sie warf ihm einen schmeichelnden Blick zu und beugte sich zu einem Wangenkuss vor.
»Du arbeitest jetzt hier?«, fragte der Baron.
»Ja.« Sie stützte eine Hand auf die Hüfte. Das lange, von einem Bandana gebändigte kastanienbraune Haar verlieh ihrem Madonnengesicht etwas Rebellisches. Unter dem mehlbestäubten Mohairpullover zeichnete sich ein imposanter, fester Busen ab. Die Zeit schien Eva nichts anhaben zu können. Ein wenig zugenommen hatte sie. Das war alles.
»Ich lasse mich gerade scheiden, wie du vielleicht weißt.«
»Nein, das wusste ich nicht«, murmelte de Palma.
Das Grün ihrer sanften Augen hatte sie mit zwei dünnen schwarzen Linien hervorgehoben. »Und deshalb muss ich jetzt arbeiten.«
»Eine gute Nachricht!«
»Dass ich arbeite?«
»Nein, dass du wieder frei bist …«
Sie lachte schallend, wobei sich die Lippen über ihren kleinen Zähnen spannten. Von seinen mehr als einen Meter achtzig herab sah de Palma sie mit den Augen eines großen Bruders an.
An den mächtigen Stamm einer Platane gelehnt, steht er wartend vor dem Schultor. Unter seinen Füßen raschelt zusammengewehtes Laub. Um 17 Uhr klingt durch die stillen Straßen der lang gezogene, klagende Sirenenton der Chemiefabrik, und gleich darauf läutet hell die Schulglocke. Eva kommt als Letzte heraus, in einem rosafarbenen T-Shirt. Ihre Freundinnen kichern, als sie auf Michel zugeht. Die größte von ihnen entblößt beim Kaugummikauen ihre Vorderzähne.
»Hast du auf mich gewartet?«, fragt Eva mit dünnem Stimmchen.
»Ja, ich bin wegen dir da. Freut dich das?«
Sie antwortet nicht. Er bietet ihr eine Zigarette an, doch sie will keine. Seine Gesten wirken linkisch. Er weiß, dass er den Mädchen gefällt, verbirgt aber seine Schüchternheit hinter den langen Haaren, mit denen er wie Jim Morrison aussehen will.
»Komm. Das nervt mich, dass meine Freundinnen uns hier anstarren.«
De Palma nimmt sie bei der Hand, zum ersten Mal. Ihre schmalen, manikürten Finger fühlen sich ganz ungewohnt an. Sie gehen auf die Huveaune zu, einen kleinen Fluss, eigentlich mehr ein Bächlein, das mitten auf dem Prado-Strand ins Mittelmeer mündet. In einer Sackgasse rosten gestohlene Autos vor sich hin. Direkt am Wasser hat sich ein Bänkchen halten können.
»Gehen wir woanders hin«, sagt Michel.
Er will sie nicht in dieser Ruinenlandschaft küssen. Evas Hand ist ganz feucht. »Wohin?«
»In den Klostergarten. Ich weiß da einen Geheimgang.«
Eva ist entzückt.
»Träumst du, Michel?«
»Nein, ich habe nur an alte Bilder zurückgedacht.«
»Was für welche?«
»Das kann ich dir nicht sagen.«
Sie schürzte ihre vollen Lippen zur Schnute, als wollte sie sagen »Ich kann mirs schon denken«.
»Was darfs für dich sein?«
»Ich nehme zwei Scheiben Pizza und eine Fougasse mit Sardellen.«
Sie hatte noch immer ihren lieblichen Charme. Durch ihr längliches Gesicht zogen sich ein paar Falten, und an den Winkeln ihrer glitzernden Augen hatte sie Krähenfüße.
»Wie läuft deine Scheidung?«, fragte er und griff nach dem Geldbeutel.
»Ach, wir sind zwei erwachsene Menschen«, erwiderte sie müde.
»Das meint man so.«
»Du bist auch geschieden, oder?«
»Ja.«
Sie blickten sich an und wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. Die Scheidung hatte in seinem Leben ein Erdbeben ausgelöst, dessen Druckwellen noch nicht verebbt waren. Gegenüber dieser Frau, die sich ihrer Schönheit noch immer gewiss war, fühlte er sich unbeholfen.
»Bis bald, Michel.«
»Bis bald, Eva.«
3
Eines Tages brachte eine Frau zwei prächtige Adler zur Welt. Die beiden Herren der Lüfte wuchsen unter der Obhut ihrer Mutter auf, und als sie stark genug waren, begannen sie Familienmitglieder anzugreifen, dann Bekannte und schließlich Leute aus dem ganzen Dorf. Überall richteten sie Unheil an und zerstörten die Harmonie einer friedlichen Gesellschaft. Manchmal töteten sie ihre Opfer und fraßen sie auf.
Ihre Mutter musste ihnen beibringen, das Leben ihrer Mitmenschen zu achten. Sie entzog ihnen alles, was eine Mutter ihren Kindern geben muss. Als das nicht genügte, befahl sie ihnen, benachbarte Dörfer anzugreifen und die Köpfe der Besiegten als Trophäen heimzubringen.
Da hörten die Adler damit auf, ihre Angehörigen zu töten, und so entstand die Tradition der Kopfjagd.
Gründungsmythos der Kopfjagd beim Volk der Iatmul in Papua-Neuguinea
Der Mann betrat den Auktionsraum im letzten Moment, mit einem zusammengerollten Katalog in der Hand. Die Luft vibrierte geradezu von der Spannung, die sich seit dem Morgen angestaut hatte. Kein Stimmengewirr, kein Lärm, nur das Knarren des Parketts und der hohen Wandtäfelung. Scharfe Blicke, die sich nicht zu begegnen wagten, diskretes Getuschel. Dem Mann war nicht wohl in seiner Haut. Er fühlte sich eingeengt und hatte Angst, erkannt zu werden.
Dabei hätte es schon mit dem Teufel zugehen müssen, damit der Kerl, wegen dem er gekommen war, ihn identifiziert hätte. So viele Jahre waren vergangen. Der Hass des Mannes hatte nicht nachgelassen, sein Äußeres jedoch war verändert. Man kann aber nicht vorsichtig genug sein, sagte er sich und rückte auf der schweißnassen Nase die Brille zurecht.
Es war wohl bloß ein dummer Gedanke, aber irgendwie hatte er das Gefühl, inmitten dieser Kunstkenner unangenehm aufzufallen. Es waren vor allem Männer reiferen Alters, vergeistigte Frauen und verschlagen lächelnde Kommissionäre. Aus dem Einerlei der dunklen Anzüge samt Krawatten stachen einige wenige mit betontem Künstlerlook heraus.
Der Mann machte den Kerl, den er suchte, in der zweiten Reihe aus. Er trug eine ungebändigte graue Mähne und ein Armband von den Trobriand-Inseln. Mehrfach murmelte der Mann den Namen des Kerls vor sich hin: Grégory Voirnec. Seit sie sich zuletzt begegnet waren, hatte er sich nicht schlecht gehalten. Das Kinn war etwas schlaffer, die Falten auf der Stirn tiefer. Der klare, fast naive Blick dagegen war unverändert.
»Artikelnummer 8718. Ein Trophäenschädel aus der Privatsammlung Monteil.«