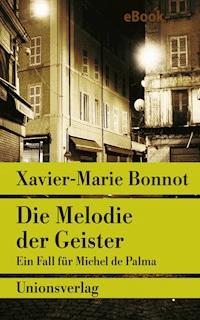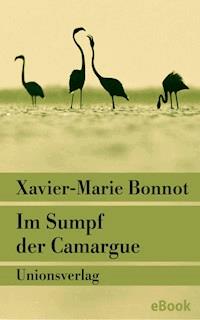
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Marseiller Polizeikommandant Michel de Palma müsste sich eigentlich von seinen Verletzungen erholen, die er sich im letzten Fall zugezogen hat. Ingrid Steinert, Ehefrau des milliardenschweren deutschen Industriellen William Steinert, braucht aber seine Hilfe: Ihr Mann ist seit einigen Tagen verschwunden. Obwohl am Anfang nicht besonders interessiert, weckt der Fall doch de Palmas Neugier, als die Leiche von Steinert in den schlammigen Sümpfen der Camargue gefunden wird. Die Polizei meint, die Lösung schnell zu kennen: ertrunken, ein Unfall. Dann überschlagen sich die Geschehnisse, als immer mehr Leichen auftauchen, alle auf bestialische Weise verstümmelt. Ist die Tarasque, das Ungeheuer aus den Sümpfen, mehr als ein Mythos?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Marseiller Polizeikommandant Michel de Palma wird von Ingrid Steinert um Hilfe gebeten: Ihr Ehemann, ein milliardenschwerer Industrieller, ist verschwunden. Kurz darauf wird seine Leiche in den schlammigen Sümpfen der Camargue gefunden. Und es bleibt nicht die einzige Leiche. Ist die Tarasque, das Ungeheuer aus den Sümpfen, mehr als ein Mythos?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Xavier-Marie Bonnot (*1962 in Marseille) studierte Soziologie, französische Literatur und Geschichte. Nach Tätigkeiten als Regisseur veröffentlichte er 2002 den ersten Kriminalroman um den Polizeikommandanten Michel de Palma. Die Reihe wurde mehrfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Xavier-Marie Bonnot.
Tobias Scheffel (*1964) studierte Romanistik, Geschichte und Geografie in Tübingen, Tours (Frankreich) und Freiburg. Seit 1992 arbeitet er als literarischer Übersetzer aus dem Französischen. 2011 wurde er für sein Gesamtwerk mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises ausgezeichnet.
Zur Webseite von Tobias Scheffel.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Xavier-Marie Bonnot
Im Sumpf der Camargue
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel
Ein Fall für Michel de Palma
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel La bête du marais im Verlag L’Écailler du Sud, Marseille.
Originaltitel: La bête du marais
© by Xavier Marie-Bonnot 2004
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Konrad Wothe/LOOK-foto
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30939-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 01:54h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
IM SUMPF DER CAMARGUE
Vorbemerkung1 – Am Vorabend, kurz nach Einbruch der Nacht …2 – In der städtischen Oper von Marsiho, wie jeder …3 – Die Naturschutzstation La Capelière bestand aus zwei nebeneinanderstehenden …4 – Montag, 7. Juli5 – De Palma sah sie, als er am Denkmal …6 – Am Freitag, 11. Juli, um 5 Uhr 30 …7 – Um sechs Uhr morgens verließ Christophe Texeira sein …8 – Milliardärsleiche in einem Sumpf der Camargue gefunden9 – Der Tag war stickig gewesen. Erst am Spätnachmittag …10 – William Steinert wurde früh am Morgen begraben11 – Als de Palma seinen Alfa neben einem schlammverschmierten …12 – Am Dienstagmorgen war der Ballistikraum leer. De Palma …13 – Jenseits der Dunkelheit erhoben sich Stimmen, Christian Rey …14 – Tarascon erwartete den Tag der heiligen Marthe …15 – Dienstag, 29. Juli. 10 Uhr morgens16 – In der Nacht hatte es zu regnen begonnen …17 – De Palma massierte sich lange die Schläfen …18 – Oberhalb des Mas de la Balme nähten die …19 – Maistres Nachforschungen über das weitere Schicksal der SIG …20 – Lamastre war seit fünf Jahren Chef der Regionalverwaltung …21 – Die Temperatur war deutlich gesunken, die feuchte Hitze …22 – Um 11 Uhr 45 trat Marceau aus seinem …23 – Anne wäre beinah von der Straße abgekommen …24 – Anne legte die Kopfhörer weg und trommelte auf …25 – Ingrid stand im Schatten der Glyzinie, die zwischen …26 – Seit einer ganzen Weile nahm die Schwüle immer …27 – Chandeler spürte, wie eine knochige Hand ihn heftig …28 – Die Schule Saint-Joseph war eine private Sekundarschule …29 – Es war ein Artikel auf der Titelseite von …DankMehr über dieses Buch
Über Xavier-Marie Bonnot
Über Tobias Scheffel
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Xavier-Marie Bonnot
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Natur
Für meinen Vater, der mir, als ich sein kleiner Junge war, als Erster die Geschichte von der Tarasque erzählte
Vorbemerkung
Die Figuren und Ereignisse dieses Romans sind Produkte meiner Fantasie, sie haben keinerlei Vorbild in der Wirklichkeit.
Bei einigen Passagen werden Kenner der Provence genau wie auch die Beamten der Mordkommission von Marseille sicherlich schmunzeln. Ich habe willentlich Orte vertauscht, Forschungseinheiten umstrukturiert, Krankenhäuser verlagert, Hierarchien erschüttert und die Büros der Mordkommission verändert. Und mir bei einigen Vorgehensweisen große Freiheiten erlaubt.
Ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen …
… Alabre
De sang uman e de cadabre,
Dins nòsti bos e nòsti vabre
Un moustren, un fléu di diéu, barruolo … Agués pieta!
La bèsti a la co d’un coulobre,
A d’iue mai rouge qu’un cinobre;
Sus l’esquino a d’escaumo e d’àsti que fan pòu!
D’un gros lioun porto lou mourre
E sieìs pèd d’ome pèr miés courre;
Dins sa cafourno, souto un mourre
Que domino lou Rose, emporto ço que pòu.
Frederic Mistral, Mirèio
… Begierig
Nach menschlichem Blut und Leichen
Durchzieht unsere Wälder und Schluchten
Ein Ungeheuer, eine Geißel Gottes … Habt Erbarmen!
Das Untier hat vom Drachen den Schweif
Und Augen, roter als Zinnober
Schuppen auf dem Rücken und furchterregende Stachel!
Von einem großen Löwen hat es das Maul
Und sechs Menschenfüße, um schneller zu rennen
Was es nur kann nimmt es mit in seine Höhle
Unter einem Felsen, der die Rhone überragt.
Frédéric Mistral, Mireille
1
Am Vorabend, kurz nach Einbruch der Nacht, hatte der Mistral sich plötzlich gelegt. Und es begann der Rausch, der Bars zu diesem Anlass in Bodegas voller aufgekratzter Musik, glänzender Gesichter, schlafloser Blicke verwandelt.
Die Polizeistreifen, cool, im zweiten Gang, ziemlich gelangweilt. Ein paar Prügeleien unter Zigeunern, Maghrebinern zweiter Generation und einflussreichen Typen des Rathauses vor den bunten Karussells; die Bullen hatten die Augen davor verschlossen, bloß keine Auseinandersetzung mit der Stadtverwaltung.
Bevor die Sonne aufging, waren in den entlegenen Ecken, den toten Winkeln der Stadt letzte Kracher explodiert; die letzten Raketen eines Festes, das in Erschöpfung endete.
An diesem Morgen troff flüssige Hitze vom Himmel. Der Mann hatte sich auf die Böschung gelegt, zusammengekrümmt, mit angezogenen Beinen, die Knie an den Ellbogen. Er öffnete die Augen und entdeckte durch die zitternden Lider über sich die wuchtigen weißen Schlosstürme, die im gesättigten Licht verschwammen.
Der Mann war schweißüberströmt, sein rabenschwarzes Haar klebte ihm wie Pappstreifen an der Stirn. Ferne Geräusche drangen undeutlich zu ihm: Sicherlich die letzten Festbesucher, die mit Müh und Not nach Hause zurückkehrten. Aber ein paar Augenblicke später wusste er es besser: Es waren die Wutschreie einer fanatischen Menge, die die Luft erfüllten und an den Mauern der Festung widerhallten.
Der Schwindel ließ ihn schwanken, er schloss die Augen wieder.
Drei Tage hatte der Mann jetzt nicht geschlafen. Drei Tage als Einzelgänger. Der Geschmack bitterer Galle ließ ihn Lippen und Nase verziehen. Der irr machende Pastis hatte sein Werk vollendet, der Mann musste auftauchen.
Er richtete sich auf. Ruhig floss die Rhone vor ihm dahin. Ein paar wie Ungeheuer gekrümmte Wurzeln bohrten sich in die friedliche Wasseroberfläche, wie um den Lauf des königlichen Stroms aufzuhalten. Er versuchte, sich zu erheben, begriff aber, dass seine Beine ihn erst nach einer Weile tragen würden. Er streckte sich im warmen, knisternden Gras aus, dann starrte er zu den mächtigen Zweigen der Akazie über ihm empor, die den Himmel bekritzelten.
Er musste nachdenken, die drei letzten Tage rekapitulieren.
Am ersten Tag hatte er sich, kaum war die Sonne über der Camargue aufgegangen, wie ein Krokodil in die Quellerpflanzen der Salzsteppe gelegt und nur wenige Meter vom Sumpf des Etang Redon entfernt stundenlang nach Löfflern Ausschau gehalten.
Er erwartete sie schon seit Monaten, seit März, als Tausende von Meeräschen sich in den ruhigen Wassern des Deltas sammelten, ein paar Flossenschläge von den kahlen, noch klammen Stränden entfernt, und Kormorane und Reiher sich ein Festmahl erster Güte aus diesen Oberflächenfischen bereiteten.
Seit Langem hatte er die Gewohnheiten der Löffler erforscht, die Orte, an denen sie sich bei ihrer Rückkehr aus Afrika niederlassen, häufig am Rand von Tamariskenwäldchen. Er wollte sie im goldenen Licht des frühen Morgens beobachten, aber die Löffler sind ebenso launische wie seltene Vögel. Dieses Jahr hatte er sich mit dem Beutetanz der Kormorane und Reiher begnügen müssen.
Und an diesem Morgen hatten die großen Vögel sich noch immer nicht eingestellt. Er hatte gewartet, bis die Sonne im Zenit stand, und schließlich beschlossen, den Ort zu wechseln.
Er war weiter westlich durch das Naturschutzgebiet La Capelière gezogen. Dort hatte er ein paar Worte mit dem Leiter des Parks gewechselt. Banalitäten, nichts weiter.
Am Nachmittag war er lange umhergestreift, den schussbereiten Apparat in einer Hand, das Fernglas in der anderen, und hatte nur ein paar Pausen zum Beobachten eingelegt.
Er hatte seinen Marsch fortgesetzt, bis das Land endete. Makellos weiß war ein erster Löffler aufgetaucht, hatte seinen anmutigen Hals durch das Schilfrohr am Rand des Sumpfs gestreckt. Ein zweiter hatte sich auf dem Rücken eines halb versunkenen Baumstamms inmitten der schwarzen Wasser niedergelassen. Die an manchen Stellen von feinen Rissen durchzogene, an anderen Stellen schwammige Erde verlor sich in der untergehenden Sonne, dem flachen Horizont und dem vom Mistral entfesselten Meer.
Die Löffler waren zu ihrem Geheimnis zurückgekehrt, und die Nacht hatte sich über dieses Ende der Camargue gesenkt. In der Ferne, jenseits der geraden Linien des Sumpfs, hatten die Schlote des großen Erdölhafens von Fos-sur-Mer wie stolze Fackeln ihre roten Flammen in den Himmel gereckt. Um ein Uhr morgens war er wieder zu seinem Wagen gegangen und nach Hause gefahren, weiter oben in der Provence.
Der zweite Tag war der Tag des Tiers.
Er hatte beschlossen, nicht das Auto zu nehmen, sondern zu trampen. Nicht länger als eine Stunde hatte er auf die gute Seele warten müssen, die ihn am Ortsausgang von Tarascon mitgenommen hatte; ein Tourist, ein in der bösartigen Sonne gebratener Engländer, der ihm in perfektem Französisch erklärte: »Ich wohne seit drei Jahren in Mouriès.«
»Ah ja«, hatte der Mann erwidert und getan, als interessiere er sich für seinen Fahrer. »Ich komme aus Eygalières.«
»Heute fahre ich nach Marseille … For the boat. Ich nehme das Boot. Um nach Korsika zu fahren«, hatte der Engländer weitererzählt und dabei mit der Hand, die durch die heiße Luft fuhr, ein imaginäres Meer angedeutet.
»Da machen Sie eine schöne Reise!«, hatte der Mann bemerkt, um irgendetwas zu sagen.
Der Landrover des Engländers, ein altes Modell, so bequem wie eine Schulbank, hatte einen Höllenlärm gemacht. Kurz nach der Abzweigung nach Mas-Thibert war der Mann aus seiner Lethargie erwacht und hatte mit dem Finger auf einen Parkplatz entlang der unendlichen geraden Linie der N 568 gezeigt, die Arles mit Martigues verbindet. »Sie können mich da rauslassen.«
Der Engländer hatte unvermittelt gebremst, ohne Fragen zu stellen. Der Mann war ausgestiegen und hatte gewartet, bis der Landrover außer Sichtweite war. Dann war er rasch hinter einer Schilfrohrbarriere verschwunden, behindert durch die langen, rasiermesserscharfen Blätter. Wie ein Buschjäger war er geradeaus marschiert und hatte die gewaltige, flache, mit mageren Gräsern bestandene und von Stacheldraht unterteilte Ebene durchquert. Eine Stunde Fußmarsch, vielleicht etwas mehr, während sich hinter ihm, am Ende der Weiden, der dunkle Kamm der Alpilles mit ihrem höchsten Gipfel, der Tour des Opies, in den letzten Sonnenstrahlen weiß färbte. In der Nähe der Zypressen-Schildwachen hatte er in der Ferne die Schafe des Mas de Méril entdeckt; ohne zu zögern war er über einen Zaun gesprungen und hatte sich inmitten junger Stiere befunden, sicherlich der Herde der Manade-Castaldi-Zucht. Der Mann war zügig weitergegangen, wobei er sich nahe genug der pechschwarzen Jungstiere hielt, um von einem möglichen Schaulustigen nicht gesehen zu werden, und fern genug, um sie nicht zu erschrecken. Zwei Mal hatte er den leeren Blick der Tiere kreuzen müssen. Aber der Mann war ein perfekter Tierkenner.
Der Tag neigte sich, als er die D 35 erreicht hatte, die die östliche Grenze des Naturparks Le Vigueirat markiert, ein paar Kilometer von Mas-Thibert entfernt. Abends hatte er beschlossen, die Nacht auf dieser Zunge der Camargue zu verbringen. Das Ende des Tages hatte im Licht einer Unmenge von Sternen geschimmert, die über der Provence aufgingen. Bevor es dunkel wurde, war der Mann zum Strand zurückgekehrt und die rostrote Salzsteppe hinaufgegangen, ohne von irgendjemandem bemerkt zu werden. Wie immer hatte er bäuchlings im Rosa der Levkojen, dem Weiß der Sandkamille und dem Gelb der Immortellen abgewartet.
Dann hatte er gesungen. Das Tier war gekommen. Er hatte ihm von den Herrlichkeiten des Festes erzählt, bevor er sich zurückzog.
Als es über Meer und Erde dunkel geworden war, hatte er seinen Schlafsack in einer weichen, vor dem Wind geschützten Mulde der Düne ausgebreitet. Er hatte ein paar Stunden geschlafen. In der Trägheit des Schlafs hatte der Mann den irrsten seiner Träume gehegt: das Tier am Abend der heiligen Marthe freizulassen.
Am Abend des 29. Juli.
Er würde mit dem Meister darüber sprechen. Aber dessen Rat war ihm sowieso egal: Das Tier gehorchte allein ihm.
Die Rhone floss weiter dahin, träge geworden durch die Regenfälle des späten Frühlings. Unter den Mauern des Schlosses von König René kletterten Kinder auf einem kleinen Felsvorsprung oberhalb der grünen Wasser des Stroms herum und klammerten sich an die Efeuwurzeln, die sich die Felsen entlangschlängelten.
Der Mann war wieder völlig zur Besinnung gekommen. Er erhob sich, legte sich die Jacke über die Schulter und wandte sich der Richtung zu, von der das Geschrei der Menge kam.
Es war Montag, der 30. Juni. Der dritte Tag.
Das letzte Stierrennen war gerade beendet, und mit ihm das überbordende Fest der Tarasque.
2
In der städtischen Oper von Marsiho, wie jeder Provenzale seine Stadt nannte, klingelte es zur Vorstellung, und das zarte Rrring, Rrring verbreitete sich über die Treppenaufgänge von den obersten Rängen bis in den marmornen Ehrensaal. Es verstummte just in dem Moment, als Michel de Palma in das Reyer-Foyer stürzte. Félix Merlino, der Methusalem der Garderoben, strich die letzten Strähnen lockiger Haare glatt, die seinen glänzenden Schädel schmückten.
»Oh, Michel, wir warten nur noch auf dich!« Merlino verzog das Gesicht zu einem Grinsen, das sein mächtiges Kinn anhob und die weißen Lippen herunterfallen ließ.
»Salut, Féli, hats schon angefangen?«
»Allerdings! Es geht los! Die letzte Vorstellung für diese Spielzeit. Los, Herr Baron, Beeilung …«
Der Baron. So lautete der Spitzname von Kommissar Michel de Palma. Die Idee stammte von Jean-Louis Maistre, dem mehr als Bruder von der Mordkommission, dem Unzertrennlichen vom Quai des Orfèvres, der an einem alkoholreichen Abend in Blödellaune angefangen hatte, ihn so zu nennen; er fand, das passe gut zu dem Adelsprädikat seines Namens, seiner hochaufgeschossenen Gestalt und seinen Umgangsformen eines traurigen Lehnsherrn.
Der Baron stieß die gepolsterten Flügeltüren zum Rang auf, hielt kurz inne und ließ den Blick über das Publikum schweifen, wie er es immer tat, seit sein Vater ihn als kleiner Junge zum ersten Mal ins große Theater geführt hatte. Der in Samt gehüllte Zuschauerraum war brechend voll, von den ersten Reihen im Parkett bis zur Galerie. In der Luft lag der Geruch von säuerlichem Atem, Moschusparfum und Schminke. Vom Orchestergraben stieg eine unmögliche Kakofonie herauf: Triller, Tonleitern, Melodiebögen, die sich ineinander verfingen wie wahnsinnig gewordene Achtelnoten. De Palma entdeckte Anne Moracchini, Inspektorin bei der Mordkommission; sie nickte ihm unauffällig zu: Er hatte sich um mindestens eine Stunde verspätet. In über zehn Jahren, die sie nun gemeinsam bei der Kripo ackerten, hatte er sie zum ersten Mal in die Oper eingeladen, und zwar in allerletzter Minute: Es war die letzte Vorstellung von La Bohème in dieser Spielzeit.
Schließlich setzte er sich in völliger Dunkelheit neben Anne Moracchini. Die ersten Minuten verstrichen. Anne schien vollständig in die Musik versunken, die das Theater erfüllte. Plötzlich verstummte der Alte auf der Galerie, der seit Jahren regelmäßig zu Beginn jeder Vorstellung hustete. Der Saal war wie elektrisiert, und es herrschte absolute Stille.
Rodolphe trat an die Rampe.
Che gelida manina
Se la lasci riscaldar
Cercar che giova? Al buio non si trova.
Anstatt Mimi anzusehen, wandte Rodolphe kein Auge vom Dirigenten und streckte sich jedes Mal, wenn er sich über die Mittellage erhob und sein Zwerchfell malträtierte, auf die Zehenspitzen.
Chi son? Sono un poeta.
Che cosa faccio? Scrivo …
Alles in allem stellte Rodolphe sich für die Ansprüche eines Spielzeitende-Publikums nicht allzu schlecht an. Doch de Palma war enttäuscht und nutzte den Applaus, um sich aus dem Zuschauerraum zu stehlen. Im Reyer-Foyer ging Félix Merlino auf und ab, langsam und vorsichtig, um das Parkett nicht knarzen zu lassen.
De Palma schaltete sein Handy ein: Er hatte zwei Nachrichten, beide von heute, Samstag, dem 5. Juli. Die erste war um 19 Uhr 58 aufgezeichnet worden, unmittelbar bevor er die Oper betreten hatte, die zweite um 20 Uhr 37, sicherlich zu dem Zeitpunkt, als Rodolphe sich in seiner Bruchbude auf Montmartre gerade die Seele aus dem Leib sang.
»Guten Tag, Monsieur de Palma. Hier ist Rechtsanwalt Chandeler. Die Person, die mir Ihre Handynummer gegeben hat, möchte lieber ungenannt bleiben, aber ich erlaube mir, Sie anzurufen. Wir kennen uns nicht, dennoch möchte ich Sie dringend treffen, um etwas mit Ihnen zu besprechen … Am liebsten so früh wie möglich, wenn Sie das nicht stört; zum Beispiel Montag, den 6. Bis bald, hoffe ich.«
Es war eine Männerstimme, die leicht die Nasalkonsonanten sang und dunkel und sanft zugleich war. Die zweite Nachricht stammte erneut von Rechtsanwalt Chandeler. Er hinterließ eine weitere Handynummer und bat inständig, sie niemandem weiterzugeben.
Félix Merlino näherte sich dem Baron und deutete mit dem Zeigefinger auf das Telefon. »Mach mir sofort dieses Drecksding aus. Wenn ich dein Unglücksgerät jemals klingeln höre …«
»Keine Angst, Féli, bei deren Ziegengemecker heute Abend ist das kein großes Risiko.«
»Du hättest zu der anderen Besetzung kommen sollen. Da hättest du was erlebt …«
»Tja! Die heute klingen eher, wie wenn der Mistral bei meiner Ex-Schwiegermutter durch die Klappläden pfeift.«
»Ha, natürlich! Heute Abend ist es eine Katastrophe.«
»Aber sie applaudieren …«
»Die applaudieren heutzutage bei allem. Es ist nicht mehr wie früher … Erinnerst du dich?«
De Palma hob den Blick zur Decke des Foyers und machte eine wegwerfende Handbewegung wie zum Zeichen der Zustimmung zu Merlinos Verklärung. »Wenn es so schlecht war wie heute Abend, haben sie manchmal sogar die Polizei rufen müssen, um sie zu beruhigen!«
Félix Merlino nickte und fegte ein Stückchen Spitze, das von einem Abendkleid abgerissen worden sein musste, mit dem Fuß beiseite. »Man hat dich ja lange nicht mehr gesehen, Michel. Letztes Mal habe ich mich mit Jean-Yves unterhalten, dem Pianisten, dem Repetitor, du kennst ihn, und er hat sich nach dir erkundigt …«
»Weißt du, dass ich einen schweren Unfall hatte?«
»Ich habs in der Zeitung gelesen. Aber jetzt scheint es ja zu gehen.«
De Palma antwortete nicht, er ließ den Blick über das Quadratmuster des Parketts schweifen. Durch die gepolsterte Tür drang gedämpft Applaus aus dem Zuschauerraum; Félix näherte sich andächtig den lackierten Türen des ersten Rangs und öffnete sie mit den Gesten eines Kirchendieners, der das Portal einer Kathedrale aufstößt.
Anne Moracchini klopfte Michel auf die Schulter. »Wirklich geglückt, dieser gemeinsame Opernabend, mein Lieber!«
»Tut mir leid, Anne, ich hab einen Parkplatz gesucht …«
Sie sah auf sein Handy und verzog die Mundwinkel.
Inspektorin Moracchini von der Mordkommission trug einen gerade geschnittenen schwarzen Rock, der oberhalb der Knie endete, und ein purpurrotes Seidentop, auf das ihr schwarzes Haar fiel. Hauchdünne Strümpfe hüllten ihre Beine ein, wie luxuriöse Schleier zogen sie sich in einer sanften, harmonischen Kurve von ihren zierlichen Fesseln zu den Knien. Als de Palma ihre Wange streifte, erkannte er die pfefferigen Noten ihres Parfums, es war Gicky.
»Du bist vor dem Ende rausgegangen! Hats dir nicht gefallen? Ich fand es gut«, sagte sie und legte ihm die Hand auf den Unterarm.
Er wollte sie nicht gleich bei ihrem ersten Opernabend enttäuschen und sagen, was er von den Sängern hielt. »Es war nicht schlecht«, erwiderte er und blinzelte Merlino zu.
Noch nie hatte er sie so schön und so elegant gesehen. Gewöhnlich trug Anne Turnschuhe oder Straßenschuhe mit flachen Absätzen, Jeans und eine Fliegerjacke über einem T-Shirt oder einem Pulli, je nach Jahreszeit, mal abgesehen von der Dienstwaffe, die sie weit oben in der Rückenwölbung trug, damit sie möglichst gut versteckt war.
»Komm, trinken wir was«, sagte de Palma schließlich, um nicht völlig in Bewunderung zu versinken. Er bestellte zwei Glas Champagner, und sie gingen in das große Foyer zurück.
»Es ist herrlich hier! Alles Art déco. Was ist das für ein Deckengemälde?«
»Ein Werk von Augustin Carrera: Orpheus verzaubert die Welt …«
»Manchmal frage ich mich, was du bei den Bullen machst«, bemerkte sie und zwinkerte ihm zu.
»Ich mich auch. Aber ich habe gute Gründe.«
»Das hoffe ich doch.«
Anne Moracchini ließ den Blick über das gewaltige Deckengemälde von Carrera schweifen, dann betrachtete sie die Einzelheiten der schmiedeeisernen Brüstungen und der blattgoldverzierten Masken an den Rängen. Das Handy des Barons klingelte.
»Änder mal den Klingelton, Michel, du machst dich ja lächerlich!«
»Monsieur de Palma?«
Er erkannte die Stimme sofort. »Ja. Einen Augenblick bitte.«
Der Baron setzte sich etwas abseits auf eine dunkelrote Bank.
»Yves Chandeler am Apparat. Ich bin Anwalt.«
Michel schwieg kurz, um ihn einzuschüchtern. »Guten Tag.«
»Haben … ähm… Sie haben meine Nachricht erhalten?«
»Ja, absolut.«
»Ich hoffe, ich störe Sie nicht?«
Die Art, wie der Anrufer jeden auch nur halbwegs offenen Vokal dehnte, der ihm beim Reden unterkam, war de Palma unsympathisch. Sie klang nach einer in den besten Schulen von Marseille verbrachten Kindheit, in einer Gesellschaft, von der der Bulle nicht das Geringste wusste und die er tendenziell verachtete.
Wieder schwieg er einen Augenblick.
»Nicht im Geringsten.«
»Ich fasse mich sehr kurz. Wann können wir uns sehen?«
Michel wollte ihm sagen, dass man ihm nur selten Fragen in Form kaum verhüllter Befehle stellte, dass er nicht verstand, wieso er angerufen wurde, und dass er ganz offen keine Lust hatte, wen immer auch zu treffen, von Anne Moracchini mal abgesehen, aber er begnügte sich damit, mechanisch zu antworten.
»Hören Sie, Montag gegen 16 Uhr in Ihrer Kanzlei, passt Ihnen das?«
»Heute ist Samstag … Sehr gut. Meine Kanzlei ist am Cours Pierre-Puget 58. Ich denke, ich muss Ihnen nicht erklären, wo das ist.«
»Nein, nicht sehr originell als Adresse eines Anwalts.«
»In der Tat, direkt neben dem Justizpalast!«
»Bis Montag also.«
Michel beendete das Gespräch, ohne auch nur Auf Wiedersehen zu sagen. Mit dem Champagnerglas in der Hand war Anne näher gekommen.
»Ich vermute, dieses abscheuliche Klingeln besagt, dass die Pause vorbei ist? Hast du vor, mich ganz allein zu Platz 35 zurückgehen zu lassen?«
»Aber nein, Anne, also wirklich!«
Er legte die Hand um ihre ranke Taille und drückte sie an sich.
Als de Palma vor dem kleinen Haus anhielt, das Anne im Chemin de la Fare 28 in Château-Gombert besaß, dem letzten Überrest ihrer Ehe, war es zwei Uhr morgens.
»Kommst du noch rein, was trinken?«
Die Luft im Auto flirrte. Sie sah ihn eindringlich an. Er ließ das Fenster herunter. »Ich fahr nach Hause … Ich muss schlafen, ich fühl mich nicht so gut. Ich hab …«
»Du hast schon wieder Migräne, komm, ich massier dich.«
Sie legte ihm ihre langen Finger auf die Schläfen und massierte ihn langsam. »Was sagt der Arzt?«
»Er sagt, er weiß es nicht, wie alle Ärzte!«
Anne fuhr mit ihrer Massage fort, indem sie kleine Kreise über den Augenbrauen vollführte, dann zog sie wie in einer Liebkosung die Hände zurück, legte sie an Michels Schläfen und drückte leicht.
»Erinnerst du dich, Anne?«
»Ja, ich erinnere mich und will nicht darüber reden …«
»Inzwischen denke ich seltener daran, aber noch vor einem Monat lief das wie eine diabolische Endlosschleife wieder und wieder in mir ab. Immer wieder, wie ein Film.«
Sie übte leichten Druck auf sein Schädeldach aus und wühlte mit den Fingerspitzen durch sein Haar.
»Ich sehe mich noch, wie ich in die Le-Guen-Höhle eindringe und unten in dem dunklen Loch ankomme. Ich hab es nie jemandem gesagt, aber wenn du wüsstest, was ich für eine Angst hatte. Magen verkrampft und die Hosen voll.«
»Was für ein Bild …«
»Nun ja, so war es aber.«
Er holte tief Luft und schloss die Augen. »Ich sehe immer noch diese fantastischen Malereien vor mir. Sehr beeindruckend. Gefühle, die ich nicht beschreiben kann, aber angesichts dieser Handabdrücke der urgeschichtlichen Menschen habe ich mich geborgen gefühlt. Und dann hab ich sie gesehen. Und ihn direkt dahinter. Ich hab mich umgedreht …«
Michel holte Luft, schloss die Augen und machte eine Drehbewegung mit dem Kopf. »Ich sehe mich noch, wie ich mich auf mein linkes Bein verlagere, auf ihn ziele und abdrücke … Er hat mich genau auf die Stirn getroffen. Wie ein Blitz.«
»Das hat einen großen Bullen aus dir gemacht, mit Orden und Anschiss. Und einem ganzen Haufen Neid. Bravo. Und zu allem Überfluss hat es dir nichts von deinem Charme genommen.«
»Er hatte übermenschliche Kräfte. Daran habe ich oft denken müssen. Mein Schuss war präzise, ich seh noch, wie ich gezielt habe … Keiner wird mich davon abbringen zu glauben, dass er der Kugel ausgewichen ist. Er hatte dieselben Reflexe wie die großen Jäger der Urzeit, davon bin ich überzeugt. Er war stark und schnell, wie kein Mensch es sein kann. Im Vergleich zu ihm sind wir degeneriert.«
»Du redest von ihm, als würdest du ihn bewundern!«
»Er ist einer .38er ausgewichen! Blitz gegen Blitz! Beide mit irrsinniger Geschwindigkeit. Vor so was kann man nur Respekt haben, verstehst du!«
»Ich verstehe, dass er lebenslang bekommt, und das alles dank dir.«
»Du hättest mir genauso sagen können, dass ich ihn verfehlt habe!«
»Aber das habe ich nicht gemacht.«
»Jedenfalls habe ich ihn nicht allein festgenommen.«
»Danke im Namen von uns kleinen Bullen, Michel!«
Unmerklich zog sie ihn an ihre Brüste. Er spürte, wie fest sie unter dem leichten Stoff waren. Sie streichelte ihm zärtlich an der Stelle die Stirn, an welcher »der Jäger« ihn mit seinem Tomahawk getroffen hatte.
»Ich fahr nach Hause, Anne.«
»Tu, was du willst, mein großer Bulle.«
Sie fuhr mit beiden Händen in seinen Nacken und drückte ihm voller Verlangen ihre sinnlichen Lippen auf den Mund.
Isabelle hat gerade ihr drittes Kind bekommen. Der Baron hat eine Geburtsanzeige erhalten. Eine blassblaue Karte, auf die sie ein Foto des kleinen Mannes geklebt hat. Er heißt Michel, genau wie er.
Isabelle wollte das. In Erinnerung an den großartigen Bullen, der ihren Weg gekreuzt hatte.
Isabelle hatte ihm immer Freundschaft bezeugt.
Stimmt, er hat sie nie fallen lassen. NIE.
Er hat immer die Erinnerung an das schöne junge Mädchen bewahrt, das er geliebt hatte. IMMER.
Wie könnte er sie vergessen?
Isabelle hätte gern, dass Michel Pate ihres dritten Kindes wird. Er weiß nicht, ob er einwilligen soll. Aber er denkt nach; er hat zwei Mal abgelehnt.
Am Ende wird sie glauben, dass er sie nicht mehr liebt.
Arme Isabelle. Wenn sie wüsste, wie oft der Baron an sie denkt. Nacht und Tag.
Tag und Nacht. Das Blatt ist vergilbt. Von den Jahren der Erinnerung verzehrt. Die kräftige Schrift von Kriminalrat Boyer, dem Vater der Mordkommission am Quai des Orfèvres in Paris. Boyer, der Fabelhafte. Der einen mit einem Schlag, mit einem einzigen Schlag erwachsen werden ließ.
De Palma liegt nackt auf seinem Bett. Er hat noch Annes Parfum auf den Lippen. Er hört Boyer. Er sagt: »Bringen Sie mir den Kerl. Bringen Sie ihn mir. Hierher. Ich will ihn vor dem großen Adios sehen. De Palma, Sie fahren mit Maistre zum Tatort. Ich denke, sie ist noch da. Sie sehen sich das mit Marceau an. Ich will wissen, was Sie darüber denken. Die jungen Leute haben manchmal neue Ideen.«
Boyer, der Chef, hat mit seinem riesigen, an einem Ende blauen, am anderen roten Wachsstift in dicken Lettern quer über das Blatt geschrieben. VERGEWALTIGUNG UND TÖTUNG, in Rot. Unten auf dem Blatt, in Blau: NICHT AUFGEKLÄRT. Name: Isabelle MERCIER.
Blondes Haar. 16 Jahre. 1 m 63. 56 Kilo. Rue des Prairies 28. 20. Arrondissement. Datum des Leichenfundes: 20. Dezember 1978, 21 Uhr 56. Fall bearbeitet von den Inspektoren de Palma, Marceau und Maistre.
»FALL NICHT AUFGEKLÄRT«, wiederholt der Baron und streicht über das Durchschlagpapier zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Buchstaben N.I.C.H.T. A.U.F.G.E.K.L.Ä.R.T. brennen tief in seinen Augen.
»Bringen Sie ihn mir!«
In sein Heft Nummer eins hat der Baron geschrieben: Isabelle Mercier. Und sonst nichts.
Oben auf der Seite ist Isabelles Foto mit einer Büroklammer befestigt.
Es ist ein Passfoto. In Schwarz-Weiß. Isabelle ist sechzehn. Sie lächelt schüchtern. Ihr Haar ringelt sich über ihren samtigen Wangen. Maistre und de Palma kommen zur Rue des Prairies 28.
Zum ersten Mal vertraut Boyer der Schreckliche ihnen eine Ermittlung an. Und an dieser hier scheint er zu hängen.
Isabelle liegt auf dem Bauch.
Jean-Claude Marceau sieht aus dem Fenster.
Der Fotograf vom polizeilichen Erkennungsdienst beobachtet ihn, seine Lippen hängen über die Mundwinkel.
»Maistre und de Palma …«
»Tag, Kollegen. Der Alte will uns einführen. Werft mal einen Blick drauf.«
DAS habe ich noch nie gesehen.
De Palma beugt sich nieder. Er hebt die Locke, die im geronnenen Blut klebt.
Man könnte denken, ein Stück Karamel. Darunter ein Auge, das ihn blöde anstarrt.
Ein Auge inmitten des Nichts. Ein Auge ohne Gesicht.
Jean-Claude Marceau hat sich abgewandt.
»Ich kann euch sagen, um ein Gesicht in einen solchen Zustand zu bringen, muss man ganz schön draufhauen. Verdammt, muss man da draufhauen. DAS hab ich noch nie gesehen, Kollegen.«
Jean-Louis Maistre ist weg, um sich zu erbrechen. De Palma schluckt. Er will das Grauen in sich behalten.
Und das Grauen ist in ihm.
Nie vergessen.
»Hallo, Maistre?«
»Hast du gesehen, wie spät es ist, Mann?«
»Sie ist wieder da, Dicker.«
»Isabelle?«
»Ja.«
»Sie war immer da …«
»Ich habe geträumt, sie hätte mir eine Anzeige zur Geburt ihres dritten Kindes geschickt.«
»Komisch. So was hab ich auch geträumt, Baron.«
3
Die Naturschutzstation La Capelière bestand aus zwei nebeneinanderstehenden alten Gebäuden im Besitz der Staatlichen Naturschutzgesellschaft SNPN. 1979 war dieses gedrungene Mas, das in den sich am Etang du Vaccarès entlangziehenden Tamariskenwäldchen versteckt lag, zum Informationszentrum des Naturschutzgebiets der Camargue geworden.
Am Eingang zeigte ein Schild auf einer Mauer aus schlecht zusammengefügten Natursteinen zwei rosa Flamingos, die sich zu beiden Seiten der Abkürzung SNPN gegenüberstanden. Die Feuchtigkeit, die aus den stehenden Wassern emporstieg, und die sengende Sonne hatten die Farbe angegriffen, sodass sie sich stellenweise von ihrem Untergrund gelöst hatte.
Im Erdgeschoss befanden sich ein kleines Museum, Büroräume und ein Labor. Im oberen Stockwerk ein Schlafraum für Studenten, die hier Praktika absolvierten, sowie die Wohnung des Leiters der Station: Dr. Christophe Texeira, Dozent an der Université de Provence und Wissenschaftler. Ein 45-jähriger Mann mit dem Aussehen eines grundzufriedenen Menschen: lockiges, graumeliertes Haar, ein Gesicht mit markigem Kiefer, schwarzen Augen, die unter dichten Brauen ständig in Bewegung waren, und vollen Lippen, die ihm großen Erfolg bei seinen Studentinnen sicherten.
An diesem Abend saß Christophe Texeira allein in seinem Büro, das ihm auch als Labor diente, und hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Ein Bericht über die jüngsten Insektenkartierungen, die er im Naturschutzgebiet Vigueirat auf der anderen Seite der Rhone beaufsichtigt hatte, ließ gewaltige Müdigkeit in ihm aufsteigen. Texeira war der Vögel wegen in die Camargue gekommen, und seit zwei Jahren tat er nun nichts anderes, als das Vorkommen von Mücken und Spinnen zu kartieren, von Fröschen und Kröten gar nicht zu reden. Diese Nacht kam er nicht weiter und warf von Zeit zu Zeit einen Blick aus dem Fenster. Es war abnehmender Mond. Die Spitzen des Schilfrohrs im dichten Röhricht zitterten in der noch hellen Nacht und verursachten silbrige Wellenlinien, die sich dem salzigen Atem des Windes folgend kreuzten. Christophe sah noch einmal durch sein Binokularmikroskop, dann lehnte er sich missmutig zurück. Was ihn heute Abend umtrieb, waren die Fotos, die auf seinem Schreibtisch neben den rosa und grünen Karteikarten des Berichts ausgebreitet lagen.
Es waren fantastische Bilder.
Ein Spaziergänger, der am vergangenen Wochenende vorbeigekommen war, hatte Löffler fotografieren können: zwei in der Nähe von Le Grenouillet und einen weiteren, der verloren auf der Rasenfläche stand, die sich zwischen den Kanälen Richtung Le Sambuc entlangzieht, nicht weit von den Pferden des Mas de Loule entfernt. Erstaunlich! Der Spaziergänger hatte mehrere Bilder von diesen sagenhaften Vögeln gemacht, während er selbst, immerhin Doktor der Biologie und Leiter der Naturschutzstation, praktisch nie welche auf dieser Seite des Deltas gesehen hatte. Gewöhnlich hielten sie sich eher am südlichen Ufer des Etang de Vaccarès Richtung La Gacholle auf. Und auch das nur selten.
»Ich suche Löffler«, hatte der Spaziergänger gesagt.
»Schwierig«, hatte Texeira geantwortet.
»Man muss ihnen von Liebe und Wundern erzählen.«
Von Wundern!
Der Spaziergänger hatte ganz den Eindruck eines Sonderlings gemacht: halblanges schwarzes Haar, bartloses Gesicht, stämmig und mit den Bewegungen eines Menschen, der nicht weiß, was er mit seinen Muskeln anfangen soll. Dazu ein Aufzug wie eine Vogelscheuche: Vietcong-Sandalen an den Füßen, trotz der Hitze ein Wollpullover, nicht ganz saubere Jeans und ein zusammengeflickter Beutel.
Hingegen ließen das Zeiss-Fernglas, das 200-mm-Objektiv mit kleiner Blende und die digitale Nikon-Spiegelreflexkamera, die ihm um den Hals hingen, den Biologen vor Neid erblassen. Dazu kam noch das Scherenfernrohr, das er in seinem Beutel gesehen hatte.
Seltene Bilder und dann der Brief im Briefkasten der Naturschutzstation, der Poststempel besagte nur: Tarascon Hauptpost. 1. Juli.
Der Biologe erinnerte sich nicht mehr an den Namen des Spaziergängers, sonst hätte er ihn gern angerufen, um ihm zu gratulieren und sich zu bedanken. Hatte er den Namen überhaupt erfahren? Texeira ging in die Eingangshalle des Zentrums, machte Licht an und warf einen Blick in das große Besucherverzeichnis auf dem Tisch neben der Registrierkasse.
Jede Seite war in sechs Spalten unterteilt, in die die Besucher die beobachteten Tierarten, Ort, Datum und natürlich ihren Namen und möglicherweise Adresse und Beruf eintragen konnten.
Auf der Seite von Samstag standen ein knappes Dutzend Namen, doch nur Touristen, die ihren Besuch dokumentieren wollten und ein paar freundliche Worte hinzugefügt hatten.
Christophe sah auf die Uhr. Es war fast eins. Er beschloss, sich wieder ans Werk zu machen und die Arbeit an den Insektenkartierungen zu beenden. Nach ein paar Minuten stellte er fest, dass seine neue Assistentin schon wieder einen Fehler gemacht hatte: Er fand eine Cassida viridis und eine Anastrangalia sanguinolenta, zwei Larven, Seite an Seite mit einer Polistes gallicus, einer Wespenart. Er musste sich Etikett für Etikett alles noch einmal vornehmen. Darauf beschloss er, es sei längst Zeit, sich den Schlaf des Gelehrten zu gönnen und in seine Wohnung im ersten Stock hinaufzugehen.
Als er die Fensterläden seines Schlafzimmers zumachte, sah er, dass das Tor zur Naturschutzstation offen stand. Er schlüpfte in seine Hose, zog murrend die Turnschuhe an und ging in die graue Nacht hinaus. Dabei hätte er schwören können, dass er das Tor zugemacht hatte, bevor er in sein Büro gegangen war. Das gab ihm zu denken: Er hatte ein absolut unfehlbares Gedächtnis. Er sah sich noch, wie er den Türdrücker anhob, und erinnerte sich sogar, dass er wieder einmal daran gedacht hatte, ihn reparieren zu lassen, weil er schon seit Monaten sehr schwer einrastete, so sehr hatte der Rost sich festgefressen.
Es war also jemand nach 19 Uhr in den Park eingedrungen. Er wollte Gewissheit haben, holte im Schuppen eine Stablampe und beschloss, bis zum Ende des Weges zu gehen, der entlang des Canal du Fournelet verläuft; der einzige Weg, den ein Besucher in diesem winzigen Sumpf einschlagen konnte. Nach fünf Minuten Fußweg auf einem verschlungenen Pfad durch die mit Eschen und ungeheuren Brombeerranken bedeckten toten Flussarme blieb er neben der Hütte des Beobachtungsstandes von Aulnes, die den Sumpf überragte, stehen. Er lauschte auf die Nacht: Zunächst vollständige Stille, dann schwollen die leisen Geräusche der Natur allmählich immer stärker an. Nach ein paar Minuten spürte er, dass alles um ihn herum in Bewegung war: ein leichtes Plätschern im stehenden Wasser ganz in seiner Nähe, die Geräusche rascher winziger Schritte in den Quellern, sicher ein Nagetier, das vor einer unmittelbar drohenden Gefahr floh. Wie eine wilde Katze kletterte er die Holzsprossen zu dem Beobachtungsstand empor. Die schlafenden Wasser glänzten wie altes Silber im Antlitz des Mondes. In ihrer Mitte hatte eine tote Eiche sich in den Schlick gedrückt und die Arme aus dem schmutzigen Wasser gereckt wie ein um Hilfe rufender Ertrinkender. Auf dem vorderen Teil des Stammes war ein kleiner Stelzvogel wach geblieben und beobachtete die schimmernde Seide des ihn umgebenden Wassers.
Der Biologe brauchte einen Moment, bis ihm bewusst wurde, dass das Quaken der Frösche aufgehört hatte; er war ihren unaufhörlichen Lärm so sehr gewohnt, dass er ihn nicht beachtet hatte. Jetzt jedoch spitzte Texeira die Ohren: Weiter in der Ferne, Richtung Vaccarès, hörte er Amphibien, nicht aber in seiner direkten Umgebung. Die Erfahrung sagte ihm, dass ein Fremder sich ganz in der Nähe befand. Dann war ganz deutlich das Geräusch von Schritten zu hören: Das Schilfrohr knackte auf der anderen Seite des Sumpfes Richtung Salzsteppe hin. Genauer gesagt kam es von der Hütte der Gardians, der berittenen Viehhirten, die sich ein ganzes Stück hinter dem Röhricht in ungefähr zweihundert Meter Entfernung befand.
Christophe lauschte mit allen Sinnen. Die Schritte hörten auf. Zunächst dachte er an ein Hochwild, ein Wildschein, vielleicht ein Reh aus einem der Schutzgebiete oder ein Stier, dem es gelungen war, den Stacheldraht vom Mas de Loule zu überwinden, was recht häufig vorkam. Aber das erklärte noch nicht das offene Tor! Es musste ein Mensch sein, vielleicht ein begeisterter Ornithologe, der lange bevor die Sonne sich über die Sümpfe erhob, Position bezog, um das morgendliche Ballett der Camargue-Vögel zu bewundern. Christophe stieg von dem Beobachtungsstand herunter, ging die letzten Meter des Pfades unter den Bäumen entlang und blieb am Saum der Salzsteppe stehen. Hinter ihm zeichneten sich im dunklen Grau der Tamarisken deutlich die hellen Mauern der Hütte und ihr Dach ab, das spitz wie ein Kirchturm war. Das Geräusch der Schritte ging unkontrolliert weiter, so als würde jemand am anderen Ende des Sumpfes am Rand des Röhrichts etwas suchen. Plötzlich war ein Plätschern zu hören, jemand lief im Wasser. Schritte. Äußerst schwerfällige Schritte. Es erinnerte Texeira an jene großen Tiere, denen er in Ostafrika gefolgt war. Er warf sich hinter einem Queller flach auf den Bauch, um besser zu beobachten.
In dem Moment drang eine seltsame Fistelstimme, wie eine hohe kristallene Falsettstimme, über die Oberfläche der stehenden Wasser. »Lagadigadeu, la tarasco, lagadigadeu …« Dann kam, tief wie ein Orgelbass, eine männlichere Stimme hinzu, die die erste überlagerte und zu einem Schreckensschrei wurde, der die Dunkelheit zerriss. »Laïssa passa la vieio masco … Laïssa passa que vaï dansa …« Die beiden Stimmen verschränkten sich. »La tarasco dou casteu, la tarasco dou casteu …«
Dann herrschte absolute Stille. Christophe trat aus seinem Versteck, richtete seine Lampe in Richtung der Stimmen, sah aber nichts. Er spähte durch die Nacht, strich mit der Lampe über die schwarze Oberfläche des Sumpfs. Nichts. Um sich Mut zu machen, rief er: »Ich bin Christophe Texeira, der Leiter des Parks, Sie haben hier nichts zu suchen, bitte verlassen Sie das Gelände … Verlassen Sie es unverzüglich. Der Spaß hat lang genug gedauert.«
4
Montag, 7. Juli.
De Palma klingelte in der Kanzlei Chandeler & Partner am Cours Pierre-Puget 58, einem ansehnlichen, von zwei kräftigen Atlanten bewachten Gebäude, wenige Schritte vom Justizpalast entfernt. Eine durch jahrelanges Rauchen heiser gewordene Frauenstimme drang aus der Gegensprechanlage. »Kanzlei Chandeler & Partner, ja bitte?«
»Michel de Palma, ich habe eine Verabredung mit Monsieur Chandeler.«
»Rechtsanwalt Chandeler ist in der ersten Etage. Ich öffne Ihnen.«
Michel schritt langsam die Stufen der breiten, von verschnörkelten schmiedeeisernen Geländern eingefassten Treppe empor, die sich zu einem lichten Glasdach hinaufwand.
Er kannte Chandeler vom Hörensagen: ein noch junger Anwalt, der sich auf höchst einträgliche Fälle spezialisiert hatte; ein tadellos wie ein Ami frisierter Robenträger, der feiste Reeder und Magnaten der kräftig expandierenden Jachtindustrie am alten Hafen zu seinen Klienten zählte.
Im Frühjahr war Chandeler von zwei Unbestechlichen des Drogendezernats anlässlich der Anklageerhebung gegen einen seiner Klienten heftig gebeutelt worden: ein großes Tier im Import-Export-Geschäft, der Papst des Containergeschäfts, der wegen Zigaretten- und Kokainhandels höchstpersönlich in die Haftanstalt Les Baumettes verfrachtet worden war. Bei diesem Fall hatten die Ermittler des Drogendezernats den Verdacht, Chandeler selbst habe Dreck am Stecken, aber sie hatten nichts beweisen können.
»Wenn Sie dort Platz nehmen möchten«, sagte die Stimme von der Gegensprechanlage, eine große blonde Sekretärin, geschminkt wie eine sizilianische Marionette. »Ich gebe Rechtsanwalt Chandeler Bescheid, dass Sie da sind.« Sie deutete auf ein Büffelledersofa.
Chandeler & Partner war eine riesige Kanzlei, die mit echten provenzalischen Stilmöbeln und Sammlerstücken eingerichtet war: ein Tragsessel aus dem 18. Jahrhundert, alte Schiffskompasse, ein paar Gemälde von Ambrogiani … Eine Hafenansicht von Algier von Bascoules. All dieser zur Schau gestellte Mammon hatte die großen Raubkatzen der Drogenfahndung wohl mächtig angestachelt – sie hatten noch die Namen einiger berühmter Anwälte im Kopf, die nebenbei in den Verhören der Bosse des Milieus gefallen waren.
Vom Empfang aus, an dem der Baron sich befand, hörte man, wie in den benachbarten Büros Telefone klingelten, dann ernstes Murmeln, durchdrungen vom Klappern von Computertastaturen. Ein riesiger Mann kam durch eine Doppeltür herein. Mit zwei Schritten stand er vor dem Baron und deutete ein Lächeln an, das ein Raubtiergebiss entblößte. »Monsieur de Palma, vermute ich. Sehr erfreut, dass Sie gekommen sind«, sagte Chandeler und drückte Michels Hand wie ein Schraubstock.
»Ich habe im Augenblick nicht viel zu tun«, antwortete der Baron und zuckte linkisch mit den Schultern.
»Dann sind Sie ein glücklicher Mensch!«
Chandeler forderte de Palma auf, sich zu setzen, und warf sich in seinen ledernen Schreibtischsessel. »Erlauben Sie mir zunächst einmal, Ihnen dafür zu danken, dass Sie in ein Treffen eingewilligt haben. Ich kann mir denken, dass Sie sich fragen warum?«
Der Baron begnügte sich mit einem starren Blick auf seinen Gesprächspartner, der mit seinem Drehsessel unaufhörlich Vierteldrehungen beschrieb, bald nach rechts, bald nach links, als würde eine Achse seinen Körper bis zum obersten Punkt seines Schädels durchziehen. »Und warum wollten Sie mich treffen?«
»Die Sache ist ein bisschen heikel. Also: Eine Klientin von mir, Madame Steinert, ist davon überzeugt, dass ihr Mann ermordet wurde. Leider versichert ihr die Polizei, es handele sich nur um ein Verschwinden und sie könne verständlicherweise noch nichts tun.«
»Seit wann ist ihr Mann verschwunden?«
»Seit fünf Tagen.«
»Erst!«
»Ich verstehe, was Sie meinen, aber seine Frau, also meine Klientin, ist überzeugt, dass er tot ist! Sie hat gute Gründe dafür: Ihr Mann hatte nicht die Angewohnheit, einfach so zu verschwinden, er war keine von diesen unsteten Seelen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Ich verstehe. Hingegen begreife ich nicht so recht, was ich für Sie tun kann.«
Chandeler hörte mit seinen Vierteldrehungen auf. Er stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch und legte die Handflächen in der Luft zusammen, als wolle er beten. »Nun, meine Klientin ist niemand x-Beliebiges. Haben Sie schon von Steinert-Klug-Metall gehört?«
»Nein.«
»Nun gut, aber William Steinert, sagt Ihnen das etwas?«
»Nein, tut mir leid.«
»Sie lesen also keine Zeitung!«
»Sie wissen so gut wie ich, dass die Journaille alles Mögliche erzählt.«
»Auf jeden Fall wiederholen sie, was gewisse Leute ihnen sagen«, bemerkte Chandeler und nestelte an seinem Krawattenknoten. »Es gab einen Artikel über sein Verschwinden, und zwar einen Artikel, der mich ziemlich reinreitet, um es klar zu sagen!«
De Palma sah den Anwalt starr an. Ein paar Sekunden lang hielt sein Gesprächspartner dem Blick stand, dann schlug er die Augen nieder und kramte auf seinem Schreibtisch herum.
»Da«, sagte er und hielt ihm einen Zeitungsausschnitt hin. »William Steinert war einer der mächtigsten Industriemagnaten der Metallindustrie jenseits des Rheins. Das Vermögen können Sie sich vorstellen!«
»Mmmmh«, machte de Palma und nickte.
»Und dieser Mann ist verschwunden. Natürlich wünscht die Familie, dass die Ermittlungen einstweilen mit äußerster Diskretion durchgeführt werden.«
De Palma legte das Blatt auf den Schreibtisch, ohne es auch nur zu lesen, und warf einen Blick auf die blaue Mappe, die vor Chandeler lag. Er las die Schrift auf dem Kopf: Fall William Steinert. SK Metall. Nichts weiter. »Ich sehe, dass Sie schon einen Fall daraus machen. Wer sagt Ihnen, dass er nicht einfach für ein paar Tage verschwunden ist, wie das bei solchen Persönlichkeiten wohl mal vorkommt?«
»Ich würde Ihnen gerne recht geben, aber ich denke, im besten Fall haben wir es mit einem Unfall oder einer Entführung, im schlimmsten mit einem Mord zu tun.«
De Palma streckte die Beine aus und rieb sich das Kinn. »Warten Sie, Chandeler. Wenn ich recht verstehe, handelt es sich um eine Familie mit Geld, und zwar mit zig Millionen.«
Der Anwalt nickte und vollführte eine Vierteldrehung mit seinem Sessel.
»Eine Familie, die sich alles leisten kann, einschließlich der besten Polypen Frankreichs.«
Chandeler stützte beide Ellbogen auf seinen Schreibtisch und verschränkte die Hände.
»Ich sehe genau, worauf Sie hinauswollen«, bemerkte er und warf ihm ein Lächeln zu. »Lassen Sie mich zunächst sagen, dass Sie genau zu dieser Gattung großer Polizisten gehören, wochenlang hat die Presse, die Sie nicht mögen, von Ihnen gesprochen. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie in einiger Zeit eine Auszeichnung erhalten.«
De Palma hob die Hand, als wolle er derlei Speichelleckerei abwehren.
»Und dann gibt es, so erstaunlich Ihnen das auch vorkommen mag, nur sehr wenige Privatermittler, die die Region und ihre kriminellen Traditionen, ihr Milieu, nun, die das alles perfekt kennen … Sie hingegen kennen es in- und auswendig. Und um offen zu sein: Ich war es, der an Sie gedacht hat. Ich kannte Sie nur aus der Presse und durch das, was man im Justizpalast über Sie erzählt. Ich weiß also, dass Sie ein großer Polizist sind, auch wenn es Sie stört, dass man in solchen Begriffen über Sie spricht! Bei Ihnen häufen sich große Fälle und Glanzleistungen. Vor allem ziehen Sie die Sachen bis zum Ende durch. Sie haben den Mut dazu. Und außerdem sind Sie der beste Kenner des örtlichen Milieus, das sagen all Ihre ehemaligen Kollegen. Und ich denke, dass das Milieu in diese Geschichte verwickelt ist. Also.«
»Wer sagt Ihnen, dass die Sache mich interessiert?«
»Nichts sagt mir das. Nur hat meine Klientin …«
»Ich kann Ihnen nicht folgen.«
»Was ich Ihnen vorschlage, wird natürlich bezahlt, und glauben Sie mir, Sie werden es nicht bereuen.«
»Sie wissen, dass ich dazu nicht das Recht habe! Ich bin krankheitshalber beurlaubt, aber noch im Dienst und beabsichtige, das bis zu meiner Pensionierung zu bleiben.«
»Ich weiß, ich weiß … Ich bitte Sie nur für ein paar Tage um Ihre freie Zeit. Die Sache wird sich in einigen Wochen so oder so herumsprechen. Wir werden das nicht so lange geheim halten können, wie wir gern hätten. Dieser Artikel macht uns beträchtliche Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, woher die Information kommt … aber gut.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich will damit sagen, dass William Steinert offiziell, zumindest bis heute, einen kleinen Ausflug auf die Inseln unternommen hat. So. Aber wie Sie wissen, lässt sich in diesem Milieu niemand täuschen. Freitag kamen bereits Fragen auf. Ich wage mir das Theater, das losgeht, sobald der Artikel in den betreffenden Kreisen bekannt wird, kaum vorzustellen. Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung werden die Haie hungrig werden. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen?«
»Absolut. Aber noch einmal, ich werde Ihnen keine große Hilfe sein.«
»Ich versuche gerade, Ihnen begreiflich zu machen, dass ich alles tun werde, damit wir binnen einer Woche die Möglichkeit einer Entführung ausschließen können.«
»Was Sie wissen möchten, ist also, ob eine Lösegeldforderung droht oder nicht.«
Der Anwalt kniff die Lippen zusammen und nickte.
»Möglicherweise möchten Sie vor allem wissen, ob Steinert noch am Leben ist?«
»Sie lesen in mir wie in einem großen Buch! Nun, wir verstehen uns also, Monsieur de Palma.«
»Ich habe Ihnen nicht Ja gesagt.«
Chandeler antwortete nicht. Er presste mehrmals die Kiefer zusammen und starrte auf einen Punkt vor sich.
»Wissen Sie, wo er verschwunden ist?«
»In Tarascon.«
De Palma lächelte: Der König der Werkzeugmaschinen verschwindet in der Stadt des Aufschneiders Tartarin de Tarascon …
»Ich weiß, das mag Ihnen komisch vorkommen, aber so ist es. William Steinert hat seit dem 24. Juni nichts mehr von sich hören lassen.«
Für Michel blieb Tarascon ein unmöglicher Name und Ort, mit einem von schönen Türmen und schönen, ganz neuen Zinnen geschmückten Schloss. Das Anhänger-erster-Kaltpressung-aus-der-Provence-Kaff. Inmitten der ewigen Provence, in einer weißen Stadt am Ende des gewaltigen Rhonedeltas.
»Die ersten Tage hat seine Frau sich keine Sorgen gemacht: In diesem Milieu kommt man nicht täglich zusammen. Dann hat sie herumtelefoniert, nach Deutschland, mit seinem Pariser Büro, doch dann musste sie sich schließlich den Tatsachen beugen: Ihr Ehemann ist in der Tat zwischen seinem Büro in Tarascon und dem Anwesen, das er wenige Kilometer von dort in der Umgebung der Dörfer Maussane und Eygalières bewohnt, verschwunden.«
Maussane: das Dreieck des großen Geldes in der Provence, eine Ecke voller Snobs, Künstler auf dem absteigenden Ast und Einheimischer, die stolz ihre erstarrten Traditionen bewahren. Alles, was der Baron verabscheute.
»Was denken Sie darüber, Monsieur de Palma?«
Er atmete tief durch und verzog zweifelnd das Gesicht. »Ich denke, dass Sie jemanden oder irgendeine Organisation im Verdacht haben und nicht wissen, wie Sie Kontakt zu ihm oder ihr aufnehmen sollen … Ich denke, dass Sie sie nicht kontaktieren wollen. Deshalb haben Sie mich kommen lassen, und deshalb hat jemand Ihnen meine Telefonnummer gegeben. Sicher so ein alter Knacker, der aller Welt erzählt, dass er ein großer Bulle war. Dass er die großen Bösewichter geschnappt hat … Nun, lassen wir das. Privatdetektive sind rar in dieser Stadt … Und es stimmt, ich bin einer der letzten Bullen, der das Telefonbuch der örtlichen Mafia aufsagen kann, ohne mich bei einer Nummer zu irren. Allerdings ist auch zu sagen, dass ich mich nicht gerade viel um die Strafprozessordnung geschert habe … Nun gut, die Zeiten sind vorbei. Die alten Knacker, die Sie getroffen haben, sind nicht auf dem Laufenden. Sie sind mindestens eine, wenn nicht zwei blutige Abrechnungen hintendrein. Ich kann Ihnen sagen, sobald einer der Typen aus dem Milieu einen Schnupfen erwischt oder was falsch macht, weiß ich das. Das ist eine Leidenschaft. Was für manche die Pferdewetten sind, ist für mich die Datenbank Organisierte Kriminalität. Anders gesagt, ich habe meine Spitzel im Milieu und kann viel erfahren.«
Chandeler hüstelte und blätterte nervös in der Akte Steinert. De Palma legte die Hand flach auf den Schreibtisch. »Wissen Sie, Chandeler, ich weiß viel über das Milieu, und trotzdem stehe ich weiter gerade wie eine Eins. Beide Füße in der Jauchegrube, aber aufrecht. Genug Stoff, um ein Buch zu schreiben, wenn ich meinerseits ein alter Knacker sein werde … Kurz, so, wie es alle alten Idioten tun, die glauben, sie wären zu irgendetwas auf dieser Erde nützlich gewesen.«
»Ich sehe, dass man mit Ihnen nicht herumreden kann …«
»Tut mir leid, Herr Rechtsanwalt, aber es ist wirklich nicht die Art von meinesgleichen, Männern wie Ihnen zu helfen …«
»Was meinen Sie damit?«
»Ich mag weder Ihre Möbel noch Ihre Sekretärin noch Ihre Schuhe …«
Chandeler bekam den Brecher mitten ins Gesicht. Er reagierte nicht und verstand die kaum verhüllte Drohung, die der Bulle ihm gegenüber eben geäußert hatte. »Ich bedaure, Monsieur de Palma. Ich dachte, wir könnten uns verständigen, aber dann eben nicht.«
De Palma erhob sich und streckte sich, ohne den Anwalt aus den Augen zu lassen.
»Monsieur de Palma, sollten Sie jemals Ihre Meinung ändern, so zögern Sie nicht, mich anzurufen, jederzeit, auch spät am Abend. Sie haben ja bestimmt meine Handynummer gespeichert!«
Als er die Tür zur Buchhandlung Rivière im Zentrum von Tarascon öffnete, tat er, als würde er die Buchhändlerin, die ihm ein breites Lächeln zuwarf, nicht sehen. Dabei war sie niedlich und erinnerte mit ihren milchweißen Zähnen und ihrem schüchternen Blick an Mireille, die berühmte Provenzalin aus den Gedichten Frédéric Mistrals. Er wandte sich direkt der Abteilung »Provence« zu, die sich neben dem Schaufenster befand und einen Blick auf die Bar des Amis auf der anderen Seite der Rue de la Mairie ermöglichte. Dort griff er sich einen voluminösen Prachtband über die Provence vom Paläolithikum bis zur Gegenwart, via die Glanzzeiten der Römischen Provence, die großen und kleinen Kriege sowie die Aufschneidereien und Possen der Tradition. Er enthielt schöne Bilder: Frauen aus Arles, jahrhundertealte Kostüme, Lavendelfelder der Abtei von Sénanque, Zigeuner bei der Pilgerfahrt von Saintes-Maries, weiße Mähnen und lange geschwungene Hörner in der halb von den Brackwassern überfluteten Camargue, seltene Vögel. Kein einziger Löffler. Schade.
Auf der anderen Straßenseite trat der Wirt der Bar des Amis auf den Bürgersteig und machte mit seinen behaarten Armen große kreisförmige Bewegungen, um die ungesunde Luft seines Schuppens aus seinen geteerten Lungen zu vertreiben.
Er legte das Buch zurück und suchte im Regal nach einem anderen, während er das Kommen und Gehen in der Bar des Amis im Auge behielt.
»Suchen Sie etwas Bestimmtes, Monsieur?«
»Ähh, nein«, antwortete er, ohne den Blick von seinem Ziel abzuwenden. »Ich suche ein Geschenk, aber habe meine Wahl noch nicht getroffen.«
»Kann ich Sie vielleicht beraten?«
»Nein, machen Sie sich keine Umstände, vielen Dank.«
Die hübsche Buchhändlerin zog sich mit einem dünnen Lächeln zurück und verschwand zwischen den Regalen der Taschenbuchabteilung.
Er sah, wie der Mann auftauchte, den er suchte: Christian Rey betrat gerade die Bar des Amis. Keine Minute später folgte ein anderer Mann, jemand, den er nie gesehen hatte, groß, wiegender Gang, graues Haar, der sehr gut ein Gast sein konnte.
»So, ich nehme das hier«, sagte der Mann zu der Buchhändlerin und hielt ihr den Band Erinnerungen und Erzählungen von Frédéric Mistral hin.
»Soll ich es Ihnen als Geschenk verpacken?«
»Nein, nein, ich habs eilig«, erwiderte er und hielt ihr das Geld passend hin.
Er stopfte Erinnerungen und Erzählungen in seinen Rucksack und ging hinaus. Die ersten Touristen waren aufgetaucht. Er beschleunigte seine Schritte, bog in der ersten Gasse rechts ab und blieb in der Öffnung einer Toreinfahrt stehen, als folge er einem sehr genauen Plan. Mit mechanischen Gesten zog er eine Baumwolljacke und eine Army-Mütze aus dem Rucksack. Schließlich kam noch eine Sonnenbrille mit hellen Gläsern hinzu, dann griff er nach seiner Nikon mit einem 200-mm-Objektiv. Er ging den Weg zurück und blieb einen Augenblick stehen, um sein Spiegelbild im Schaufenster der Apotheke zu beobachten: Er befand seine Verkleidung für ausreichend, um mögliche Zeugen zu verwirren. Was immer geschehen würde, er wäre der Herr mit Mütze, Sonnenbrille und Fotoapparat. Mitten in der Sommersaison in einer Straße von Tarascon das Alltäglichste der Welt.
Keine Minute später betrat er die Bar des Amis und bestellte an der Theke ein kleines Bier, indem er mit dem Finger auf den Leffe-Hahn zeigte. So wäre er der Mann mit Mütze, der außerdem kein Französisch sprach. Ein echter Tourist auf der Durchreise.
Der Wirt, ein großer Korse mit grauem Teint und lachenden Augen, stellte ihm das Bier hin und polierte weiter schweigend den Tresen, während er von Zeit zu Zeit einen Blick auf den Fernseher warf, der die schönsten Szenen der diesjährigen Fußballmeisterschaft zeigte.
Plötzlich kam Christian Rey, begleitet von Grauhaar, wie ein Schatten aus dem Hinterzimmer; die beiden Männer wechselten ein paar Worte. Er nutzte die Gelegenheit, um zu zahlen und die Bar zu verlassen.
Rey und Grauhaar: Das war ein neues Element. Doch weder störte es ihn, noch machte es die Mission, die er sich auferlegt hatte, schwieriger. Vielleicht müsste auch Grauhaar aus dem Weg geräumt werden? Das hatte keinerlei Bedeutung. Einer mehr oder weniger. Vor der Bar machte er zwei Fotos, dann ging Rey nach links, Grauhaar nach rechts.
Der Mann hingegen musste sich an der Ecke der Rue de la Mairie rasch noch einmal umziehen. Er wusste, dass Rey gerissen war, und wollte kein Risiko eingehen. Er zog seine Jacke aus, nahm die Sonnenbrille ab und streifte ein rotes Polohemd über. Rey machte in der Bar Chez François halt, dann gegenüber dem Rathaus im Narval und schließlich in der Bar de la Fontaine, unweit der Mauern des Schlosses von König René. Jedes Mal war es das gleiche Szenario: Er ging hinein, schüttelte ein paar Hände und kam einige Minuten später mit einem in einer Supermarkttüte verborgenen Päckchen wieder heraus. Jedes Mal machte der Mann Fotos. Dann wandte Rey sich zum Parkplatz am Schloss und stieg in seinen Mercedes Kompressor Cabrio. Der Mann sah ihm im Verkehr hinterher und ließ ihn aus den Augen, als er auf die Brücke einbog, die die Rhone überquert und nach Beaucaire führt. Der Vormittag hatte genügend Informationen geliefert, jetzt wusste er, an welchem Ort er Christian Rey fangen würde. Dann würde er ihn dem Tier bringen.
Es war Zeit.
5
De Palma sah sie, als er am Denkmal für die Gefallenen der Kriege im Orient vorbeiging. Sie stand auf der anderen Seite der Corniche Kennedy, zum Meer gewandt, auf der weißen Steinbrücke, die die schmale Bucht des Vallon des Auffes überspannt. Von Weitem konnte er ihr Gesicht kaum erkennen. Sie war eine schöne blonde Frau mit hochgewachsener Figur. »Bestimmt eine Ausländerin, die die letzten Sonnenstrahlen des Tages nutzt, um noch ein Foto von der Basilika Notre-Dame de la Garde zu schießen.«
Wie tausend andere Touristen. Aber diese Frau hatte weder Fotoapparat noch Camcorder, sondern lediglich eine schwarze Handtasche, und sie schien ihn zu beobachten.
De Palma blieb einen Moment stehen und stützte sich auf das schmiedeeiserne Gitter vor dem Kriegerdenkmal. Der Regen kam näher. Am anderen Ende des Hafens verschwammen die hohen Wohnblöcke der nördlichen Stadtteile im schmutzigen Licht des zu Ende gehenden Tages. Ein Schnellboot des Zolls glitt auf dem glänzenden Wasser durch die Sainte-Marie-Passage. Seit einiger Zeit waren die Kollegen fest entschlossen, den Zigarettenschmugglern das Handwerk zu legen. Die Jungs überprüften alle Schiffe aus dem Maghreb. Unwillkürlich wandte de Palma den Blick nach links und konnte in der Ferne im Dunst die Fähre El Djazaïr erkennen, die sich langsam am Château d’If und den Frioul-Inseln entlangschob.
Der Lärm der Autos, die die Corniche entlangfuhren, erfüllte die Luft und breitete sich über dem Meer aus. De Palma blieb vor der Bar Le Grand Bleu stehen, steckte kurz den Kopf hinein, um ein Bier zu bestellen, und gab dem Kellner zu verstehen, dass er draußen Platz nehmen werde. Er setzte sich dem Meer zugewandt, mit dem Rücken zum Dröhnen der Autos. Eine Migräne kündigte sich an. Er schloss die Augen und atmete tief durch, wie um den Griff eines Schraubstocks zu lockern.
»Guten Tag, Monsieur de Palma.«