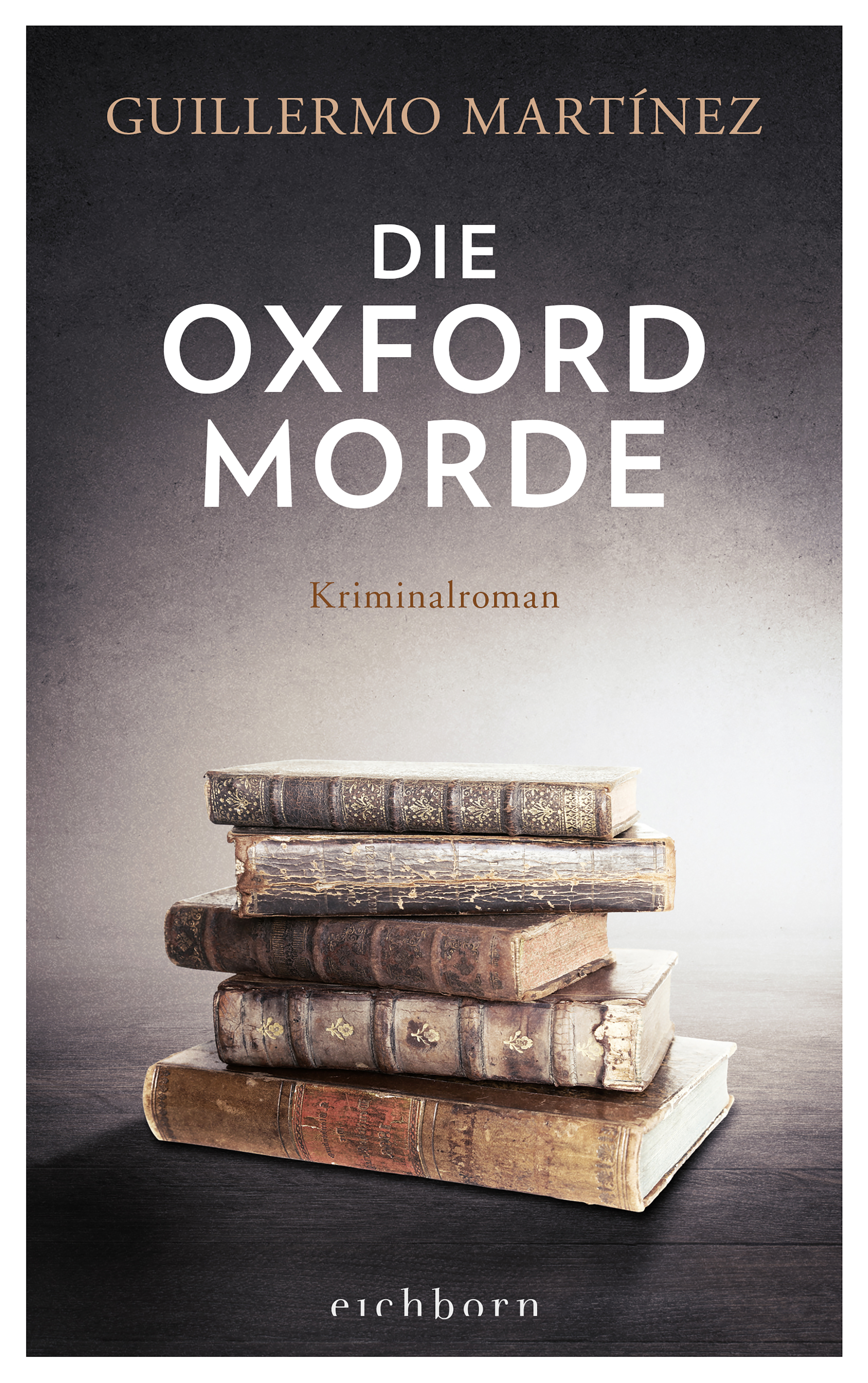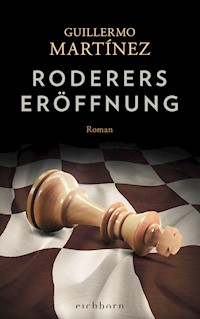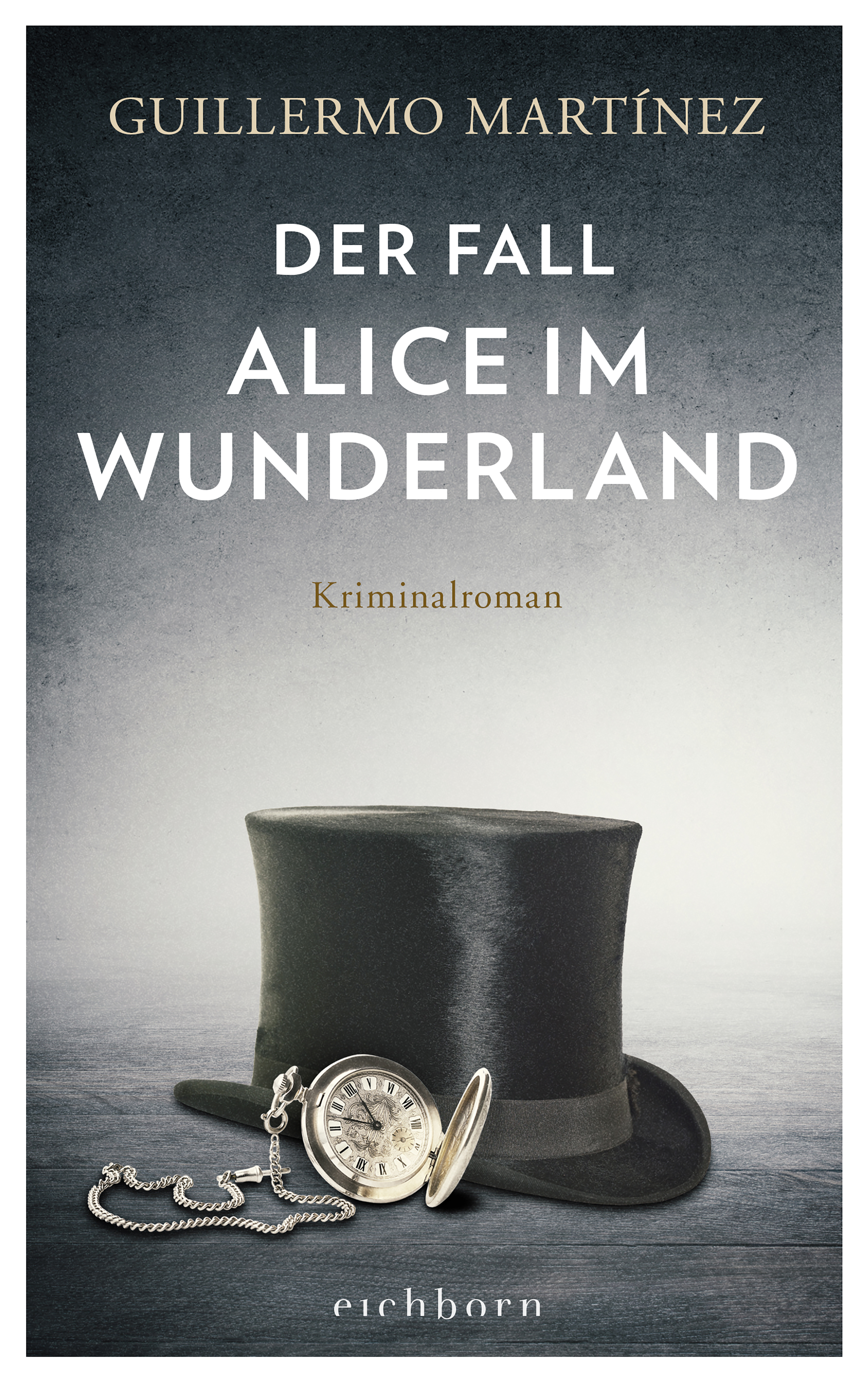
11,99 €
Mehr erfahren.
Die ehrwürdige Oxforder Lewis-Carroll-Bruderschaft ist einer Sensation auf der Spur: Aus dem Tagebuch des weltberühmten Schöpfers von Alice im Wunderland ist eine bis dato verschollene Seite aufgetaucht, die Brisantes offenbart. Doch bevor die Bruderschaft den Fund veröffentlichen kann, geschehen mehrere Morde, die durch das literarische Universum von Lewis Carroll inspiriert zu sein scheinen. Auch in ihrem zweiten Fall müssen Logik-Professor Arthur Seldom und sein junger argentinischer Mathematik-Doktorand scharf kombinieren, um den rätselhaften Fall zu lösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Die ehrwürdige Oxforder Lewis-Carroll-Bruderschaft ist einer Sensation auf der Spur: Aus dem Tagebuch des weltberühmten Schöpfers von Alice im Wunderland ist eine bis dato verschollene Seite aufgetaucht, die Brisantes offenbart. Doch bevor die Bruderschaft den Fund veröffentlichen kann, geschehen mehrere Morde, die durch das literarische Universum von Lewis Carroll inspiriert zu sein scheinen. Auch in ihrem zweiten Fall müssen Logik-Professor Arthur Seldom und sein junger argentinischer Mathematik-Doktorand scharf kombinieren, um den rätselhaften Fall zu lösen.
Über den Autor
Guillermo Martínez wurde 1962 Premio Planeta 2003 in Bahía Blanca, Argentinien, geboren und lebt in Buenos Aires. Er ist promovierter Mathematiker und verbrachte zwei Jahre seiner Doktorandenzeit an der Universität in Oxford. Für Die Oxford-Morde erhielt er 2003 als erster Argentinier den Premio Planeta, den bedeutendsten Literaturpreis der spanischsprachigen Welt. Der Roman wurde in 40 Sprachen übersetzt und 2008 mit Elijah Wood und John Hurt fürs Kino verfilmt. Seitdem veröffentlichte Guillermo Martínez mehrere hoch gelobte Romane, Essays und Kurzgeschichten.
GUILLERMO MARTÍNEZ
DER FALL
ALICE IMWUNDERLAND
Kriminalroman
Übersetzung aus demargentinischen Spanisch von Angelica Ammar
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der spanischen Originalausgabe:
»Los crímenes de Alicia«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Guillermo Martínez
Copyright © 2019 by Editorial Planeta, S. A., Barcelona
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ilona Jaeger, Berlin
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einbandmotiv: © nevodka; Rawpixel.com; Gemenacom; Rob Stark/shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-8791-9
www.eichborn.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Brenda, die in mir DEAD in LIVE verwandelte
1
Ein paar Jahre vor der Jahrtausendwende bin ich kurz nach meinem Universitätsabschluss mit einem Stipendium nach England gereist, um in Oxford Logik zu studieren. In meinem ersten Jahr dort hatte ich das Glück, den großen Arthur Seldom kennenzulernen, Autor der Ästhetik des Denkens und der philosophischen Fortführung des Gödel’schen Unvollständigkeitssatzes. Ziemlich unverhofft, war es nun Zufall oder Schicksal, wurde ich an seiner Seite unmittelbarer Zeuge einer seltsamen Reihe von Todesfällen, alle so unauffällig und leise, fast schon abstrakt, dass die Zeitungen sie »unsichtbare Verbrechen« nannten. Vielleicht werde ich eines Tages in der Lage sein, den verborgenen Schlüssel zu enthüllen, den ich über diese Vorfälle in Erfahrung brachte; einstweilen soll ein Satz genügen, den ich Seldom einmal sagen hörte: »Ein Verbrechen ist nicht perfekt, wenn es ungelöst bleibt, sondern wenn ein falscher Täter gefasst wird.«
Als ich im Juni 1994 mein zweites Jahr in Oxford begann, wurde kaum noch über die Ereignisse gesprochen, alles war zur Normalität zurückgekehrt, und so hoffte ich, in den vor mir liegenden langen Sommertagen die verlorene Zeit nachzuholen, um die gefährlich näher rückende Frist für meinen Stipendiumsbericht einzuhalten. Die Betreuerin meiner Doktorarbeit, Emily Bronson, die meine mangelnde Produktivität während der letzten Monate gnädig übergangen hatte, in denen sie mich allzu oft in Tenniskleidung und in Begleitung einer hübschen Rothaarigen gesehen hatte, brachte mich auf sehr britische Weise ebenso diskret wie bestimmt dazu, mich für eines der verschiedenen Themen zu entscheiden, die sie mir am Ende des Semesters vorgeschlagen hatte. Ich wählte das einzige aus, das irgendwie mit meiner heimlichen Liebe zur Literatur vereinbar war.
Dabei ging es um die Entwicklung eines Programms, das es ermöglichen würde, anhand eines Manuskriptfragments die Linienführung der Schrift nachzuvollziehen, das heißt die Bewegung von Hand und Stift im Moment des Schreibens. Es handelte sich um die noch hypothetische Anwendung eines Satzes zur topologischen Dualität, über den sie gearbeitet hatte – eine Herausforderung, die mir ausreichend originell und komplex erschien, dass ich meiner Betreuerin eine gemeinsame Veröffentlichung vorschlagen konnte, sollte mein Vorhaben von Erfolg gekrönt sein.
Schneller als gedacht war ich ausreichend vorangekommen, um Seldom in seinem Büro aufzusuchen. Wir hatten uns angefreundet, seit wir an der Aufklärung jener Reihe von Morden beteiligt gewesen waren, und auch wenn Emily Bronson meine offizielle Betreuerin war, testete ich meine Ideen lieber bei ihm aus. Sein geduldiger, immer leicht amüsierter Blick gab mir eine größere Freiheit, Hypothesen zu wagen, die Tafel vollzukritzeln und mich – meistens – zu irren. Wir hatten lange über Bertrand Russells implizite Kritik an Wittgenstein in seinem Prolog zum Tractatus geredet, über das versteckte mathematische Element im zentralen Unvollständigkeitsphänomen, über Borges’ Pierre Menard und die Unmöglichkeit, aus der Syntax auf den Sinn zu schließen, die Suche nach einer perfekten künstlichen Sprache, die Versuche, den Zufall in einer mathematischen Formel einzufangen … Mit meinen dreiundzwanzig Jahren war ich überzeugt, die Lösungen zu einigen dieser Probleme gefunden zu haben, und waren sie vielleicht auch etwas naiv und größenwahnsinnig, so schob Seldom, sobald ich sein Büro betrat, dennoch seine eigenen Papiere zur Seite, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und lauschte schmunzelnd meinen begeisterten Ausführungen, ehe er mich auf irgendeine Arbeit hinwies, in der meine Überlegungen bereits ausgeführt oder widerlegt worden waren. Ungeachtet Wittgensteins lakonischen Satzes, worüber man nicht reden könne, darüber solle man schweigen, redete ich doch immer ein wenig zu viel.
Doch dieses Mal war es anders: Seldom fand das Thema vernünftig, interessant, durchführbar. Außerdem habe es, sagte er ein wenig geheimnisvoll, auch mit anderen Fragestellungen zu tun, die wir in Erwägung gezogen hätten. Schließlich gehe es darum, ausgehend von einem statischen Bild – grafisch festgehaltenen Symbolen – eine mögliche Vergangenheit zu rekonstruieren. Ich nickte, und ermuntert von seiner Zustimmung zeichnete ich schnell eine Wellenlinie auf die Tafel, deren Verlauf ich dann direkt daneben langsam nachzog.
»Ich stelle mir einen Kopisten vor, der die Linienführung mit ruhiger Hand, beharrlich wie eine Ameise, zu imitieren versucht. Aber das Originalmanuskript wurde in einem bestimmten Rhythmus geschrieben, mit einer Leichtigkeit, in einem anderen Tempo. Meine Absicht ist es, die physische Bewegung im Moment des Schreibens nachzuvollziehen, den Entstehungsakt des Textes. Oder zumindest die unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufzuzeichnen. Es ist so ähnlich wie das, was wir über Pierre Menard gesagt haben: Cervantes hat den Quijote sicherlich mit Verve geschrieben, wie Borges es sich vorstellt – dem Zufall, Impulsen und spontanen Einfällen folgend. Pierre Menard dagegen muss ihn mit den Schildkrötenschritten der Logik reproduzieren, an unerbittliche Gesetze und Überlegungen gekettet. Der Text, den er erhält, ist im Wortlaut identisch, nicht aber in den ihm zugrunde liegenden, unsichtbaren mentalen Vorgängen.«
Seldom schwieg einen Moment nachdenklich, als erwäge er das Problem aus einer anderen Perspektive oder als sehe er seine möglichen Komplikationen voraus, dann schrieb er mir den Namen eines Mathematikers und ehemaligen Studenten von ihm auf, Leyton Howard, der inzwischen in der wissenschaftlichen Abteilung der Polizei als Schriftsachverständiger arbeitete.
»Sie sind ihm bestimmt schon über den Weg gelaufen, ein Australier, der immer zum Vier-Uhr-Tee kam, auch wenn er kaum je ein Wort mit irgendjemandem wechselte. Sommers wie winters läuft er barfuß herum, das ist Ihnen bestimmt aufgefallen. Er ist ein wenig menschenscheu, aber ich werde ihm schreiben und ihn bitten, Sie eine Weile bei sich arbeiten zu lassen, es wird Ihnen helfen, Ihre Aufgabenstellung mit realen Beispielen zu untermauern.«
Seldoms Vorschlag erwies sich wie immer als goldrichtig, und so verbrachte ich im darauffolgenden Monat etliche Stunden in dem winzigen Büro unter dem Dach, das man Leyton im Polizeipräsidium zugewiesen hatte, und machte mich anhand seiner Archive und Notizen vertraut mit den Tricks von Scheckfälschern, Poincarés statistischen Argumenten als mathematischer Gutachter in der Dreyfus-Affäre, den chemischen Feinheiten von Tinte und Papier und historischen Fällen gefälschter Testamente.
Ich hatte mir für diesen zweiten Sommer ein Fahrrad geliehen, und wenn ich auf dem Weg zum Polizeipräsidium St. Aldate’s hinunterfuhr, begrüßte ich die junge Verkäuferin von Alice’s Shop, einem kleinen, funkelnden, an ein Puppenhaus erinnerndes Ladengeschäft voller Kaninchenfiguren, Uhren, Teekannen und Herzköniginnen, das sie stets um diese Zeit öffnete. Manchmal begegnete ich auf der Treppe des Präsidiums auch Inspektor Petersen. Beim ersten Mal zögerte ich, ihn zu grüßen, aus Sorge, er könnte Seldom und indirekt auch mir den Ausgang der Ermittlungen nachtragen, während derer sich unsere Wege gekreuzt hatten, aber zum Glück war dem nicht so; stattdessen machte er sich sogar immer wieder den Spaß, mir auf Spanisch einen guten Tag zu wünschen.
Wenn ich in das Büro unter dem Dach kam, war Leyton immer schon da, eine Kanne Kaffee vor sich auf dem Tisch. Mein Eintreffen bedachte er mit einem fast unmerklichen Nicken. Er war vielleicht fünfzehn Jahre älter als ich, hatte ein blasses, sommersprossiges Gesicht und einen langen rötlichen Bart, den er beim Nachdenken um einen Finger wickelte. Man hätte ihn für einen in die Jahre gekommenen Hippie halten können oder für einen der ausgesucht zerlumpten Bettler, die vor den Toren der Colleges Philosophiebücher lasen. Er sprach nur das Nötigste, und das auch nur, wenn ich ihm eine direkte Frage stellte – die er nach längerem Sinnieren schließlich mit einem kurzen Satz beantwortete, der ebenso notwendig und hinreichend war wie eine mathematische Bedingung. Ich stellte mir vor, dass er in diesen Momenten aus einem sinnlosen Stolz heraus im Geiste verschiedene Formulierungen durchging, bis er die kürzeste und prägnanteste gefunden hatte.
Als ich ihm mein Projekt dargelegt hatte, zeigte er mir zu meiner großen Enttäuschung ein Programm, das die Polizei vor einigen Jahren initiiert hatte und dem die gleiche Idee zugrunde lag wie meine: Anhand der unterschiedlichen Stärke der Tintenstriche sollte die Schreibgeschwindigkeit ermittelt werden, der Abstand zwischen den Wörtern markierte den Rhythmus, eine verstärkte Schräglage war ein Indikator für Beschleunigung … Wobei man sagen muss, dass das Programm der Polizei auf ziemlich groben Simulationen mit einem Algorithmus sukzessiver Approximation beruhte. Als Leyton mir meine Entmutigung ansah, ließ er sich zu einem vollständigen Satz des Zuspruchs herab: Ich solle das Programm trotzdem einmal gründlich analysieren, vielleicht könne das Theorem meiner Betreuerin, das ich ihm zu erklären versuchte, seine Effizienz ja steigern. Ich beschloss, auf ihn zu hören, und als er sah, dass ich mich ernsthaft an die Arbeit machte, öffnete er mir großzügig seine Zauberkiste, und ich durfte ihn sogar zu zwei Prozessterminen ins Gericht begleiten. Auf der Empore vor den Richtern war Leyton kurzzeitig kaum wiederzuerkennen, vielleicht, weil er zu dem Anlass Schuhe hatte anziehen müssen. Seine Ausführungen waren brillant, voller stichhaltiger und unwiderlegbarer Details.
Auf dem Rückweg ins Büro versuchte ich es mit ein paar bewundernden Kommentaren, aber er antwortete mir mit seiner gewohnten Einsilbigkeit, als hätte er sich bereits wieder in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Mit der Zeit gewöhnte ich mich daran, unsere gemeinsamen Stunden im Büro ebenso schweigsam wie er zu verbringen. Allerdings brachte es mich immer wieder aus dem Konzept, wenn er, während er über irgendeiner Formel brütete, seine nackten Füße überkreuz auf den Schreibtisch legte und ich, wie Sherlock Holmes höchstpersönlich, auf seinen Fußsohlen die Spuren der verschiedenen Schlamm- und Vegetationsarten von halb Oxfordshire identifizieren konnte, leider inklusive der dazugehörigen Gerüche.
Kurz vor Ende meines Monats mit Leyton begegnete ich Seldom beim Vier-Uhr-Tee im Mathematischen Institut. Ich setzte mich neben ihn, und er fragte mich, wie ich mit Leyton auskäme. Etwas mutlos sagte ich, das Programm, das ich mir ausgedacht hätte, existiere bereits und dass ich nur versuchen könne, es ein wenig zu optimieren. Seldom hielt mit der Tasse in der Hand inne. Etwas an meinen Worten schien ihn mehr zu interessieren als meine übliche Niedergeschlagenheit.
»Sie meinen, die Polizei verfügt bereits über ein solches Programm? Und Sie, mein Freund, sind in der Lage, es anzuwenden?«
Ich sah ihn neugierig an: Seldom hatte sich immer der theoretischen Logik verschrieben, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die konkrete, prosaische Anwendung irgendeines Programms ihn interessieren könnte.
»Den ganzen Monat habe ich nichts anderes getan. Ich habe jeden Aspekt gründlich durchdacht. Ich kann es nicht nur anwenden, ich könnte den Code inzwischen sogar auswendig aufsagen.«
Seldom trank schweigend einen Schluck Tee, als gäbe es da etwas, das er nicht auszusprechen wage, oder als kämpften seine Überlegungen mit einem letzten Hindernis.
»Aber dieses Programm ist sicherlich geheim und unter Verschluss. Und vermutlich wird jeder Benutzer registriert.«
Ich zuckte die Achseln.
»Das glaube ich nicht. Ich habe hier im Institut eine Kopie davon und habe es mehrmals auf den Computern unten im Keller geöffnet. Und was die Geheimhaltung betrifft«, ich sah ihn verschwörerisch an, »niemand hat von mir verlangt, auf die Königin zu schwören.«
Seldom nickte lächelnd.
»In diesem Fall könnten Sie uns vielleicht einen großen Gefallen tun.« Er beugte sich in seinem Stuhl vor und senkte die Stimme. »Haben Sie schon einmal von der Lewis-Carroll-Bruderschaft gehört?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Vielleicht auch besser so«, sagte er. »Kommen Sie heute Abend um halb acht ins Merton College, ich würde Ihnen gern jemanden vorstellen.«
2
Als ich mich in der Portierloge des Merton College anmeldete, war es noch hell, es war einer dieser friedlichen englischen Sommerabende. Während ich darauf wartete, dass Seldom mich abholte, ging ich bis zum Rasenviereck des ersten Innenhofs und wurde wieder einmal vom Zauber dieser verborgenen Gärten erfasst. Es musste mit der Proportion und Höhe der Mauern zu tun haben oder den scharfen Kanten der Dachfirste, dass das ausgestanzte Rechteck des Himmels wie durch einen optischen Effekt oder einfach in seiner Reglosigkeit wundersam nah erschien, fast als könnte man es berühren. In der Mitte des Rasens waren symmetrische Beete mit leuchtenden Mohnblumen angelegt. Ein schräger Lichtstrahl fiel in den Wandelgang ein, und der Winkel, in dem er den jahrhundertealten Stein erhellte, erinnerte an die Sonnenuhren vergangener Zivilisationen, eine Millimeter für Millimeter kreisende übermenschliche Zeit. Seldom tauchte an einer Ecke auf und führte mich durch einen weiteren Wandelgang in den Garten der Fellows. Mehrere Professoren eilten in ihren steifen schwarzen Roben wie ein Schwarm Raben in die entgegengesetzte Richtung.
»Das ganze College ist jetzt im Speisesaal beim Abendessen«, sagte Seldom, »hier im Garten können wir uns in Ruhe unterhalten.«
Er deutete auf einen Tisch in einer Nische des Wandelgangs. Ein greiser Mann sah von dort zu uns herüber, legte bedächtig seine Zigarre auf den Tisch, schob seinen Stuhl zurück und richtete sich mithilfe eines Stocks ein wenig auf.
»Das ist Sir Richard Ranelagh«, raunte Seldom mir zu. »Er war viele Jahre stellvertretender britischer Verteidigungsminister, seit seiner Pensionierung ist er der Präsident unserer Bruderschaft. Außerdem ist er ein bekannter Autor von Spionageromanen. Ich muss Ihnen nicht erst sagen, dass alles, was wir hier besprechen werden, unbedingt unter uns bleiben muss.«
Ich nickte, und wir traten zu dem Tisch. Ich schüttelte eine gebrechliche Hand, deren Griff jedoch noch erstaunlich fest war, stellte mich vor, und wir tauschten ein paar Höflichkeitsfloskeln aus. Unter seinem runzligen Gesicht und seinen Schildkrötenlidern erwies sich Ranelagh als aufmerksamer Beobachter mit kühlem, durchdringendem Blick, den er leicht nickend auf mich gerichtet hielt, während Seldom etwas zu meiner Person erzählte, was Ranelagh mit einem zurückhaltenden Lächeln quittierte, als mache er sich lieber selbst ein Bild und hebe sich sein Urteil für später auf. Dass er im Verteidigungsministerium nur die Nummer zwei gewesen war, schmälerte seine Verdienste in meinen Augen nicht, ganz im Gegenteil. Aus den Romanen von John le Carré wusste ich, dass bei der nationalen Sicherheit, wie in vielen anderen Bereichen, die Nummer zwei die wahre Nummer eins war.
Auf dem Tisch standen drei Gläser um eine Flasche Whisky, aus der Ranelagh sich ganz offensichtlich schon gut bedient hatte. Seldom schenkte sich und mir großzügig ein, damit wir mithalten konnten. Als wir mit dem Smalltalk fertig waren, steckte sich Ranelagh wieder die Zigarre in den Mund und nahm einen langen Zug.
»Arthur hat Ihnen wahrscheinlich schon gesagt, dass wir Ihnen eine etwas heikle Geschichte erzählen müssen.« Er sah zu Seldom, als wolle er sich für diese schwere Aufgabe seiner Hilfe versichern. »Wir werden es zusammen tun. Aber wo sollen wir anfangen?«
»Der König«, antwortete Seldom, »würde sagen, fangen Sie mit dem Anfang an, machen Sie bis zum Ende weiter, und dort hören Sie auf.«
»Aber vielleicht sollten wir vor dem Anfang beginnen«, sagte Ranelagh und lehnte sich in seinem Stuhl zurück, als wolle er mich prüfen. »Was wissen Sie über die Tagebücher von Lewis Carroll?«
»Ich hatte keine Ahnung, dass es überhaupt welche gibt«, gestand ich. »Ich weiß so gut wie gar nichts über sein Leben.«
Ich kam mir vor wie in einer schlecht vorbereiteten Prüfung. Vage erinnerte ich mich, als Kind in einer wahrscheinlich mittelmäßigen spanischen Übersetzung Alice im Wunderland und die Jagd nach dem Snark gelesen zu haben. Ich war einmal im Christ Church College gewesen, wo Carroll Mathematik unterrichtet und Predigten gehalten hatte, und ich hatte sein Porträt im Vorbeigehen in der Dining Hall gesehen, aber ich war nie auf den Gedanken gekommen, mehr über ihn nachzuforschen. Ich hegte damals zudem noch eine gewisse – durchaus gesunde – Indifferenz gegenüber den Autoren hinter den Werken und beschäftigte mich lieber mit den fiktiven Figuren als ihren Schöpfern aus Fleisch und Blut. Was ich aber zwei Mitgliedern der Lewis-Carroll-Bruderschaft schlecht sagen konnte, ohne herablassend zu klingen.
»Es gibt Tagebücher, ja«, sagte Ranelagh, »und sie sind auf eine ziemlich verwirrende Weise unvollständig. Carroll hat im Laufe seines Lebens dreizehn Hefte vollgeschrieben, und nur sein erster Biograf, sein Neffe Stuart Dodgson, war in der glücklichen Lage, sie vollständig lesen zu können. Das wissen wir, weil er Auszüge aus den Tagebüchern in seiner 1898 erschienenen Biografie zitiert. Danach lagen die Hefte dreißig Jahre lang im Haus der Familie, aber als zu Carrolls hundertstem Geburtstag das Interesse an seiner Person wieder aufflammte, beschlossen seine Verwandten, die zerstreuten Papiere zusammenzutragen. Als sie zu den Tagebüchern kamen, stellte sich heraus, dass vier der Originalhefte fehlten. Waren sie aus Nachlässigkeit oder bei einem Umzug verloren gegangen? Oder hatte jemand sie während dieser drei Jahrzehnte gelesen, vielleicht ein besorgter Verwandter, der den guten Ruf der Familie wahren wollte und diese vier Hefte wegen ihres möglicherweise kompromittierenden Inhalts zerstörte? Wir wissen es nicht. Glücklicherweise sind die Hefte aus der Zeit erhalten, in der Carroll Alice Liddell kennenlernte und Alice im Wunderland schrieb. Doch bei der genauen Durchsicht dieser Aufzeichnungen machten die Literaturwissenschaftler eine ebenso unerklärliche Entdeckung, die zu allen möglichen Spekulationen und Hypothesen führte: Im Heft von 1863 fehlen mehrere Seiten, und insbesondere eine, die einen heiklen Moment in der Beziehung zu Alices Eltern beschreiben dürfte, wurde ganz eindeutig herausgerissen.«
»Heikel … in welcher Hinsicht?«, unterbrach ich ihn.
»Ich würde sagen, in der heikelsten Hinsicht.« Sir Ranelagh zog an seiner Zigarre, und mit veränderter Stimme fuhr er fort, als begebe er sich auf vermintes Terrain: »Sie wissen sicherlich etwas über die Entstehung von Alice im Wunderland. Deshalb nur kurz: Im Sommer 1863 war der einunddreißigjährige Carroll Dozent für Mathematik in Oxford und bereitete sich auf die Priesterweihe vor. Acht Jahre zuvor war der neue Dekan Henry Liddell mit seiner Frau und seinen vier Kindern Harry, Ina, Alice und Edith an das Christ Church College gekommen. Carroll sah die Kinder oft in den Gärten der Bibliothek, bei ihrer ersten Begegnung war Alice gerade drei Jahre alt. Er freundete sich mit der Familie an und unterrichtete den ältesten Sohn Harry auf Bitte des Dekans in Mathematik. Carroll notierte in seinem Tagebuch die immer häufigeren Spaziergänge mit der ältesten Tochter der Liddells, Ina, stets in Begleitung ihrer Gouvernante Miss Prickett, eine offenbar alles andere als reizvolle Person, über die Carroll sich mit den Mädchen heimlich lustig machte. Als Alice älter wurde, nahm sie auch an den Ausflügen zum Fluss teil, wo Carroll Spiele und Lieder für die Kinder erfand, immer in der unvermeidlichen Begleitung von Miss Prickett, wie es im Tagebuch jedes Mal vermerkt ist. Carroll hatte inzwischen auch seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt und lichtete die Mädchen mit seiner ersten eigenen Ausrüstung in allen möglichen Posen und Verkleidungen ab, manchmal auch ziemlich dürftig bekleidet, wie auf dem berühmten Foto von Alice als Bettlerin. So seltsam uns das heute vorkommen mag, haben der Dekan und seine Frau nie etwas gegen diese Spiele und Ausflüge einzuwenden gehabt, vielleicht, weil Carroll ihnen als Dozent und künftiger Geistlicher ausreichend respektabel erschien oder im Gegenteil als ein ebenso exzentrischer wie harmloser Zeitgenosse, oder womöglich schlichtweg, weil man damals noch ein anderes Grundvertrauen hatte. Carroll musste nur ein Billett schreiben, schon durfte er die Mädchen einen ganzen Nachmittag lang an den Fluss mitnehmen. Bei einem dieser Ausflüge hat er ihnen die Geschichte von Alice unter der Erde erzählt, und er musste der echten Alice versprechen, dass er daraus ein Buch für sie machen würde. Es nahm Carroll sechs Monate in Anspruch. Im Sommer 1863 war es noch nicht fertig, sein Verhältnis zur Familie Liddell war offenbar bestens. Bis zum 24. Juni. An diesem Morgen begeben sich Alice und Edith zu Carrolls Wohnung, um ihn zu einem Ausflug nach Nuneham zu überreden, an dem auch der Dekan und seine Frau und mehrere andere Personen teilnehmen. Insgesamt sind sie zu zehnt, Carroll notiert alle Namen in sein Tagebuch. Ausnahmsweise ist die Gouvernante Miss Prickett nicht mit von der Partie, was sehr ungewöhnlich ist, vielleicht, weil die Mädchen von ihren Eltern begleitet werden. Ein großes Boot wird gemietet, der Reihe nach setzt die Gruppe ans andere Flussufer über, man trinkt Tee unter den Bäumen, und als die Erwachsenen am späten Nachmittag in ihren Kutschen zurück nach Hause fahren, nimmt Carroll mit den drei Mädchen den Zug. In seinem Tagebuch vermerkt er den Moment, in dem er mit den Mädchen allein blieb, mit dem in Klammern gesetzten Ausruf ›mirabile dictu!‹, den er immer benutzte, wenn etwas sich auf unvorhergesehene Weise zu seinen Gunsten wendete. Und er fügt hinzu: ›Ein angenehmer Ausflug mit einem sehr angenehmen Ende.‹ Das ›sehr‹ von ihm selbst unterstrichen.« Ranelagh hielt inne, vielleicht um die Wirkung des letzten Satzes ebenfalls zu unterstreichen.
»Wie alt waren die Mädchen?«, fragte ich.
»Eine sehr scharfsinnige Frage, obwohl dasselbe Alter damals und heute wohl nicht vergleichbar ist. ›Die Vergangenheit ist ein fernes Land‹, sagte Hartley, und dasselbe gilt für ihre Sitten und Gebräuche. Man muss sich nur das Paradox in Erinnerung rufen, dass Frauen mit zwölf Jahren bereits legal heiraten konnten, in anderen Aspekten jedoch wesentlich kindlicher waren als die Mädchen heutzutage. Carroll selbst verwendete mehrmals den Ausdruck ›Kindfrau‹ in Bezug auf die pubertierenden Gattinnen mancher Zeitgenossen. Ina war vierzehn, ein prachtvoller Backfisch, den Fotos nach zu urteilen hochgewachsen und schön. Mit ihr hatte Carroll sich als Erstes angefreundet, ihr Name taucht in seinen Tagebüchern immer wieder auf. Es war der letzte Sommer, in dem sie ohne Anstandsdame ausgehen durfte. Alice war elf Jahre alt, seit dem Vorjahr war sie Carrolls Favoritin. Mehrere Zeitzeugen sind sich darüber einig, dass er von ihr besonders angetan war, worauf es jedoch sonderbarerweise keine expliziten Hinweise in den Tagebüchern gibt. Sie stand an der Schwelle zu ihrem zwölften Lebensjahr, einem Alter, in dem Carroll seine kleinen Freundinnen auszuwechseln pflegte. Edith war neun.« Ranelagh sah uns an, als erwarte er eine Frage, dann schenkte er sich Whisky nach und fuhr fort.
»Sie kommen von dem Ausflug zurück, am Ende des Tages legt Carroll sich ruhig schlafen. Am nächsten Tag schreibt er den Liddells erneut, um die Mädchen mit an den Fluss zu nehmen, doch dieses Mal bittet Mrs Liddell ihn zu sich, und es kommt zu dem berühmten Gespräch, bei dem Mrs Liddell mit ihm bricht und ihn bittet, sich ihrer Familie nicht mehr zu nähern. Was ist während des Ausflugs oder womöglich während der Rückfahrt im Zug passiert? Was ist Mrs Liddell an Carrolls Verhalten gegenüber ihren Töchtern aufgefallen? Was haben die Mädchen bei ihrer Rückkehr erzählt? Was auch immer Carroll darüber zu sagen hatte, ob wenig oder viel, stand zweifellos auf dieser ausgerissenen Tagebuchseite. Tatsache ist jedenfalls, dass Carrolls Beziehung zu den Liddells abkühlt und sie mehrere Monate lang distanziert bleiben. Als er einige Zeit später erneut um die Erlaubnis bittet, die Mädchen zu sehen, verweigert Mrs Liddell sie ihm rundweg. Und als er schließlich das Buch geschrieben hat, kann er es Alice nicht persönlich überbringen, sondern muss es ihr per Post schicken. Trotz allem, und das ist das Sonderbare, bricht der Kontakt nicht ganz ab. Nach einer gewissen Zeit wird Carroll wieder bei den Liddells empfangen, allerdings von den Mädchen ferngehalten. Später gibt es freundliche Begegnungen mit Mrs Liddell, und er schickt den Mädchen Exemplare seiner Bücher, als sie bereits erwachsen sind. Er fotografiert die achtzehnjährige Alice sogar noch einmal.«
»Das würde darauf hindeuten, dass vielleicht doch nicht als so schlimm erachtet wurde, was er getan hat«, sagte ich. »Oder dass sie im Zweifel zu seinen Gunsten entschieden haben.«
»Das ist eben die Frage: Hat Carroll während dieser Zugfahrt irgendetwas getan? Das heißt, hat er die Grenzen überschritten, an die er sich gegenüber den Mädchen offenbar immer gehalten hatte, und ist es während dieser Reise zu einem, sagen wir einmal physischen Kontakt gekommen? Zu etwas, das die Mädchen vielleicht ganz unschuldig erzählt haben, ohne zu verstehen, was ihre Mutter daran so alarmierte? Oder war es in Wirklichkeit womöglich nur ein vages Gefühl der Gefahr, das die Mutter während des Ausflugs selbst verspürte, vielleicht beim Anblick der extremen Vertrautheit, die zwischen Carroll und ihren Töchtern herrschte? Oder hat irgendjemand aus der Gruppe sie gewarnt, als Carroll allein mit den Mädchen den Zug nahm? Oder war es etwas ganz anderes, wie manche spekulieren? Ein eminentes Mitglied unserer Bruderschaft, Thornton Reeves, hat vor Kurzem die bisher ausführlichste Biografie von Carroll veröffentlicht, und er stellt die Vermutung an, dass dieser während seines Gesprächs mit Mrs Liddell möglicherweise um Alices Hand angehalten hat, was ihn der Mutter plötzlich in einem völlig anderen Licht erscheinen ließ.«
»Der Donnerhall der Sexualität, der die idyllische viktorianische Bootsfahrt erschüttert«, sagte Seldom.
»Genau«, pflichtete Ranelagh ihm bei. »Tatsächlich ist es ein wahrer Gewittersturm, der sich seit jener Zeit über Carrolls Kopf zusammengebraut hat. Und das ist auch der Grund für den größten schwelenden Disput in unserer Bruderschaft.«
»Ein Disput … worum?«, fragte ich.
Ranelagh schien die Antwort abzuwägen, als hätte er sich ein wenig zu weit vorgewagt und wäre lieber wieder zu einer vorsichtigeren Formulierung zurückgekehrt.
»Eine Diskussion darüber, wie schuldig oder unschuldig Carrolls Liebe zu kleinen Mädchen war. Carroll pflegte in seinem Leben Dutzende solcher Freundschaften, aber die Eltern haben an seinem Verhalten offenbar nie etwas auszusetzen gehabt. Er lebte seinen Hang zu kleinen Mädchen und die Freundschaft mit ihnen ganz offen aus. Weder in seiner Korrespondenz noch in seinen Papieren gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass er die schmale Schwelle zwischen Fantasie und Wirklichkeit überschritten hätte. Andererseits wissen wir aus den Tagebüchern, dass Carroll in den Jahren, während derer er mit den Liddells verkehrte, eine tiefe spirituelle Krise durchmachte und immer wieder Gott anflehte, er möge ihm helfen, sich zu bessern und von seinen Sünden abzuwenden. Doch worin bestanden diese Sünden? Waren es sündige Gedanken oder sündige Taten? Ganz deutlich drückt er sich nie aus, als gestatte er sich sogar gegenüber seinem Tagebuch keine absolute Offenheit. Carroll hatte eine streng religiöse Erziehung genossen, sein Vater war Erzdiakon; der kleinste zweifelhafte Gedanke, jede innere Verwirrung konnten deshalb ein Anlass für solch inbrünstiges Beten sein. Kurz, jegliche biografische Rekonstruktion von Carrolls Leben balanciert auf diesem schmalen Grat, geht jedoch von seiner Unschuld aus, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Und gibt es in unserer misstrauischen Zeit auch einige, die gern automatisch vom Gegenteil ausgehen, konnte bislang doch keiner von denen, die auf der Jagd nach einem pädophilen Carroll sind, einen konkreten Beweis liefern.«
»Auch wenn sie anführen könnten«, wandte Seldom ein, »dass die Fotos, die er von den Mädchen machte, Beweis genug sind.«
»Darüber haben wir doch schon zur Genüge diskutiert, Arthur.« Sir Ranelagh schüttelte den Kopf und fuhr, den Blick nur auf mich gerichtet, fort, als müsse er die Unparteilichkeit verteidigen, die ein imaginäres Gerichtstribunal bei einem so schwierigen Fall zu wahren habe.
»Nichts ist einfach oder klar. Zu jener Zeit wurden Mädchen als Engel betrachtet, kindliche Nacktheit war ein paradiesisches Ideal, und Carroll hat diese Fotografien unter den Augen und mit der Zustimmung der Eltern angefertigt, nie als etwas Beschämendes, das er heimlich betreiben müsste. Er machte seine Aktaufnahmen, um sie zu zeigen und auszustellen, als die Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte. Es ist gut möglich, dass er sich wie ein Maler sah, der seine Modelle in verschiedenen Aufmachungen oder ohne alles posieren ließ. Wenn seine Freundinnen älter wurden, schickte er die Negative stets an die Mütter, damit sie sie zerstören konnten, falls die Mädchen sich ihrer in irgendeiner Weise schämten. Es war eine andere Zeit, vor Freud und Humbert Humbert. Und wenn es stimmt, dass die menschliche Natur Leerstellen verabscheut, dann sollten wir nicht ausschließen, dass es innerhalb der riesigen Bandbreite menschlicher Typen auch solche gab – und selbst jetzt noch gibt –, die Kinder auf eine absolut keusche Art liebten und sie niemals berührt hätten.« Ranelagh blickte wieder zu Seldom, als handele es sich um ein Thema, über das sie sich nicht einig werden konnten und bei dem es bislang unentschieden zwischen ihnen stand.
»Doch zurück zu unserem Ausgangspunkt: Ich hoffe, Sie verstehen jetzt, warum diese herausgetrennte Seite eine solche Anziehungskraft auf die Biografen ausgeübt hat, ja, gewissermaßen zu einem Prüfstein wurde. Auf ihr, und vielleicht nur dort, stand der entscheidende Beweis, das verhängnisvolle Ereignis, das explizite Eingeständnis einer kompromittierenden Handlung. Seit die Tagebücher in den Sechzigerjahren veröffentlicht wurden, hat diese Phantomseite uns vielerlei Möglichkeiten eingeflüstert. Es gibt keine vielversprechendere Quelle als das ungesagte Wort, kein längeres Buch als das, dem eine Seite fehlt, das habe ich einmal irgendwo gelesen. Doch bis vor Kurzem gab es nicht mehr als das, Mutmaßungen. Kein Literaturwissenschaftler kam über Vermutungen hinaus, die für gewöhnlich das jeweilige Bild bestätigten, das derjenige sich von Carroll gemacht hatte. Nur Josephine Grey, einer der Gründerinnen unserer Bruderschaft, gelang vor etwa fünfzehn Jahren ein kleiner Vorstoß: Auf geniale Weise konnte sie beweisen, dass die Seite nicht von Carroll, sondern mit größter Wahrscheinlichkeit von einer seiner beiden Großnichten ausgerissen worden war, Menella oder Violet Dodgson, Stuarts Töchtern, von denen die Papiere verwaltet wurden. Was ein indirekter Hinweis darauf ist, dass Carroll nicht unbedingt bereute oder sich für das schämte, was er auf dieser Seite festgehalten hatte. Doch was lasen die Schwestern dann zwischen den Zeilen oder was interpretierten sie hinein, dass sie sich entschlossen, die Seite herauszureißen? Was enthüllte das Geschriebene, möglicherweise ungewollt?
Zu Beginn diesen Jahres hat die Bruderschaft sich nun vorgenommen, Carrolls noch existierende Tagebücher in einer kommentierten Ausgabe zu veröffentlichen. Wie erwähnt, handelt es sich um neun verbliebene handgeschriebene Hefte, die sich in dem Haus befinden, das Carroll gegen Ende seines Lebens in Guildford erstanden hat und das inzwischen ein kleines Museum ist. Da keines der Vollmitglieder der Bruderschaft die nötige Zeit aufbringen könnte, sich dorthin zu begeben und alle Aufzeichnungen zu studieren, haben wir in der letzten Versammlung vor ein paar Tagen beschlossen, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin zu beauftragen, die uns auch bei anderen Dingen zur Hand geht und ein Wunder an Sorgfalt und Zuverlässigkeit ist. Ihr Name ist Kristen Hill. Wir haben sie gebeten, zwei Tage in Guildford zu bleiben und den Zustand der Tagebücher zu überprüfen; sie sollte Fotokopien von jeder Seite und allen dazugehörigen Papieren machen, die sie fände. Kristens Mutter lebt in der Nähe des Dorfes, damit war die Frage der Unterkunft gelöst. An ihrem zweiten Tag erreichte uns jedoch eine höchst verblüffende Nachricht.«
»Hat sie die Seite gefunden?«, fragte ich unwillkürlich.
Sir Ranelagh bedeutete mir mit hochgezogenen Augenbrauen, mich ein wenig zu gedulden, und hielt einen weiteren Augenblick inne, als bemühe er sich um eine möglichst präzise Formulierung.
»Sie fand etwas, das für uns … höchst misslich sein könnte. Doch diesen Teil erzählt Ihnen besser Arthur, denn er war es, der Kristens ersten Anruf aus Guildford erhielt.«
3
Seldom hatte sich unterdessen eine Zigarette gedreht, und als die träge Meduse aus Rauch mich erreichte, stieg mir der unverwechselbare Geruch seines indischen Tabaks in die Nase. Im Unterschied zu Sir Ranelaghs schnellem, weichem Englisch schien seine tiefe Stimme mit dem breiten schottischen Akzent in der Stille des grünen Gartens widerzuhallen.
»Kristen Hill war bis letztes Jahr eine meiner Doktorandinnen. Eine äußerst schüchterne junge Frau. Fleißig, konzentriert, sehr intelligent. Sie hat mit neunzehn Jahren ihren Abschluss gemacht, aber mit ihrer Doktorarbeit kam sie nicht voran. Irgendwann ist sie durch eine Erwähnung in einem alten Artikel auf eine sehr originelle Arbeit über Determinantenberechnung gestoßen, die Carroll in seiner Funktion als Mathematiker veröffentlicht hatte, natürlich unter seinem echten Namen Charles Dodgson. Über diesen Umweg gelangte Kristen zu den Tagebüchern, auf der Suche nach Carrolls Briefwechsel zu diesem Thema mit anderen Mathematikern seiner Zeit. Ich stellte den Kontakt zu den Mitgliedern der Bruderschaft her, die an den Tagebüchern arbeiteten, womit uns Kristen für die Mathematik verloren ging, weil sofort alle Biografen und Forscher sie für sich gewinnen wollten. Sie ist die ideale Mitarbeiterin, schnell, effizient, diskret, nichts entgeht ihr. Aktuell hat sie ein Forschungsstipendium und wird bei ihrer Doktorarbeit von Thornton Reeves betreut, deshalb war ich etwas erstaunt, dass sie mich anrief. Das war vorgestern Vormittag. Sie wirkte sehr aufgeregt, geradezu euphorisch, ich hatte sie noch nie so erlebt. Ihre Stimme klang stolz und glücklich und gleichzeitig ein wenig erschrocken. Sie erzählte mir, sie habe in Carrolls Papieren etwas ganz Außergewöhnliches gefunden, die Lösung des Rätsels um die verlorene Seite. Offenbar handelt es sich um ein Stück Papier, das jedermann zugänglich gewesen sei, wie sie sagte, das aber bislang offenbar niemand gesehen habe. In dem Haus in Guildford gibt es einen von den Verwandten erstellten Katalog, in dem alle Schriftstücke und persönlichen Objekte von Carroll verzeichnet sind, die sie im Laufe der Zeit zusammengetragen haben. Und wenn es stimmt, was Kristen sagt, so lautet einer der Punkte in diesem Katalog, so unglaublich es auch klingen mag: Aus dem Tagebuch entfernte Seiten.«
»Dem ist in der Tat so«, fügte Ranelagh hinzu. »Ich muss gestehen, ich habe diesen Katalog nie im Detail studiert, aber heute Morgen bin ich selbst nach Guildford gefahren, um mich persönlich davon zu überzeugen. Ich begreife nicht, wie es uns allen entgehen konnte.«
»Kristen musste nur zum entsprechenden Archivordner gehen, wo sie, ordentlich an seinem Platz, zwischen zwei Blättern ein zerknittertes, beidseitig beschriebenes Stück Papier fand. Auf einer Seite sind die Eckdaten von Alice Liddells Erwachsenenleben festgehalten: Ihre Hochzeit, die Geburt ihrer Kinder, ihr Todestag. Auf der anderen Seite wurde, sicherlich von der Person, die die Seite herausgerissen hat, kurz zusammengefasst, was Carroll an jenem Tag in sein Tagebuch geschrieben hatte. Kristen sagte mir, sie kenne die Handschrift gut, es sei die von Menella Dodgson, der älteren der beiden Großnichten. Sie habe sie immer verdächtigt, die heimliche Zensorin der Tagebücher zu sein, und dieses Blatt scheint es zu bestätigen. Menella Dodgson war sehr fromm, das mochte sie zu dieser Tat getrieben haben, doch bevor oder nachdem sie die Seite herausgetrennt hatte, überkam sie anscheinend doch Reue, und so beschloss sie wohl, ihren Inhalt an einem separaten Ort festzuhalten. Es sei ein einziger Satz, sagte Kristen, aber er sei entscheidend. Sie glaubt, dass dieser Satz eine endgültige, wenn auch gänzlich unverhoffte Antwort auf das Rätsel gibt, das Carroll seit jeher umgibt. Natürlich fragte ich sie sofort, wie der Satz lautete. Kristen zögerte und sagte dann, das könne sie nicht einmal mir anvertrauen, auch wenn ich der Einzige sei, dem sie in der Bruderschaft vertraue. Sie wolle den Satz geheim halten, bis sie sicher sein könne, dass man seine Entdeckung ihr zuschreiben würde. Es handele sich um etwas fast »lächerlich Logisches«, auf das niemand gekommen sei, doch sie fürchte vor allem, dass Thornton Reeves sich diesen Fund zu eigen machen und alle Meriten für sich beanspruchen könne, da sie nur eine wissenschaftliche Mitarbeiterin war. Ich hätte keine Vorstellung davon, sagte sie, wie egozentrisch er sein könne.
Ich fragte sie, wie sie die Sache geheim halten wolle, wenn sie doch selbst erklärt habe, dass dieses Blatt Papier allen zugänglich sei und jeder, der sich nach Guildford begebe, es lesen könne. Nach einem weiteren kurzen Schweigen gestand Kristen, dass sie das Blatt entwendet hatte. So drückte sie sich nicht aus, aber es wurde klar, dass sie es an sich genommen und versteckt hatte, wenngleich sie mir versprach, es an seinen Platz zurückzubringen, sobald es ihr gelungen wäre, einen Artikel über ihren Fund zu veröffentlichen. Ich fragte sie, warum sie mich dann angerufen habe, und vor allem, warum sie mir das alles anvertraue. Ich war gar nicht begeistert davon, auf diese Weise zu ihrem Komplizen gemacht zu werden, obwohl sie sehr gut wusste, dass ihr Handeln eigentlich nicht gutzuheißen war. Sie sagte, nachdem sie den Zettel mitgenommen habe, sei es ihr sehr merkwürdig vorgekommen, dass ihn bis dahin niemand sonst gesehen habe. Alle Biografen seien in dem Haus in Guildford gewesen. Mit Sicherheit hätten alle denselben Katalog durchgesehen. Wie könne es sein, dass nur sie auf diesen Zettel gestoßen sei? Sie würde sie alle lächerlich machen, wenn es öffentlich würde. Aber vielleicht gebe es doch eine Erklärung, sagte sie. Vielleicht habe ihn sehr wohl jemand gesehen, aber lieber nichts gesagt. Denn dieser einzige Satz entkräfte so gut wie alle Theorien, die bisher über Carroll kursierten. Eine andere Erklärung wäre, so sagte sie, während sie ganz offensichtlich insgeheim das Gegenteil erhoffte, dass es sich um eine Fälschung handele, dass jemand Menellas Handschrift imitiert und den Zettel vor Kurzem in das Archiv gesteckt habe, als wäre er schon immer dort gewesen, als Scherz oder Falle für andere Gelehrte. Zumindest würde das erklären, warum bis jetzt niemand darauf gestoßen sei. Sollte das zutreffen, wäre das für sie natürlich eine fürchterliche Blamage. Deshalb rief Kristen mich an. Als meine Studentin wusste sie von Leyton Howard und seiner Tätigkeit als Schriftensachverständiger und dass ich der Einzige bin, der Kontakt zu ihm hat. Sie bat mich umständlich, ein Treffen mit ihm zu arrangieren, damit er die Echtheit der Schrift bestätige. Ich sagte ihr, sie habe mich in eine verzwickte Situation gebracht, ich wolle es mir aber durch den Kopf gehen lassen und sie wieder anrufen.
Nachdem ich aufgelegt hatte, zerbrach ich mir den restlichen Vormittag den Kopf. Ich wollte die Entwendung dieses Dokuments nicht decken, so etwas verstößt gegen alle Prinzipien unserer Bruderschaft. Ich wollte aber auch nicht zu streng mit Kristen sein und sie erst recht nicht verraten. So entschloss ich mich schließlich, mich Richard anzuvertrauen, denn es gibt da eine andere äußerst wichtige Frage, die in der Bruderschaft gerade entschieden werden soll und für die dieses Blatt Papier ebenfalls von Bedeutung sein könnte.«
»Von unvorhersehbarer Bedeutung«, sagte Sir Ranelagh. »Die von uns geplante kritische Werkausgabe von Carrolls Tagebüchern soll zu einem Standardwerk werden. Alle Biografen der Bruderschaft werden daran mitarbeiten, und wir sind dabei, die Tagebücher aufzuteilen, jeder soll sich mit einem bestimmten Teil und einer Epoche beschäftigen. Es ist eine gewaltige Arbeit, und natürlich müssen wir dabei zwingend berücksichtigen, was immer auf diesem Papier steht. Ich würde sogar sagen, dass diese Seite mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde als der gesamte Rest der Ausgabe. Mehr noch, sollte sich als richtig erweisen, was Kristen sagt, müsste man wahrscheinlich den gesamten kritischen Apparat neu überdenken. Wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass dieses Fundstück irgendwann separat auftaucht und die den Anmerkungen zugrunde liegende Logik entkräftet. Wir brauchen dieses Blatt, und zwar so schnell wie möglich. Was diese Frau getan hat, ist vollkommen unzulässig, aber wie Arthur tendiere ich dazu, ihr eine Gelegenheit zu geben, es auf eine … elegante Art zurückzugeben. Wir sind übereingekommen, ihr die Hand zu reichen.«
»Ich habe sie gestern angerufen, natürlich ohne ihr zu sagen, dass ich Richard zu Rate gezogen habe, und habe ihr vorgeschlagen, für diesen Freitag eine außerordentliche Sitzung der Bruderschaft anzuberaumen, sollte sich die Schrift als echt erweisen. Sie würde das Blatt vor allen zeigen, es würde mit ihrem Namen im Protokoll festgehalten werden, und sie würde es an seinen Platz zurückbringen. Auf diese Weise würde der Fund ihr zugeschrieben werden und sie hätte Zeit, einen Artikel zu verfassen und zu veröffentlichen. Ich war mir sicher, dass sie sofort auf das Angebot eingehen würde, so nervös und verängstigt hörte sie sich an. Sie schlafe nachts kaum noch, seit sie den Zettel bei sich habe, hatte sie gesagt. Aber sie machte einen Rückzieher, als ich sagte, wir müssten damit zur Polizei gehen. Sie wusste nicht, dass Leyton inzwischen dort arbeitet, und ich glaube, sie hatte Angst, man könnte ihr eine Falle stellen. Ich konnte sie nicht überzeugen, obwohl ich ihr erklärte, dass Leyton oben unter dem Dach ganz für sich in einem Büro arbeitet und wir sonst niemandem über den Weg laufen würden. Nachdem ich aufgelegt hatte, war ich natürlich ziemlich besorgt. Daran dachte ich, als ich heute in den Gemeinschaftsraum ging, wo ich, dem Schicksal sei Dank, Ihnen begegnete. Danach rief ich Kristen unverzüglich erneut an, erzählte ihr von Ihrem Programm, und schließlich willigte sie ein, morgen mit einer Fotokopie des ersten Teils des Satzes ins Mathematische Institut zu kommen. Ich hoffe, es wird für ein Gutachten ausreichend sein. Sie sagte, das Original würde sie auf keinen Fall mitnehmen und sie würde auch nicht den zweiten Teil des Satzes enthüllen.«
»Vier oder fünf Wörter genügen«, sagte ich, »aber wir brauchen natürlich irgendwelche handgeschriebenen Briefe oder Notizen von besagter Menella, möglichst aus derselben Zeit, um sie zu vergleichen.«
»Ja, daran hatte Kristen schon gedacht. Offenbar gibt es im Archiv der Bruderschaft eine Menge Briefe, die Menella im Laufe ihres Lebens geschrieben hat. Kristen wird sie mitbringen.«
»Sie werden sicherlich verstehen«, sagte Ranelagh, »dass diese Angelegenheit äußerst delikat ist und der größtmöglichen Diskretion bedarf.«
»Ich habe mir schon überlegt«, sagte Seldom, »dass wir uns, wenn es Ihnen nichts ausmacht, vielleicht am besten am späteren Abend im Computerraum im Keller treffen, um ungestört arbeiten zu können. Ich habe einen Schlüssel.«
»Kein Problem«, sagte ich. »Ich hoffe, damit können wir morgen zumindest einen Teil des Rätsels lösen. Vielleicht stimmt das ja alles tatsächlich, eben weil es so unglaublich klingt. Als läge der geraubte Brief in Poes Erzählung nicht nur offen da, sondern befände sich außerdem noch in einem Umschlag mit der Aufschrift gestohlener Brief. Glauben Sie wirklich, dass keiner der Biografen je dieses Blatt gesehen hat?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Ranelagh. »Ich jedenfalls war äußerst beschämt, denn mir ist es tatsächlich entgangen. Und wenn das Blatt echt ist, werden andere fraglos noch beschämter sein. Vermutlich wird es niemanden besonders glücklich machen, von seiner Existenz zu erfahren.«
4
Am nächsten Tag wartete ich in unserem Dachstübchen geduldig ab, bis Leyton abends seine Unterlagen zusammenschob. Kaum war er weg, entfernte ich vorsichtig die Platte, die am Fotokopierer befestigt war. Es handelte sich um einen ausgetüftelten Mechanismus, den sein Mentor erfunden hatte, bevor er von Microtek angeheuert worden war. Er ermöglichte es, die Aufnahme des Fotokopierers an den Computerbildschirm zu schicken, ein Prototyp dessen, was man viele Jahre später einen Scanner nennen würde.
Bei Einbruch der Nacht ging ich in den Computerraum des Mathematischen Instituts. Als außer mir niemand mehr da war, setzte ich die Platte in den Fotokopierer neben den Computern ein, machte ein paar Tests, um sicherzugehen, dass alles richtig funktionierte, und wartete. Um Punkt neun kam Seldom mit Kristen die Treppe herunter. Bei ihrem Anblick dachte ich daran, was Seldom und Ranelagh über sie gesagt hatten: intelligent, fleißig, konzentriert. Aber mit der typisch britischen Diskretion hatten beide mit keinem einzigen Wort ihr Aussehen erwähnt. Nun begriff ich, warum die Mitglieder der Bruderschaft sie einander streitig machten. Sie war schlicht und einfach bezaubernd, auch wenn sie, offenbar aus fast krankhafter Schüchternheit, den Kopf gesenkt und den Rücken leicht gekrümmt hielt, vielleicht unbewusst, um ihre Brüste zu kaschieren, die wohl auffallender waren, als ihr lieb war. Sie trug eine Brille mit breitem Gestell, und als Seldom uns vorstellte und ich ihre Hand schüttelte, erhaschte ich einen Blick auf ihre scheuen, durch das Brillenglas vergrößerten tiefblauen Augen. Ich hatte ihre Hand ein wenig länger als nötig gehalten, was sie nicht zu stören schien, vielleicht zog sie sie aber auch nicht gleich zurück, damit es mir nicht unangenehm war. Allein schon die schlichte Begrüßung hatte sie erröten lassen, und auch ich spürte, wie in einer Fourier’schen Überlagerung von Wellen, eine Hitzewallung in mir hochsteigen. Ich bot ihr einen Drehstuhl an, und kaum hatte sie darauf Platz genommen, zog sie auch schon eine Mappe hervor, aus der sie mehrere handgeschriebene Briefe nahm.
»Arthur hat mir gesagt, du bräuchtest Briefe von Menella Dodgson«, sagte sie. »Sie sind alle datiert und chronologisch geordnet.«
So sachlich wie möglich legte ich sie unter die Lampe neben dem Bildschirm und studierte sie.
»Ideal wäre es«, sagte ich, »wenn wir einen hätten, der aus demselben Jahr stammt wie die Notiz auf dem Blatt Papier. Ihre Handschrift hat sich mit dem Alter ziemlich verändert.«
»Aber wir können nicht wissen, wann sie die Notiz gemacht hat. Und sie hat die Tagebücher über dreißig Jahre lang gehütet.«
Ich dachte einen Moment nach.
»Es könnte aber vielleicht doch einen Hinweis darauf geben.« Ich blickte kurz zu Seldom. »Ich habe gehört … Sind nicht auf der Rückseite dieses Blattes wichtige Momente in Alice Liddells Leben mit Datum festgehalten? Wenn Menella Dodgson diese Notizen im Laufe der Jahre machte, könnten wir jeden Eintrag mit der Schrift auf dem Zettel vergleichen. Und wenn sie alle Einträge gleichzeitig vorgenommen hat, wissen wir zumindest, dass dies nach Alice Liddells Tod geschehen sein muss. In jedem Fall würde uns die Rückseite des Zettels meines Erachtens weiterhelfen. Hast du ihn dabei?«
Kristen schüttelte den Kopf, offensichtlich auf der Hut. Sie blickte Seldom vorwurfsvoll an, als habe er mir zu viel erzählt, dann sah sie wieder zu mir.
»Natürlich nicht«, sagte sie. »Der Zettel ist an einem sicheren Ort. Ich habe nur dabei, was ich mit Arthur vereinbart habe: eine Kopie vom ersten Teil des Satzes. Es sind fünf Worte. Und diese Briefe hier. Ich dachte, das genügt.«